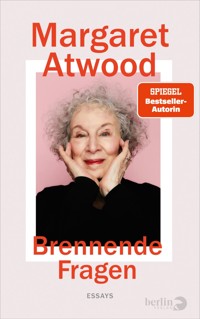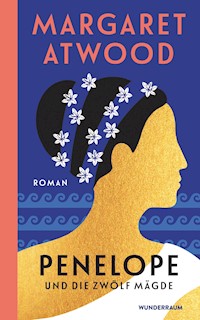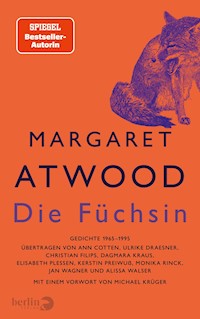13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
»Immer wenn ich gerade beschlossen habe, weniger zu schreiben und stattdessen etwas für meine Gesundheit zu tun - vielleicht Eistanz oder so –, ruft mich garantiert irgendein glattzüngiger Verleger an und macht mir ein Angebot, das ich unmöglich ablehnen kann. In gewisser Weise ist dieses Buch also schlicht das Ergebnis meiner unterentwickelten Fähigkeit, nein zu sagen.« Ob Rezensionen zu John Updike und Toni Morrison oder eine Würdigung Dashiell Hammets; ob ein Afghanistan-Reisebericht, der zur Grundlage für den Report der Magd wurde, ob leidenschaftliche Schriften zu ökologischen Themen, herrlich komische Geschichten über »meine peinlichsten Momente« oder Nachrufe auf einige ihrer großen Freunde und Autorenkollegen: Margaret Atwoods Vielfalt, ihr großes Engagement und ihr herrlicher Witz machen dieses durchaus lehrreiche Kompendium zu einem Riesen-Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Für meine Familie
Deutsch von Christiane Buchner, Claudia Max und Ina Pfitzner
ISBN 978-3-8270-7944-2
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel Curious Pursuits bei Virago Press London.
© O. W. Toad Ltd. 2015
Für die deutsche Ausgabe
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2017
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzerin des ersten Teils: Christiane Buchner
Übersetzerin des zweiten Teils: Claudia Max
Übersetzerin des dritten Teils: Ina Pfitzner
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Cover & Impressum
Allgemeines Vorwort
ERSTER TEIL – 1970–1989
1 | Reisen zurück
2 | Rezension zu ins Wrack tauchen
3 | Rezension zu Anne Sexton: Selbstporträt in Briefen
4 | Der Fluch der Eva – oder: Was ich in der Schule gelernt habe
5 | Betrachtungen zu Northrop Frye
6 | Männer gestalten: Romanfigur Mann
7 | Dem Frausein auf der Spur
8 | Vorwort zu Susanna Moodie, Roughing It in the Bush
9 | Von Albträumen verfolgt
10 | Wie Utopia entstand
11 | Tolle Tanten
12 | Blind lesen
13 | Die Frau im öffentlichen Amt: Ehrenmitglied im Männerclub
ZWEITER TEIL – 1990–1999
14 | Ein zweischneidiges Messer: Subversives Lachen in zwei Erzählungen von Thomas King
15 | Neun Anfänge
16 | Sklave der eigenen Befreiung
17 | Angela Carter: 1940–1992
18 | Nachwort zu Anne auf Green Gables
19 | Einleitung zu The Early Years
20 | Übeltäterinnen mit befleckten Händen: von der Schwierigkeit, über böse Frauen zu schreiben
21 | Grunge
22 | Gar nicht so Grimmig: Die zeitlose Kraft von Märchen
23 | »Kleine Kerle mit Brüsten«
24 | Auf der Suche nach Alias Grace: Kanada und der historische Roman
25 | Warum ich Die Nacht des Jägers liebe
DRITTER TEIL – 2000–2005
26 | Pinteresk
27 | Mordecai Richler, Diogenes von Montreal: 1931–2001
28 | Als in Afghanistan noch Frieden war
29 | Einführung zu Sie
30 | Einführung zu Doktor Glas
31 | Mystery Man: Sachdienliche Hinweise zu Dashiel Hammett
32 | Von Mythen und Männern
33 | Räuber und Gendarm
34 | Die unauslöschliche Frau
35 | Die Königin des König*innenreichs
36 | Victory Gardens – Gärtnern für den Sieg
37 | Blamagen
38 | Wie ich Oryx und Crake schrieb
39 | Brief an Amerika
40 | Edinburgh und sein Festival
41 | George Orwell: Einige persönliche Bezüge
42 | Carol Shields, die letzte Woche starb, schrieb Bücher voller Freuden
43 | Er währet ewiglich
44 | Nach Beechey Island
45 | Ent-deckt: Eine amerikanische Ilias
46 | Kopftuch oder Tod
47 | Zehn Annäherungen an Die Insel des Dr. Moreau
Anhang
Danksagung
Bibliografie
Erster Teil: 1970–1989
Zweiter Teil: 1990–1999
Dritter Teil: 2000–2005
Allgemeines Vorwort
Aus Neugier und Leidenschaft ist ein Mischmasch aus Gelegenheitswerken, also Werken, die für bestimmte Gelegenheiten geschrieben wurden. Manchmal waren diese Gelegenheiten Bücher von anderen, sodass Artikel oder Rezensionen entstanden; manchmal waren sie politischer Natur, dann entstanden journalistische Arbeiten unterschiedlicher Art; manchmal, und mit der Zeit immer häufiger, waren es Tode, und die Bitte um einen Nachruf ereilte mich gern kurzfristig und an seltsamen Orten (den Text zu Carol Shields schrieb ich zum Beispiel in einem fahrenden Zug).
Im Rückblick über die Jahrzehnte habe ich wohl um die zwanzig solcher Artikel pro Jahr geschrieben. Dabei erspare ich dem Leser die politischen Pamphlete zu den Bürgermeisterwahlen in Toronto genauso wie die flammenden Umweltschutztraktate, jedenfalls die meisten, und genauso die Parodien à la Gilbert and Sullivan anlässlich von Ruhestandsfeiern und zudem die verhunzten Popsongs, die ich mit allen anderen verfügbaren Witzbolden für Organisationen wie den PEN vortrug. Sich für einen guten Zweck lächerlich zu machen hat in Kanada lange Tradition, und hinter dieser Tradition stehe ich felsenfest.
Begonnen habe ich mit dem Schreiben von Gelegenheitswerken in den 1950er-Jahren, mit sechzehn: Ich war offiziell dazu abgestellt, die Treffen des Schulbeirats an meiner Schule zu dokumentieren, und meine Berichte über diese mitunter mühsamen Zusammenkünfte erschienen im hektografierten Newsletter an die Eltern, der über Themen wie die schickliche Rocklänge für Schülerinnen Auskunft gab. Schon damals hatte ich beschlossen, passionierte Schriftstellerin zu werden – so richtig passioniert, also mit den entsprechenden Lungenkrankheiten, unglücklichen Liebesgeschichten, mit Alkoholsucht und einem höchstwahrscheinlich frühen Tod –, aber mir war auch klar, dass ich, um das schäbige Kämmerchen und den Absinth finanzieren zu können, einen Brotjob brauchte, und das war mein erster Ausflug in die schmachvolle Welt der Auftragsschreiberei. Und? Habe ich dabei etwas gelernt? Eigentlich hätte mir klar werden können, dass es für jede Geschichte nicht nur eine Erzählerin gibt, sondern auch eine Zuhörerin und dass so mancher Witz nicht zu jeder Gelegenheit passt, aber speziell diese Lektion begriff ich erst relativ spät.
An der Universität schrieb ich dann Rezensionen und Artikel für unser Literaturmagazin – zum Teil unter fremdem Namen, da wir damals gern so taten, als interessierten sich mehr Menschen für die Kunst, als tatsächlich der Fall war. Wie so viele junge Leute war ich intolerant und anspruchsvoll, was ich allerdings in den Rezensionen nicht allzu sehr heraushängen ließ; die sind eher freundlich-herablassend und strotzen vor langen Wörtern und Nebensätzen. Das mit den Rezensionen behielt ich jedenfalls auch nach meinem ersten Abschluss bei, auch während meines Graduiertenstudiums in Harvard in den Sechzigerjahren und auch noch, als ich mich mit diversen schlecht bezahlten Jobs finanzierte und begann, in kleinen Zeitschriften Prosa und Gedichte zu veröffentlichen.
Diese Sammlung fängt nicht mit dem Anfang an. Die Meisterwerke auf Matrize erspare ich dem Leser genauso wie meine vollmundigen Äußerungen als Undergraduate. Wir beginnen 1970, als ich bereits zwei Gedichtbände und einen Roman veröffentlicht hatte und auf dem Buchrücken als »preisgekrönte Autorin« beschrieben werden konnte. Die Frauenbewegung in ihrer Ausprägung des späten zwanzigsten Jahrhunderts war 1968 losgetreten worden und hatte mittlerweile volle Fahrt aufgenommen, zumindest in Nordamerika, und jede Frau, die je den Griffel in die Hand genommen hatte, wurde in einem neuen Licht gesehen, dem rotäugigen Schein flammenden Feminismus. Anhänger favorisierten sie, Gegner attackierten sie – neutralen Grund und Boden gab es nicht. In diesem Strudel wurde ich mitgerissen, und dabei taten sich mir viele faszinierende Welten auf.
So ging es eigentlich bis heute weiter. Irgendwann erschien ich dann auch in größeren Presseorganen wie der New York Times, der Washington Post, der Times, der New York Review of Books und dem Guardian, aber das hat seine Zeit gedauert.
Wenn ich mir diese Ansammlung von Seiten so ansehe, fällt mir auf, dass meine Interessen die Jahrzehnte über ziemlich konstant geblieben sind, auch wenn mein Horizont sich hoffentlich erweitert hat. Was mich schon früh beschäftigt hat, die Umweltproblematik zum Beispiel, galt damals als Außenseiterposition einer Verrückten, ist inzwischen aber in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Ich schreibe nicht gern im Dienst einer Sache – es macht keinen Spaß, weil die entsprechenden Themen keinen Spaß machen –, fühle mich jedoch trotzdem bemüßigt, hin und wieder aufrüttelnde Artikel zu verfassen. Die Folgen sind natürlich nicht immer angenehm, denn was dem einen gesunder Menschenverstand ist, ist dem anderen ärgerliche Polemik.
Manche Beiträge in diesem Buch waren ursprünglich Reden oder Vorlesungen. Ich habe meine erste Rede mit zehn gehalten, und es war kein guter Start. Lampenfieber habe ich nach wie vor, und zwar schon im Vorfeld, beim Schreiben. Mich verfolgt dabei eine Metapher von Edith Wharton, aus ihrer Erzählung Der Pelikan, in der der Vortrag einer Dame mit einem Zaubertrick verglichen wird, bei dem Berge von leerem weißen Papier aus dem Mund des Zauberers quellen. Und Rezensionen zu schreiben, finde ich immer problematisch: Es erinnert so an Hausaufgaben, und ich bin dabei gezwungen, eine Meinung zu haben, statt nur, frei nach Keats, die Fähigkeit zu akzeptieren, dass nicht jeder komplexe Sachverhalt erschöpfend erklärt werden kann. Was der Verdauung so viel besser täte. Ich schreibe trotzdem welche, denn wer rezensiert wird, soll auch seinerseits rezensieren, sonst hat das Prinzip der Gegenseitigkeit versagt.
Es gibt aber noch einen Grund: Die Werke anderer zu rezensieren zwingt einen, die eigenen ethischen und ästhetischen Vorlieben unter die Lupe zu nehmen. Was heißt bei einem Buch denn »gut«? Welche Eigenschaften finden wir »schlecht« oder »gut«, und warum? Gibt es nicht eigentlich zwei Arten von Rezensionen mit zwei unterschiedlichen Vorläufern? Da ist einerseits die journalistische Rezension, die auf den Klatsch am Dorfbrunnen zurückgeht (sie fand ich toll, ihn fand ich grässlich, und habt ihr die Schuhe gesehen!), und da ist andererseits die »akademische« Rezension, die auf die Bibelexegese und andere Traditionen der minutiösen Erforschung sakraler Texte zurückgeht. Hinter dieser Art von Analyse steht unausgesprochen der Glaube, dass manche Texte heiliger sind als andere und dass man mithilfe einer Lupe oder Zitronensaft verborgenen Sinn aufdecken kann. Geschrieben habe ich beides.
Ich bespreche keine Bücher, die mir nicht gefallen, obwohl das die Ms. Hyde in mir natürlich spaßig fände und die eher maliziös gesinnten Leser unterhaltsam. Aber entweder ist ein Buch wirklich schlecht, dann sollte es überhaupt nicht besprochen werden, oder es ist gut, aber einfach nicht mein Fall, und dann sollte jemand anderes es besprechen. Es ist ein großer Luxus, keine Vollzeitkritikerin zu sein: Wenn mich ein Buch nicht anspricht, kann ich es zuklappen, ohne es öffentlich verreißen zu müssen. Im Lauf der Zeit habe ich mich übrigens immer mehr für Geschichte einschließlich Militärgeschichte interessiert; genauso für Biografien. Und im Bereich Belletristik trauen sich auch meine weniger hochgestochenen Vorlieben (Krimis, Science-Fiction) inzwischen aus ihren Löchern.
Apropos Vorlieben, da kann ich gleich noch ein Muster erwähnen, das auf diesen Seiten wiederkehrt. Laut einer Leserin dieses Manuskripts beginne ich die Diskussion eines Buches, eines Autors bzw. einer Autorin oder einer Auswahl von Büchern gern mit der Bemerkung, dass ich es (oder ihn oder sie) als Jugendliche im Keller gelesen habe oder zufällig im elterlichen Bücherschrank gefunden oder im Cottage oder dass ich es mir in der Bibliothek ausgeliehen habe. Wenn das Metaphern wären, würde ich sie bis auf eine streichen, aber es sind einfach Einblicke in meine Lesegeschichte. Gerechtfertigt finde ich die Erwähnung dessen, wann und wo ich ein Buch zum ersten Mal gelesen habe, weil ich wie so viele Leser die Erfahrung gemacht habe, dass der Eindruck, den ein Buch bei uns hinterlässt, oft mit dem eigenen Alter und den Umständen zu tun hat, unter denen man das Buch gelesen hat, und wenn man ein Buch als junger Mensch geliebt hat, behält es ein Leben lang seinen Glorienschein.
Ich habe Aus Neugier und Leidenschaft in drei Teile gegliedert. Teil eins umfasst die Siebziger- und Achtzigerjahre, in denen ich eine Reihe von Gedichtbänden und Romanen geschrieben und veröffentlicht habe, darunter den Report der Magd, jenes meiner Bücher, das am ehesten auf Collegelektürelisten auftaucht. Damals stieg ich so allmählich von »weltberühmt in Kanada« (um mit Mordechai Richler zu sprechen) zu weltberühmt auf, mehr oder weniger jedenfalls, so weltberühmt Autoren eben werden. (Die Rolling Stones sind einfach ein anderes Kaliber.) Er endet 1989, mit dem Jahr, als die Berliner Mauer fiel und alle Figuren auf dem weltpolitischen Schachbrett kräftig durchgerüttelt wurden. Teil zwei versammelt Beiträge aus den Neunzigerjahren – einer Art Flautephase, in der manche etwas voreilig schon das Ende der Geschichte ausriefen – und kulminiert im Jahr 1999, als das Jahrtausend zu Ende geht. Teil drei reicht vom Jahr 2000, dem Millenniumsjahr, in dem nichts wie erwartet in die Luft flog, über das Jahr 2001, als die unerwartete 9/11-Explosion die Welt erschütterte, bis in die heutigen Tage. Wenig überraschend, schrieb ich plötzlich wieder mehr über politische Themen als in der Zeit davor.
Auf Englisch heißt dieses Buch Curious Pursuits. »Curious« im Sinne von »neugierig« beschreibt einerseits meine grundsätzliche Einstellung – bis hin zur Taktlosigkeit – und andererseits im Sinne von »seltsam, kurios« manche Themen, über die ich hier geschrieben habe. Wie Alice wurde ich im Lauf meines Lebens immer »curiouser and curiouser« und die Welt immer »kuriöser und kuriöser«. Man könnte auch sagen: Wenn etwas meine Neugier nicht weckt, werde ich vermutlich auch nicht darüber schreiben. Wobei Neugier vielleicht zu oberflächlich klingt – mein Wissensdurst ist (hoffentlich) kein Selbstzweck. Passionate Pursuits wäre als Titel vielleicht treffender gewesen, doch das hätte den falschen Eindruck erweckt und wahrscheinlich ein paar Männer in Trenchcoats enttäuscht.
»Pursuits« wiederum ist ein Substantiv, in dem das Verb »verfolgen« steckt. Und was kann man mit der Wirklichkeit schon anderes tun, als ihr nachzujagen? Sie irgendwie letztgültig erhaschen zu wollen, ist utopisch, denn das olle Ding steht nicht still. Man stelle sich also vor, wie ich mit Schmetterlingsnetz oder Spielzeugpistole in der Hand über die Felder hüpfe, und der flüchtige Gegenstand entflattert in die Ferne, oder wie ich hinter dem Busch hocke, um vielleicht einen Blick zu erhaschen.[1]
Einen Blick worauf eigentlich?
Tja. Das weiß man eben nicht.
[1] Da auf Deutsch die Verfolgungsjagd im Titel zumindest befremdlich gewesen wäre, haben wir uns entschieden, die oben erwähnte Leidenschaft hierzulande wieder einzuführen (Anm. des Verlags).
Erster Teil
1970–1989
Anfang der Siebzigerjahre habe ich in London gelebt, in einem Viertel namens Parsons Green – inzwischen längst luxussaniert, damals gerade im Übergang, was hieß: Bei Kälte fror das Wasser in der Küche ein. Maximäntel zu hohen Stiefeln und Miniröcke aus Knittersamt waren in Mode, und beides bekam man auf der King’s Road, die damals ihre große Zeit hatte. In dem einen Jahr erlebten wir sowohl einen Streik der Stromversorger als auch der Müllabfuhr, und beides schienen die Londoner eher zu genießen.
Hier schrieb ich einen Gedichtband namens Power Politics fertig und fing einen Roman namens Der lange Traum an, übrigens auf einer Schreibmaschine mit deutscher Tastatur. Danach ging ich nach Frankreich (zur Untermiete in einem Städtchen bei Saint-Tropez), wo ich auf einer gemieteten Schreibmaschine mit französischer Tastatur tippte und mit dem Regisseur Tony Richardson ein Drehbuch zu meinem ersten Roman Die essbare Frau ausheckte. Wenig später lebte ich dann in Italien – wieder zur Untermiete –, wo ich Der lange Traum auf einer Schreibmaschine mit italienischer Tastatur fertigschrieb. Es hat was für sich, wenn man nicht richtig tippen kann: Die Umstellung fällt einem leichter.
Anschließend kehrte ich für zwei Jahre nach Toronto zurück, in den Lehrkörper der Universitäten York und Toronto, und arbeitete bei einem kleinen Verlag namens House of Anansi Press. Dort war ich für die Lyrik verantwortlich; außerdem stellte ich ein Buch über kanadische Literatur zusammen, das den Titel Survival bekam – das Erste seiner Art zu diesem Thema für eine breitere Öffentlichkeit. Der Band war im damaligen Kanada sofort ein Riesenerfolg, allerdings auch »umstritten«, und all das, dazu die Furore, die der Feminismus machte, sorgte dafür, dass ich ziemlich angefeindet wurde.
Bald darauf traf man mich dann auf einer Farm bei meinem Schriftstellerkollegen Graeme Gibson an. Wir blieben dort neun Jahre lang und bewirtschafteten die Farm mit viel Elan, aber ohne nennenswerten finanziellen Ertrag. Dafür hatten wir einen großen Gemüsegarten und weckten alles Mögliche ein. Sogar an Sauerkraut wagten wir uns, was man in der Nähe des Hauses tunlichst lassen sollte. Wir hatten unter anderem Kühe, Hühner, Gänse, Schafe, Enten, Pferde, Katzen, Hunde und Pfauen. Viele davon landeten irgendwann im Kochtopf, und dann zechten wir munter zum Takt explodierender Eigenbräubierflaschen im Keller und den Fragen von Graemes Kindern, ob das da auf dem Teller etwa Susan sei.
1976 bekamen wir ein Kind, und als das ins schulpflichtige Alter kam und uns klar wurde, dass es jeden Tag zwei Stunden im Schulbus würde sitzen müssen, zogen wir in die Stadt. Um die Zeit lebten wir auch mal ein Jahr in Edinburgh, da Graeme den kanadischen Teil des schottisch-kanadischen Schriftstelleraustausches verkörperte. Edinburgh übertrumpfte London dann noch, mit einem Lkw-Fahrer-Streik, dem Einsturz eines Eisenbahntunnels auf der Strecke nach London und einem Winterdienststreik. Zu essen gab es vor allem Rosenkohl, Lachs und Hammel.
Damals kam ich auch zum ersten Mal auf Lesereise nach Deutschland. Außerdem gingen wir auf Weltreise, auf dem Weg zum australischen Adelaide-Festival in Australien, und zwar mit unserem eineinhalbjährigen Kleinkind und mit den Stationen Iran (acht Monate später wurde der Schah gestürzt), Afghanistan (sechs Wochen nach unserer Abreise begann der Bürgerkrieg) und Indien, wo unser Kind in einem Hotel in Agra das Treppensteigen lernte, während wir den Tadsch Mahal erkundeten.
Für mich waren die Achtzigerjahre eine tatkräftige Zeit und für die Welt waren sie ja dann bahnbrechend. Anfangs stand die Sowjetunion scheinbar unerschütterlich da, und das noch auf lange Sicht; allerdings war sie bereits in einen kostspieligen, kräftezehrenden Krieg in Afghanistan verstrickt, und 1989 fiel dann die Berliner Mauer. Es ist schon erstaunlich, wie schnell bestimmte Machtstrukturen sich auflösen, wenn der Eckpfeiler wegbricht. Wobei dieses Ergebnis 1980 wirklich kein Mensch voraussehen konnte.
Begonnen habe ich das Jahrzehnt eher still und leise. Ich bemühte mich, zum zweiten Mal und erfolglos, das Buch zu schreiben, aus dem später Katzenauge werden sollte, und Der Report der Magd gärte schon in mir – Letzterem wich ich allerdings so gut wie möglich aus: Zu unbezwingbar erschien die Aufgabe, zu abartig die Idee.
Mittlerweile lebte unsere Familie in Toronto, in einem Reihenhaus in Chinatown, das man modernisiert hatte, indem ein Großteil der Türen entfernt worden war. An Schreiben war dort nicht zu denken, dazu war es viel zu laut, also radelte ich hinüber ins portugiesische Viertel, um dort zu schreiben, wieder in einem Reihenhaus, im dritten Stock. Genau in diesem dritten Stock waren kurz zuvor noch über den ganzen Boden die einzelnen Seiten des Oxford Book of Canadian Poetry in English verstreut gelegen, mit dessen Herausgabe ich gerade fertig geworden war.
Im Herbst 1983 gingen wir nach England und mieteten uns ein Pfarrhaus in Norfolk, in dem es angeblich spukte: im Wohnzimmer Nonnen, im Esszimmer ein fröhlicher Gesell und in der Küche eine Frau ohne Kopf. Zu Gesicht bekamen wir die Gespenster nie, wobei tatsächlich einmal ein fröhlicher Gesell aus dem benachbarten Pub hereinschneite und das Klo suchte. Das Telefon war ein Münzfernsprecher in einem Häuschen außerhalb, das nebenbei als Kartoffelkeller diente, und ich musste für diverse Redaktionsgespräche – zum Beispiel zur Updike-Rezension in diesem Buch hier – über und durchs Gemüse klettern.
Zum Schreiben ging ich in eine zum Ferienhaus umgebaute Fischerhütte, wo ich mit dem AGA-Ofen genauso zu kämpfen hatte wie mit meinem gerade begonnenen Roman. Dabei zog ich mir zwar meine ersten Frostbeulen zu, musste den Roman aber irgendwann aufgeben, da ich mich in der zeitlichen Reihenfolge hoffnungslos verfranzt hatte.
Direkt darauf zogen wir nach Westberlin, wo ich im Frühjahr 1984 mit dem Report der Magd begann. Wir machten Abstecher nach Polen, Ostdeutschland und in die Tschechoslowakei, und das schlug sich in der Atmosphäre des Romans nieder: Das Klima der Angst und des Schweigens haben totalitäre Diktaturen, egal, in welchem Gewand, ja gemeinsam.
Im Frühjahr 1985 schrieb ich das Buch fertig, inzwischen im Rahmen einer Gastprofessur an der Universität von Alabama in Tuscaloosa. Das war der letzte Roman, den ich auf einer elektrischen Schreibmaschine schrieb. Die Kapitel faxte ich, sobald sie fertig waren, einzeln an meine Schreibkraft in Toronto, damit sie ordentlich getippt wurden – und ich weiß noch, wie fasziniert ich von der Zauberei der Direktübertragung war. Der Report der Magd erschien 1985 in Kanada und 1986 in England und den USA und sorgte für ein bisschen Wirbel, unter anderem kam er auf die Shortlist des Booker-Preises.
1987 lebten wir eine Zeit lang in Australien, wo ich endlich mit Katzenauge zurande kam, einem Roman, mit dem ich jahrelang gerungen hatte. Die verschneitesten Szenen im Buch wurden übrigens an lauen Sydneyer Frühlingstagen geschrieben, während die Kookaburras auf der Terrasse lautstark um Hamburger bettelten. Der Roman erschien 1988 in Kanada und 1989 in den Vereinigten Staaten und in England, wo er wiederum auf die Booker-Preis-Shortlist kam. Zur selben Zeit wurde die Fatwa gegen Salman Rushdie verhängt. Wer hätte damals geahnt, dass das der erste Stein war, der eine wahre Lawine ins Rollen bringen würde?
Während der ganzen Zeit hatte sich Der Report der Magd allmählich durch die Eingeweide der Filmindustrie gerobbt. Schließlich kam er in fertiger Form zum Vorschein, das Skript von Harold Pinter und gedreht unter der Regie von Volker Schlöndorff. Seine Premiere hatte er 1989 in West- und Ostberlin, direkt nach dem Fall der Mauer, von der man übrigens Steine kaufen konnte, die besprühten waren etwas teurer. Ich flog zu beiden Premierenfeiern hin. Dieselben Grenzbeamten, die uns 1984 noch so kaltschnäuzig behandelt hatten, tauschten jetzt grinsend mit Touristen Zigarren aus. Die Ostberliner konnten dem Film übrigens besonders viel abgewinnen. »Genau so war unser Leben«, sagte eine Frau leise zu mir.
Wie euphorisch wir 1989 waren, einen Augenblick lang zumindest. Wie fasziniert vom Unmöglichen, das Wirklichkeit geworden war. Wie sehr wir uns täuschten mit der schönen neuen Welt, die sich da vor uns auftat.
1 Reisen zurück
Drei Uhr morgens, Highway 17 zwischen Ottawa und North Bay, November. Ich schaue nach draußen auf das Fastnichts, das sich vor dem Fenster auftut. Noch den Kaffeegeschmack vom Busbahnhof in Ottawa im Mund, wo ich vier Stunden lang festsaß, weil irgendwer in Toronto sich mit den Fahrplänen vertan hat; ich habe Briefe geschrieben und mich bemüht, nicht zu gaffen, während die Bedienungen sich einen verhutzelten Betrunkenen vom Hals schafften. »Ich war schon überall auf der ganzen Welt, Süße«, lallte er, während sie ihm kurzerhand den Mantel überstülpten, »ich war schon an Orten, davon kannst du nur träumen!«
Der Bus legt sich in die zahlreichen Kurven; die Scheinwerfer beleuchten Asphalt, schneegesalzene Straßenränder, dunkle Bäume. Ich male mir aus, wie wir am Motel vorbeirauschen, denn das sei gleich bei Renfrew, hatte es geheißen, aber davor oder dahinter?, und ich mit meinen zwei Koffern zu Fuß gehen muss, bestimmt eine Meile, die Koffer voller eigener Bücher, die ich mitschleppe, weil es am Ziel vielleicht gar keine Buchhandlung gibt, woher soll man das in Toronto schon wissen? Dann ein Truck, und all das schöne, authentische Kanada wird zu Brei. Später würde sich die Polizei fragen, was ich da überhaupt zu suchen hatte, und genau das frage ich mich im Moment auch. Morgen um neun (um neun!) soll ich in der Highschool von Renfrew eine Dichterlesung abhalten. Viel Spaß in Renfrew, haben mir meine Freunde in Toronto gewünscht, das war dann wohl ironisch gemeint.
Ich denke an den Sommer, an einen Swimmingpool in Frankreich, ein Bekannter planscht auf dem Rücken im Wasser und erklärt, warum es verboten sein sollte, dass kanadische Bankdirektoren sich Group-of-Seven-Bilder an die Wand hängen – gibt ein falsches Bild, lauter Landschaft, keine Menschen –, und ein buntes Gemisch aus Europäern und Amerikanern lauscht ihm skeptisch.
»Mann, Kanada«, knödelt der eine. »Das sollten sie doch einfach den Staaten schenken, das wäre das Beste. Alles außer Quebec, das kriegen die Franzosen. Also, zieh doch einfach endgültig hierher, du lebst doch gar nicht mehr richtig da in der Pampa.«
Irgendwann kommen wir in Renfrew an, und ich steige aus dem Bus direkt in knöcheltiefen, früh gefallenen Schnee. Da lag er falsch, der Amerikaner: Wenn ich überhaupt irgendwo hingehöre, dann hierher. Der Highway 17 war mein erster Highway, ein halbes Jahr nach meiner Geburt bin ich ihn entlanggefahren, von Ottawa über North Bay und Temiskaming und weiter auf einer einspurigen Holperstraße in die Wildnis. Dann nahmen wir ihn zweimal pro Jahr, in Richtung Norden, wenn das Eis schmolz, und wenn der Schnee kam, in Richtung Süden, die Zeit dazwischen wurde im Zelt oder in der Quebecer Blockhütte verbracht, die mein Vater auf einem Granitfelsen gebaut hatte, eine Bootsmeile von einem so abgeschiedenen Dorf, dass es erst zwei Jahre vor meiner Geburt überhaupt eine Straße dorthin gab. Die Städte, an denen ich damals vorbeikam und jetzt vorbeikomme – Arnprior, Renfrew, Pembroke, Chalk River, Mattawa, mit ihren alten Zuckerbäckervillen, errichtet mit Geld aus der Holzwirtschaft und im unerschütterlichen Glauben, dass der Wald nie zur Neige gehen würde –, das waren Marksteine, auch Zwischenstationen auf der Fahrt. Aber das ist alles 30 Jahre her, inzwischen ist der Highway ausgebaut, jetzt gibt es Motels. Mir kommt überhaupt nichts bekannt vor, nur die Schwärze der Bäume.
Erst mit elf ging ich zum ersten Mal ein ganzes Jahr lang in die Schule. Amerikaner finden solche Schilderungen meiner Kindheit – Nomadenleben, abgeschieden, viel Wildnis – immer weniger erstaunlich als Kanadier: So wird Kanada in der Hochglanzwerbung schließlich dargestellt. Sie sind ein bisschen enttäuscht, wenn sie hören, dass ich nie in einem Iglu gelebt habe und mein Vater auch nicht »On, huskies!« ruft wie Sergeant Preston in der amerikanischen Radiosendung von anno dazumal, aber ansonsten finden sie mich ganz plausibel. Die Stirn runzeln eher die Kanadier, besser gesagt, die Leute aus Toronto. Es ist, als gehörte ich zu ihrer eigenen Vergangenheit, die sie für unwürdig halten oder schwer vorstellbar oder schlicht frei erfunden.
Ich habe noch nie in einer Highschool gelesen. Anfangs bin ich furchtbar nervös und kaue, während die Lehrerin mich vorstellt, auf meinen Tums herum; ich weiß noch genau, wie wir in der Highschool durchreisende Honoratioren behandelt haben: unverschämtes Geflüster, Krach, schlimmstenfalls Gummibänder und Büroklammern, wenn keiner aufgepasst hat. Bestimmt haben sie noch nie von mir gehört und interessieren sich keine Spur. Wir hatten in der Highschool keine kanadische Lyrik und auch sonst nicht viel Kanadisches. In den ersten vier Jahren nahmen wir die Griechen und Römer durch, die alten Ägypter und die Könige von England, und im fünften hatten wir dann Kanada, aus einem langweiligen blauen Buch, in dem es hauptsächlich um Weizen ging. Einmal im Jahr tauchte ein gebrechlicher alter Mann auf und las ein Gedicht über eine Krähe; anschließend verkaufte er seine eigenen Bücher (wie ich gleich) und signierte sie mit spilleriger Handschrift. So ging kanadische Lyrik. Ob ich wohl so wirke wie er: verletzlich, fehl am Platz und überflüssig? Ist die wahre Action – die wahre Action – nicht eher ihr Fußballspiel am Nachmittag?
Fragestunde: Haben Sie eine Botschaft? Sind Ihre Haare von Natur aus so, oder ist das eine Dauerwelle? Woher kriegen Sie Ihre Ideen? Wie lange braucht man für ein Gedicht? Was bedeutet das denn? Finden Sie es nicht komisch, Ihre eigenen Gedichte vorzulesen? Ich könnte das nicht. Was ist überhaupt die kanadische Identität? Wo kann ich meine Gedichte hinschicken? Damit sie veröffentlicht werden?
Das sind alles Fragen mit Antworten, manchmal mit kurzen, manchmal mit langen. Erstaunlich daran finde ich, dass sie überhaupt fragen, dass sie mit mir reden wollen: An meiner Highschool hat man nicht gefragt. Und manche schreiben sogar, unglaublich. Das war früher anders, denke ich mir und komme mir unheimlich alt vor.
In Deep River wohne ich bei meinem Cousin zweiten Grades, einem Naturwissenschaftler mit den erbarmungslosen blauen Augen, der wulstigen Stirn und der Adlernase meiner Verwandten mütterlicherseits aus Nova Scotia. Er führt mich durch den Forschungsreaktor, in dem er arbeitet; wir tragen weiße Mäntel und Socken, damit wir nicht verstrahlt werden, und schauen zu, wie hinter einer 35 Zentimeter dicken, verbleiten Glasscheibe eine eiserne Klaue ganz unschuldig aussehende, tödliche Gegenstände bewegt – Stifte, eine Blechdose, ein Taschentuch. »Drei Minuten da drin«, sagt er, »und du bist tot.« Die Faszination unsichtbarer Kräfte.
Anschließend begutachten wir, was die Biber auf seinem Grundstück wieder angerichtet haben, und er erzählt mir Geschichten über meinen Großvater, aus der Zeit, als es noch keine Autos und Radios gab. Ich mag solche Geschichten, ich sammle sie von all meinen Verwandten, sie spinnen für mich einen Faden in die Vergangenheit und zu einer Kultur, die aus Menschen besteht, aus ihren Beziehungen und Vorfahren, nicht nur aus Landschaft mit Objekten. Diesmal kriege ich eine neue Geschichte erzählt: von der gescheiterten Bisamfarm meines Großvaters. Sie bestand aus einem sorgfältig eingezäunten Sumpf, denn mit Zaun, dachte mein Großvater, würden sich die Bisamratten leichter einfangen lassen; mein Cousin meinte allerdings, er habe außerhalb der Umzäunung mehr Bisamratten gefangen als mein Großvater je drinnen. Das Unternehmen ging pleite, als ein Farmer weiter oben sein Apfelspritzmittel in den Fluss kippte und die örtlichen Bisamratten damit ausrottete; allerdings kam dann die Depression, und der Bisamrattenmarkt fiel ohnehin ins Bodenlose. Der Zaun steht noch.
Die meisten Geschichten über meinen Großvater sind Erfolgsgeschichten, aber diese bekommt jetzt einen Platz in meiner Sammlung: Wenn Totems Mangelware sind, haben Misserfolgsgeschichten ihren Platz. »Wusstest du eigentlich«, sage ich zu meinem Cousin und wiederhole, was mir meine Großmutter unlängst erzählt hat, »dass eine unserer weiblichen Vorfahren als Hexe ertränkt wurde?« Das war in New England; ob sie unschuldig unterging oder schuldig über Wasser blieb, ist nicht überliefert.
An seinem Wohnzimmerfenster mit Blick über den Ottawa River nichts als Bäume, da bin ich zu Hause. Mehr oder weniger jedenfalls.
Über Nacht gefrierender Regen; zur nächsten Dichterlesung ziehe ich meine zwei Koffer auf einem Schlitten zwei Meilen weit über Glatteis.
Wegen des Eisregens komme ich mit einer Stunde Verspätung in North Bay an. Abends lese ich in der Oddfellow’s Hall, in einem Kellerraum. Die Uni-Leute, die die Lesung organisiert haben, sind nervös, wahrscheinlich komme keiner, meinen sie, eine Lyriklesung habe es in North Bay noch nie gegeben. In einer Stadt, in der alle den einen Film im Kino schon gesehen haben, brauchten sie sich keine Sorgen zu machen, sage ich, und tatsächlich, die erste Viertelstunde lang tragen sie hauptsächlich immer weiter Stühle herein. Diesmal sind es keine Schüler oder Studenten, sondern alle möglichen Zuhörer, alte, junge, eine Freundin meiner Mutter, die immer bei uns in Quebec abgestiegen ist, ein Mann, dessen Onkel das Angelcamp am Ende des Sees betrieb.
Am Nachmittag hatte ich noch ein Interview fürs Lokalfernsehen gehabt, mit einem steifen Herrn im engen Anzug. »Na, was haben wir denn da?«, fragte er und fasste ein Buch von mir nonchalant zwischen Daumen und Zeigefinger, um den Zuschauern zu demonstrieren, dass er mit Lyrik nichts am Hut hat, sondern ein richtiger Mann ist: »Ein Kinderbuch?« Ich schlug ihm vor, es doch mal mit Lesen zu versuchen, wenn er wissen wolle, was drinsteht. Er wurde wütend, so eine Unverschämtheit sei ihm noch nie untergekommen, nicht einmal Jack McClelland habe ihn so behandelt, als der in North Bay gewesen sei. Anstelle des Interviews kam dann ein Feature über grüne Nudeln.
Später, dreißig Lyriklesungen später. Ein Gedicht in New York lesen, in dem ein Plumpsklo vorkommt, und dann Plumpsklo erklären müssen (hinterher kommen die zwei, drei Zuschauer alle verstohlen nach vorn und sagen, sie hätten auch mal, früher …). Einen Mann kennenlernen, der noch nie eine Kuh gesehen hat, der überhaupt noch nie aus New York herauskommen ist. Darüber reden, ob es eigentlich einen Unterschied zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten gibt (»Ich war schon an Orten, davon kannst du nur träumen …«). In Detroit zu erklären versuchen, dass in Kanada aus unerfindlichen Gründen zu Dichterlesungen nicht nur andere Dichter kommen. (»Sie meinen, da lesen Menschen wie meine Mutter Gedichte?«) Mir von jemandem sagen lassen, die Stärke an meinen Gedichten sei wohl ihre »regionale« Qualität, »wissen Sie, wie bei Faulkner …«.
In London, Ontario, die letzte Lyriklesung des Jahres oder vielleicht, denke ich mir, für immer. Ich komme mir allmählich vor wie ein Grammofon. Eine Dame: »Seit dieser ganze Nationalismus aufgekommen ist, fühle ich mich immer weniger als Kanadierin.« Noch eine Dame, sehr alt, mit erstaunlich wachem Blick: »Denken Sie in Metaphern?« Jemand anderes: »Was ist eigentlich die kanadische Identität?« Solche Themen beschäftigen die Leute anscheinend.
Wie soll man das alles in seinem Kopf zusammenbringen, wie ich in meinem Kopf? Ich lebe doch auch nur da, wo alle anderen leben: nicht einfach an einem Ort oder in einer Region, wobei das natürlich schon auch (ich hätte genauso gut Vancouver und Montreal nehmen können, wo ich je ein Jahr gelebt habe, oder Edmonton, da waren es zwei, oder den Lake Superior oder Toronto …), sondern an einem Flecken Erde, der sich aus Bildern zusammensetzt, aus Erfahrungen, dem Wetter, der eigenen Vergangenheit und der seiner Vorfahren; aus dem, wie die Leute reden, wie sie aussehen und wie sie auf das reagieren, was man tut; aus bedeutsamen Ereignissen und trivialen, ohne dass einem die Verbindungen dazwischen immer klar sind. Die Bilder kommen von außen, die sind da, mit denen leben wir, und mit denen müssen wir umgehen. Aber wie wir sie einschätzen und welche Verbindungen wir ziehen (Was bedeutet das eigentlich?), das leisten wir im Kopf, und wir leisten es mit Wörtern: gut, schlecht, schön, scheußlich, soll ich bleiben oder weiterziehen, will ich überhaupt noch da leben? Für mich geht es beim Schreiben unter anderem darum: zu erforschen, wo in der Wirklichkeit ich lebe.
Ich glaube, Kanada ist mehr als andere Länder ein Ort, für den man sich entscheidet. Nichts ist leichter, als wegzugehen, und viele tun das ja auch. Da sind die USA und England, über deren Geschichte wir in der Schule mehr lernen als über unsere eigene, dort können wir uns unauffällig unters Volk mischen, zu Dauertouristen werden. Man wird in Kanada ständig aufgefordert, sein tatsächliches Erleben zu negieren, zu glauben, nur in »richtigen« Städten wie New York, London oder Paris könne das Leben sinnvoll oder bedeutsam sein. Verlockend ist das natürlich: Der Swimmingpool in Frankreich ist ja so herrlich abgehoben. Aber die eigentliche Frage ist: Warum bleiben? Und die muss man sich beantworten, immer wieder.
Ich halte Kanada nicht für »besser« als andere Länder, genauso wenig, wie ich kanadische Literatur für »besser« als sonst eine halte; ich wohne im einen und lese die andere aus einem simplen Grund: Sie gehören zu mir, mit allem Besitzerstolz, der da mitschwingt. Wenn man nicht anerkennt, wo man herkommt – und das schließt auch den Nudelmann mit seiner Feindseligkeit und die antinationalistische Lady samt ihren Zweifeln mit ein –, dann verstümmelt man sich selbst: Man bekommt vielleicht etwas Freischwebendes, wird Weltbürger (in welchem Land hat man sonst noch diesen Ehrgeiz?), aber das kostet: einen Arm, ein Bein, das Herz. Indem man seine Zugehörigkeit entdeckt, entdeckt man sich selbst.
Aber da ist noch ein Bild, eine äußere Tatsache, die ich hier anführen muss. Dieses Gebiet, dieses Etwas, das meinen Besitzerstolz weckt, ist vielleicht schon bald nicht mehr meines. Zur viel beschworenen kanadischen Identität gehört nämlich auch, dass die Kanadier so begeistert wie wenig andere Nationalitäten ihr Land verscherbeln. Natürlich gibt es Käufer, die unsere Bodenschätze »erschließen« wollen, wie sie das nennen; die gibt es immer. Dass wir sie so bereitwillig hergeben, das sollten wir überdenken. Bodenschätze erschließen und Potenziale fördern sind zweierlei: Das eine geschieht von außen, mit Geld, das andere von innen, mit, und das schreibe ich jetzt, fast ohne zu zögern, mit Liebe.
2 Rezension zu ins Wrack tauchen
Der vorliegende Gedichtband ist Adrienne Richs siebter, und er ist ein außerordentliches Werk. Als ich die Autorin zum ersten Mal daraus lesen hörte, dachte ich, jemand schlage auf meinen Schädel ein, mal mit einem Eispickel, mal mit einem Hammer oder Beil. Mir schienen vor allem Wut und Hass daraus zu sprechen, und die stecken auch sicherlich drin, aber als ich die Gedichte später las, weckten sie viel subtilere Emotionen. Diving into the Wreck ist eines jener seltenen Bücher, die einen zwingen, Stellung zu beziehen; nicht nur zu ihm, sondern zu einem selbst. Es ist ein Buch, das etwas riskiert, und es zwingt seine Leser, dasselbe zu tun.
Wäre Adrienne Rich keine gute Lyrikerin, könnte man sie leicht als laute Emanze abtun, die uns Polemik statt Poesie serviert, simplizistische Botschaften statt komplexen Gehalts. Aber sie ist eine gute Lyrikerin, und ihr Buch ist kein Manifest, auch wenn es Manifeste enthält, keine Proklamation, auch wenn es Proklamationen macht. Es ist ein Buch der Erkundungen, der Reisen. Das Wrack, in das sie in dem sehr starken Titelgedicht taucht, ist das Wrack der obsoleten Mythen, besonders derer zu Männern und Frauen. Sie macht sich auf den Weg zu etwas, das bereits in der Vergangenheit liegt, um die Realität hinter dem Mythos für sich zu entdecken, »das Wrack und nicht die Geschichte des Wracks / das Ding selbst und nicht den Mythos«. Was sie findet, ist halb Schatz, halb Leiche, im Übrigen erkennt sie, dass sie selbst Teil des Ganzen ist, ein »halb zerstörtes Instrument«. Ganz distanzierte Forscherin, hat sie ein Messer im Gepäck, um sich den Weg ins Innere zu bahnen, Strukturen freizulegen; eine Kamera zum Dokumentieren und das Buch der Mythen selbst, ein Buch, in dem bisher kein Platz für solche Forscherinnen war wie sie.
Ihre Suche – die Suche nach etwas Unbestimmtem jenseits der Mythen, nach den Wahrheiten über Männer und Frauen, nach dem Ich und dem Du, dem Er und dem Sie oder, allgemeiner, nach den Machtlosen und den Machthabern (in den Anspielungen auf Kriege und Verfolgungen unterschiedlichster Art) –, diese Suche zieht sich durchs ganze Buch und präsentiert sich in einem klaren, pointierten Stil und in Metaphern, die selbst zu Mythen werden. An den besten Stellen changieren die Gedichte wie Träume, sind offenbarungs- und anspielungsreich, maskieren und kaschieren gleichermaßen. Die Wahrheit ist eben nicht bloß, was man findet, wenn man eine Tür aufmacht: Sie ist selbst eine Tür, durch die die Dichterin sich jeweils anschickt zu gehen.
Die Landschaften sind vielfältig. Das erste Gedicht, Versuch, mit einem Mann zu reden spielt in einer Wüste, einer Wüste, die nicht nur Mangel und Sterilität ist, der Ort, an dem alles außer dem Lebensnotwendigen abgestreift wurde, sondern auch der Ort, an dem Bomben getestet werden. Das »Ich« und das »Du« haben alle Nichtigkeiten aus ihrem früheren Leben aufgegeben, »Abschiedsbriefe« ebenso wie »Liebesbriefe«, um das Wagnis einzugehen, die Wüste zu verändern; doch es wird klar, dass die »Szenerie« bereits »verdammt« ist, dass die Bomben keine äußerliche Bedrohung sind, sondern eine innerliche. Die Dichterin spürt, dass sich die beiden etwas vormachen, »wir reden von der Gefahr / als läge sie nicht in uns / als testeten wir etwas Fremdes«.
Wie das Wrack, so liegt auch die Wüste in der Vergangenheit und kann nicht mehr errettet werden, aber vielleicht noch verstanden, genauso, wie die Landschaft in Im Dunkeln aufwachen:
Die Tragödie Sex
umgibt uns, ein Waldstück
für das man schon die Äxte schärft …
Nichts kann es retten, ich bin allein
geb letzten rotten Stämmen einen Tritt mit ihrem eigentümlichen Geruch nach Leben
nicht nach Tod frage mich, was um alle Welt
daraus hätte werden können.
Da sie der Ansicht ist, das Wrack, die Wüste, das Waldstück könnten nicht erlöst werden, ist es die Aufgabe der Frau, der Sie, der Machtlosen, sich darauf zu konzentrieren, sich nicht etwa in die Landschaft einzufügen, sondern sich selbst zu erlösen, eine neue Landschaft zu schaffen, sich auf die Welt zu bringen:
… deine Mutter tot und du
noch nicht geboren
mit beiden Händen packst du deinen Kopf
drehst ihn gegen die Schneide
des Lebens
nervös wie eine Hebamme
die ihr Handwerk erst lernt
Aus: Der Spiegel, in dem zwei als eins erscheinen
Wie schwierig das ist (die Dichterin ist schließlich immer noch von der alten verdammten Landschaft und den »Spuren der Zerstörung« umgeben), darum geht es in diesem Buch hauptsächlich. Klar zu sehen und zu dokumentieren, was man gesehen hat – die Vergewaltigungen, die Kriege, die Morde, die unterschiedlichsten Sorten von Gewalt und Verstümmelung –, das ist ihr Bestreben, dafür benötigt sie ein drittes Auge, ein Auge, das Schmerz mit »Klarheit« sieht. Das andere ist ihre Reaktion darauf, und diese Reaktion ist Wut; aber eine »visionäre Wut«, die hoffentlich Platz schafft für die Fähigkeit zu lieben.
Am meisten überzeugen mich die Gedichte, wenn sie sich als Strukturen von Wörtern und Bildern selbst treu bleiben, wenn sie der Versuchung des Parolenschmetterns widerstehen, wenn sie mir nichts predigen. »Die Wörter sind Richtungen, die Wörter sind Karten«, sagt Rich, und mir sind sie als Karten lieber (wobei Rich vermutlich sagen würde, das eine bedinge das andere, und ich ihr vermutlich zustimmen würde). Gedichte wie Vergewaltigung und Anspielungen auf den Vietnamkrieg sagen mir weniger, auch wenn sie zweifellos die Wahrheit sprechen, als Gedichte wie Von einer Überlebenden und August mit seinem grauenhaften Schlussbild:
Er ist zu schlicht, ich kann
seine Albträume nicht weiter teilen
Meine eigenen werden klarer, sie
öffnen sich
in die Vorzeit
es sieht aus wie ein Dorf, flammend vor
Blut
In dem alle Väter schreien:
Mein Sohn gehört mir!
Es genügt nicht, die Wahrheit auszusprechen; ausmalen müssen wir sie uns, ausmalen, und wenn Rich das tut, ist sie unwiderstehlich. Wenn sie das tut, ist sie außerdem am typischsten sie selbst. Bei ihren besten Bildern, ihren besten Mythen spürt man, dass niemand sonst so schreibt wie sie.
3 Rezension zu Anne Sexton: Selbstporträt in Briefen
Anne Sexton war eine der wichtigsten amerikanischen Dichterinnen ihrer Generation. Wegen des intensiven »bekenntnishaften« Charakters ihrer Gedichte wurde sie von der Kritik gleichermaßen gepriesen und geschmäht. Zu Anfang wäre es ein Leichtes gewesen, sie wie so viele andere vielversprechende junge Autorinnen in den Fünfzigerjahren als neurotische Hausfrau mit Lagerkoller abzuqualifizieren, die unbedingt schreiben will. Aber mit der Zeit wäre das doch schwierig geworden. Zwar war sie Hausfrau, zwar war sie neurotisch – auf beidem besteht sie in ihren Briefen nachdrücklich –, aber sie hatte auch Talent, Ehrgeiz und Elan. Obwohl sie erst mit neunundzwanzig anfing, ernsthaft zu schreiben, hatte sie am Ende ihrer achtzehn Jahre währenden poetischen Laufbahn neun Bücher veröffentlicht und alles an weltlichem Erfolg gehabt, was einem mit Gedichten zuteilwerden kann. Sie hatte einen Pulitzer-Preis bekommen, war auf mehreren internationalen Lyrikfestivals in Erscheinung getreten, hatte an der Universität unterrichtet, ohne selbst studiert zu haben, und hatte sich eine breite Leserschaft erobert. 1974 nahm sie sich dann ohne offensichtlichen Grund zu Hause in Weston, Massachusetts, das Leben.
Vor ihrem Selbstmord hatte sie noch für die Entstehung dieser Briefsammlung gesorgt. Sie hatte eine literarische Nachlassverwalterin und eine offizielle Biografin benannt und war zeit ihres Erwachsenenlebens Sammlerin gewesen – alles hatte sie aufgehoben: gepresste Blumen, Tanzkarten, Postkarten und Schnappschüsse. Außerdem hatte sie von all ihren Briefen Durchschläge aufbewahrt, und die Herausgeberinnen des vorliegenden Bandes mussten sich, bevor sie diese relativ kleine Auswahl trafen, durch 50 000 Schreibzeugnisse aller Art lesen. Man läuft sofort instinktiv zum Ofen – nicht mit dem Buch, sondern mit seiner eigenen Zettelwirtschaft. Wer will schon, dass nach seinem Tod Fremde dein Flirtgezwitscher an den Highschool-Boyfriend lesen, deine boshaften Bemerkungen über andere, deine Liebesbriefe? Anne Sexton wollte das – und vielleicht besteht hier ein Zusammenhang zu ihrem letzten Akt. Ihre sorgfältig gehütete Korrespondenz gehörte zu dem Denkmal, das sie ihrem toten Ich zu Lebzeiten so sorgsam errichtet hatte. Wenn man die Zeit anhalten kann, solange man noch darin lebt, dann kann einem kein unbekanntes Monster aus der Zukunft etwas anhaben. Und Anne Sexton hatte zutiefst Angst vor der Zukunft.
Die Briefe von Dichterinnen sind nicht unbedingt interessanter als die Briefe von Bankangestellten, aber Anne Sexton schrieb außergewöhnliche Briefe. Im täglichen Umgang mochte sie schwierig, manchmal sogar unmöglich sein, das machen uns die Herausgeberinnen nur allzu deutlich klar, in ihren Briefen dagegen kamen ihre besten Seiten zur Geltung. Auf Distanz fand sie es wohl leichter, mit anderen umzugehen. Jedenfalls sind ihre Briefe – selbst die an Menschen, die sie angeblich nicht mochte – charmant, einfallsreich, unmittelbar und lebendig, auch wenn sie es ihrem Gegenüber manchmal zu sehr recht machen will, ja, ihm geradezu schmeichelt. Viele sind natürlich an andere Autoren gerichtet, und es wimmelt nur so von literarischen Anspielungen und sonstigen Details, die das Herz des Historikers höherschlagen lassen, aber nicht das ist das Spannende daran, vielmehr ist es der geschmeidige, spritzige, gewinnende Ton der Briefe selbst.
Dieser Ton ist allerdings nicht »die Stimme« von Anne Sexton; es ist nur eine ihrer Stimmen. Sie selbst teilte sich gern in zwei Persönlichkeiten auf: die »gute Anne« und die »böse Anne«, und die Briefe sind von der »guten Anne« geschrieben. Ihre Gedichte stammen von einer viel härteren, brüchigeren Stimme, und eine dritte Stimme wiederum war verantwortlich für ihre Wutanfälle, die paranoiden Schübe, die Zusammenbrüche, die schamlosen Manipulationen und die Alkoholsucht, die sich durch ihr Leben zogen. Sie verlangte viel von ihren Freunden, forderte unersättlich Aufmerksamkeit und vor allem Bestätigung und Liebe. Sie war eine schillernde Romantikerin, konnte sich über die Maßen freuen und praktisch in derselben Sekunde maßlos depressiv sein. Über diese Seite erfahren wir allerdings erst von ihren unsentimentalen Herausgeberinnen – eine davon ihre Tochter –, die man nur beglückwünschen kann, dass sie der sicherlich großen Versuchung widerstanden haben, alles fromm zu frisieren. In ihren Händen erscheint Sexton weder als Heldin noch als Opfer, sondern als Mensch mit Ecken und Kanten – komplex, oft liebevoll und manchmal unerträglich.
Die Briefe an sich sind übrigens nicht unbedingt ein »Selbstporträt«. Wie die Briefe von Sylvia Plath lesen sich die von Anne Sexton wie Tarnung, wie eine Maske von Sorglosigkeit. Plaths’ atemloser und oft spiegelglatter Briefstil hat scheinbar kaum etwas zu tun mit dem Menschen, der ihre außergewöhnlichen Gedichte schrieb. Bei Sexton sind sich Briefe und Gedichte näher, trotzdem tut sich noch eine Kluft dazwischen auf. Selbst wenn Anne Sexton ihre eigenen Selbstmordversuche beschreibt, lesen sich die Briefe nicht wie Briefe von jemandem, der sterben wollte, sondern vielmehr wie Briefe einer Frau, die sich leidenschaftlich wünschte zu leben und die sich wünschte, leidenschaftlich zu leben.
Für sie waren dieser Wunsch und der dann doch folgende Selbstmord keine unvereinbaren Gegensätze. Zwar sagte sie einmal, Selbstmord sei das Gegenteil von Poesie, sie konnte aber auch darüber spekulieren, dass einem ein Selbstmord »eine gewisse Macht« verleihe: »Ich betrachte das als Möglichkeit, den Tod auszutricksen.« (In typischer Anne-Sexton-Manier kommt sie schnell auf den Boden der Tatsachen zurück und fügt hinzu: »Sich umzubringen ist immer nur ein Versuch, dem Schmerz auszuweichen, trotz all der interessanten Vorstellungen, die ich dazu habe.«
Ein Selbstmord ist sowohl ein Vorwurf an die Lebenden als auch ein Rätsel, das nie zu lösen ist. Wie ein Gedicht ist ein Selbstmord in sich abgeschlossen, fertig und beantwortet keine Fragen nach seinem letzten Grund. Als missliche Folge solcher Akte fällt immer ein Schatten auf das Leben ihrer Urheber, und nur das Rätsel ihres Todes bleibt übrig.
Es wäre schade, wenn das bei Anne Sexton passieren würde. Diese Briefe sollten gelesen werden, und zwar nicht nur, weil sie Hintergründe für ihren Selbstmord liefern könnten, was sie sicherlich tun, sondern vor allem wegen ihrer Überschwänglichkeit und Lebensbejahung: nicht um des Todes, sondern um des Lebens willen.
4 Der Fluch der Eva – oder: Was ich in der Schule gelernt habe
Es war einmal … eine Zeit, da hätte man mich gar nicht eingeladen, um vor Ihnen zu sprechen, und diese Zeit ist noch gar nicht so lange her. Als ich 1960 an der Universität von Toronto studierte, galt es als offenes Geheimnis, dass die Englischabteilung des dortigen University College keine Frauen einstellte, wie qualifiziert sie auch sein mochten. Mein College hingegen stellte durchaus Frauen ein, es beförderte sie nur nicht besonders schnell. Eine meiner Dozentinnen war eine angesehene Expertin für Samuel Taylor Coleridge, und sie war viele Jahre lang eine angesehene Coleridge-Expertin, bis man es endlich für angebracht hielt, ihr mehr anzubieten als eine Dozentenstelle.
Zum Glück wollte ich keine Coleridge-Expertin werden, sondern Schriftstellerin, wobei Schriftstellerinnen offensichtlich noch weniger verdienten als Dozentinnen, weshalb ich beschloss, doch weiterzustudieren. Hätte ich brennenden akademischen Ehrgeiz besessen, wäre mir der allerdings gründlich vergangen, als mich einer meiner Professoren fragte, ob ich denn wirklich weiterstudieren wolle und nicht lieber heiraten. Ich kenne eine ganze Reihe von Männern, für die die Ehe eine vernünftige Alternative zum Beruf gewesen wäre; die meisten Männer sehen die Sache allerdings wenn nicht freiwillig, so doch notgedrungen ähnlich wie ein Freund von mir, der dafür bekannt ist, nichts fertig zu bringen, was er einmal angefangen hat.
»Also, mit dreißig«, hat er mal zu mir gesagt, »muss ich mich ja dann entscheiden zwischen Ehe und Beruf.«
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Na ja, um zu heiraten, muss ich ja wohl einen Beruf haben«, erwiderte er.
Von mir dagegen erwartete man wirklich eine Entscheidung für das eine oder das andere, und wenigstens in dieser Hinsicht haben sich die Zeiten doch hoffentlich geändert. Damals hätte eine Universität auch nicht im Traum daran gedacht, eine Vorlesungsreihe »Frauen über Frauen« zu nennen. Wenn sie sich dem Thema überhaupt gewidmet hätte, dann hätte sie wahrscheinlich einen bedeutenden Psychologen – keine Psychologin – eingeladen, über den angeborenen weiblichen Masochismus zu sprechen. Ein Studium für Frauen ließ sich kaum und wenn doch, dann nur dadurch rechtfertigen, dass die betreffenden Frauen so intelligentere Ehefrauen und besser informierte Mütter abgeben würden. Experten für Frauen waren dabei meistens Männer, die über dieses wie auch jegliches andere Wissen allein kraft ihres Geschlechts verfügten. Nun, die Zeiten haben sich geändert, und jetzt sollen Frauen angeblich über dieses Wissen verfügen – nur weil sie Frauen sind. Vermutlich hat man mich deshalb eingeladen, vor Ihnen zu sprechen, denn ich bin keine Expertin für Frauen und für sonst übrigens auch nichts.
Ich bin der akademischen Welt dann entfleucht und habe den Journalismus umgangen – den anderen Beruf, den ich in Betracht zog, bis mir jemand sagte, Journalistinnen schrieben am Ende doch bloß wieder über Todesfälle und Hochzeiten für die Frauenseite; das passe ja auch zu ihrer angestammten Rolle als Göttinnen des Lebens und des Todes, Bereiterinnen des Brautbetts und Leichenwäscherinnen. Geworden bin ich schließlich Schriftstellerin. Einen Roman habe ich gerade abgeschlossen, und deshalb möchte ich mich dem Thema als praktizierende Romanautorin nähern.
Ich beginne mit einer einfachen Frage, einer, mit der sich jeder Romanautor, ob männlich oder weiblich, irgendwann auseinandersetzen muss und ganz bestimmt auch jeder Kritiker.
Wozu sind Romane gut? Welche Funktion sollen sie erfüllen? Was sollen sie dem Leser Gutes tun, falls sie das überhaupt sollen? Sollen sie erbaulich oder lehrreich sein oder beides, und falls beides, behindern sich die beiden Ansprüche je gegenseitig? Soll ein Roman hypothetische Möglichkeiten ausloten, die Wahrheit aussprechen oder einfach eine gute Geschichte sein? Soll es in einem Roman darum gehen, wie man sein Leben leben soll, wie man es leben kann (da zeigen sich normalerweise erste Einschränkungen) oder wie die meisten Menschen ihr Leben tatsächlich leben? Soll ein Roman etwas über unsere Gesellschaft aussagen? Tut er das nicht sowieso? Und angenommen, ich schreibe einen Roman mit einer Frau als Hauptfigur, wie viel Aufmerksamkeit sollte ich den genannten Fragen dann widmen? Wie viel Aufmerksamkeit muss ich ihnen aufgrund der Kritikervorurteile widmen? Will ich diese Figur liebenswert, ehrenwert oder glaubhaft gestalten? Kann sie alles drei zugleich sein? Mit welchen Annahmen derer, die sie liebenswert, ehrenwert oder glaubhaft finden sollen, muss ich rechnen? Soll die Figur »Vorbild« sein?
Dass mir der Begriff »Vorbild« so ein Dorn im Auge ist, hat auch mit dem Kontext zu tun, in dem er mir zum ersten Mal begegnet ist. Das war nämlich an einer Universität, wo sonst, einer ausgesprochen männerdominierten Universität, an die ein Frauencollege angegliedert war, und für das Frauencollege wurde eine Dekanin gesucht. Mein Freund, ein Soziologe, erklärte mir, dass dieser Mensch eine Vorbildfunktion erfüllen müsse. »Was heißt das genau?«, fragte ich. Nun, die Dekanin müsse nicht nur akademische Meriten errungen haben und mit den Studenten zurechtkommen können, sie müsse auch verheiratet sein, Kinder haben, gut aussehen, gut gekleidet sein, sich sozial engagieren und so weiter. Ich fiel als Vorbild also schon mal aus. Andererseits wollte ich ja auch kein Vorbild werden, sondern Schriftstellerin. Und Zeit für beides hatte man offensichtlich nicht.
Wenn man als Dekanin in spe Vorbildfunktion erfüllen muss, ist das vielleicht gerade noch hinnehmbar, aber da Literaturkritiker diese Messlatte ebenfalls gern anlegen, besonders wenn sie weibliche Romanfiguren und manchmal auch die Autorinnen selbst beurteilen, heißt es da ganz genau hinzuschauen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Vor ein paar Jahren habe ich eine – von einer Rezensentin geschriebene – Besprechung von Marian Engels The Honeyman Festival gelesen. Die Heldin des Buches ist Minn, eine hochschwangere Frau, die meistens nichts Besseres zu tun hat, als der Vergangenheit nachzutrauern und sich über ihre Gegenwart zu beklagen. Sie hat keinen Job und wenig Selbstbewusstsein; sie ist schlampig, lässt sich gehen, hat dauernd ein schlechtes Gewissen und zweifelt an ihren Kindern genauso wie an ihrem Mann, der nur selten zu Hause ist. Die Rezensentin beklagte nun die mangelnde Initiative, die offensichtliche Faulheit und Planlosigkeit dieser Figur. Ihr wäre eine positivere, schwungvollere Heldin lieber gewesen, eine, die in der Lage ist, ihr Leben in die Hand zu nehmen, dem idealen Frauenbild, das sich damals in der Frauenbewegung allmählich etablierte, eher zu entsprechen. Minn war für die Kritikerin kein akzeptables Vorbild, und das gab Punkteabzug für das Buch.
Ich glaube allerdings, dass es viel mehr Minns gibt als ideale Frauen. Das hätte die Rezensentin vielleicht sogar unterschrieben, aber wohl auch gleichzeitig behauptet, die Autorin treffe dadurch, dass sie Minn und nur Minn beschreibt, also keine Alternative zu Minn liefert, zum Wesen der Frau eine Aussage, die diese unerwünschten, ohnehin im Übermaß vorhandenen Minn-mäßigen Eigenschaften noch verstärke. Sie wollte keine Loser-Geschichte lesen, sondern eine Erfolgsstory, und das ist für Romanschriftsteller jetzt ein echtes Problem. Wie definiert sich denn Erfolg, wenn man über Frauen schreibt? Wäre Erfolg da überhaupt plausibel? Warum hat zum Beispiel George Eliot, selbst erfolgreiche Autorin, nie eine Geschichte mit einer erfolgreichen Autorin als Hauptfigur geschrieben? Warum musste Maggie Tulliver als Preis für ihre Aufmüpfigkeit ertrinken? Warum wusste Dorothea Brooke mit ihrem Idealismus nichts Besseres anzufangen, als ihn an zwei Männer zu verschwenden, von denen der eine ihn überhaupt nicht verdiente, der andere ein arg schlichtes Gemüt war? Warum haben Jane Austens Figuren ihren Witz und ihren Scharfsinn in die Wahl des richtigen Ehemannes investiert und nicht ins Schreiben geistreicher Romane?
Eine mögliche Antwort könnte lauten, dass diese Autorinnen sich mit dem Typischen beschäftigt haben oder zumindest mit Ereignissen, die ihre Leser glaubhaft fänden; sich selbst in ihrer Existenz als Autorinnen hielten sie dagegen für so ungewöhnlich, dass sie sich die Glaubwürdigkeit absprachen. Eine Autorin war damals noch eine Anomalie, eine Kuriosität, eine dubiose Gestalt. Wie viel von dieser Gesinnung heute noch herumschwirrt, überlasse ich Ihrem Urteil, gleichzeitig möchte ich aber eine Bemerkung zitieren, die ein hochdekorierter männlicher Autor vor ein paar Jahren mir gegenüber gemacht hat. »Lyrikerinnen«, sagte er, »haben immer so was Geducktes. Sie wissen eben, dass sie in männliches Hoheitsgebiet eindringen.« Darauf folgen ließ er ein Statement des Inhalts, Frauen, und demnach auch Autorinnen, seien sowieso nur für eines zu gebrauchen, aber da diese Vorlesung veröffentlicht werden soll, werde ich diese kaum veröffentlichungsreife Bemerkung nicht zitieren.
Zurück zu meinem Problem, der Schaffung einer weiblichen Romanfigur. Ich gehe das Ganze noch mal aus einer anderen Ecke an. In unserer Literaturtradition herrscht ja kein Mangel an Frauenfiguren, und Autoren wie Autorinnen leiten ihre Vorstellung von Frauen natürlich aus denselben Quellen ab wie jeder andere auch: aus den Medien, aus Büchern, Filmen, Funk, Fernsehen und Presse, aus dem Elternhaus, aus der Schule und aus der Kultur insgesamt, der herrschenden Meinung. Manchmal übrigens zum Glück auch aus eigenen Erfahrungen, die alldem widersprechen. Jedenfalls könnte sich meine hypothetische Romanfigur an einer Vielzahl literarischer Vorläuferinnen orientieren. Ich könnte zum Beispiel ein paar Worte über weise alte Frauen verlieren, über delphische Orakel, über die Parzen, über böse Hexen, gute Hexen, weiße Göttinnen, Schlampengöttinnen, schlangenhaarige Medusen, die Männer zu Stein erstarren lassen, Meerjungfrauen ohne Seele, Kleine Meerjungfrauen ohne Stimme, über Schneeköniginnen, Sirenen mit Gesängen, Harpyien mit Flügeln, über Sphinxen mit und ohne Geheimnis, über Frauen, die sich in Drachen verwandeln, und Drachen, die sich in Frauen verwandeln, über Grendels Mutter und warum sie ein noch größeres Ungeheuer ist als Grendel; auch ein paar Worte über böse Stiefmütter, klischeehafte Schwiegermütter, Rabenmütter, leibliche Mütter, wahnsinnige Mütter, Medea, die ihre eigenen Kinder umgebracht hat, Lady Macbeth und ihre befleckten Hände, über Eva, unser aller Mutter, über das Meer als Urmutter und Mutter, was habe ich mit dir zu schaffen? Auch ein paar Worte über Wonder Woman, Superwoman, Batgirl, Mary Marvel, Catwoman und Rider Haggards Sie mit ihren übernatürlichen Kräften und dem Stromstoß im Gepäck, die einen armen kleinen sterblichen Mann allein durch eine Umarmung um die Ecke bringen konnte; auch über Little Miss Muffet und ihr Verhältnis zu der Spinne, Rotkäppchen und seine Unbesonnenheit dem Wolf gegenüber, Andromeda an ihrem Felsen, Rapunzel in ihrem Turm, Aschenputtel in Sack und Asche, über die Schöne und das Biest, die Frauen von Blaubart (bis auf die letzte), über Ann Radcliffes verfolgte Maiden, auf der Flucht vor Verführung und Mord, über Jane Eyre, auf der Flucht vor der Unschicklichkeit und Mr Rochester, über Tess of the D’Urbervilles, verführt und verlassen; auch über den viktorianischen Engel im Haus, über Agnes, die nach oben deutet, über die erlösende Liebe einer tugendhaften Frau, über Little Nell, die unter dem scheinheiligen Geschluchze eines ganzen Jahrhunderts vor sich hin stirbt, Little Eva desgleichen, nur ist da der Leser froh, über Ophelia, die ihren murmelnden Bach anbrabbelt, über die Lady von Shalott, die unter Schwanengesang gen Camelot treibt, über Fieldings Amelia, die sich durch Hunderte von Seiten Elend und Tücke des Schicksals flennt, und Thackerays Amelia, die das Nämliche tut, nur mit weniger Mitgefühl seitens des Autors. Auch über die Vergewaltigung der Europa durch den Stier, die Vergewaltigung der Leda durch den Schwan, die Vergewaltigung der Lucretia und ihren anschließenden Selbstmord, über das wundersame Entrinnen vor der Vergewaltigung seitens mehrerer weiblicher Heiliger, über Vergewaltigungsfantasien und was sie von der Vergewaltigungsrealität unterscheidet, über Männermagazine mit Bildern von Blondinen und Nazis, über Sex und Gewalt von den Canterbury Tales bis hin zu T. S. Eliot, und ich zitiere: »Ich kannte mal einen, der machte ein Mädchen kalt. Jeder Mann könnte ein Mädchen kaltmachen, jeder Mann muss das, braucht das, will das, einmal im Leben ein Mädchen kaltmachen.« Auch ein paar Worte über die Hure Babylon, über die Hure mit dem goldenen Herzen, die Liebe eines liederlichen Frauenzimmers, die Hure ohne goldenes Herz, den scharlachroten Buchstaben, die scharlachrote Frau, die roten Schuhe, Madame Bovary und ihr Streben nach dem Spontanfick, Molly Bloom mit ihrem Nachttopf und ihrer ewigen Jasagerei, Kleopatra und ihren Freund, die Natter, was auch auf Little Orphan Annie und ihren Freund Asp, zu Deutsch Natter, ein ganz neues Licht wirft. Genauso über Waisenmädchen, genauso über Salome und den Kopf Johannes’ des Täufers und über Judith und den Kopf des Holofernes. Auch über Heftchenromane und was sie mit dem Calvinismus zu tun haben. Leider habe ich weder die Zeit noch das nötige Fachwissen, um all diese Bilder in der gebotenen Breite und Tiefe zu diskutieren – aber verdient hätten sie es. Bei allen handelt es sich natürlich um Frauenklischees aus der westeuropäischen Literaturtradition und deren kanadischen und nordamerikanischen Ablegern.
Es gibt noch viel mehr Varianten als die erwähnten, und die westliche Literaturtradition wurde zwar hauptsächlich von Männern etabliert, aber keineswegs wurden alle von mir erwähnten Frauenfiguren von Männern erfunden, von Männern tradiert oder von Männern rezipiert. Erwähnt habe ich sie nicht nur, um zu zeigen, wie viele Frauenbilder einem als Leser begegnen können, sondern vor allem, welche Bandbreite diese Bilder haben. Selbst die von Männern beschriebenen Frauen sind keineswegs auf die Figur der Einsamen Heulsuse beschränkt (diese passive, hilflose Kreatur, die nicht handeln kann, sondern nur erdulden), die bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein von der offiziellen Lehrmeinung zu Frauen befördert wurde. An Frauen war schon immer mehr dran, sogar an Frauenklischees, sogar damals.
Zum Beispiel scheint mir die moralische Bandbreite der Frauenklischees in der Literatur größer zu sein als die der männlichen Figuren. Helden und Bösewichte haben immerhin viel gemeinsam: Beide sind stark, beide haben sich in der Gewalt, beide handeln und tragen die Konsequenzen ihres Handelns. Selbst die beiden großen übernatürlichen Männerfiguren, Gott und der Teufel, haben eine Reihe von Eigenschaften gemeinsam. Sherlock Holmes und Professor Moriarty sind praktisch Zwillinge, und allein vom Kostüm und von der Handlung her ist sehr schwer zu sagen, welche von den Marvel-Comics-Supermännern angeblich böse sind und welche gut. Macbeth ist zwar nicht besonders nett, aber man versteht ihn wenigstens, außerdem haben ihn die drei Hexen und Lady Macbeth im Grunde ja angestiftet. Die drei Hexen sind dabei übrigens besonders interessant: Macbeths’ Motiv ist der Ehrgeiz, aber welche Motive haben die Hexen? Keine. Sie sind einfach, wie Steine oder Bäume: die guten nur gut, die bösen nur böse. Höchstens Jago und Hyde kommen da heran, aber bei Jago liegt zumindest teilweise der Neid als Motiv zugrunde, und Hyde hat als Kehrseite ja den allzu menschlichen Jekyll. Selbst der Teufel will einfach siegen, aber die extremen Frauenfiguren wollen anscheinend gar nichts. Sirenen verschlingen Menschen, weil Sirenen das eben so machen. Die bösen spinnenartigen alten Weiber bei D. H. Lawrence – ich denke da besonders an die Großmutter in The Virgin and the Gypsy