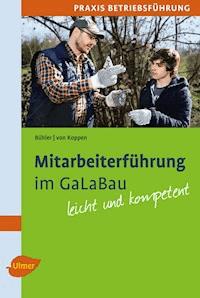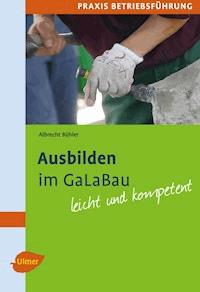
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie finde ich den richtigen Azubi für meinen Garten- und Landschaftsbaubetrieb? In diesem Buch finden Sie zahlreiche Praxisbeispiele und erprobte Werkzeuge, die fit für die neuen Herausforderungen machen und eine gute betriebliche Ausbildung gewährleisten. Für Unternehmer und Ausbilder in der Grünen Branche sowie im Handwerk. Der Autor ist selbstständiger Garten- und Landschaftsbauunternehmer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Albrecht Bühler
Ausbilden im GaLaBau
leicht und kompetent
Vorwort
Azubis im GaLaBau
Zukunftsthema Ausbildung
Wir entscheiden heute für morgen
Gut auszubilden ist eine bewusste Entscheidung
Der Wirkungsgrad der Ausbildung
Der demografische Wandel
Drei Fragen für die Ausbildung
Warum bilden wir aus?
Fachkräfte für den Betrieb
Fachkräfte für die Branche
Betriebliche Prägung
Ausbilden macht glücklich!
Das Ausbildungsparadox
Wen bilden wir aus?
Lernschwäche oder kein Bock
Artenvielfalt in der Ausbildung
Von der Bewerbung bis zur Unterschrift
Wie ticken Azubis?
Wie bilden wir aus?
Die Ausbildungspyramide
Checkliste zur Arbeitsqualität
Die Dimension Sicherheit
Die Dimension Vertrauen
Die Dimension Team
Die Dimension Herausforderung
Die Dimension Entwicklung
Ausbildung und Marketing
Wie finden mich die guten Azubis?
Persönlichkeit zeigen auf der Homepage
Checkliste Ausbildungsmarketing
Ausbildungsinitiativen
Gute Ausbildung lohnt sich!
Service
Beispiel für eine Azubivereinbarung
Musterbrief an die Schule
Zwei Tools für den Start ins neue Ausbildungsjahr
Hilfreiche Internetlinks für Ausbilder und Azubis
Literatur
Bildquellen
Impressum
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein gestandener Landschaftsgärtner setzt sich hin und schreibt ein Buch – das ist bemerkenswert. Und dann schafft er es auch noch, ein hochaktuelles Thema zu besetzen: Wie bilden wir unsere Top-Fachkräfte von morgen aus? Und wie finden wir die Top-Azubis, die zu uns passen? Diese Fragen treiben Unternehmer quer durch alle Branchen um, ob im 5-Mann-Betrieb oder im Großkonzern. Längst haben die Verantwortlichen erkannt: Wir können hoch qualifizierte Fachkräfte nicht einfach kaufen oder abwerben, sondern wir müssen sie selbst qualifizieren, sprich: ausbilden.
Für den Autor, Landschaftsgärtner und Diplom-Sozialpädagogen Albrecht Bühler ist Ausbildung ein Herzensthema. Das habe ich in zahlreichen gemeinsamen Ausbilder-Seminaren gespürt und erlebt. Er sieht seine Azubis mindestens ebenso gerne wachsen wie die Pflanzen in seinen Gärten. Unerschrocken und ideenreich fordert und fördert er sie mit klassischen und ungewöhnlichen Methoden. Mit diesem Buch öffnet er seine Schatzkammer. Werfen Sie einen Blick hinein, profitieren Sie von seinen Ideen und praktischen Erfahrungen. Sie werden jede Menge Anregungen für Ihren Betrieb und Ihre Ausbildung finden. Prüfen Sie einfach, was zu Ihnen passt und lassen Sie sich anstecken vom Enthusiasmus Ihres Kollegen – es lohnt sich.
Viel Spaß beim Lernen wünscht Ihnen
Eberhard Breuninger
Azubis im GaLaBau
Der Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) ist im Spektrum der grünen Ausbildungsberufe ein stark wachsender Bereich; hier werden seit Langem die meisten Gärtner ausgebildet. Was können die Betriebe tun, um neue Herausforderungen gut zu meistern? Eines ist sicher: Wer in Zukunft noch über gute Fachkräfte verfügt, der hat die Nase vorn.
Zukunftsthema Ausbildung
„Bewerbermangel und fehlende Ausbildungsreife gefährden Fachkräftesicherung. Die demografische Trendwende schlägt voll auf den Ausbildungsmarkt durch“, heißt es in einer Ausbildungsumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK. In Bezug auf die Grüne Branche warnt Sachsens Landwirtschaftsminister Kupfer vor Nachwuchsmangel und mahnt mehr Werbung für die Ausbildung von Fachkräften an (Sächsische Zeitung 21.04.2010).
Diese beispielhaften Stimmen machen deutlich: Ausbildung ist ein ganz heißes, ein ganz drängendes Thema. Ob wir dem Thema Bedeutung beimessen und wie wir damit umgehen, hat direkte Auswirkungen auf die Zukunft.
Für die Branche, für die Betriebe, aber auch für die Jugendlichen ist Ausbildung ein Thema, das für die Zukunft entscheidend ist.
Für die Branche stellt sich die Frage, wie die Attraktivität des Berufsbildes Gärtner in den verschiedenen Fachsparten nach außen positiv vermittelt werden kann. Wir können sicher sein: die Konkurrenz schläft nicht. Alle Mitbewerber im Handwerk und in der Industrie werden ihr Möglichstes tun, im Wettbewerb um die guten Auszubildenden zu punkten.
Für die Betriebe entscheidet sich hier zu 50% ihr Erfolg. Haben sie in den kommenden Jahren überhaupt noch die erforderlichen Fachkräfte? Können sie ihre Aufträge überhaupt noch abarbeiten? Bleibt das Know-how, das in den Unternehmen aufgebaut wird, erhalten und entwickelt es sich weiter?
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ Perikles, griechischer Politiker
Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist natürlich die Entscheidung für das Berufsfeld sowie für den jeweiligen Ausbildungsberuf ebenfalls ein Top-Thema und zukunftsentscheidend. Bin ich in einer Branche, in der ich mit einer guten Ausbildung mein Geld für den Lebensunterhalt verdienen kann? Finde ich einen guten Ausbildungsbetrieb, der mir die dafür notwendigen Fertigkeiten vermittelt?
Wir entscheiden heute für morgen
Im Bereich Ausbildung werden ständig Entscheidungen getroffen, die sich auf die Zukunft auswirken: beispielsweise die Auswahl von neuen Azubis oder die Festlegung, wie viele Personen der Betrieb ausbilden möchte. Ist der Vertrag erst einmal unterschrieben, hat sich das Unternehmen für drei Jahre festgelegt, mit dieser Person zusammenzuarbeiten und kontinuierlich Zeit und Ressourcen in deren Ausbildung zu investieren. Je nachdem, wie gut der Auswahlprozess gelungen ist, kann das drei Jahre Frust oder drei Jahre Freude bedeuten, wie viele Unternehmer aus eigener Erfahrung wissen.
Schon hier wird deutlich: Zu Beginn der Ausbildung entscheiden wir über einen Abschnitt in der Zukunft, nämlich die folgenden drei Jahre. Sehr häufig wird nach meiner Erfahrung aber die Zeit nach der Ausbildung schon so sehr in Betracht gezogen, dass sie uns den Blick für den zuerst anstehenden Abschnitt, die Ausbildung selbst, verstellt.
Veränderungsprozesse laufen in diesem Bereich sehr langsam ab, weil ein Umsteuern erst nach einer gewissen Zeit Wirkung zeigt. Das heißt, wenn ein Betrieb heute entscheidet, andere Kriterien für die Azubiauswahl einzuführen, dann startet er in 6–12 Monaten mit neuen Auszubildenden, die dann 2–3 Jahre später ihre Ausbildung abschließen. Andere Prozesse, etwa die Frage: „Wie bilden wir aus?“, können dagegen wesentlich kurzfristiger gesteuert und verändert werden.
Schatzkreis: Das Wertvolle in der Ausbildung.
Praxistipp: Gemeinsam Ziele definieren
Gestalten Sie zunächst die nahe Zukunft so, dass Sie möglichst viel Freude und Gewinn dabei haben. Überlegen Sie, welchen Gewinn die Ausbildung Ihrem Unternehmen bringt. Wenn Unternehmer, Ausbilder und Azubis das schriftlich festhalten, können sie die Ergebnisse in einer Gesprächsrunde austauschen. So finden Sie heraus, was die gemeinsamen Punkte sind und wo sich unterschiedliche Erwartungen ergeben.
Gut auszubilden ist eine bewusste Entscheidung
Es gibt wohl kaum Betriebe, die sich bewusst dafür entscheiden, eine schlechte Ausbildung durchzuführen. Allerdings gibt es genügend drastische Fälle in der Branche, bei denen sich dieser Eindruck geradezu aufdrängt.
Im Gegensatz zu guter Ausbildung, die eine bewusste Entscheidung voraussetzt und nur über einen kontinuierlichen Prozess erreicht werden kann, erfolgt schlechte Ausbildung von ganz allein, beinahe mühelos. Wenn ich will, dass sich etwas verbessert oder ein hohes Qualitätsniveau erhalten bleibt, dann muss ich Zeit und Energie investieren, und zwar kontinuierlich. Wenn ich will, dass sich etwas verschlechtert, dann genügt es, gar nichts zu tun. Ich höre auf, mir Gedanken zu machen, Zeit und Energie zu investieren. Der Rest ergibt sich von allein. Das gilt für meinen Schreibtisch zu Hause oder im Betrieb, für private Beziehungen, für Kundenbeziehungen und auch für Prozesse wie die betriebliche Ausbildung.
Sehr viele Betriebe wollen eine gute Ausbildungsarbeit leisten, so wie viele Eltern eine gute Erziehungsarbeit anstreben. Aber Erziehung im familiären Alltag wird meist nicht als bewusst gesteuerter Prozess begriffen und umgesetzt, sondern man lebt einfach zusammen. Im Gegensatz dazu liegen jeder Ausbildung ein Ausbildungsvertrag sowie ein Ausbildungsplan zugrunde, den beide Seiten unterzeichnen. Schon an dieser Stelle gibt das Unternehmen ein schriftliches Ausbildungsversprechen ab, das mehr beinhaltet als drei Jahre lang nebeneinander herzulaufen.
Wenn ich bei Vorträgen die Frage stelle: „Wer hat selbst eine betriebliche Ausbildung absolviert?“, melden sich meist mehr als 80% der Zuhörerinnen und Zuhörer. Das bedeutet, die meisten Menschen, die als Unternehmer oder Ausbilder mit dem Thema befasst sind, haben eigene Erfahrungen gemacht, gute und weniger gute. So kommt man sehr schnell auf Antworten, was denn einen guten oder einen weniger guten Betrieb ausmacht.
Wir können immer sagen, was o.k. oder nicht o.k. für uns ist, auch beim Thema Ausbildung.
Folgendes ist für Ausbilder, die auf eigene Erfahrungen zurückblicken, nicht o.k.:
– Führungslosigkeit
– alleingelassen werden
– zu wenig Kommunikation
– fehlende Rückendeckung
– Unsauberkeit
– Unterforderung
– ständig scharfe Kontrollen
– kein Lob und ein Chef, der meint, er könne alles besser
Folgendes ist für Ausbilder, die auf eigene Erfahrungen zurückblicken, o.k.:
– Interesse an den Mitarbeitern
– Förderung der Mitarbeiter
– Anerkennung der Arbeit
– Teamarbeit
– Freundlichkeit
– Fachkenntnis
– leistungsgerechte Bezahlung
– klare Anweisungen
Diese Ergebnisse wurden bei einem Workshop zum Thema Mitarbeiterführung beispielhaft zusammengetragen.
Praxistipp: Ziele umsetzen
Die bewusste Entscheidung „Wir möchten eine gute Ausbildung bieten“ sollte mit Ort und Datum getroffen werden. Diskutieren Sie mit Ihren Ausbildern und Azubis, was für jeden einzelnen gute Ausbildung bedeutet und setzen Sie dann in einem definierten Zeitraum – beispielsweise die nächsten sechs Monate – einzelne dieser Punkte um. Nach einem halben Jahr können Sie dann wieder zusammenkommen und feststellen, was schon erreicht wurde und was im nächsten Abschnitt umgesetzt werden soll.
Der Wirkungsgrad der Ausbildung
Der Wirkungsgrad der Ausbildung in den grünen Berufen mit einer Verlustquote von mehr als 40% reicht in Zukunft nicht mehr aus, um genügend Fachkräfte zu gewinnen. Von 100 Personen, die eine Ausbildung beginnen, stehen am Ende weniger als 60% als Fachkräfte zur Verfügung. Zwar bildet die Grüne Branche sehr viele Menschen aus, die Ausbildungsquote liegt beispielsweise in Niedersachsen bei über 14%. Zum Ende der Ausbildung reduziert sich der Erfolg jedoch drastisch, weil Ausbildungsverhältnisse abgebrochen werden, Azubis in den Prüfungen scheitern oder anschließend enttäuscht der Branche den Rücken kehren. Hanns-Jürgen Redeker, Präsident des GaLaBau-Verbandes, sagte auf der Mitgliederversammlung in Baden-Württemberg: „40–50% der Gelder für die Ausbildung verpuffen. Wir können so nicht weitermachen.“ (DEGA GaLaBau 4/2010) Dieser Wirkungsgrad ist weder für die Branche, die händeringend Facharbeiter sucht, noch für die jungen Menschen akzeptabel.
Es kommt darauf an, was bei der Ausbildung herauskommt. Ein Wirkungsgrad von 60% reicht nicht aus, um den Bedarf an Fachkräften zu decken.
Was das Problem brisant macht: Aufgrund des demografischen Wandels bekommen wir in Zukunft nur noch halb so viele Azubis an die Startposition.
Wie kann dieser Wirkungsgrad verbessert werden? Der wichtigste Ansatzpunkt zur Verbesserung der Ausbildung sind die Betriebe! Hier kann die Entscheidung für eine gute Ausbildung getroffen und auch direkt in die Tat umgesetzt werden.
Mehr dazu im Kapitel: Wie bilden wir aus? (siehe Seite 48).
Der demografische Wandel
Alle Branchen in Handwerk und Industrie spüren den demografischen Wandel. Es handelt sich dabei um einen Megatrend, also um ein Phänomen, das sich über sehr lange Zeit hinzieht und jeden betrifft.
In Westeuropa hat sich die Bevölkerungspyramide zum Bevölkerungspilz entwickelt: Der untere Teil wird schlanker, weil die Geburtenrate sinkt. Der obere wird aufgrund einer gestiegenen Lebenserwartung der Menschen breiter.
Aus dem Megatrend demografischer Wandel hat sich ein zweiter entwickelt, der die Unternehmen zunehmend beschäftigt: der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal. Der demografische Wandel bewirkt in Deutschland einen zunehmenden Wettbewerb um gute Schulabgänger und um Fachkräfte. Ernst Pfister, Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg, formuliert es so: „Künftig werden die jungen Leute mit dem Lasso eingefangen.“ (Stuttgarter Zeitung 10. 11. 2010) Der Kampf um die talentierten Nachwuchskräfte und Schulabgänger wird härter. Das zeigt sich auch darin, dass viele Branchen mehr Geld und Anstrengung in die Nachwuchswerbung investieren. Es konkurrieren nicht nur die Gärtnerbetriebe untereinander um die Schulabgänger, sondern auch die unterschiedlichen Branchen aus Handwerk und Industrie. Sie haben alle dasselbe Problem!
Im Osten Deutschlands ist die Talsohle bereits 2011 erreicht, wenn nicht einmal mehr halb so viele Jugendliche die Schule verlassen werden wie im Jahr 2006.
In den westlichen Bundesländern beträgt der Rückgang insgesamt 25% bei den nicht studienberechtigten Schulabgängern (Haupt- und Realschule) und verteilt sich gleichmäßig auf die nächsten Jahre bis 2020. Im Jahr 2007 gab es im Westen noch 556 000 Schulentlassene, im Jahr 2020 werden es 416 000 sein, so die Prognose. Lediglich bei den Abiturienten wird die Zahl noch bis zum Jahr 2016 ansteigen.
In Westdeutschland kam die gefühlte Trendwende mit dem Jahr 2010. Das Thema zu wenig Ausbildungsplätze wurde abgelöst vom Lehrlingsmangel und einer Vielzahl unbesetzter Lehrstellen in allen Branchen, wie IHK und Handwerkskammern vermeldeten. Die meisten freien Stellen wiesen dabei Großstädte wie Stuttgart und Hamburg aus. Aber auch im Osten wurde Bedarf signalisiert: Die Zahl der nicht besetzten Lehrstellen ist dort überproportional hoch.
Eine Folge des demografischen Wandels: Die guten Schulabgänger können jetzt auswählen. Wer eine gute Ausbildung anbietet, ist klar im Vorteil.
Infolge der beiden Megatrends Demografiewandel und Fachkräftemangel erleben wir einen Paradigmenwechsel von einem anbieter- zu einem nachfrageorientierten Markt: Konnten sich bisher Betriebe unter den Bewerbungen die passende Person auswählen, so sind es in Zukunft vermehrt die Schulabgänger – zumindest die mit einem guten Abschluss –, die sich die passenden Betriebe auswählen können.
Für die Betriebe ergibt sich daraus eine neue Fragestellung. Da die Schulabgänger nicht mehr bei den Betrieben Schlange stehen, ist es an den Unternehmen, sich vermehrt Gedanken über die Wünsche und Motivation der Jugendlichen zu machen. Die Schulabgänger werden zur neuen Zielgruppe und müssen wie Kunden umworben werden.
Die Frage: „Habe ich genügend Fachkräfte im Betrieb?“ wird zur Existenzfrage für einen Betrieb. Eine kurzfristige Lösung der Personalprobleme nach dem Motto „Dann stelle ich eben jemanden ein“ hat immer weniger Erfolgsaussichten. Dadurch rückt eine langfristige strategische Herangehensweise in den Fokus. Die Ausbildung von Nachwuchskräften im eigenen Betrieb ist, neben der Weiterbildung eigener Beschäftigter, ein wichtiges Element einer langfristigen strategischen Personalarbeit.
Drei Fragen für die Ausbildung
Die folgenden drei Grundfragen helfen uns, das Thema Ausbildung zu strukturieren und systematisch anzugehen:1 Warum bilden wir aus?2 Wen bilden wir aus?3 Wie bilden wir aus?Jedes Unternehmen kann diese Fragen nur für sich selbst beantworten und jedes Unternehmen wird diese Fragen anders beantworten.
Praxistipp: Antworten finden
Bevor Sie weiterlesen, nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um Ihre eigenen Antworten auf diese drei Fragen zu finden. Ganz wichtig ist, diese Punkte schriftlich festzuhalten, z.B. mit Karteikarten, auf die Sie die Stichworte notieren. Sie können sich dann auch mit anderen Personen im Unternehmen und mit Ihren Auszubildenden dazu austauschen. „Wer schreibt, der bleibt“, diese alte Handwerkerweisheit gilt auch für die wichtigen Fragen der Ausbildung.
Warum bilden wir aus?
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür auszubilden. Manche liegen auf der Hand, wie die Gewinnung von Fachkräften für den eigenen Betrieb. Es können aber auch andere gute Gründe ins Feld geführt werden, die dafür sprechen Ressourcen für die Ausbildung junger Menschen bereitzustellen.
Fachkräfte für den Betrieb
Na klar! Fachkräfte für den eigenen Betrieb zu erhalten, ist Motivation Nr. 1 für die meisten Ausbildungsbetriebe. Es ist nur logisch, dass ich eine Ressource, die am Markt begrenzt verfügbar ist, nämlich gut ausgebildete Facharbeiter, einfach selbst herstelle. Vorausgesetzt ich weiß, wie es geht. Nach einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung, BIBB, über Wege zur Sicherstellung des Fachkräftenachwuchses wollen 80% der Ausbildungsbetriebe, die mit zukünftigen Problemen bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal rechnen, ihren Bedarf durch eigene betriebliche Ausbildung decken. Dagegen beabsichtigen 85% der Betriebe, die nicht selbst ausbilden, ihren Bedarf durch Einstellung qualifizierter Kräfte am Arbeitsmarkt zu decken (Philipp Ulmer, Joachim Gerg Ulrich 2008).
Die eigene Ausbildung ist hier ganz klar der Königsweg, zumindest wenn es gelingt, gute, motivierte Schulabgänger anzusprechen, wenn die Betriebe wissen, wie gute Ausbildung funktioniert und dafür Zeit und Mittel aufbringen.
Fachkräfte für die Branche