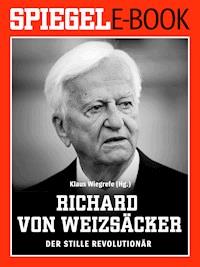Inhaltsverzeichnis
Die Überlebenden
„Mich hat Auschwitz nie verlassen“
70 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz
19 Auschwitz-Überlebende berichten: Coco Schumann / Renate Harpprecht / Anna und Izzy Arbeiter / Marko Feingold / Raphaël Esrail / Philomena Franz / Helga Kinsky / Esther Bejarano / Anita Lasker-Wallfisch / Zofia Posmysz / Bronia Brandman / Kazimierz Albin / Frederick Terna / Erna de Vries / Marta Wise / Jehuda Bacon / Frieda Tenenbaum / Morris Kesselman
Die Befreiung
„Die Russen, die Russen“
Am 27. Januar 1945 floh die SS-Lagermannschaft vor der Roten Armee aus Auschwitz. Zuvor tötete sie noch Hunderte Häftlinge
„Wir trauten unseren Augen nicht“
Ex-Rotarmist Nikolai Politanow erinnert sich an die Befreiung des KZ Auschwitz
Warum Auschwitz?
Ort des Unfassbaren
Wie konnte es zum Massenmord in Auschwitz kommen?
Der ungeschriebene Befehl
Der Historiker Peter Longerich über Hitler und den Holocaust
Die stillen Helden
Mehrere zehntausend Deutsche halfen Juden bei der Flucht vor den Nazis
Die Täter
Morden für das Vaterland
Die meisten NS-Verbrecher waren ganz normale Männer
„Das hat jeder mitgekriegt“
Jakob W. war SS-Mann im KZ Auschwitz. Ist er schuldig?
Interviews mit den Auschwitz-Wächtern Kaduk, Erber und Klehr
„Machen Sie fertig den Galgen für 12 Mann“ / „Da hat man alle verbrannt“ / „Da hat doch kein Häftling geweint“
Schöne Tage in Auschwitz
Das verstörend normale Leben der Mörder im Vernichtungslager
„Da habe ich für 20 Jahre Arbeit!“
Der Arzt Josef Mengele führte in Auschwitz grausige Versuche an Häftlingen durch
Der Buchhalter von Auschwitz
Oskar Gröning zählte das Geld der ermordeten Juden. Er sagt, er sei kein Täter gewesen
Die Gaskammern
Wie Ingenieure zum Massenmord in Auschwitz beitrugen
„Jeweils drei Leichen hineinstoßen“
„Verhörprotokolle der Auschwitz-Ingenieure Prüfer, Sander und Schultze“
Luftdicht in Blechdosen
Warum wurde gerade Zyklon-B zum Auschwitz-Gas?
Das lange Zögern der Alliierten
„Es fehlte der Wille zum Retten“
SPIEGEL-Gespräch mit dem Schweizer Gerhart Riegner, der 1942 den Westen über den Holocaust informierte / Schreckensnachricht aus der Schweiz
Stalins Versagen
Der Kreml-Diktator hätte die Gleise nach Auschwitz bombardieren können. Warum tat er es nicht?
„Bomben auf Auschwitz“
Was die Alliierten vom Judenmord wussten und was sie dagegen taten
Auschwitz vor Gericht
Die Schande nach Auschwitz
Die meisten Täter wurden nie bestraft. Lag das am deutschen Recht, an braunen Seilschaften oder allgemeinem Desinteresse?
Aufklärer des Grauens
Fritz Bauer, der Initiator der Auschwitz-Prozesse, wird erst jetzt angemessen gewürdigt
Die Gesichter des Bösen
Der Auschwitz-Prozess 1963/65 führte vielen Deutschen die NS-Verbrechen vor Augen
„Kleine Leute waren nötig für den Massenmord“
Zeitgenössischer Kommentar zum Urteil im Auschwitz-Prozess
Kein Schlussstrich
„Der Holocaust verschwindet nicht“
SPIEGEL-Gespräch mit dem Historiker und Friedenspreisträger Saul Friedländer
Auschwitz • Vorwort
Vorwort
Auch siebzig Jahre nach der Befreiung am 27. Januar 1945 löst Auschwitz, der deutsche Name für die Kleinstadt Oswiecim im Süden des heutigen Polen, immer noch Emotionen aus wie kein anderer Ort, an dem die Nationalsozialisten mit industrieller Effizienz Häftlinge umbrachten. Auschwitz – das ist ein Synonym für eine „Revolution gegen die Menschheit schlechthin“, wie der israelische Historiker Yehuda Bauer schreibt.
Mindestens 1,1 Millionen Juden, zudem mehrere Zehntausend nichtjüdische Polen, kriegsgefangene Rotarmisten, Sinti und Roma starben in diesem größten Vernichtungslager des „Dritten Reiches“. Die Opfer stammten aus fast allen Teilen Europas, sie wurden zumeist unmittelbar nach der Ankunft in Gaskammern ermordet.
Die SS brach den Leichen das Zahngold heraus, schmolz es ein und übergab es dann der Reichsbank. Die Knochen wurden zerkleinert und das Knochenschrot an eine Düngemittelfirma verkauft, die Asche der verbrannten Körper auch zum Straßenbau verwendet, die Haare der Frauen zu Filz verarbeitet.
Das staatlich angeordnete Jahrtausendverbrechen ließ Auschwitz zum furchtbarsten Wort der deutschen Sprache werden. Mit ihm ist zugleich das große Rätsel der deutschen Geschichte verbunden: Wie konnte es dazu kommen?
Dieses E-Book enthält Interviews mit überlebenden Opfern, aber auch SS-Leuten aus der Lagermannschaft. Es bietet Analysen der Geschichte des Vernichtungslagers und des Versagens der deutschen Justiz bei der Ahndung des Holocaust. Die Texte sind im SPIEGEL erschienen und sollen jenen helfen, die wissen wollen, was in Auschwitz geschehen ist.
Klaus Wiegrefe
Die Überlebenden • „Mich hat Auschwitz nie verlassen“
„Mich hat Auschwitz nie verlassen“
Die Befreiung des größten Vernichtungslagers jährt sich zum 70. Mal. Nur wenige Zeugen können noch berichten, was geschah. Hier erzählen 19 ehemalige Häftlinge von ihrem Leidensweg durch den Holocaust. Von Susanne Beyer und Martin Doerry
Januar 1945. Die zehnjährige Frieda, ein jüdisches Mädchen aus Polen, will mit ihrer Mutter das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verlassen. SS-Männer leeren das Lager, die Häftlinge sollen auf einen Marsch Richtung Westen gehen. Doch als Frieda und ihre Mutter am Tor ankommen, schickt ein SS-Mann sie weg und brüllt: „Für euch kommt der Himmelswagen.“ Auch andere Häftlinge bleiben auf dem Gelände, ein paar Tausend.
Dann der 27. Januar. Aufregung im Lager. „Die Russen kommen.“ Auf einem schneebedeckten Feld marschieren vermummte Gestalten in langen Mänteln durch den tiefen Schnee auf das Lager zu. Eine Einheit der 60. Armee der 1. Ukrainischen Front - die Befreier von Auschwitz.
Später kommt auch das polnische Rote Kreuz, gibt den Befreiten Vitamintabletten. Frieda Tenenbaum sagt: „Ich weiß noch, wie sie aussahen: orange, dreieckig, mit einem glatten Überzug, wahrscheinlich aus Zucker.“
Frieda Tenenbaum sitzt nun, knapp siebzig Jahre später, in der Küche eines Freundes im amerikanischen Cambridge. Sie erzählt dem SPIEGEL-Korrespondenten Johann Grolle von ihrer Zeit als Kind in Auschwitz, von der Befreiung und von ihrem Leben danach.
Sie erinnert sich, dass einige Tage nach der Befreiung ein sowjetisches Kamerateam nach Auschwitz gekommen ist. Aus den Filmaufnahmen sind auch Fotos geworden, Standbilder. Doch Frieda Tenenbaum kann sich darauf nicht mehr finden: „Ich scheine herausgeschnitten worden zu sein oder was auch immer. Meine Mutter aber erkenne ich.“
Tenenbaum ist 80 Jahre alt. Sie gehört zu den jüngsten Überlebenden. Kinder sind in Auschwitz in der Regel sofort vergast worden, sie habe „Glück“ gehabt, so sagt sie. Und doch, das Trauma bleibt. Tenenbaum, eine promovierte Archäologin, hat in ihrer Lebensmitte Depressionen bekommen, ihre Ehe scheiterte, sie machte eine Ausbildung zur Traumatherapeutin. Jetzt, nach den Anschlägen in Paris, so sagte sie SPIEGEL-Mann Grolle am Telefon, habe sie Angst vor antisemitischen Angriffen.
Eine andere Zeitzeugin aus Auschwitz, Zofia Posmysz, fasst das Gefühl einer immerwährenden Bedrohung so zusammen: „Mich hat Auschwitz nie verlassen.“
Die meisten Zeugen der Lagerhaft, die heute noch erzählen können, sind um die neunzig Jahre alt. Es sind die letzten Zeugen, die aus dem Inneren dieser in der Menschheitsgeschichte einzigartigen Mordmaschine berichten können.
Als zentraler Schauplatz des Holocaust steht der Name Auschwitz synonym für die Verbrechen des Hitler-Regimes. Die Verwandlung des Konzentrationslagers in ein Vernichtungslager war nicht allein Ergebnis strategischer Planung, sondern eine Folge der Eskalation nationalsozialistischer Kriegführung.
Im Sommer 1940 wurde das Lager in der Nähe der Stadt Oświęcim gegründet. Auf dem Areal standen noch Unterkünfte aus dem Ersten Weltkrieg, die für Saisonarbeiter gedacht gewesen waren. 10.000 polnische Intellektuelle und Mitglieder des Widerstands sollten dort inhaftiert werden. Seit 1941 errichteten große Unternehmen aus dem Reichsgebiet im Umfeld des Konzentrationslagers Fabriken, die dort auf eine wachsende Zahl von Zwangsarbeitern zurückgreifen konnten. Die SS ließ zu diesem Zweck zwei Kilometer vom sogenannten Stammlager entfernt ein weiteres Lager errichten, Birkenau, in dem zunächst etwa 50.000 sowjetische Kriegsgefangene untergebracht werden sollten.
Doch die meisten Gefangenen waren schon auf dem Weg nach Auschwitz verhungert. Stattdessen wurden Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle sowie politische Häftlinge aus ganz Europa deportiert und - seit 1942 - bei der Ankunft in Birkenau einem bis dahin einzigartigen Verfahren ausgesetzt, das die Nazis „Selektion“ nannten: Junge Männer und Frauen kamen zunächst mit dem Leben davon und mussten auf den Baustellen der neuen Fabriken und in diversen Nebenlagern arbeiten; Mütter mit kleineren Kindern, Schwangere, Kranke und ältere Menschen wurden in der Regel sofort in den Gaskammern umgebracht.
Die Häftlinge wurden regelrecht ausgeraubt. Die Befreier von Auschwitz entdeckten in den Tagen nach dem 27. Januar 1945 in den noch intakten Magazinen neben Tausenden Schuhen, Bergen von Brillen, Rasierpinseln und Zahnprothesen 348.820 Herrenanzüge und 836.255 Damenkleider und -mäntel. Außerdem fanden sie sieben Tonnen Haar, das, nach Schätzungen, von 140.000 Frauen stammte. Die Asche der verbrannten Körper wurde auch im Straßenbau verwendet.
Schon am 31. Juli 1941, also wenige Wochen nach dem Angriff auf die Sowjetunion, hatte Reichsmarschall Hermann Göring den Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, beauftragt, ein Konzept „für die Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage“ vorzulegen. Die ersten Tötungsexperimente mit Zyklon B fanden dann im September 1941 im Stammlager Auschwitz statt. Wenig später setzten die Mörder hinter der Front im Osten Gaswagen ein und erschossen zudem massenweise jüdische Zivilisten. Am 20. Januar 1942 wurde in Berlin auf der erst später so genannten Wannsee-Konferenz ein Masterplan für die Vernichtung der europäischen Juden besprochen.
Zur gleichen Zeit begann in Birkenau (Auschwitz II) die systematische Vergasung der zumeist jüdischen Häftlinge. Die ersten Gaskammern wurden in zwei schon bestehenden Bauernhäusern eingerichtet, später folgten vier große Neubauten mit Krematorien und Gaskammern. Ebenfalls noch 1942 wurde ein drittes Lager eröffnet, Monowitz, das erste von einem Privatunternehmen finanzierte Konzentrationslager. Der Chemiekonzern I. G. Farben brachte hier vor allem die Zwangsarbeiter seiner Buna-Fabrik unter, die der kriegswichtigen Produktion von synthetischem Kautschuk dienen sollte.
In den Lagern Auschwitz I, II und III kamen bis Kriegsende mindestens 1,1 Millionen Menschen ums Leben, entweder in den Gaskammern, durch Erschießung, durch Hunger, Krankheiten oder im Verlauf medizinischer Versuche. Seinen Höhepunkt erreichte das Vernichtungsprogramm im Sommer 1944: Innerhalb von zwei Monaten verschleppte die SS etwa 400.000 ungarische Juden nach Auschwitz, um sie - mit wenigen Ausnahmen - sofort zu töten.
Nach ihrer Ankunft und Selektion wurden die Deportierten von der SS direkt zu den Gaskammern getrieben. Entscheidend für den von den NS-Verbrechern erwünschten reibungslosen Ablauf des Massenmords war laut einer Studie des Soziologen Wolfgang Sofsky die „systematische Täuschung der Opfer“.
Die SS, so Sofsky, sei darauf angewiesen gewesen, „dass sich die Menschen bereitwillig selbst entkleideten, ihre Habseligkeiten ordneten und ohne Zögern in die Gaskammern gingen“: Die Gaskammern wurden als Duschräume getarnt, im Umfeld der Krematorien wurden Bäume gepflanzt und irreführende Schilder aufgestellt. SS-Führer hielten Ansprachen, um die Todgeweihten in Sicherheit zu wiegen.
Häftlinge allerdings, die schon länger in Auschwitz gelebt hatten und nun in den Tod geschickt wurden, wussten genau, was sie erwartete. Die Opfer waren jedoch meistens zu geschwächt, um Widerstand zu leisten; vereinzelt kam es vor den Gaskammern zwar zu Angriffen auf SS-Leute, die aber stets niedergeschlagen wurden.
Nur ein größerer Häftlingsaufstand ist überliefert: Im Oktober 1944 griffen Mitglieder des Sonderkommandos, Häftlinge also, die vor allem in den Krematorien arbeiten mussten, ihre Bewacher an, ein Krematorium ging in Flammen auf, drei SS-Leute wurden getötet, mehr als zwölf verwundet. Doch niemand konnte fliehen, fast alle Aufständischen wurden getötet.
Mit dem Heranrücken der sowjetischen Truppen wurden die Vergasungen eingestellt, der Abbau der Gaskammern begann, und Tausende Häftlinge wurden in westlich gelegene Konzentrationslager verschleppt.
Über die Psyche der Täter ist viel gerätselt worden. Wie konnte es geschehen, dass Väter tagtäglich zu Mördern wurden und den Feierabend wieder bei ihrer Familie verbrachten? Was sollte es bedeuten, wenn SS-Führer Heinrich Himmler behauptete, die SS sei beim Massenmord „moralisch anständig“ geblieben?
Den Versuch einer Antwort hat die Historikerin Sybille Steinbacher gegeben: Die Ermordung der angeblich „Minderwertigen“ habe der eigenen Zukunft im Osten gedient und sei somit „ideologisch gerechtfertigt“ worden. „Der häusliche Frieden stand zum beruflichen Alltag der SS-Leute nicht im Widerspruch.“ Vielmehr habe er „das Töten im Lager befördert“, wie Steinbacher erklärt, die SS-Männer hätten so „die nötige psychische Stabilität“ erhalten.
Angeregt durch die Wiener Burgtheater-Inszenierung „Die letzten Zeugen“, in der Auschwitz-Überlebende von ihren Erinnerungen erzählen und die zu den herausragenden Theaterproduktionen des vergangenen Jahres gehört, haben SPIEGEL-Redakteure in den vergangenen anderthalb Monaten in Polen, Frankreich, Österreich, Israel, den USA und Deutschland 19 ehemalige Auschwitz-Häftlinge getroffen und deren Erinnerungen an die Zeit im Konzentrationslager in Form von Protokollen festgehalten.
Vergleichbare journalistische Formen, Porträts etwa oder Gespräche, setzen voraus, dass Journalisten intervenieren, Sichtweisen zwar aufnehmen, andere aber dagegenstellen. In diesem Fall hielten sich die SPIEGEL-Leute zurück, ließen die Zeitzeugen reden, soweit keine Nachfragen nötig waren. Mit der Wahl des Protokolls als Form ist ein Signal verbunden: Ein Gespräch - im Wortsinn - über Auschwitz zu führen ist kaum möglich. Journalisten können Fragen stellen, das schon, aber sie können dem Geschilderten keine eigene Erfahrung gegenüberstellen, keine andere Ansicht.
Die Geschichtswissenschaft hat die Methode der Oral History, des ungehinderten Erzählenlassens, entwickelt, auch um herauszufinden, welche Gefühle sich bei Zeitzeugen mit historischen Ereignissen verbinden. Einige schaffen Distanz zu den Ereignissen über Ironie oder durch den Wechsel der Sprache zum Beispiel vom Deutschen ins Englische. Andere versuchen, den Gefühlen von damals so nahe wie möglich zu kommen, indem sie den körperlichen Ausdruck der Not beschreiben. „Ich hatte wie in Trance gehandelt“, sagt ein Überlebender.
Auschwitz sah die Vernichtung der Häftlinge vor, die Überlebenden sind Ausnahmefälle. Insofern zeichnen die Protokolle weniger ein Bild dessen, was Auschwitz faktisch gewesen ist, als vielmehr ein Bild dessen, wie sich Erinnerung heute präsentiert, und zwar bei denjenigen, die die Ausnahme gewesen sind.
Historiker, Journalisten, aber auch Gerichte brauchen möglichst viele Zeugen, um einen Sachverhalt aufzuklären. Jede neue Erzählung vervollständigt das Bild, nach und nach stellt sich heraus, wer die Hauptverantwortlichen gewesen sind. Mehrere der vom SPIEGEL befragten Zeitzeugen kamen von sich aus auf Josef Mengele zu sprechen. Der SS-Lagerarzt in Auschwitz hat bei Selektionen Verwandte der Zeugen in den Tod geschickt, hat die Zeugen untersucht und grausame Experimente an ihnen vollzogen.
Viele der Zeitzeugen, die heute über die Erlebnisse sprechen, sind über Jahrzehnte nicht gehört worden, einige sahen sich aber auch nicht in der Lage, über die Exzesse der Entwürdigung zu reden. Inzwischen berichten die Zeitzeugen bereitwillig, gern sogar an Schulen, damit die jungen Leute wissen, was war und was nie wieder sein soll.
Aber was geschieht, wenn keiner der Überlebenden mehr berichten kann? Der Friedensnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel hat diese Frage vor ein paar Jahren in einem Beitrag für ein SPIEGEL-Buch so beantwortet: „Jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden.“
Das Wissen um Auschwitz muss also von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wissen heißt allerdings nicht verstehen. Denn wer sich als Zuhörer oder Leser tief in das Innere dieser Mordmaschine begibt, steht am Ende wieder vor einem Rätsel.
Die Überlebenden • SPIEGEL-Titel 5/2015
„Ich wollte nicht, dass geklatscht wird, weil ich im KZ war.“
BERLIN, 9. DEZEMBER.
Coco Schumann, 90 Jahre alt, sitzt in dem kleinen Wohnzimmer seines Reihenhauses in der Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf und erzählt. Der Jazzgitarrist macht das nicht zum ersten Mal, aber Auschwitz wurde erst Jahrzehnte nach seiner Befreiung ein Thema für ihn. Warum so spät?
Wissen Sie, ich bin ja ein ziemlich bekannter Musiker. Und ich wollte nicht, dass geklatscht wird, weil ich im KZ war, sondern weil ich Musik mache und das ein bisschen besser als viele andere.
Ich bin ein positiv denkender Mensch. Viele, die im Lager waren, sind nie wieder richtig rausgekommen, auch wenn sie längst draußen waren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich jammer auch nicht darüber, dass ich drin war, ich jubel eher, dass ich rausgekommen bin.
Meine Mutter war Jüdin, mein Vater trat erst bei seiner Hochzeit zum Judentum über. Ich besuchte die jüdische Schule in der Joachimstaler Straße in Berlin. Unsere Clique, so sagte man damals, war musikbegeistert. Diese Filme aus Amerika, mit Ginger Rogers und Fred Astaire, liefen schon vor dem Krieg im Kino. Als der Swing dann verboten wurde, entdeckten wir aber doch noch Schallplatten in einem Geschäft unterm Ladentisch. Damals hörte ich zum ersten Mal Ella Fitzgerald und wusste sofort: Das ist meine Musik. Dass ich sie später mal begleiten würde, habe ich damals natürlich noch nicht geahnt.
Wir spielten im Groschenkeller in der Kantstraße nur verbotene Musik. Es gab ja auch Rassenschande, wie die Nazis es nannten. Ich habe reichlich Rassenschande getrieben, und irgendeiner, dem ich die Braut ausgespannt hatte, hat rausgekriegt, dass ich den gelben Stern mit der Aufschrift „Jude“ nicht trug. Im März 43 wurde ich zum Alexanderplatz zur Kriminalpolizei hinbestellt. Und die übergab mich der SS.
Erst kam ich nach Theresienstadt, dann, im Herbst 44, nach Auschwitz. Die Zugfahrt im Viehwaggon war schrecklich. Furchtbar eng. Irgendwann fragte ich den SS-Mann, ob ich mal austreten dürfte, und merkte, dass wir gerade durch Berlin fuhren, durch Halensee, ganz langsam. Ich erkannte sogar die Wohnung meiner Eltern durch die offene Tür, den SS-Mann mit dem Gewehr daneben.
In Auschwitz wurden wir in Baracken untergebracht, das waren ehemalige Pferdeställe mit Stockbetten. Als ich das sah, dachte ich, das war es jetzt mit uns. Da höre ich eine Stimme: „Woher kommst du denn, Coco?“ Und ich drehe mich um und sehe einen Lagerkapo. So ein Lagerkapo hatte das Sagen. Wir mussten vor ihm strammstehen und die Mütze abnehmen. Ich sage also: „Aus Berlin, Herr Kapo.“ Der sagt: „Mensch, Coco, ich bin doch der Heinz.“ Der war wohl ein großer Fan von mir, aber natürlich kannte ich nicht alle Fans. Er war dann mein großes Glück. Er sagte zu mir: „Die haben hier die ganzen Zigeunermusiker vergast.“ Er hatte sich jeden Abend von den Zigeunern vorspielen lassen. Wenn ein Musiker kam, haben sie sich den gekrallt, das war die einzige Ablenkung. „Du kannst gleich heute Abend spielen“, sagte der Kapo. Später bekamen wir Musiker sogar eigene Betten in der Schreibstube. Die ganze Organisation wurde ja von Häftlingen gemacht, fast alles.
Am Tor, wo die Leute zur Arbeit gingen, nach Buna, spielten wir dann. Und die SS wünschte sich immer „La Paloma“. Ich habe jahrelang nicht gewusst, warum die jedes Mal „La Paloma“ wollten. Wir haben alle gerätselt. Vielleicht wegen der Zeile „einmal muss es vorbei sein“. Erst viel später habe ich mal den Film mit Hans Albers gesehen, das war damals bei den SS-Leuten offenbar der Number-one-Hit. Wir wussten das nicht.
Als die Russen kamen, im Januar 45, ging es wieder auf einen Transport, diesmal nach Kaufering in Bayern, ein Nebenlager von Dachau. Und als Kaufering aufgelöst wurde, gingen wir auf einen Todesmarsch. Die SS-Leute hatten schon die Maschinengewehre für uns aufgebaut, aber Gott sei Dank: Die Amis waren schneller und befreiten uns. Von den Amis bekam ich die Genehmigung, dass ich mit dem Zug nach Berlin fahren durfte.
Meine Mutter war auch in einem Gefängnis. Als in Wedding bombardiert wurde, stürzten einige Mauern um, und es brannte. Sie war plötzlich frei. Nachdem ich meine Eltern getroffen hatte, ging ich gleich zum Ku'damm. Und was sehe ich? Ein Schild mit dem Namen „Ronny Bar“, man hörte draußen schon die Musik. Irgendein Schlauer hatte also schon wieder eine Bar aufgemacht. Die Amis sind ja viel ausgegangen. Ich also rein und sehe meine Kollegen von früher dort Musik machen. Das war natürlich eine große Überraschung für die. Alle fragten: „Mensch, Coco, du lebst?“
Die Überlebenden • SPIEGEL-Titel 5/2015
„Die schlimmsten Häftlinge waren die russischen Frauen. Die haben gestohlen wie die Raben.“
HAMBURG, 10. DEZEMBER.
Renate Harpprecht, 90, ist mit ihrem Mann, dem Journalisten Klaus Harpprecht, nach Hamburg gekommen. Er will seine soeben erschienenen Lebenserinnerungen im Literaturhaus vorstellen. Das Treffen mit ihr findet im Konferenzraum eines großen Hotels statt. Die alte Dame bewegt sich mädchenhaft und elegant. Sie trägt eine Kette mit einem goldenen Davidstern. Ein Erbstück?
Nein, ich habe nichts geerbt, gar nichts. Diese Kette hat mir mein Mann zum 90. Geburtstag geschenkt. Ich hatte ihm vorher gesagt, dass ich jetzt keinen Schmuck mehr haben will. Aber so ein schöner Davidstern, das ist etwas anderes. Das hat bei mir ja überhaupt nichts mit Religion zu tun. Dieser Davidstern ist eine Demonstration für Menschen, die irgendwelche dreckigen Bemerkungen über Juden machen. Dann zeige ich auf den Stern und sage: „Better not!“
Ich bin inzwischen gern bereit zu erzählen, aber wenn ich das tue, kommt bei den Älteren in Deutschland häufig eine lange Geschichte, wie schwer man es doch damals hatte, als man im Krieg ausgebombt oder vertrieben wurde. Diese merkwürdigen Vergleiche kann ich kaum ertragen.
Wir hatten ein schönes Leben zu Hause in Breslau, jede Woche Kammermusik. Meine Eltern lebten in der Illusion, dass das mit Hitler nicht andauern würde. Mein Vater sagte: Was soll ich in Amerika? Ich bin Rechtsanwalt! Er hatte einen Sozius, der ihn bekniete, nach Palästina zu gehen. Mein Vater fuhr dann sogar dorthin, kam aber wieder zurück.
Meine Eltern und meine Großmutter Flora wurden vor uns deportiert, sie haben nicht überlebt. Meine Schwester und ich haben versucht zu fliehen, wir kamen ins Gefängnis. Von dort aus bin ich in einem normalen Zug nach Auschwitz gekommen. Im Dezember 43. Es war tiefe Nacht, als wir ankamen. Da standen SS-Männer und Frauen, die uns in ein Gebäude führten. Ich kriegte kurz einen großen Schreck, als ich sah, dass an der Decke lauter Duschen waren, und sagte zu mir: „Oi weh“, das kann man so wohl nur auf Jiddisch sagen. Aber Gott sei Dank hatte ich mich getäuscht. Es kam nämlich ein Rudel von Frauen, nackt, elend. Sie durften alle drei oder vier Wochen zum Duschen gehen. Ich habe mir allerdings gesagt, wenn ich mal so aussehe, dann kann ich mich gleich umbringen.
Im KZ arbeiteten, abgesehen von den Aufsehern, nur Häftlinge. Sie machten sich dann über mich her, die Haare wurden abgeschnitten, danach sah man so aus wie ein Skinhead. Als ich da so auf diesem Stuhl saß, sah ich ein paar Schuhe, so eine Art Wanderschuhe aus Schweinsleder, mit roten Schnürsenkeln. Die kamen mir bekannt vor. Ich fragte, wem diese Schuhe gehörten, und erfuhr, sie hätten einem Mädchen gehört, das vor einer Woche gekommen sei, es sei jetzt im Orchester, und wie sich dann herausstellte, war das wirklich meine Schwester. So eine Geschichte kann man ja gar nicht erfinden.
Meine Schwester Anita (siehe Protokoll Anita Lasker-Wallfisch) sah zu meiner Überraschung richtig gut aus, fast elegant; weil sie im Orchester war, hatte sie ordentliche Sachen an. Wir waren beide abgehärtet, Gott sei Dank. Unsere Eltern hatten darauf geachtet. Die Häftlinge, die aus warmen Ländern kamen, waren das natürlich nicht. Die griechischen Mädchen zum Beispiel starben wie die Fliegen. Die Häftlinge aus dem Osten, aus Polen und Russland, hielten sich viel länger als unsereins.
Man wagt ja gar nicht, solche Sachen zu sagen: Aber die schlimmsten Häftlinge waren die russischen Frauen. Die haben gestohlen wie die Raben, Brot vor allem. Die waren von einer solchen Brutalität, das kann man sich gar nicht vorstellen. Beim Schlafen legte man sich auf alles drauf, was man besaß, Schuhe, Brot; und trotzdem wurde man im Schlaf bestohlen.
By the way: Wir hatten alle konstant Durchfall. Wenn Ihnen das den ganzen Tag die Beine herunterrinnt, dann denken Sie nur daran, wie Sie den nächsten Tag erreichen. Richtige Freundschaften gab es da nicht. Das, woran andere junge Mädchen in dem Alter denken, an Freunde, an die Liebe, daran haben wir schon bald nicht mehr gedacht. Wenn Sie nur noch Hunger haben, Durst und Angst, und stinken, dann ist das weg.
Bergen-Belsen, wo wir dann hinkamen, war die Unterwelt. Überall lagen Leichen. Als die englischen Soldaten kamen, war das ein irres Gefühl, kein Jubelschrei, nirgends, es war totenstill. Erst mal fing die große Entlausung an, mit DDT, das ist heute ja verboten. Keiner wollte sich entlausen lassen. Aber das war dann meine letzte oder auch erste Heldentat. Ich habe zu den anderen gesagt: „Das sind doch unsere Befreier, die werden uns doch nicht umbringen. Ich gehe da jetzt hin, denn ich kann dieses Gejucke nicht mehr aushalten.“ Die englischen Mediziner haben mit so einer riesigen Spritze oben in die Jacke weißes Pulver reingesprüht. Man mag sich das gar nicht vorstellen, was sich da unter der Wäsche getan hat, ich sage nur: ein Massenmord. Und dann sind die anderen Häftlinge auch hingegangen. Man ist ja immer erst clever after the event.
Die Überlebenden • SPIEGEL-Titel 5/2015
„Und da stand er, und ich dachte: Mein Gott, du lebst noch.“
NEWTON/USA, 15. DEZEMBER.
Anna und Izzy Arbeiter, beide 89, sind seit 68 Jahren ein Paar. Sie sitzen im Wintergarten ihres Einfamilienhauses mit schönem Blick auf den Charles River. Es ist vor allem er, der erzählt. Er könne besser reden, sagt seine Frau. Aber in Auschwitz waren sie beide. Wo sahen Sie sich das erste Mal?
Izzy: Wir kannten uns aus dem Ghetto. Im Oktober 42 haben sie das Ghetto der polnischen Stadt Starachowice aufgelöst, wir wurden in ein nahes Lager gebracht.
Anna: Ich lebte dort im Frauenlager, Izzy im Männerlager, die Lager waren getrennt durch einen Zaun. Aber man konnte ein paar Worte durch den Zaun wechseln, wenn man aufgepasst hat, wo gerade die Wachen waren. Ich arbeitete in der Küche, und ein Mädchen kam und sagte: „Da ist so ein Typ am Zaun. Der will mit dir sprechen.“ Ich ging also raus, und da stand Izzys Bruder und sagte: „Du kennst doch Srulek(*). Er ist krank. Vielleicht kannst du ihm helfen. Kannst du irgendwas aus der Küche besorgen? Kartoffeln, Brot. Irgendwas.“
Izzy: Sie hat dann wirklich Essen gestohlen und es unter dem Stacheldraht durchgeschoben. Mein Bruder hat es dort abgeholt. Ich glaube, ohne dieses Essen hätte ich es nicht geschafft. Ich war ihr etwas schuldig. Im Juni 1944 kam ich nach Auschwitz. Dort traf ich Anna wieder. Ich arbeitete als Kanalreiniger. Wir mussten die Toiletten leeren. Wir hatten ein Fass mit einem langen Stock daran. Dieses Fass stand auf einem Wagen. Da mussten wir die Scheiße einfüllen. Und dann haben wir - genau wie Pferde - den Wagen gezogen und das Zeug als Dünger auf die Felder gebracht. Toiletten gab es überall in Auschwitz. Deshalb kamen wir zum Frauenlager, zum Krematorium, ins Zigeunerlager, ins Familienlager. Andere Kommandos waren immer von deutschen Wachen begleitet. Aber der Geruch war nicht gerade angenehm. Deshalb sind wir meist unbewacht von Toilette zu Toilette gezogen. Wir konnten organisieren, wie das hieß. Vor allem im Krematorium gab es jede Menge Essen. Die Frage war nur: wie es rauskriegen? Dazu spannten wir einen Draht im Inneren der Tonne. Und wann immer wir etwas organisiert hatten, haben wir es an diesen Draht gehängt. Wir wurden kontrolliert, aber keiner hat in der Tonne nachgeguckt. Dass wir darin Essen schmuggeln könnten, auf diese Idee ist keiner gekommen. Wir haben die Sachen zwar eingepackt, aber natürlich haben sie gestunken. Manchmal sah ich Anna, wenn ihr Kommando sich aufstellte zur Arbeit. Und dabei konnte man sich ein paar Worte zurufen. Einmal zum Beispiel, als wir im Frauenlager waren, rief Anna: „Ich brauche ein paar Schuhe.“ Also ging ich zu einem dieser Schuhberge, hoch wie ein Haus. Ich hatte nicht viel Zeit, mir welche auszusuchen. Aber immerhin waren sie alle in Paaren. Die SS hatte den Menschen ja gesagt, sie sollten ihre Kleider falten und die Schuhe mit den Schnürsenkeln zusammenbinden, ehe sie sie in die Gaskammer schickten. Ein Paar habe ich dann für Anna mitgenommen.
Anna: Sie waren schwarz, genau wie die, die mein Großvater getragen hatte.
Izzy: Es waren gute Schuhe. Die Leute hatten ja ihre besten Schuhe bei der Deportation angezogen. Als ich die Schuhe brachte, sagte Anna nicht: „Ihh, die stinken.“ Ich brachte ihr auch Brot mit. Beim Vorbeifahren mit unserem Wagen konnte ich schnell zu ihrer Pritsche laufen und Brot auf ihren Strohsack werfen. Rein, Brot hinwerfen und wieder raus. Natürlich wusste ich: Ein ungeschütztes Stück Brot würde keine fünf Minuten dort liegen bleiben. Deshalb musste ich auch dem Stubendienst etwas mitbringen.
Anna: Abends empfing mich der Stubendienst: „Da ist wieder Brot für dich.“ Aber noch wichtiger waren die Schuhe.
Izzy: Ich habe Anna erst im April 1945 wiedergesehen. Ich lebte nach meiner Befreiung in einem Auffanglager in Stuttgart. Dort sprach mich ein Mädchen an und fragte: „Du bist Israel Arbeiter? Kennst du eine Chanka aus Starachowice? Sie lebt. Sie ist in Bergen-Belsen.“ Ich hatte mir ein Motorrad organisiert, und die Amerikaner hatten mir erlaubt, es zu behalten. Mit dem fuhr ich nach Bergen-Belsen. Das war ein großes Lager mit bewaffneter Wache an der Tür. Ich zeigte dem Mann meine Papiere, und er ließ mich ein. Und da war ich, in ziviler Kleidung, mit Motorradhelm und dieser großen Brille.
Anna: Wir lebten damals zu fünft in einem Zimmer, in dem deutsche Soldaten gewohnt hatten. Mir hatte schon vorher ein Mädchen erzählt: Da ist so ein Typ. Der will mit dir reden. Und eines Morgens, es war noch dunkel, klopfte er an die Tür. Und da stand er, und ich dachte: Mein Gott, du lebst noch.
Izzy: Ich fragte sie: „Willst du nicht mit mir rausgehen?“ Und sie sagte: „Ich würde ja gern. Aber hier sind fünf Mädchen, und wir haben nur ein Paar Schuhe. Heute ist nicht mein Tag, die Schuhe zu tragen.“ Also musste ich betteln, bis die anderen die Schuhe rausgerückt haben. So konnte ich sie für eine Runde auf dem Motorrad mitnehmen.
Anna: Die anderen sagten zu mir: Pass bloß auf. Das ist ein Casanova.
Izzy: Ja, die versuchten alles, um Anna auszureden, mit mir zu kommen. „Er wird dich nur benutzen und dann sitzen lassen“, sagten sie. Sie ist trotzdem mit mir mitgekommen. Nach 68 Jahren sind wir immer noch zusammen und stolze Begründer von vier Generationen Arbeiter-Familie.
* Er nannte sich damals „Srulek“, sie „Chanka“. Die Namen Izzy und Anna haben sie erst nach ihrer Emigration in die USA angenommen.
Die Überlebenden • SPIEGEL-Titel 5/2015
„Man jagte uns durch einen Korridor von SS-Leuten, die auf uns einschlugen.“
SALZBURG, 17. DEZEMBER.
Marko Feingold erhebt sich zur Begrüßung von seinem mit Papieren überhäuften Schreibtisch in der Salzburger Synagoge. Der 101-Jährige leitet die Israelitische Kultusgemeinde der Stadt. Während er sein Hörgerät einstellt, erzählt er einen Witz: Der Kunde eines modernen Hörgerätegeschäfts beschwert sich so lange über die hohen Preise der elektrischen Hörhilfen, bis ihm der Ladenbetreiber entnervt ein altertümliches Hörrohr anbietet. Fragt der Kunde skeptisch: „Und mit dem Rohr hört man besser?“ Sagt der Verkäufer: „Nein, aber die Leute reden lauter.“ Feingold wurde im März 1940 als „Saboteur“ nach Auschwitz deportiert. Was warf man Ihnen vor?
Mein Bruder und ich hatten in Prag für eine Wirtschaftsabteilung der Deutschen gearbeitet. Unsere Aufgabe war es, Inventarlisten anzulegen in den Wohnungen von Pragern, die beim Einmarsch der Deutschen im März 1939 geflohen waren. Viele von ihnen waren Juden, Kommunisten, Homosexuelle. Verschafft hatte uns diese Arbeit ein SS-Mann, den ich aus Wien kannte. Der war schon früh ein Nazi gewesen, und er wusste, dass wir Juden waren, aber er sagte, er könne uns brauchen. Die meisten der Wohnungen, in denen wir die Möbel inspizierten, waren schon von den lieben Nachbarn geplündert worden. In unserer Ahnungslosigkeit dachten wir damals, die Besetzung Prags würde bald vorüber sein und die Deutschen würden den Geflohenen den Schaden irgendwann ersetzen. Deshalb taten wir so, als gäbe es in den Wohnungen nur wertvolle Möbel.
Eines Tages wollte sich aber ein wichtiger deutscher Beamter, der sich gerade in Prag niederließ, mit unseren Listen in den verlassenen Wohnungen die besten Möbel zusammensuchen. Unser Schwindel flog auf, weil er nur Brennholz vorfand. Die SS hat uns wochenlang verhört und verprügelt, weil sie wissen wollte, welche tschechische Organisation hinter unserer Sabotage stand, dabei war es nur unser gutes Herz.
Im November 1939, als die Deutschen in Polen eingefallen waren, wurden wir aus dem Prager Gefängnis in das Militärgefängnis nach Krakau gebracht und von dort einige Monate später mit 400 anderen Häftlingen nach Auschwitz. Unser Zug blieb irgendwann auf freiem Feld stehen. Es waren damals noch ungefähr zwei Kilometer vom Bahngleis zum Tor von Auschwitz. Man trieb uns aus dem Waggon. Leichen lagen herum. Geschossen wurde, getreten wurde, wir mussten uns aufstellen in Zweierreihen. Ich stand neben meinem Bruder, es hieß: „Alles rechts um!“ Da kam ein SS-Mann mit einem Zettel daher und schrie „Feingold“, weil er eine Liste mit angeblichen Saboteuren hatte. Mein Bruder hob die Hand. Und schon bekam er einen Tritt in den Bauch, der so barbarisch war, dass wir beide umfielen. Das war unsere Begrüßung in Auschwitz.
Dann rückten wir ins Lager ein. Man jagte uns durch einen Korridor von SS-Leuten, die mit ihren Gewehrkolben auf uns einschlugen. Dort standen an Tischen kriminelle Häftlinge, das waren die Kapos, die Funktionäre in jedem Konzentrationslager. Wir mussten die Taschen ausleeren. Ich hatte eine goldene Füllfeder, die war gleich weg. Einer der Kriminellen sagte: „Du wirst sie eh nicht brauchen. Du hast eine Lebensdauer von höchstens drei Monaten.“
Meine Nummer in Auschwitz war 11996.
Der Block 13, in den man uns trieb, war ein Rohbau, keine Fenster, keine Türen, keine Toiletten. Sie haben uns Strohsäcke und Decken hingeschmissen. Es war so eng, wir sind da gelegen wie Heringe. Wenn man sich umdrehen wollte, musste sich der andere mit umdrehen. Um fünf Uhr wurde Licht gemacht, und wir sahen, dass die Marmeladeneimer in der Ecke nicht ausgereicht hatten für den Harn und die Scheiße der Häftlinge. Natürlich wollte von da an keiner mehr in der Ecke liegen. Deshalb haben uns die Kapos aufstehen lassen, und wir mussten herumgehen, und wenn gepfiffen wurde, musste man sich hinlegen, wo man gerade stand. Es war so dürftig, so primitiv, so mörderisch.
In Auschwitz gab es zu meiner Zeit noch kein Gas. Das Massensterben in Auschwitz war ein Totschlagen. Man gab die Devise aus: Ein Häftling ist die Patrone nicht wert. Die Häftlinge starben durch Verhungern und durch Schläge, vorgeschrieben von der SS, ausgeführt von den Kriminellen, den Zuchthäuslern. Nie wurde einer von denen belangt. In unserem Block gab es diesen tschechischen Ringer, zu dem die Kapos sagten: „Zeig uns mal die Krawatte.“ Am nächsten Morgen hatten sie drei Häftlingen das Genick gebrochen.
Mein Bruder und ich waren in der Strafkompanie. Wir mussten mit Holztragen Kies schleppen und die Rampe von Auschwitz auffüllen, wo später die Züge einfuhren und die Ankommenden in Arbeitsfähige und nicht Arbeitsfähige eingeteilt wurden.
Später kam ich nach Neuengamme, Dachau und Buchenwald. In jedem KZ umringten mich Häftlinge, weil sie wissen wollten: „Wie ist es in Auschwitz?“ Und fast immer haben sie dann gesagt: „Du bist verrückt.“ Wissen Sie, ich habe in meinem Leben so viele Situationen gesehen, die man unmenschlich nennt. Aber nirgends hat man die Bestien so wenig in Schach gehalten wie in Auschwitz.
Die Überlebenden • SPIEGEL-Titel 5/2015
„Meine Tochter hat darunter gelitten, dass meine Frau und ich nicht darüber sprechen konnten.“
PARIS, 17. DEZEMBER.
Raphaël Esrail, 89, hat den Termin für dieses Treffen einmal verschoben, aus gutem Grund: Er war zu einem Mittagessen mit der Schauspielerin Isabelle Adjani eingeladen. Wie es war? Sie sei eine nette Person, allerdings, sagt Esrail und zwinkert, werde selbst eine Frau wie die Adjani natürlich nicht jünger. Seinen trockenen Humor verliert er auch nicht, während er über den Schrecken seines Lebens erzählt. Er arbeitete für den französischen Widerstand. Wie erlebten Sie den Tag, an dem alles aufflog?
Es war kalt in Lyon, sehr kalt, an diesem 8. Januar 1944, und an kalten Tagen war mein Doppelleben natürlich ein bisschen beschwerlicher als sonst. Ich war 18 Jahre alt, Student und Widerstandskämpfer. Spezialist für falsche Papiere. Zum Widerstand kam ich über die Pfadfinder. Unsere geheime Zentrale war mitten im Zentrum von Lyon, in einem kleinen Apartment, direkt neben der Polizeistation an der Place Bellecour. Hier „wusch“ ich Dokumente, aus Monsieur Dupont wurde Monsieur Durand. Ich habe auch viele ganz neue Ausweise fabriziert, vor allem natürlich für die Juden. Das Blöde an der Geschichte war, dass mein Kamerad diese Wohnung von jemandem gemietet hatte, den wir nicht kannten. Und an diesem 8. Januar bekam ich dann die Quittung dafür: Es war gegen elf Uhr morgens, als ich plötzlich der Gestapo und ihren Helfern gegenüberstand.
Ich fand mich mit Handschellen im Hauptquartier wieder. Dort hat man mich splitterfasernackt ins Eiswasser einer Badewanne getaucht und mir mit einem Stock auf meine Geschlechtsteile geschlagen. Das war eine interessante Erfahrung, die mehrere von uns durchgemacht haben müssen, denn das Wasser war bereits blutig. Sie wussten ja sofort, dass ich Jude war, denn alle Juden sind beschnitten. Schließlich wurde ich ins Sammellager Drancy deportiert. Dort lernte ich ein Mädchen kennen - das wurde später meine Frau.
Wir alle kamen am 3. Februar 1944 in den Zug, drei Tage und drei Nächte dauerte der Transport von Drancy nach Polen. Vielleicht waren wir 70 Menschen im Waggon, vielleicht 90. Damit Sie das verstehen: Plötzlich sind Sie in so einem Viehwaggon, eingepfercht mit vielen anderen Menschen, mit denen Sie nichts verbindet.
Damals war das ja eine Zeit, da war man viel schamhafter als heute. Und plötzlich musste jeder vor allen anderen seine Bedürfnisse verrichten, da war nichts als ein Fass. Besonders für die Frauen war das wohl unerträglich. Wir haben dann unsere Jacken und Mäntel ausgezogen und sie als Vorhang vor das Fass gehalten, aber dann, nach einem Tag, war das Fass voll, und es lief über. Ach. Es war fürchterlich, einfach fürchterlich.
Am 6. Februar 1944 kamen wir in Auschwitz an, da standen SS-Offiziere. Mein Gott, waren die perfekt: groß, schlank, tadellos gekleidet in ihren Uniformen. Sauber, jede Falte spitz gebügelt. Und jede Menge Schäferhunde. Die Kranken, die Schwachen sollten in die Wagen des Roten Kreuzes steigen, riefen die Soldaten. Das war natürlich eine Lüge, es gab keine Wagen des Roten Kreuzes. Die gesunden, jungen Frauen sollten ihre Babys den alten Frauen geben. Wenn die Mütter ihre Kinder nicht hergeben wollten, gingen auch sie direkt mit ins Gas.
Meine eintätowierte Nummer habe ich mir später entfernen lassen, wegbrennen, andere Dinge konnte ich leider nicht aus meinem Kopf löschen.
Im Lager dürfen Sie nie sitzen, nie. Im Stehen essen, im Stehen arbeiten, immer sauber sein - ohne sich waschen zu dürfen. Perfides System. Irgendwann haben wir es alle gewusst, dass es nur das eine Ziel gibt, getötet zu werden, aber verschiedene Wege dorthin: direkt ins Gas. Oder eben vorher arbeiten. Oder sich tot arbeiten. Oder erschlagen werden.
Als Auschwitz schließlich evakuiert wurde, machte ich den Todesmarsch, das Schlimmste, was ich je erlebt habe, viel schlimmer als das Lager. Am 18. Januar 1945 ging es los. Die Ordnung im Lager war aufgebrochen, für einen kurzen Moment, für zwei, drei Stunden etwa. Nie werde ich es vergessen, Milou, mein Freund und Kamerad, hatte ein paar Stiefel für mich geklaut. Wir hatten ja nur diese Galoschen mit den Holzsohlen. Milou meinte: Raphaël, wir werden sicherlich lange marschieren müssen. Dann liefen wir los, in Fünferreihen. Es war eine kalte, klare Nacht, sehr gute Sicht. Es war wie in diesem Gedicht von Victor Hugo: „Il neigeait, il neigeait toujours! La froide bise sifflait; sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts.“(*) Genauso war das. Tote Frauen lagen am Wegesrand, unzählige tote Frauen. Männer auch, und Pferde.
Als wir frei waren, bot mir ein amerikanischer Soldat eine Zigarre an. Ich starb vor Hunger, und er bot mir eine Zigarre an.
Mittlerweile träume ich wieder, verhaftet zu werden, das habe ich lange nicht getan. Meine Tochter hat darunter gelitten, dass meine Frau, die Birkenau und Ravensbrück überlebt hat, und ich nicht mit ihr darüber sprechen konnten. „Ihr sagt nichts, aber der Tod atmet überall durch“, das hat sie immer wieder gesagt. Jetzt ist meine Tochter 64 Jahre alt, und wir haben mit ihr so wenig wie möglich darüber gesprochen, um sie zu schützen. Was hätten wir ihr sagen können: Ja, wir haben gelitten?
* Aus der Sammlung „Les Châtiments“ (1853): „Es schneite, es schneite ohne Unterlass! Der kalte Wind pfiff; auf dem Glatteis, an unbekannten Orten, man hatte kein Brot und man ging barfuß. Die Verwundeten suchten Schutz im Bauch der verendeten Pferde.“
Die Überlebenden • SPIEGEL-Titel 5/2015
„Ich habe geschrien, ich gehe nicht ins Bordell. Lieber sterbe ich.“
BERGISCH GLADBACH, 18. DEZEMBER.
Philomena Franz, 92, zeigt Fotos ihrer Kinder, sie hatte sechs, drei Söhne kamen bei einem Autounfall um, eine Tochter starb früh. Philomena Franz ist „Zigeunerin“, so sagt sie selbst. Von rund 23.000 Sinti und Roma in Auschwitz sind schätzungsweise 21.000 umgebracht worden. Warum sprechen Sie von sich als Zigeunerin?
Das Wort steht für eine Lebensart, eine Kultur. Wir Zigeuner haben unsere Lieder, unsere Märchen. Ich komme aus einer Familie von Musikern, wir haben für hochrangige Leute gespielt.
Mein Vater hat einen Wagen für uns bauen lassen, der hat 2000 Reichsmark gekostet, da hätten Sie schon fast ein Haus dafür kaufen können. Wir hatten auch Häuser, eines in Bad Cannstatt und eines in der Provence. Wenn Schule war, lebten wir im Haus in Deutschland, in den Ferien sind wir Kinder in dem Wagen mitgefahren.
Meine Familie, das waren Bühnenmenschen, und über den Hitler haben sie gesagt: „Das ist so theatralisch, wie der auftritt.“
Mein Bruder hat für die Wehrmacht gekämpft, während sie uns ins Lager steckten. Im April 1943 bin ich nach Auschwitz gekommen. Im Untersuchungsraum hat einer der SS-Männer gesagt, meine Haare sollten nicht rasiert werden, ich hatte ja Haare bis über die Taille. Die Frau, die neben mir stand, sagte: „Mensch, du hast es gut, du darfst ins Bordell.“ Ich habe losgeschrien: „Nein, da gehe ich nicht hin. Lieber sterbe ich!“ Der SS-Mann hat mich dann weggestoßen, und eine Frau hat mich geschnappt und mir die Haare rasiert.
Der Mann, der mich tätowiert hat, sagte: „So ein schönes Mädchen, ich mache dir eine schöne Tätowierung.“ Ich habe die Nummer 10550. Und das Z, das steht für Zigeunerlager. Dann musste ich zur Rassen- und Sippenforscherin, die hat uns die Nase, die Ohren, die Augen ausgemessen und zu mir gesagt: „Lauf mal!“. Da hat sie gesagt: „Ja, typisch Inderin.“ Die Sinti kommen ja aus Indien.
Zu dem Dr. Mengele musste ich auch. Der hat ja die Medizinversuche gemacht. In einem Raum lagen ein erwachsener Mensch und ein Kind nebeneinander, die waren aufgeschlitzt. Und Reagenzgläser standen herum mit Teilen von Menschen, Leber, Galle. Mir haben sie eine Spritze gegeben, tief in den Brustkorb, ich habe noch eine Narbe davon. Ich war zwei Wochen gar nicht richtig bei Bewusstsein.
Ich kam ins KZ Ravensbrück, da war meine Schwester. Nach einem Jahr gelang mir die Flucht. Es war Sommer, ich sah die Felder, ich habe gedacht, lieber Gott, ich will draußen noch einmal das Gras riechen, noch einmal in einen Apfel beißen - ich habe im Wald gelebt, dann haben sie mich wieder aufgegriffen.
Sie haben sich an meiner Schwester gerächt, haben sie gefoltert an einem Galgen, haben mich danebengehängt, sie hat mir noch zugerufen: „Ich bin bei dir.“ Ich habe sie nie wiedergesehen. Sie haben mich nicht erhängt, es war eine Scheinerhängung zur Abschreckung für die anderen, sie haben mich in den Stehbunker gebracht, tagelang musste ich stehen.
Dann kam ich wieder nach Auschwitz. Wir mussten am Krematorium arbeiten. Ich kann es gar nicht sagen, wie hoch die Menschenasche da lag. Und die war wie Kiesel. Wir mussten sie wegschaufeln auf Lastwagen. Dann wieder Abtransport in ein Lager 15 Kilometer entfernt von Wittenberge an der Elbe. Ich konnte fliehen Mitte April 45, ein Mann hat mich aufgegriffen und mit nach Hause genommen, ein guter, älterer Mann. „Rein in die Wanne“, hat er zu mir gesagt, und da hatte ich zum ersten Mal wieder Schamgefühl. In Auschwitz war das weg gewesen.
Die Überlebenden • SPIEGEL-Titel 5/2015
„Wir mussten nackt Aufstellung nehmen und an der SS vorbeigehen.“
WIEN, 19. DEZEMBER.
Helga Kinsky, die vor 84 Jahren als Helga Pollak in Wien geboren wurde, war zwölf Jahre alt, als sie mit ihrem Vater in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde. Helga Pollak lebte dort mehr als eineinhalb Jahre lang im Zimmer 28 des Mädchenheims L 410, wo sie ein inzwischen veröffentlichtes Tagebuch führte. Hatten Sie am Tag der Deportation nach Auschwitz Angst?
Ich glaube: noch nicht. Mir war bange, gewiss. Wir waren ja alle wie gelähmt. Aber noch war ich mit vertrauten Menschen zusammen, mit meiner Freundin Handa, mit der Betreuerin vom Zimmer 28, Ella Pollak. Ich war fest überzeugt davon, dass ich meine Verwandten und Freunde wiedersehen würde. Ein KZ wie Auschwitz, so ein Ort war ja unvorstellbar.
Der Transportbefehl kam nicht überraschend. Ich musste mich von meinem Vater verabschieden. Es muss für ihn schrecklich gewesen sein, mich gehen zu sehen.