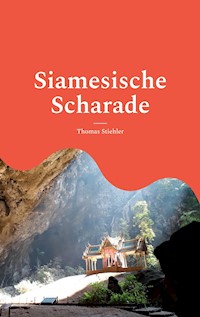Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen lernen sich kennen und lieben. Natascha ist eine Studentin aus einem Dorf an der Wolga, Richard ein fünfundzwanzig Jahre älterer Deutscher. Er ist fasziniert von Nataschas Jugend; sie träumt von einem Leben in Deutschland. Sie heiraten und begeben sich auf einen gemeinsamen Weg, der zunächst von Glück gepflastert scheint. Doch im Alltag türmen sich zunehmend Probleme auf. Natascha beginnt unter der Dominanz Richards zu leiden. Hat sie den Richtigen geheiratet? Nach sechzehn Jahren trennt sie sich von ihm. Sie kann dank ihrer Jugend und ihres erstarkten Selbstbewusstseins ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Richard zieht sich resignierend in eine Hütte in den Bergen zurück und sinniert über sein Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen lernen sich kennen und lieben. Natascha ist eine Studentin aus einem Dorf an der Wolga, Richard ein fünfundzwanzig Jahre älterer Mann aus Deutschland. Er ist fasziniert von Nataschas Jugend; sie träumt von einem Leben in Deutschland. Sie heiraten und begeben sich gemeinsam auf einen Weg, der zunächst von Glück gepflastert scheint. Doch im Alltag türmen sich zunehmend Probleme auf. Natascha beginnt unter der Dominanz Richards zu leiden. Hat sie den Richtigen geheiratet? Nach sechzehn Jahren trennt sie sich von ihm. Sie kann dank ihrer Jugend und des gewachsenen Selbstbewusstseins ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Richard zieht sich resignierend in eine Hütte in den Bergen zurück und sinniert über sein Leben.
Der Autor (Jahrgang 1946) ist Physiker und arbeitete viele Jahre nebenberuflich als Übersetzer. Bei BoD veröffentlichte er 2015 den Roman „Kaiserwalzer“. Er lebt in Bayern und in Thailand.
Wunderlichstes Buch der Bücher
Ist das Buch der Liebe;
Aufmerksam hab ich’s gelesen:
Wenig Blätter Freuden,
Ganze Hefte Leiden;
Einen Abschnitt macht die Trennung.
Goethe „West-östlicher Divan“
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
Prolog
Als Richard den abgedunkelten Spielsaal des Casinos betritt, schnipst der Croupier am mittleren Tisch gerade die Kugel in ihre Umlaufbahn. Zuerst das bekannte surrende Geräusch, dann das langsamer werdende Klapp, Klapp, Klapp. Im Lichtkegel der tief hängenden Lampe, die den Tischfilz mit gelber Glasur überzieht, scheinen die Akteure nur aus Händen zu bestehen, die regungslos auf der Mahagonibande liegen. Als die Kugel auf der roten 21 zur Ruhe kommt, ruft ein Spieler, ein junger, stämmiger Mann mit Sternenbanner am Hemdkragen und Goldkettchen am Hals: „Yes, old fellows, that’s great.“ Einige der old fellows stöhnen leise, einer verzieht den Mund zu einem gequälten Lächeln. Ein Moment des Erstarrens, kaum irgendwo anders liegen Freude und Leid so nah beieinander wie im Casino. Dann plötzliche Betriebsamkeit, die Jetons werden hastig hin und her geschoben, neu platziert oder zum eigenen Jetonhäufchen gerafft. Richard setzt sich auf den einzigen freien Platz neben die alte Dame mit dem hohen Turmaufbau aus gelb gefärbtem Haar. Auch sie – wie Richard – ein Stammgast. Sie nickt ihm zu, er nickt zurück und zwingt sich ein Lächeln ab. Aus ihrem zerfurchten Mund mit den grell geschminkten Lippen ragt wie immer die Zigarettenspitze aus Perlmutt und Silber. Aus dem schlanken Zigarillo kräuselt ein blauer Faden senkrecht nach oben, verwirbelt zu einer Wolke, um schließlich im Dunkel zu verschwinden. Dass sie fast nie gewinnt, nimmt sie gelassen hin. Mit reglosem Blick sieht sie zu, wie der Berg Jetons vor ihr dahin schmilzt. Dieser Blick scheint zu sagen: Auf Glück muss man warten können. Doch das ihr zugewiesene Maß an Zeit wird sich wohl bald erschöpfen.
Richard setzt mehrmals auf die 6, seine Lieblingszahl. Doch die bringt ihm heute kein Glück. Viele Runden lang geht es ihm wie seiner rauchenden Nachbarin – seine Jetons sind von Verschwindsucht befallen. Doch Warten ist Richards Sache nicht, weder auf Glück, diesen unzuverlässigen Gesellen, noch auf weitaus banalere Dinge. Denn er ist Realist, auch ihm bleibt mit seinen fünfundsiebzig Jahren nicht mehr viel Zeit. Er ändert seine Strategie, versucht es mit Primzahlen und deren Quersummen. Tatsächlich klappt es damit besser. Hin und wieder erntet er sogar ein „Compliments, old fellow“ von dem Stämmigen mit dem Sternenbanner, der bei jedem „Faites vos jeux!“ das Kreuz an seinem Halskettchen anschaut, das ihm offenbar den richtigen Einsatz verrät.
Richard spielt, bis seine Verluste egalisiert sind, drückt dem Croupier dessen Teil in die Hand, nickt der gelbhaarigen Raucherin zu und verlässt lustlos das Casino. Er gehört nicht zu den Fanatikern, die den Virus der Spielsucht in sich tragen. Was will ich überhaupt hier? Einen großen Gewinn einfahren? Ganz bestimmt nicht. Das plissierte Gesicht der Räucherdame studieren oder das Gequatsche von old fellow anhören? Nein, das alles brauche ich nicht. Wenn ich es recht bedenke, brauche ich gar nichts mehr, gar nichts und niemanden. Und niemand braucht mich. Rien ne va plus.
Richard – trotz seines Alters noch erstaunlich rege – überquert die Straße und bleibt vor der Poststation Riezlern stehen, reckt den Kopf hinauf zur vom Mondlicht bestrahlten Kulisse der umliegenden Berge. Links das Fellhorn, dann die Kanzelwand und weiter rechts die Spitze des Großen Widdersteins, die knapp über die Dächer lugt. Davor das Casino. Wie ein Fremdkörper steht der Glaswürfel inmitten der Allgäuer Architektur. Welcher Architekt hat sich nur diesen Fauxpas erlaubt, und wer hat das zugelassen?
Der Walsertal-Bus kommt, um diese Zeit fast leer; Richard fährt zwei Haltestellen, an Restaurants und geschlossenen Läden vorbei, bis hinunter zur Kanzelwandbahn, und schlägt von dort den Pfad zu seiner Hütte ein. In hellen Mondnächten hinaufsteigen, sich selbst beweisen, dass er es noch kann, ja, das bereitet ihm Vergnügen. Hier kennt er jeden Stein und jede Wurzel. Er spricht mit dem Wald, und der antwortet ihm mit tiefer Rauschestimme. Die einsame Tanne an der ersten Weggabelung mag wohl dreimal so alt sein wie er. Sie blickt ernst auf ihn herab und winkt zur Begrüßung mit ihren nadeligen Armen. Richard hat mit Mystik nichts im Sinn, aber immer wenn er bei der Tanne ankommt legt er eine Verschnaufpause ein und verneigte sich, als müsse er der dem uralten Nadelriesen Respekt zollen.
Nachdem sein Herz wieder im Normaltakt schlägt, verabschiedet er sich von der Tanne und trabt weiter, jetzt in Serpentinen bergauf. Der Aufstieg erinnert ihn an seine Studienzeit. Wie oft war er als Student den steilen Hang zum Spitzhaus in Radebeul hinaufgestiegen, damals natürlich ohne Pausen einzulegen, viele, viele Stufen, er hatte sie nicht gezählt. Er hatte sich gezwungen, erst zurückzublicken, wenn er oben war. Die Belohnung war atemberaubend: das weite Elbtal, ein Fluss, der unbegradigt seinen Weg nimmt, so wie ihm die Natur Raum lässt, davor das vom Krieg unbehelligte Radebeul, Weinberge mit ihren Weingütern und den kleinen schlossartigen Anwesen der Weinbergbesitzer. Wenn ihm seine Mutter in den letzten Brief wieder mal fünf Mark gesteckt hatte, konnte er sich auf der Terrasse des Spitzhauses ein Glas Wein leisten und den Blick die geschwungene Elbe entlang bis hinauf nach Dresden genießen.
Nach Erreichen der Baumgrenze kommen erst der Mast des Lastenaufzugs mit seinem roten Riesenballon und dann seine Hütte in Sicht. Zehn Jahre nach seiner Scheidung hatte Richard sich da oben verschanzt. Alles begann mit einem Anruf des Maklers, eines Herrn Reichel, in allgäugefärbtem Hochdeutsch. Die Hütte sei nicht zu groß und nicht zu klein, abgelegen und ganzjährig bewohnbar, mit Versorgungslift und etwas Land für eine kleine Tierhaltung, alle Touristenpfade seien weit weg, die Substanz sei solide, kurz – ein Bergkristall. Der Redeschwall des eloquenten Herrn Immo-Reichel war kaum zu bremsen. Wie alle Makler gefiel er sich darin, lange Wortschlangen mit schillernden Adjektiven zu schmücken. Richard hatte nur die Hälfte von dem geglaubt, was der Makler so wortreich pries, er kannte die Makler. Die schildern ihre Objekte immer so, als seien es liebgewonnene Kinder, die sie nur unter Schmerzen zur Adoption freigeben. Doch die blumige Schilderung des Objekts passte recht gut zu Richards Wunschliste, die er dem Immobilienbüro Reichel in Sonthofen geschickt hatte.
Er fuhr hin, kletterte mit Herrn Reichel den Berg hinauf, sah den „Bergkristall“ und wusste sofort: Das ist sie, seine Hütte. Ein Sockel aus Naturstein, tief gezogenes Dach, im Erdgeschoss ein einziger Raum mit Kamin, rohen Holzdielen und rustikalen Stützbalken, oben drei Kammern, in denen man den Kopf einziehen musste, wenn man an die Dachluke treten wollte. Seine Begeisterung hatte Richard sich nicht anmerken lassen, übermäßiges Schwärmen für ein Objekt treibt bekanntlich dessen Preis in die Höhe.
„Die Hütte hat einige Jahre leer gestanden“, ließ Immo-Reichel verlauten. „Sie gehörte früher einem Italiener, eigentlich einem deutschen Italiener, jedenfalls sprach er fließend Deutsch. Ein komischer Kauz, scheu und wortkarg. Er murmelte immer nur Simonettamia. Weiß der Teufel, was er damit meinte.“
„Was ist aus dem deutschen Italiener geworden?“, wollte Richard wissen.
Immo-Reichel versuchte das Thema zu wechseln: „Schauns nur, welch fantastische Aussicht!“ Er zeigte mit dem Finger auf das flache Felsplateau gegenüber: „Da drüben, der Hohe Ifen.“
„Was ist aus dem deutschen Italiener geworden?“
„Hm, also, der ist hier oben gestorben. Die Hirten fanden ihn erst beim nächsten Viehabtrieb.“ Immo-Reichel hatte sich verlegen am Kopf gekratzt und den Blick gesenkt, als trüge er Mitschuld an des Italieners Dahinscheiden.
„Ich nehme die Hütte“, sagte Richard trocken, er hatte sich längst entschieden. Dem Himmel nah und den Menschen fern, das war genau nach seinem Geschmack. Dass der Italiener hier gestorben war, ließ ihn kalt. In fast jedem Haus ist irgendwann irgendwer gestorben. In diesem ‘Bergkristall‘ den letzten Atemzug tun – warum nicht! Besser als in einer so genannten Seniorenresidenz, wo man den ganzen Tag nur auf den nächsten Tag wartet, der auch wieder nur aus Warten besteht. Und sollte mich hier oben doch mal die Schwatzsucht packen, dachte er, wird es ein Leichtes sein, unten im Ort Leute zu finden, die einem Schwätzchen nicht abgeneigt sind.
Immo-Reichels Miene hatte sich nach Richards Entschluss schlagartig aufgehellt, denn nach des Italieners Tod galt die Hütte als schwer vermittelbar. Er zog den vorbereiteten Vertrag aus der Mappe und reichte Richard erst den Stift und dann seine verschwitzte Hand.
Das letzte Stück des Weges ist steil, brüchig und teilweise überwuchert. Wurzeln und Stolpersteine stellen sich Richard in den Weg. Er muss sich auf seinen Stock stützen und Pausen einlegen. Aber – denkt er – es ist wie im Leben: wenn es auf dem Weg keine Widerstände gibt, dann ist es der falsche Weg.
Was hatte Doktor Steinhoff, sein Hausarzt, bei der letzten Visite gesagt? Es wäre vernünftiger, das Herz zu schonen und nicht mehr so oft den beschwerlichen Gang ins Tal zu wagen. Richard hatte genickt und sich seinen Teil gedacht: ja, ja, ab Siebzig ist nichts wichtiger, als vernünftig zu sein, und nichts ist deprimierender als das. Ihm ist bewusst, dass er zu einer Art Naivität neigt, die auch, oder gerade bei seinem Gesundheitszustand deutlich wird. Doch die diversen Leiden, die wie drohende Gespenster um ihn herum tanzen, versucht er trotzig zu ignorieren. Mal ist es das Herz, mal die Knie oder die Augen. Wie oft hat er versucht, diesen dunklen Fleck, der sich in alle Bilder drängt, mit einer Handbewegung wegzuschieben. Ein vergebliches Bemühen, der dunkle Fleck ist sein ständiger Begleiter geworden. Doch schlimmer als schlecht sehen, ist nicht gesehen werden. Hat man ein gewisses Alter erreicht, schauen die Leute, vor allem die jungen, nicht nur vorbei, sie schauen durch einen hindurch, als wäre man Luft, ein komprimiertes Nichts. Man hat das Gefühl, sich für seine Existenz entschuldigen zu müssen.
Schnaufend in der Hütte angekommen, lässt Richard sich in den fellbehangenen Sessel neben dem Kamin fallen. Dieser Sessel – ein monströses, knarrendes Ungetüm dominiert den Raum, der ansonsten eher spärlich möbliert ist: einige Bücherregale aus Fichtenholz (von Richard selbst gezimmert), ein ehemals mit bunten Blumen bemalter Bauernschrank, von dem die Farbe abbröckelt als würde der Wind die Blumen rupfen, und ein wuchtiger Schreibtisch mit dicker Platte aus Eichenholz. Richard lauscht. Wind schleicht ums Haus und hat dunkles Rauschen im Gepäck, die Sparren der Hütte knarren, als wollen sie zu ihm sprechen. Claudius, sein Bernhardiner, lümmelt mit halbgeschlossenen Augen auf der Couch und wedelt zur Begrüßung mit dem Schwanz. Das soll wohl ‚Grüß Gott, Richard’ heißen. Der Fressnapf steht unberührt am Boden, genau da, wo ein Fleck, Folge von Claudius’ letztem Darmleiden, den Teppich ziert. Vor den Bücherregalen liegen Stapel von Büchern. Eigentlich wollte Richard heute Ordnung in seine Bibliothek bringen, alle Bücher nach Themen sortieren und bei dieser Gelegenheit abstauben. Als er die Hälfte herausgenommen hatte, war ihm eingefallen: Heute ist ja Freitag, Casinotag.
Aber jetzt, nach dem kräftezehrenden Heimweg, ist ihm nicht nach Büchersortieren, zumal in seinem Kopf scharenweise Wörter Schlange stehen, die heraus wollen. Richard entfacht ein Feuer im Kamin, legt Beethovens Fünfte auf, setzt sich an den Schreibtisch und greift zu Papier und Stift. Wie aus einem porösen Weinschlauch tropft sein Leben aufs Papier und gerinnt dort zu Buchstaben und Wörtern. Er ahnt, dass sich sein Kreis schließen wird, sobald der letzte Tropfen heraus ist. Denn so viel ist sicher: Hineinfüllen wird er nichts mehr.
Um ihn herum auf dem Fußboden liegt sein Leben, gekritzelt in unleserlicher Schrift auf hunderten Seiten. Er greift wieder zum Stift und beginnt eine neue Seite: Was ist der Mensch? Die Summe all dessen, was er bereit ist, anderen zu geben… Und ich? Was hab ich genommen, was gegeben? Nein, das riecht nach Inventur und Pathos. Er streicht die Sätze wieder aus. Aber das mit dem Geben stimmt schon. Wer nie zu geben bereit ist, hat umsonst gelebt. Nächster Versuch: Das Vergangene ist nicht tot, es lebt weiter im Gegenwärtigen; in dem, was wir tun, steckt die Summe all dessen, was wir getan haben. Er tippt mit dem Stift an den Mund, eigentlich ein schöner Satz, streicht ihn aber dennoch durch. Zu mathematisch, wie eine buchhalterische Bilanz. Stattdessen schreibt er: Alles, was du vorhast, all deine Pläne musst du selbst verwirklichen; alles, was DU willst, musst DU tun. Es gibt viele gute Dinge, die geschehen nicht, weil du sie nicht anpackst.
Die Zeilen fliehen ihm immer nach rechts oben davon. Unten an der Seite entsteht ein leeres Dreieck, Raum für nachträgliche Notizen. Und Striche, überall Striche, unter dem Text, durch den Text und manchmal quer über ganze Absätze. Die Blätter sehen chaotisch aus, wie sein Leben. Nur, dass er aus seinem Leben nichts ausstreichen kann.
Richard überfliegt die letzte Seite. Auf Orthographie (darin war er immer schwach) braucht er nicht zu achten, diesen Text wird ohnehin kein Mensch lesen. Wen interessiert schon das Geschwätz eines alten Mannes, wer will schon die Bilder sehen, die sein Gedächtnis hervorkramt? Bilder von Glück und Enttäuschung, von Erfolgen und Niederlagen, Liebe und Hass. Und Bilder, auf denen immer wieder eine Frau auftaucht: Natascha als junges Mädchen mit Wuschelhaar, engem Pulli und Jeans, Natascha im Brautkleid vor dem Standesamt, Natascha mit Bikini und Sonnenbrille am Strand, Natascha im engen Kostüm neben ihrem Anwalt vor dem Scheidungsrichter, Natascha am Portal des Festspielhauses im cremefarbenen Kleid mit einem Federbusch im Haar …
1.
Natascha strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schloss die Augen. Dabei war sie weder müde noch erschöpft, im Gegenteil, sie war hellwach und erlebte in Gedanken noch einmal das eben Gesehene: eine Bilderreise durch Deutschland. Dias, die von ihrem Deutschlehrer Nemzow an die Wand geworfen und kenntnisreich kommentiert worden waren. Ihre Gedanken glichen Schnellzügen, die durch Tunnel rasen und beim Auftauchen immer neue, unerwartete Bilder zeigen. Der Kölner Dom, der Frankfurter Römer, das mäandernde Band der Mosel, das Brandenburger Tor, die bizarren Gipfel der Alpen … Sie wähnte sich an diesen Orten, die sie in ihren Träumen oft besucht, aber nie mit eigenen Augen gesehen hatte.
Träume sind Schäume, hatte ihre Freundin Elena gesagt, wenn Natascha von Nemzows Deutschstunden schwärmte, und spöttisch gefragt, ob diese Schwärmerei für alles Deutsche vielleicht etwas mit dem Mann Nemzow zu tun habe. Das hatte sich Natascha selbst schon gefragt, aber war zu dem Schluss gekommen: Dieser Herr Nemzow, ledig, Anfang dreißig, Halbglatze und altmodische Hornbrille, war ihr als Mann völlig gleichgültig. Doch dass sie „Homo Faber“ im Original lesen konnte und dass sie – entgegen aller Regel – das Buch aus der Schulbibliothek mit nach Hause nehmen durfte, das immerhin verdankte sie Nemzow. Und nicht nur dieses Buch. Eigentlich hatte sie freie Hand; Nemzow drückte beide Augen zu, wenn Natascha in den verstaubten Regalen der Bibliothek unter dem Dach der Schule auf Schatzsuche ging. Da vergaß sie die Welt um sich herum und das banale Alltagsleben in ihrem Dorf am Unterlauf der Wolga. Sie tauchte ein in spannende Abenteuer und feurige Liebesromanzen, während sie, beide Fäuste auf das Kinn gestützt, bäuchlings auf dem schwarzen Ledersofa der Bibliothek lag, vor sich die Lektüre, neben sich das Wörterbuch und ihre private Vokabelliste.
Die meisten anderen Schüler hatten den Klassenraum schon verlassen, als sich eine Hand von hinten auf Nataschas Schulter legte. Nemzow – das spürte sie sofort. Seine warme, weiche Hand, mehr Entschuldigung als Berührung, erkannte sie ohne Hinsehen. „Natascha, kannst du mir noch beim Aufräumen der Bibliothek helfen?“
Natascha drehte sich zu ihm um und sah das Flimmern in seinen Augen, das immer ankündigte, dass es beim Aufräumen der Bibliothek um mehr als nur um Bücher geht. „Ja, gern.“ Beinahe hätte sie noch hinzugefügt: Aber nur, wenn Sie mich dabei in Ruhe lassen. Denn meist nutzte er solche Gelegenheiten, frivole Sprüche zu klopfen oder – wie er es nannte – ihr beim Aufräumen unter die Arme zu greifen. Wie peinlich das war! Immerhin war er fast doppelt so alt wie sie, und außer der deutschen Sprache verband sie rein gar nichts mit ihm. Er sollte mir den Schlüssel geben, dachte sie, dann könnte ich in diesen Büchern stöbern, wann immer ich will. Sie las eh am liebsten, wenn sie allein war.
„Also, dann wollen wir mal!“ Nemzow zog seine Hand zurück und ging voraus bis zum Ende des Korridors, dann die steile Treppe hinauf in die oberste Etage der Schule. Die Tür zur Deutschen Bibliothek klemmte etwas und gab beim Öffnen quietschende Geräusche von sich. Natascha begann ihre Wanderung durch die Reihen der deutschsprachigen Autoren. Manchmal strich sie mit dem Zeigefinger über einen Buchrücken, Bände, die sie schon gelesen hatte, als wolle sie sich bei ihnen zurückmelden: Hallo, da bin ich wieder. Bei Goethe blieb sie stehen und suchte im „Faust“ die Szene in Auerbachs Keller. „Mein Leipzig lob ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute.“
Sie nahm die Goethe-Bände heraus und wischte den Staub von Büchern und Regalböden.
Sie hatte noch nicht alle Bücher zurückgestellt, da schob Nemzow sie weiter, vorbei an Heine, Keller, Heinrich und Thomas Mann, bis hin zum letzten Regal, wo Remarque, Werfel und schließlich Stefan Zweig ihren Platz hatten. Hinter Stefan Zweig war nur noch die Wand, bis in Schulterhöhe mit grüner Ölfarbe gestrichen. Nemzow kam ihr immer näher, um seine Augen herum ein nervöses Zucken, ein Alarmzeichen für Natascha. Wie zufällig berührte er ihre Schulter und brachte sich in eine Position, aus der er einen Blick in den Ausschnitt ihrer Bluse werfen konnte. „Eine tolle Bluse hast du an, ist die neu?“ Ungeniert begann er, an der Knopfleiste zu nesteln.
Natascha wich zurück, immer weiter, bis sie mit dem Rücken den grünen Ölsockel berührte. „Jetzt geht das schon wieder los“, stöhnte sie und versuchte, Nemzow auf Distanz zu halten.
„Du solltest etwas netter zu mir sein“, sagte Nemzow auf Deutsch, als ob der Gebrauch der Fremdsprache den Satz akzeptabler machte.
„Netter geht nicht“, antwortete Natascha ebenfalls auf Deutsch, stellte sich auf die Zehenspitzen und Stefan Zweigs Bücher in alphabetische Reihenfolge. Nemzow gab sein Vorhaben auf und näherte sich Goethe. Als wäre nichts geschehen, pfiff er leise „Sah ein Knab ein Röslein stehn …“ und stellte Goethes Gedichtband etwas schräg, damit die anderen Bücher nicht umfallen konnten. Für Buchstützen hatte die Schule kein Geld.
Nachdem sich Natascha von Nemzow, von Böll und Zweig und allen Autoren dazwischen verabschiedet hatte und auf die Freitreppe der Schule hinaustrat, ging ein Gewitterguss nieder, der wie ein Vorhang vor dem Portal hing. Die ganze Woche schon jagte eine Wolke die andere. Dazu hatte sich brütende Hitze über das Dorf gelegt. Natascha hielt mit der einen Hand ihre Schultasche schützend über den Kopf und streckte die andere Hand aus, um über die ausgelegten Holzbretter zu balancieren. Wenn sie daneben trat, versank sie bis über die Knöchel in Pfützen, und der Schlamm spritzte bis zu den Waden hoch. Schon deshalb zog sie in die Schule nie die Seidenstrümpfe an, die ihr Onkel Igor vorige Woche zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hatte. „Eine hübsche junge Dame wie du, muss ihre Beine gehörig zur Geltung bringen“, hatte er augenzwinkernd gesagt. Natascha war ins Nebenzimmer gegangen, hatte die Strümpfe angezogen, den Spiegel auf den Boden gestellt und war davor Probe gelaufen. Nein, als Dame fühlte sie sich zwar nicht, aber zum ersten Mal wurde ihr bewusst, dass sie auch kein Kind mehr war. Sie hängte den Spiegel wieder an die Wand und prüfte ihr Gesicht. Die Nase saß an der richtigen Stelle, vielleicht etwas zu schmal, aber durchaus zu den hochliegenden Wangenknochen passend. Und die Pickel auf der Stirn? Die verschwinden, sobald du achtzehn bist, hatte ihr Vater versprochen. Sie trat einen Schritt zurück, stemmte beide Hände in die Taille, drehte sich hin und her und ließ ihren Pferdeschwanz fliegen. Das Spiegelbild bestätigte ihr: alles passabel, schmale Hüfte, straffer Po, schlanke Beine, dazu halblange, gelockte Haare, zu einem Pferdeschwanz gebunden. Nur der Busen war zu klein, aber das konnte ja noch werden.
Kurz vor dem Haus ihrer Eltern blieb sie stehen und drehte sich um. Das Dorf wirkte wie ausgestorben. Die Bänke vor den Häusern waren verwaist, und selbst die Hunde hatten sich in ihre Hütten verzogen. Auf der anderen Seite der Wolga schoss ein Sonnenstrahl durch eine Wolkenlücke und bohrte sich in den Boden der Steppe. Nataschas Vater hatte erzählt, dass dort viele hundert Kilometer weit keine Menschenseele wohne, nur eine Betonstraße führe zu einem Raketenversuchsgelände. Das Getöse der Raketenstarts hörten sie manchmal bis zu ihrem Dorf.
2.
Als Natascha das Haus ihrer Eltern erreichte, wurde sie von ihrer Mutter bereits am Gartentor erwartet. „Na endlich kommst du, ich warte schon über eine Stunde auf dich.“ Die Mutter stemmte beide Hände in die Hüfte und blockierte wie ein Cerberus das Gartentor, auf dem Kopf eine Plastiktüte gegen den noch immer heftigen Regen.
Natascha stammelte eine Entschuldigung: „Ich musste Herrn Nemzow in der Bibliothek helfen.“
Das ließ die Mutter nicht gelten: „Du mit deinen Büchern! Nichts als Flausen hast du im Kopf. Es gibt Wichtigeres, zum Beispiel unser Grünzeug hier.“ Sie deutete mit einer Handbewegung auf eine Reihe von Eimern, die am Gartenzaun standen. „Ich wollte das Gemüse heute in Wolgograd an den Mann bringen, aber kein Bus fuhr nicht, Pfu, pfu …“
Natascha trat von einem Bein aufs andere und sah ihre Mutter trotzig an. Sie fühlt sich weder für den Bus noch für das Gemüse verantwortlich. Was kann sie dafür, dass der Bus nicht fährt, schließlich ist das keine Seltenheit. Mal gibt es keinen Strom, mal stockt – wie gestern – die TV-Übertragung und manchmal fährt eben kein Bus. Sie hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. „Und was soll ich da machen?“
„Lauf schnell zu Onkel Igor, frag ihn, ob er mich morgen mit seiner Klapperkiste zum Markt nach Wolgograd chauffieren kann.“
Jetzt zu Onkel Igor gehen, ans andere Ende des Dorfes? Nein, dazu hatte Natascha überhaupt keine Lust. Mitten im Satz hatte sie gestern eine Übersetzung des „Osterspaziergangs“ abgebrochen. Wie könnte man das auf Russisch sagen: „Hier ist des Volkes wahrer Himmel“? Mehrere Varianten schwirrten ihr durch den Kopf, für eine musste sie sich entscheiden.
Doch damit konnte sie ihrer Mutter nicht kommen. Für die war Gemüse allemal wichtiger als Goethe, und die Falte auf ihrer Stirn sprach dafür, dass der Gang zu Onkel Igor unvermeidlich war.
Sie lockerte die Blockade des Gartentores, zog ihr Allzwecktuch aus der Schürzentasche, wischte sich den Schweiß von Stirn und Hals und schlug einen versöhnlichen Ton an: „Gib mir deine Schultasche und dann Abmarsch zu Onkel Igor. Wenn du willst, kannst du meinen Schirm mitnehmen. Und geh auf dem Rückweg am Med-Punkt1 vorbei, lass dir von Amputovka die Salbe für mein Bein geben.“
Onkel Igor, der sich von Fremden gern Gospodin2 Petruchin nennen ließ, nahm im Dorf eine Sonderstellung ein. Er hatte die Schlüsselgewalt über das Warenlager des Kolchos, und wer diesen Schlüssel hat, der war ein Gott. Oder etwas Ähnliches. Wahrscheinlich hatten sein großes Steinhaus und sein Auto, eines der wenigen im Dorf, in irgendeiner Weise mit dieser Gottähnlichkeit zu tun.
„Tschort poberi!“3, fluchte Onkel Igor, nachdem Natascha ihr Anliegen vorgebracht hatte. Er setzte die Bierflasche ab, streckte seine hünenhafte Gestalt zu voller Größe und spuckte den Zigarettenstummel in den Ausguss. Er hätte gern geholfen, denn immerhin war Nataschas Mutter eine Verwandte, aber jetzt musste er passen. „Meine Karre tut streiken, schon drei Wochen bockt sie rum, macht keinen Mucks nicht.“ Seinem klapprigen Lada fehle ein kleines, aber lebenswichtiges Teil vom Vergaser, ein Ventil, eines der wenigen Teile, die man nicht selber basteln könne. Sein Kumpel Boris, dem er die gebrauchten Winterreifen überlassen habe, könne ihm zwar das Teil besorgen – Beziehungen sind eben alles –, aber der wohne in Wolgograd, sechzig Kilometer, wenn nicht mehr. Igor nahm einen Schluck aus der Bierflasche und kratzte sich am unrasierten Kinn. „Tschort poberi!“ Ohne Auto war auch er auf den Bus angewiesen. Und wann der wieder fährt, das wusste nicht mal Halbgott Igor.
„Aber warte, dein Onkelchen hat eine Idee.“ Natascha hatte schon auf den rettenden Einfall gewartet, denn im Improvisieren war Onkel Igor Weltmeister. „Wir, deine Mutter und ich, könnten zusammen per Anhalter nach Wolgograd fahren. Irgendein Grusowik4 wird uns schon mitnehmen.“ Igors Augen blitzten, während er mit der Bierflasche einen Kreis in die Luft malte. Der Rynok-Chef, den er gut kenne, werde ihrer Mutter einen Förstklass-Stand zuweisen. (Seit er im Fernsehen den amerikanischen Film „Commando“ gesehen hatte, sagte er oft und gern förstklass.) „Ich kann in Ruhe mein Autoteil holen, und wir fahren am Abend gemeinsam zurück. Gemeinsam ist besser, denn man weiß ja nie … Eine Frau allein, mit einer Menge leerer Eimer. da könnte mancher Besdelnik5 denken: Eimer leer – Geldbeutel voll.“ Er verzog das Gesicht zu Furcht einflößenden Grimassen, um Natascha zu zeigen, wie gut er sich mit solchen Burschen auskannte und wie sehr ihm das Wohl ihrer Mutter am Herzen lag. Natascha umarmte ihn und lachte über seine pantomimische Gesichtsgymnastik. „Danke, Onkel Igor, ich wusste, du lässt uns nicht hängen.“
Igor riss einen Zeitungsrand ab und notierte: Morgen früh, Punkt fünf: Gemüsestart nach Wolgograd. „Vergiss nicht, deiner Mutter den Zettel zu geben“ rief er noch, aber Natascha war schon aus dem Haus.
Auf dem Weg zum Med-Punkt sah sie in Gedanken ihre Mutter in Wickelschürze am Gemüsestand, Gurken und Tomaten in der ausgestreckten Hand, mit der anderen Hand und mit lautem Geschrei potentielle Käufer lockend. Einmal war Natascha schon mitgefahren, um auf dem Markt die eigene Ernte unter die Leute zu bringen. Ein Samstag im August, in sengender Hitze hatte sie mit einem geblümten Tuch auf dem Kopf von früh bis abends inmitten von Eimern und Obstkisten gestanden und versucht, den vorübergehenden Kunden das Grünzeug aufzuschwatzen. Nehmen Sie doch unsere Tomaten, die sind die besten; schauen Sie nur, wie prall die sind, und nur drei Rubel das Kilo. Probieren Sie mal! … Dann nahm eine Dame mit Lockenwicklern und Damenbart eine Tomate, stieß ihren gelben Zähnen hinein, verzog das Gesicht und sagte: „Na ja, da schau ich lieber mal weiter.“ Am nächsten Stand zog sie das gleiche Theater ab.
Nein, das war nicht nach Nataschas Geschmack. So will sie später nicht ihr Geld verdienen. Sie wird es anders machen, besser. In Tomaten beißt man selbst und lässt nicht beißen.
Auf dem Weg zum Med-Punkt musste Natascha auf einem Brett über einen Graben balancieren, in den alle Leute der Umgebung ihren Müll warfen. Der Regen hatte den Graben in einen Bach verwandelt, von dem all der Unrat begleitet von einem infernalischen Gestank in die Wolga gespült wurde. Dahinter führte der Pfad über einen Hügel, der einen freien Blick über das bunte Gewirr von Hütten und Häuschen bis hinunter zum Fluss bot. Eigentlich liebte sie dieses Dorf, aber ihr ganzes Leben hier fristen? Nein, nein und nochmals nein! Bisher hatte sie – von kurzen Ausflügen nach Wolgograd und einem Pionierlager einige Kilometer wolgaaufwärts abgesehen – kaum etwas anderes gesehen als dieses Dorf. Doch ihre Bücher und die Erzählungen Nemzows hatten sie ahnen lassen, dass es da draußen eine andere Welt gibt, aufregend und verlockend. Die wollte sie sehen und zwar mit eigenen Augen.
Als der Regen eine Pause machte, trocknete die Schlammschicht an ihren Schuhen und Strümpfen. Bei jedem Schritt bröselte scheibchenweise die Dreckschicht ab.
Bin in einer Minutotschka6 zurück – der Zettel war auf einen rostigen Nagel an die Tür zum Med-Punkt gespießt.
Minutotschka, Minutotschka … Das kann dauern. Eine Minutotschka – so viel war Natascha klar – ist weder ein Minütchen noch der Bruchteil einer erwachsenen Minute. Eine russische Minutotschka ist einfach eine unbestimmte Zeit; meist weniger als eine Stunde, aber immer mehr als sechzig Sekunden. Natascha setzte sich auf die oberste Stufe vor dem Med-Punkt und stellte sich auf eine längere Wartezeit ein. Zwar regnete es nicht mehr, aber der Natur dampfte die Feuchte aus allen Poren. Die Hühner auf der Wiese vor dem Med-Punkt saßen träge im Schatten der Dorflinde, selbst das sonst unvermeidliche Herumgackern schien ihnen zu anstrengend zu sein.
Wenn es wenigstens einen Arzt im Dorf gäbe, dachte Natascha, dann hätten die Koslovs mit ihrer Anuschka, gerade mal drei Jahre alt, nicht bis in die Kreisstadt fahren müssen, und sie wäre vielleicht schon wieder gesund. Anuschkas plötzliche Apathie vorige Woche, ihr hohes Fieber und ihre Nahrungsverweigerung hatten das ganze Dorf in Aufregung versetzt. Mit dem fast bewusstlosen Kind auf dem Arm war Anuschkas Mutter zum Med-Punkt gerannt. Doch Amputovka, die Krankenschwester, hatte nicht helfen können. Ein Feldscher könne keinen Arzt ersetzen, hatte sie gesagt und spüren lassen, dass es ihr Leid tat. Daraufhin sind Anuschkas Eltern mit dem Kind zum Arzt in die Kreisstadt gefahren. Ein krankes Kind zwischen Vater und Mutter auf dem Motorrad – das muss man sich mal vorstellen!
Als Natascha nach einer halben Stunde des Wartens eben gehen wollte, kam Amputovka mit großen Schritten herbeigeeilt; die Minutotschka war vorbei. Obwohl diese freundliche, immer hilfsbereite Krankenschwester selbstredend keine Amputationen vornahm, wurde sie von allen im Dorf Amputovka genannt, niemand wusste, wie sie wirklich hieß. Sie war ganz außer Atem. „Entschuldige, ich musste eine Versite bei den Koslovs abstolvieren. Anuschka geht es – Slava Bogu7 – schon besser.“ Amputovka schloss die Tür zum Med-Punkt auf. Ein Fenster gab es nicht in dem Raum, aber elektrisches Licht. Natascha beäugte die medizinischen Gerätschaften, die auf weiß lackierten Regalen herumlagen. Verbandszeug war allerdings nicht vorhanden, das musste jeder Patient selbst mitbringen. Eine mit Leinen bezogene Liege und diverses vernickeltes Werkzeug deuteten darauf hin, dass Amputovka kleinere Reparaturen an der Dorfbevölkerung selbst vornahm.
„Du kommst wegen der Salbe für deine Mutter.“ Amputovka wusste Bescheid.
Sie kramte aus ihrer Kitteltasche ein Päckchen hervor, das sie umständlich aus Zeitungspapier auswickelte. Wie ein Goldsucher einen Fund präsentiert, so hielt sie die Salbe auf der flachen Hand: ein winziges Döschen mit einer gelblichen Masse.
„Das ist ein ausländisches Produkt“, sagte Amputovka, jedes Wort einzeln betonend. „Wenn es helfen sollte, müsst ihr eine ganze Tube davon besorgen. Vielleicht bittest du noch mal den netten Herrn aus Deutschland, der dir diese tolle Brille mit den Klarsichtgläsern geschickt hat.“
„Dieser nette Herr, Amputovka, ist ein Kriegsveteran, der es damals mit viel Glück geschafft hatte, dem Stalingrader Kessel zu entkommen. Er hatte mich als Dolmetscherin engagiert und wollte noch mal die Gräber seiner Kameraden besuchen. Ich weiß von ihm nur, dass er Kurt heißt und in Deutschland einen Brillenladen hat.“
„Nun ja, wenn die Salbe helfen sollte, musst du eben einen Deutschen finden, der einen Salbenladen hat und hier tote Kameraden besuchen will. Du kannst ja fließend Deutsch. Eine Tube Salbe ist doch nicht die Welt.“
Sie werde es versuchen, versprach Natascha, und machte sich auf den Heimweg.
Einen Mann suchen, der einen Salbenladen in Deutschland hat – na, wie die sich das vorstellt. Einen Deutschen finden – selbst ohne Salbenladen und tote Kameraden – ein schier hoffnungsloses Unterfangen. Sie wickelte das Päckchen von Amputovka nochmal aus. Was ist das überhaupt für ein Gemisch? Sie öffnete vorsichtig die Dose mit der Salbe und schnupperte daran. Sie roch nach ranziger Butter und irgendwas Chemischen. Auf dem Deckel stand: Acyprocynolhydrat – Made in Germany. Na, dann wird sie schon helfen.
Auf dem Hauptweg des Dorfes kam das Kulturhaus in Sicht. Wie ein Fremdkörper ragte es aus dem Durcheinander von ärmlichen Hütten und Häuschen hervor. Ein massiges Gebäude mit Portikus und sechs Säulen, nicht aus Marmor, sondern aus Ziegelsteinen, ehemals verputzt und weiß gestrichen. Jetzt bröckelte an vielen Stellen der Putz, und die darunter liegenden Ziegel kamen zum Vorschein. An den Außenwänden des Gebäudes arbeiteten sich weiß-gelbe Salpeterausblühungen wie Kletterpflanzen empor, manche Fenster waren zerbrochen, und letzte Woche war ein Brocken vom Dachsims herunter gekracht. Seitdem war das Gelände um das Kulturhaus abgesperrt.
Als kleines Mädchen hatte Natascha im Kinosaal dieses Hauses über Hase und Wolf gelacht. Die beiden lieferten sich auf der Leinwand einen ungleichen Kampf, den immer der Schwächere gewann. Oder sie hatte mit roten Wangen den Hokuspokus der bösen Hexe Baba Jaga verfolgt. Wenn die Hexe im gleißenden Licht auf dem Besen durch den Kamin ritt, versteckte sich Natascha tief in ihrem Kinosessel. Umso höher wagte sie sich bei der „Schneekönigin“ heraus, wenn Kay in seinem glitzernden Kleid aus dem Eispalast auf die Kinder herabschaute.
Später hatte sie in diesem Haus ihren ersten Kuss bekommen, von Sergej aus der 6b, dem Jungen mit der schwarzen Igelfrisur. Während eines Schulfestes hatte er sie in einen Nebenraum gelockt, sich mit feuchtem Mund ihrem Gesicht genähert und mit seinen Lippen flüchtig ihren Mund berührt. Danach war er wortlos aus dem Kulturhaus gerannt. Natascha hatte sich mit dem Handrücken über den Mund gewischt und ihrer Freundin Elena ins Ohr geflüstert: „Er hat!“
Gegenüber dem Kulturhaus reichte Nataschas Blick bis hinunter zur Wolga. Ein Fischerboot trieb aufs Ufer zu. Der Fischer versuchte mit aller Kraft den Köcher ins Boot zu hieven. Der Fisch zappelte im Netz, seine Flossen spritzten Wasserfontänen über das Boot, doch er verlor schließlich den Kampf. Wind kräuselte die Wasseroberfläche des angestauten Flusses, irgendwo bellte ein Hund, sonst lag Stille über dem Dorf. Ihr Dorf, das waren all die windschiefen Hütten, die Wege, auf denen man bei Regen bis über die Knöchel im Schlamm versank, die versteppten Wiesen, deren Stacheln die nackten Füße piksten, wenn sie als Kinder Fangen gespielt hatten. Das war auch die Wolga, in der sie mit ihren Freunden an heißen Sommertagen herumgetollt war. Und das waren die Menschen des Dorfes. Die verwitterten Frauen, die auf Bänken vor den Holzhütten saßen, während ihre zahnlosen Münder immer wieder denselben Tratsch durchkauten. Und die Männer, die abends zu ihren Treffpunkten verschwanden, wo sie die in Zeitungspapier eingewickelten Flaschen hervorholten und der Becher die Runde machte. Hier kannte Natascha alle, und alle kannten sie.
1 Schwesternstation (für einfache medizinische Hilfe)
2 Alte russische Anrede: Herr
3 Russ.: Hol’s der Teufel
4 Russ.: Lastwagen
5 Russ.: Nichtsnutz
6 Russ.: Verkleinerungsform von Minute
7 Russ.: Gott sei Dank
3.
Richard saß auf der vorderen Kante des Schreibtischsessels in seinem Büro im Neubau A3 des Institutes, spielte mit dem Bleistift und schaute abwechselnd zur Tür und dem Stapel Papier auf seinem Schreibtisch. Eben hatte Fräulein Kirschreuth die Ausdrucke aus dem Rechenzentrum gebracht, war beim Hinausgehen im Türrahmen stehen geblieben und hatte Richard zum wiederholten Male versichert: „Sie gönn ruisch Ilona zu mir sachn, Herr Dogdor.“
„Danke schön Ilona, Sie sind ein Schatz.“
Er hätte es bei dem Dankeschön belassen sollen, denn nun blieb Ilona an der Tür stehen, wohl in der Erwartung, dass dem Schatz-Kompliment noch weitere folgen. Sie zauberte ein Lächeln auf ihr sorgfältig geschminktes Gesicht, klapperte mit den Stöckelschuhen und machte keinerlei Anstalten, Richards Büro zu verlassen. Eigentlich eine hübsche Person, dachte Richard, warum fällt es mir so schwer, sie als Frau zu sehen und nicht immer nur als Assistentin? Wenigstens einen Kaffee hätte ich ihr anbieten sollen.
Doch beim Blick auf die Rechnerausdrucke schob Richard den Gedanken an einen Kaffee mit Fräulein Kirschreuth beiseite. Sein neues Computerprogramm wird endlich die Klärung bringen: Reicht die Energie aus, um das Proton vom Neutron zu trennen? Dann wären interessante Experimente zur Deuteronendesintegration möglich, hier an ihrem Institut, an ihrem Teilchenbeschleuniger! Wie bunt schillernde Seifenblasen stiegen seine Phantasien in die Luft.
Fräulein Kirschreuth strich eine Strähne ihrer blonden Haare aus dem Gesicht, hielt sich mit der anderen Hand am Türrahmen fest und intensivierte ihr Lächeln. Richard legte eine Hand auf den Papierstapel aus dem Rechenzentrum und bemühte sich um einen freundlichen Ton: „Vielen Dank noch mal Ilona, dass Sie so schnell gekommen sind. Wirklich nett von Ihnen. Ich habe mit Ungeduld auf die Ergebnisse gewartet.“
„War mir ein Vergnüchen. Dann mal tschüs, bis zum nächsten Mal, Herr Dogdor.“ Immer noch lächelnd drehte Ilona sich um und schloss leise die Tür. Zurück blieb ihr Duft. Ich werde sie irgendwann mal auf ein Glas Wein oder zu einem Kinobesuch einladen, dachte Richard, während er sich über das Endlospapier beugte. Zahlenkolonnen vom linken gelochten Rand der Seite bis ganz nach rechts, wo die Zahlen in die Löcher zu fallen schienen. Quer über jede Seite ein Wasserzeichen: Zentralinstitut für Kernforschung Rossendorf bei Dresden. Hastig arbeitete sich Richard durch den Papierstapel. Auf einer der letzten Seiten, unter schier endlosen Zahlenkolonnen – ein fettgedrucktes +53,22 MeV – Richard hielt einen Moment die Luft an, bis es aus ihm herausplatzte: „Ein positives Vorzeichen! Ja, es geht!“ Er erschrak über sich selbst. Hatte er das wirklich laut in den Raum geschrien und dabei den Bleistift zerbrochen, dessen Hälften er jetzt in den Händen hielt? Er lehnte sich im Schreibtischsessel zurück und griff zur Kaffeetasse. Richard – erst mal abschalten, ausnüchtern, das Chaos im Kopf sortieren, die Anspannung der letzten Tage abschütteln! Er steckte sich eine Pfeife an und verordnete sich Abstand von den Zahlen, die so schön waren, dass er sie hätte küssen können.
Nach dem Plakat mit dem Spitzbubengesicht kam der Aktenschrank mit der Spiegeltür. Sollte ich mir auch einen Bart wachsen lassen, fragte Richard sein Spiegelbild. Der könnte meinem etwas fettlastigen Gesicht etwas Kontur geben und das Doppelkinn kaschieren. Ein Vollbart würde auch die immer noch abstehenden Ohren kaschieren. Lärm von draußen unterbrach Richards Selbstbeschau. Vom Fenster aus sah er, wie ein Tieflader seine sperrige, von Planen verdeckte Ladung durch die enge Straße des Institutsgeländes manövrierte. Offensichtlich der Transport, der heute den Verkehrsstau auf der Straße von Dresden heraus zum Institut verursacht hat. Sogar in der „Sächsischen Zeitung“ hatte es gestern gestanden: Das Institut für Kernforschung bekommt einen neuen Magneten, Gewicht: zwanzig Tonnen, Durchmesser: über vier Meter. Die Dresdner fragten sich, wieso man für die Untersuchung dieser winzigen Atome solche Riesendinger braucht. Ohnehin war vielen Dresdnern das nah gelegene Institut nicht geheuer. Was machen die dort mit den Atomen? Etwa spalten? Wenn der Wind aus östlicher Richtung kam, schlossen sie die Fenster.
Richard stellte die Kaffeetasse ab, setzte sich wieder an den Schreibtisch und nahm sich die Rechnerausdrucke noch mal vor, verglich Zwischenergebnisse und prüfte die Energiebilanz. Soviel Zeit muss sein, mag Professor Sais-Mutlig, der die Ergebnisse nächste Woche in Tokio präsentieren will, noch so sehr zur Eile drängen. Ein verbales Plagiat müsste man Sais-Mutligs Präsentation nennen, wäre er nicht der Chef. Alle Arbeitsgruppen waren verpflichtet zu liefern. „Tokio wird ein Highlight, wir müssen Präsenz zeigen“, hatte Sais-Mutlig auf der letzten Besprechung getönt. Für ihn und einige Auserwählte mochte das stimmen. Für Richard und seinesgleichen war Präsenz nicht wörtlich gemeint. Tokio war für sie weiter weg als der Mond. Es gab eine rote Linie auf der Landkarte, die durfte nur überschreiten, wer würdig war. Gemeint war mit würdig – linientreu, eine Worthülle, scheußlich wie ihr Inhalt. Als Linienuntreuer, noch dazu Lediger, der keine Familie als Pfand zurücklässt, hatte Richard keine Chance, die rote Linie legal zu überqueren. Selbst wenn er vorgehabt hätte zurückzukommen.
Vor dem Fenster tauchte jetzt ein Autokran auf, der seinen Ausleger in den Himmel reckte. Die Befehle des Kranführers kämpften gegen den Motorenlärm an. Interessant wäre es schon, in Tokio Dr. Lippnik aus Karlsruhe zu treffen. Damals in Budapest, auf der Vorgänger-Konferenz, hatten sie nächtelang über Deuteronendesintegration diskutiert, und Lippnik hatte Richard zu einem Arbeitsbesuch nach Karlsruhe eingeladen. Leider war Karlsruhe für Richard genauso weit weg wie Tokio.
Jetzt hatten sie endlich den Magneten an den Haken genommen. Die Seile am Kranausleger strafften sich wie die Saiten einer Geige. Richard stopfte sich eine Pfeife und blies Ringe an die Decke. Wenn wir unsere Detektoren am Beschleuniger in Karlsruhe installierten – kein Problem, meinte Dr. Lippnik – könnte man die Lücke zwischen den beiden Energiebereichen schließen. Kein Problem? Hat der eine Ahnung! Noch nie etwas von der roten Linie gehört?
Auf dem Vorplatz war der erste Versuch schief gegangen. Wie ein überforderter Gewichtheber setzte der Kran den Magneten wieder ab. Richard öffnete das Fenster einen Spalt, die Rauchringe zerfaserten zu bizarren Gebilden. Zweiter Versuch. Jetzt schwebte der Magnet knapp über dem Boden. Langsam zog er eine Kreisbahn über den Vorplatz des Zyklotrongebäudes und setzte sich dann auf eine fahrbare Lafette. Der Kranarm schwenkte zurück. Die Seile hingen schlaff herab, die Männer nickten zufrieden. Richards Pfeife war kalt.
Das Telefon klingelte. „Ich warte auf Ihren Bericht für Tokio, Herr Doktor Claris?“ Wenn der Alte Herr Doktor sagt, war Eile geboten. Gewöhnlich sagt er einfach nur Claris. „Die anderen haben alle schon geliefert.“
Richard spürte etwas Pelziges auf der Zunge; es schien, auf seinem Kopf sträubten sich Haare, obwohl dort kaum welche waren. „Ja, Herr Professor, ich kontrolliere gerade die neuesten Berechnungen. Ich bringe Ihnen noch heute den Bericht vorbei.“
„Ich verlass mich auf Sie! Ich will mich in Tokio nicht blamieren.“
In Gedanken sah Richard den Professor am Schreibtisch sitzen und die Beiträge seiner Mitarbeiter zu einem mehr oder weniger homogenen Pamphlet zusammenschweißen. Am Ende wird er seinen Namen darunter setzen, seine Krawatte mittig ausrichten und voller Stolz dem Familienfoto auf dem Schreibtisch zunicken. Die Krawatte trägt er selbst dann, wenn er in dieser lächerlichen graugrünen Uniform auftritt, erdfarbene Hose mit Koppel, Jacke ohne Epauletten, Schirmmütze, schwere Stiefel. Erst gestern hatte Richard vom Fenster aus die zusammengewürfelte Truppe beim Trainingsmarsch durchs Institutsgelände beobachtet. Sais-Mutlig in der ersten Reihe, militärisch aufgemotzt, mit Gewehr über der Schulter. „Kampfgruppe der Arbeiterklasse“ – was war das eigentlich? Weder Polizei noch Armee, aber uniformiert und bewaffnet. Arbeiter war jedenfalls keiner von denen, die da unten im Gleichschritt zeigen wollten, dass … Ja, was eigentlich?
Richard übertrug die fett gedruckte Zahl aus dem Computerausdruck samt positivem Vorzeichen in seinen Bericht und klappte die Mappe zu.
Soll er sich feiern lassen in Tokio.
4.
Auf dem Weg zum Institutsparkplatz kam Richard an der Kantine vorbei. Wie die meisten Gebäude des Institutes im Stil der 50er Jahre gebaut, schnörkellos, solide, zweckmäßig. „Marcel Uhrig“ stand in Riesenlettern auf einem Plakat neben dem Eingang. In kleinerer Schrift darunter: „Die neue Realität in der Malerei“. Und noch kleiner: „Besuchen Sie unsere Ausstellung im Versammlungssaal“. Richard hatte keine Ahnung wer Marcel Uhrig war.
Neugierig geworden betrat er den Ausstellungssaal. Gleich am Eingang hing ein Steckbrief, der Richard darüber aufklärte, wer das war, Marcel Uhrig: Ein in Dresden wirkender deutscher Maler, der der sich besonders Porträt-, Alltags- und Landschaftsmotiven widmet. Und weiter stand dort, U. habe ein Gespür für die Symbolik zeitlich begrenzter und von Lebensrhythmen bestimmter Existenz.