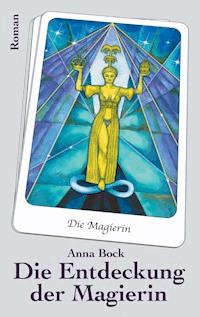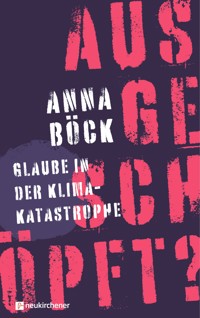
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neukirchener Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Klimakatastrophe ist längst keine Glaubenssache mehr: Wir befinden uns bereits mittendrin. Glaubenssache ist allerdings, was wir in, mit und gegen diese Weltlage machen, was wir erleben, fühlen und ertragen - davon ist Pfarrerin und Klima-Aktivistin Anna Böck überzeugt. Was bedeutet diese katastrophale Lage für unseren Glauben? Hat Gott uns angesichts der hoffnungslosen Aussicht noch etwas zu sagen? Wie kann Glaube uns tragen? In kurzen, in sich abgeschlossenen Texten geht sie diesen Fragen nach, verknüpft Aktuelles aus der Klimabewegung mit biblischen Bezügen und zeigt auf, wo christlicher Glaube und Klimakatastrophe sich treffen. Ihre Beobachtungen sind scharfsinnig und schonungslos, einladend und einfühlsam, inspirierend und motivierend, machen betroffen und rütteln uns zugleich aus unserer Kirchenbanklethargie auf. Die vielfältigen Gastbeiträge stehen dem in nichts nach und machen das Buch zu einem kollektiven Denkprozess der Generationen zum gegenwärtigen Zeitgeschehen. Es geht um Schöpfungsverantwortung und Schuld, Glaube und Gerechtigkeit, Kipppunkte und Klima-Angst und vieles mehr. Beim Lesen wird schnell klar, warum wir nicht glauben können, ohne uns mit der Klimakatastrophe auseinanderzusetzen. Ein Buch für alle, die nach Mut suchen, nach Antworten und nach neuen Impulsen für den eigenen Glauben. Mit Gastbeiträgen u.a. von Sarah Vecera (Klimagerechtigkeit), Walter Faerber (Weltuntergang), Anna-Lena Moselewski (Vorsätze), Heiko Metz (Wald, Schutzraum), Vincent Kühn (Glaube), Daniel Hufeisen (Schalom), Ronja Künstler (Straße), Micha Kunze (Die Abschaffung des Menschen) sowie einem Geleitwort von Jesuitenpater Jörg Alt "Für Anna Böck sind Glaube und der aktive, wissenschaftlich fundierte Einsatz für das Klima untrennbar miteinander verbunden. Zu lesen, wie ihr Glaube gerade angesichts des Klimanotstands handlungsleitend wird und damit konkrete Lebensrelevanz gewinnt, ist nicht nur erhellend und kurzweilig, sondern auch zutiefst ermutigend." (Friedrich Kramer, Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G
von Jörg Alt
Warum kann eine Pfarrerin Klimaaktivistin sein? Warum ist ein Buch, das sie über ihre Erfahrungen schreibt, lesenswert?
Zunächst einmal gehören die Bilder und Erzählungen der Religionen zum Wirkmächtigsten und Handlungsleitenden, das die Menschheit in ihrer Geschichte kennt. Nehmen wir die beiden Schöpfungsgeschichten: Jahrtausendelang dominierte die erste Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1, während die zweite Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 2 weitestgehend unbekannt war. Die hymnische Komposition der ersten Schöpfungsgeschichte gipfelt in der Erschaffung des Menschen und Gottes Auftrag an ihn, den Luther wie folgt übersetzt: „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ Dieses Bild vom Menschen als Krone der Schöpfung, den Gott als Herrscher über die Erde eingesetzt hat, war natürlich schmeichelhaft und setzte sich in den Köpfen fest; eine Wirkungsgeschichte dieses Menschenbilds kann von der Bibel über die Renaissance, den englischen Liberalismus bis hin zum heute herrschenden Neoliberalismus und dem Menschen als Homo Oeconomicus nachgezeichnet werden. Wir alle wissen/ahnen heute, wie fatal dieses Menschenbild ist und in welche Schwierigkeiten es uns gerade bringt.
Umso wichtiger ist es, dass Pfarrpersonen und Theolog*innen alles nur Mögliche daransetzen, dieses zunehmend todbringende Bild durch ein lebensdienlicheres in den Köpfen und dem Handeln der Menschen zu ersetzen: eben den Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, der den Menschen nicht als Krone, sondern integralen Bestandteil der Schöpfung darstellt, dem Gott den Auftrag gibt, wie ein sorgfältiger Gärtner gut und verantwortungsvoll für seine Schöpfung zu sorgen.
Und damit sind wir schon beim Klimaengagement von Pfarrpersonen. Um Verkündigung so glaubwürdig wie möglich zu machen, ist Kompetenz wichtig: zunächst die Kompetenz, von der man annimmt, dass sie durch das Theologiestudium erworben wird, zum anderen die angelesene Kompetenz durch die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Fakten hinter der Klimakatastrophe und schließlich durch die Kompetenz, die man als Seelsorger durch zahllose Gespräche mit Menschen gewinnt, in deren Verlauf man deren Sorgen und Nöte kennenlernt.
Wer aber die Fakten hinter der Klimakatastrophe kennt und versteht, weiß, dass es nicht länger ausreicht, nur zu predigen oder Bücher zu schreiben – man muss sich auch in Formen engagieren, die dem Ernst der Lage angemessen sind: Dazu kann auch gehören, zivilen Ungehorsam zu unterstützen oder sich daran zu beteiligen. Solch ein provozierend-störendes Verhalten ist nichts, wofür sich eine Pfarrperson schämen müsste – gibt es doch in der Heiligen Schrift in den Gestalten der Prophet*innen große Vorbilder für ein solch provozierend-anklagendes Verhalten. Oder Jesus, der die Not des leidenden Menschen höher wertet als das ansonsten strenge Gebot der Sabbathruhe. Oder in der christlichen Tradition durch Martin Luther King.
Wenn also jemand, der sowohl theologisch-naturwissenschaftliche Kompetenz als auch eine – wie ich finde – zeitgemäße Form prophetischen Handelns praktiziert, ein Buch zur Klimakatastrophe und zum „Klimaglauben“ schreibt, kann man sicher sein, durch die Lektüre gut durchdachte und inspirierende Impulse zu erhalten, die helfen können, die eigene Einstellung zu Bibel, Wissenschaft und Klimaprotest zu durchdenken. Deshalb wünsche ich diesem Buch viele aufmerksame Leser*innen.
Ich bin im Gespräch mit einer Bischöfin und erzähle von mir. Ich bin Anna, aufgewachsen in Württemberg und entsprechend pietistisch geprägt. Ich arbeite für einen Arbeitgeber, der eine ähnliche Herkunft hat, nur am Niederrhein. Ich bin Pfarrerin und Klimaaktivistin. Die Bischöfin meint völlig erstaunt: „Da haben Sie aber einen weiten Weg hinter sich!“ In ihrem Kopf passt die Klimaaktivistin nicht zu meiner frommen Herkunft. Aber doch. Genau da passt sie hin! Und weil nicht nur eine Bischöfin das anders sieht, sondern mir sehr oft Unverständnis begegnet, schreibe ich dieses Buch.
Glaube und Klima gehören zusammen. Das eine ergibt sich aus dem anderen und das andere aus dem einen. Immer wieder sehe ich Parallelen zwischen Gemeinde und Klimabewegung, zwischen meinem Glauben und den Gedanken, die ich mir um die Zukunft dieser Welt mache. Wenn mein Glaube sich nicht mit meiner Realität konfrontieren lässt, ist er nichts wert. Die Klimakatastrophe ist und wird immer mehr unsere Realität. Also gehe ich in diesem Buch der Frage nach, wie Glaube und Klima miteinander in Wechselwirkung sind. Dieses Buch will ein Fenster öffnen für Christ*innen, die mehr über Klimakatastrophe und Klimaaktivismus wissen wollen. Wenn das Buch auch andersherum zum Fenster für Klimaakivisti wird, die G*tt kennenlernen, die ihre Verzweiflung mitaushält und teilt, habe ich mehr erreicht, als ich wollte.
Das Buch ist eine lose Blattsammlung meiner Gedanken, die im Austausch mit guten Freund*innen stehen, die ihren kleinen Beitrag beigesteuert haben. Es kann von vorne nach hinten gelesen werden, ist aber auch zugänglich, wenn man sich die Themen herauspickt, die einen gerade besonders bewegen.
Das Buch ist eine Mischung meiner Erfahrungen und Einsichten als Klimaaktivistin, die glaubt, und als Pfarrerin, der die Erde nicht egal ist. Sie sind sicher nicht erschöpfend. Ich verstehe sie mehr als Einstieg in eine Diskussion, die ich mit euch führen möchte. Kommt dafür gerne mit mir ins Gespräch. Schreibt mir auf SocialMedia (@pfarrertogo)! Ladet mich zu Lesungen und Workshops ein!
Hat G*tt ihr Potential bei der Schöpfung ausgeschöpft? Haben wir es in der Gestaltung unserer Welt getan? Was ist eigentlich noch möglich auf einem Planeten, der sich rasant verändert? Ich frage nach der Schöpfung, ihren Grenzen und meinem Glauben.
Im Normalfall werde ich in diesem Buch das Gender* verwenden. Sollte ich das Maskulinum Plural verwenden, kann es tatsächlich sein, dass ich über eine Menschengruppe spreche, die nur aus Männern besteht. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich einfach vertan habe. Auch in meinen Genen stecken Jahrtausende des Patriarchats. In der Klimabewegung wird mit einem i am Ende gezeigt, dass alle mitgemeint sind. Bei spezifischen Begriffen aus der Szene verwende ich deshalb diese Form: Aktivisti, Polizisti, Richteri …
G*tt lässt sich keinem Geschlecht zuordnen, weswegen ich sie mit * schreibe und ihr weibliche Pronomen gebe. Unsere patriarchal geprägten Ohren zucken dann jedes Mal zusammen und stutzen. Das innerliche Stolpern wird so jedes Mal zu einer kleinen Erinnerung, das eigene Bild der Schöpferin nicht zu fest zu klopfen. Auch hier entschuldige ich mich für maskuline G*ttesbezeichnungen, die mir dazwischen gerutscht sein könnten.
Den Gastbeiträger*innen habe ich es freigestellt, wie sie diese Dinge handhaben. Gerade bei poetischen Texten ergibt manchmal ein anderer Umgang mit Sprache Sinn.
In diesem Buch geht es auch ab und zu um die „Letzte Generation vor den Kipppunkten“. Seit Januar 2025 bezeichnen wir uns nicht mehr so. Dennoch stehen die Aktionen, Straßenblockaden und Gerichtstermine, um die es in diesem Buch gehen wird, mit dem Bewegungsnamen in Verbindung, weswegen ich die Bewegung dann weiterhin so bezeichne. Manchmal auch verkürzt als Letzte Generation. Dennoch ist es wichtig und kommt auch in diesem Buch vor, dass wir mit diesem Namen nicht der Hoffnungslosigkeit Raum geben (nach uns kommt niemand mehr), sondern die Wahrheit benennen, dass die Kipppunkte, die das Klima sehr radikal verändern werden, teilweise schon überschritten sind und nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Dieses Buch entstand hauptsächlich im RE5 von Koblenz nach Duisburg oder andersherum. In eineinhalb Jahren Fernbeziehung und seither in umgedrehter Richtung zu meinem Arbeitsplatz an den Niederrhein habe ich eine Hassliebe zum RE5 entwickelt. Selten hat alles funktioniert. Meist gab es keine funktionierende Toilette und ich habe den Anschluss in Koblenz verpasst oder der RE5 drehte vor Koblenz um und ließ mich in Koblenz eine Stunde auf den nächsten warten. Und dennoch: Die Bahn ist ein wichtiger Baustein in einer klimaneutralen Welt. Ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr ist unverzichtbar, wenn wir Individualverkehr abbauen wollen. Lieber RE5, du kannst nichts für ein marodes Schienennetz. Du stöhnst und zuckelst halt auf alten Gleisen mit deinen kaputten Türen und Toiletten. Dabei bringst Du mich zur Arbeit oder zu meinem Lieblingsmenschen. Irgendwann bin ich noch immer angekommen. Dir ist dieses Buch gewidmet – dir und all den Fußballfans, Karnevalist*innen, Pendler*innen, Familien, Musiklauthörenden, Türblockierer*innen … kurz: allen, die dich und die Öffis brauchen, hassen, lieben und ihnen treu bleiben.
Schöpfung
Ich laufe gerne barfuß. Also eigentlich fast immer: in der Stadt, auf dem Land, am Bahnhof und auf dem Autobahnparkplatz (auf dem ich eher selten bin). Ich habe extra flache Pedale am Fahrrad und wenn ich doch mal am Steuer eines Autos sitze, dann auch meist ohne Schuhe.
Man läuft nicht barfuß in unserer Gesellschaft. Es verstößt gegen den Arbeitsschutz und das allgemeine Wohlbefinden von Menschen (allerdings nicht direkt gegen die StVO). So wird mir oft ungefragt und sehr deutlich gesagt, was Menschen davon halten: Das wäre zu kalt, eklig, gefährlich … Am besten fand ich die Person, die mir ungefragt erklärte, dass sie vom Hingucken eine Blasenentzündung bekommen würde, um sich direkt im Anschluss vor mir eine Zigarette anzustecken. Dass sie damit auch mein Risiko auf Lungenkrebs tatsächlich erhöht hat und ihre Blasenentzündung reine Fantasie war, schien ihr nicht aufzufallen. Aber es gibt auch die anderen, die mir ungefragt sagen, wie toll ich doch sei und man laufe ja auch barfuß, in der Wohnung und im Garten. Für RTL durfte ich einmal barfuß durch eine grüne Wiese laufen, um deren Klischee einer grünen Aktivistin bildlich Rechnung zu tragen.
Barfuß ist verbunden mit der Vorstellung einer heilen Natur. Barfuß ist cool, aber bitte nicht im echten Leben. Ganz ehrlich: Ja, ich mache das, weil ich mich dadurch mehr verbunden mit meiner Umgebung fühle und weil ich mich selbst besser spüre. Aber ich mache das nicht, weil ich so naturverbunden bin.
Denn was bedeutet eigentlich „naturverbunden“? Was ist Natur? Nur unberührte Urwälder (Spoiler, die gibt es in Europa nur noch ganz selten) oder die gewerblich angelegten Forste neben dem Wohngebiet? Was aber ist denn nicht Natur auf dieser Welt? Oder frommdeutsch gesagt: Was ist nicht von G*tt geschaffen?
Wir leben, als gäbe es zwei Bereiche: Natur und Zivilisation. Im Märchen von Hans Christian Andersen „Des Kaisers Nachtigall“ ersetzt eine künstliche Nachtigall eine echte. Das ist doch ein Unterschied, wer dem Kaiser sein Lied singt! Ja, aber beide sind nur deshalb da, weil G*tt diese Welt geschaffen hat. Sie hat alle Materialien der künstlichen Nachtigall geschaffen und Menschen Ideen gegeben, wie sie das Tier konstruieren können. Natur ist das Ökosystem, in und von dem wir leben. Wenn wir dazwischen unterscheiden, entfremden wir uns davon, dass wir in einem ökologischen System leben, von dem wir abhängig sind. Dann ist die Natur nur noch der Wald, in den ich gehe, um Bäume zu umarmen. Mit Tamburinen über Wiesen laufend. Dann ist Schöpfung nur noch ein Bild wie in einer bunten Kinderbibel, auf dem zwei Nackedeis bei Sonnenschein durch einen Wald voller Tiere laufen und weltfremd lächeln. Übrigens sind wir Menschen auch nicht die Krone der Schöpfung. Das steht zumindest nicht in der Bibel. Wir wurden am sechsten Tag zusammen mit den Tieren geschaffen. Abgeschlossen und „gekrönt“ wird die Schöpfung eher durch die Ruhe des siebten Tages. Wir sind vielleicht nach G*ttes Bild geschaffen, aber dann sollten wir uns auch fragen, ob wir sie wirklich immer so toll widerspiegeln.
Wenn ich aber mich selbst und die Menschheit als Teil der Schöpfung und des Ökosystems Natur verstehe, dann hat Schöpfung auch mit mir zu tun, wenn ich in Essen im Stau stehe. Wir leben nicht auf der Erde, wir leben von ihr. Wir sind Natur. Wir gestalten Natur. Wir tun das sehr effizient, wesentlich effizienter als irgendein anderes Lebewesen, das in die Natur eingreift, und das könnte unser Verhängnis werden.
Deswegen ist es gut, dass wir den Auftrag bekommen haben, G*ttes Schöpfung zu bewahren. Das wiederum tun wir eher weniger effizient. Aber genau das ist Schöpfungsspiritualität! Ich muss dafür nicht Bäume umarmen, ich kann für sie auf die Straße gehen. Schöpfung bewahren kann auch heißen, Errungenschaften der Zivilisation zu bewahren: Ich mag Städte, Kinos, Theater, Freizeitparks, Schwimmbäder und so vieles mehr eigentlich auch ganz gern. Wie können wir das alles schön, nachhaltig und für alle lebenswert erhalten?
G*tt hat uns so geschaffen, dass wir ordentlich was gestalten und reißen können. Wir haben das Impfen erfunden und den Staubsauger (habt ihr schon einmal einen Teppich ausgeklopft?). Wir können die coolste Musik machen, die unsere Herzen zutiefst berührt, und sind fähig, spannende Geschichten zu erzählen. Das zu bestaunen, ist Schöpfungsspiritualität. Zu G*ttes Schöpfung und ihren Folgen gehören aber auch viele Dinge, die uns kaputt machen. Manchmal zeigt sich das ganz direkt. Wir haben Konflikte und Waffen, um uns zu bekämpfen. Manchmal geschieht das auch indirekt. Wir können sehr bequem weite Strecken überwinden, zerstören dabei aber G*ttes Schöpfung. Wir genießen das kühle Bier am Abend, kommen davon aber nicht mehr los. Wir belohnen uns mit einer Shoppingtour, verursachen dabei aber sehr viel Leid bei den Näherinnen, die unsere Kleidung herstellen. Hier heißt Schöpfungsspiritualität, mein Scheitern anzuerkennen und meinen Teil beizutragen, dass die Zerstörung aufhört. Wo sind die schöpfungsspirituellen Bußg*ttesdienste?
Im Gegensatz zur Natur habe ich bei der Schöpfung eine konkrete Adresse, von der wir Menschen diese Schöpfung mit allem bekommen haben. Ein riesengroßes Geschenk G*ttes für ihre Schöpfung ist: ihre Schöpfung. Schöpfungsspiritualität ist die Frage, was ich mit diesem Geschenk mache. Es ist ein Geschenk und wir sind frei, es in Ehren zu halten oder es zu zerstören. Diesen Grund, sich gegen die Klimakatastrophe zu stemmen, haben nicht alle Menschen, aber er gibt mir Kraft, mich umso mehr für dieses große Geschenk einzusetzen, das wir bekommen haben. Ich versuche, mir abzugewöhnen, Christ*innen im Vergleich mit anderen besser abschneiden zu lassen. Wir Christ*innen sind nicht automatisch die angenehmeren, moralisch besseren Menschen, die nie einen Fehler machen. Aber in dem Fall habe ich als Christin tatsächlich einen Grund mehr, mich für die Erde einzusetzen. Für Menschen, die nicht glauben, ist es vielleicht unterm Strich egal, warum wir uns für die Erde einsetzen. Hauptsache, wir tun es!
G*ttes Schöpfung ist nicht nur grün und lebenssprühend. G*ttes Schöpfung ist auch im Tagebau, der Lützerath und viele andere Dörfer ersetzt hat. Ihre Schöpfung ist im Stau, der mich nicht zu meinem Termin bringt, und im Asphalt, der im Sommer so heiß wird, dass ich Schuhe anziehen muss. Das muss ich übrigens auch meistens im Wald, weil Waldboden ganz schön weh tun kann.
Die Abschaffung des Menschen (Micha Kunze)
Grenzen & Ziele
In diesem Buch schreibe ich sehr wenig über die konkreten Probleme der Klimakatastrophe. Das können andere viel besser und haben es auch schon getan. Deswegen gibt es in den Buchdeckeln einige sehr griffige Schaubilder, die verdeutlichen, worüber wir eigentlich reden. Fakt ist: Spätestens im letzten Jahrhundert hat die Menschheit festgestellt, dass wir mit unserem Lebensstil so nicht weitermachen können. Das Klima wird exponentiell wärmer, wie man an den „climate stripes“ sehen kann, einem Schaubild, das der Durchschnittstemperatur eines Jahres einen Blau- bzw. Rotton zuordnet und das in den letzten Jahren immer röter wird.1 Der Planet hat Grenzen. Die Hauptgrenzen sind die sogenannten planetaren Grenzen.2 Sie sind ein von Klimawissenschaftler*innen entwickeltes System, das einschätzt, ob das Ökosystem Erde sich in einem sicheren Rahmen weiterentwickeln kann. Wie man auf dem Schaubild sieht, sind diese Grenzen zu großen Teilen bereits jetzt überschritten. Überschrittene planetare Grenzen führen zu Kipppunkten. Kipppunkte sind irreversibel. Also die großen Meeresströmungen, Gletscher oder Waldflächen werden soweit zerstört, dass sie sich nicht wieder regenerieren können. Damit verändert sich das gesamte Klima der Welt in einer Art und Weise, die keine Wissenschaftler*innen mehr voraussagen können.
Mit Grenzen ist das so allgemein eine Sache. Es gibt sichtbare Grenzen, die aufgezogen werden, weil Menschen sich von anderen Menschen bedroht fühlen. Dann gibt es unsichtbare Grenzen, die Menschen für sich haben. Weil man diese eben nicht sieht, gehen andere gerne bewusst und unbewusst über diese Grenzen hinweg. Oft sind ältere Menschen sehr erstaunt, wenn ich die Grenzen meiner Bonuskinder auslote und mir verbitte, dass diese einfach so angefasst werden. Grenzen schützen und grenzen aus. Manchmal beides gleichzeitig. Auch G*tt setzt immer wieder Grenzen in der Bibel. Da ich G*tt unterstelle, dass sie gut ist, wird sie nie unbegründet Menschen eingrenzen. So hat G*tt auch dieser Welt und damit uns Menschen im Umgang mit der Welt Grenzen gesetzt. Warum sie das getan hat, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es meine Aufgabe ist, diese Grenzen zu respektieren aus ganz egoistischen Gründen: Ich möchte, dass das Leben in G*ttes Schöpfung lebenswert bleibt, auch für die Kinder meiner Bonuskinder.
So ähnlich hat die Weltgemeinschaft auch gedacht und die UN hat 17 Nachhaltigkeitsziele3 entwickelt, die wir verfolgen sollten, um die Klimakatastrophe zu einem Ding der Vergangenheit erklären zu können. Seit 2016 definieren sie, wie die Reise zu einem stabilen Ökosystem Erde gelingen kann. Das mag alles sehr vereinfacht klingen, ist aber der Überbau für 169 kleinere Einzelziele mit dem Bewusstsein für Zielkonflikte. Ziele sind noch nicht Wirklichkeiten. Bei Zielen denken wir an eine Rennstrecke, die mit einer schwarz-weiß-karierten Ziellinie endet. Meist verschieben sich bei großen Zielen die Strecke und das Ziel unterwegs. Man hangelt durch ungeahnte Täler und bekommt zwischendrin eine Oase zum Ausruhen geschenkt.
Auch in der Bibel gibt es Ziele. Josefs Brüder haben ein Ziel mit ihm. Am Ende seines Lebens zieht Josef Bilanz: „Ihr hattet Böses für mich geplant. Aber Gott hat es zum Guten gewendet.“ (1. Mose 50,20)G*tt hat wohl etwas mit unseren Plänen und Zielen zu tun. Sie lässt sich von falschen Zielen nicht beeindrucken, sondern verfolgt ihre eigene Agenda mit dieser Erde. Ich vertraue darauf, dass sie ihr Ziel mit uns Menschen nicht aus dem Blick verliert. Aber ich habe auch meinen Anteil daran: Ich lese die Bibel mit der Frage danach, was G*tt für diese Welt will. Ich sehe, wie wir G*ttes Werk kaputt machen und bin mir sicher, dass das nicht G*ttes Ursprungsidee war. Paulus beschreibt den Lauf auf ein Ziel zu:
„Ich möchte nicht behaupten,
dass ich das alles schon erreicht habe
oder bereits am Ziel bin.
Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen.
Denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen.
Brüder und Schwestern,
ich bilde mir wirklich nicht ein,
dass ich es schon geschafft habe.
Aber ich tue eines:
Ich vergesse, was hinter mir liegt.
Und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt.
Ich laufe auf das Ziel zu,
um den Siegespreis zu gewinnen:
die Teilhabe an der himmlischen Welt,
zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat.“
(Philipper 3,12-14)
Das nennt man theonome Reziprozität: Das Ziel, eine himmlische Welt zu erreichen, ist eine wechselwirkende (reziproke) Gemeinschaftsaufgabe der Menschheit und G*ttes, aber theonom heißt, dass die Schöpferin am Ende die Fäden in der Hand hat. Und ja, ich glaube, dass ein gesundes Ökosystem, eine lebenswerte Erde und eine Beachtung der Grenzen in G*ttes Schöpfung schon ganz viel himmlische Welt ist, von der in der Bibel die Rede ist.
1 https://showyourstripes.info/s/europe/germany/all (zuletzt abgerufen am 13.2.2025).
2 https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit/integriertes-umweltprogramm-2030/planetare-belastbarkeitsgrenzen (zuletzt abgerufen am 13.2.2025).
3 https://sdg-portal.de/de/ (zuletzt abgerufen am 13.2.2025).
Heimat
Während ich dieses Buch schreibe, ziehe ich um – mal wieder, um genau zu sein, je nach Zählung, an meinen 12. neuen Lebensmittelpunkt. Dopplungen und Umzüge innerhalb einer Stadt habe ich mal bewusst übersprungen. Ich bin also die ungeeignetste Person, um dieses Kapitel zu schreiben. Ich habe offenkundig keine Ahnung, was Heimat ist. Anders geht es Menschen, die ich sehr schätze und deren Erfahrung ich nicht einfach kleinreden kann. Sie sind irgendwo verwurzelt. Sie erleben Halt, tanken auf, wenn sie zuhause sind. Dort ist ihnen alles vertraut. Sie kennen die Regeln. Sie verbinden gute Erinnerungen mit ihrer Heimat. Ihre Heimat lässt sie aber auch wieder los, wenn sie gehen müssen. Ihre Heimat verändert sich immer wieder. Manchmal nehmen sie das belustigt, manchmal traurig wahr. Aber es bleibt ihre Heimat. Sie gibt ihnen Beständigkeit. Ich gebe zu: Ich bin sehr neidisch auf diese Form der Heimat!
Aber ich bin erst einmal skeptisch, wenn jemand von Heimat spricht. Mir ist zu oft ein Heimatbegriff begegnet, der mich einengen, ausschließen und auf jeden Fall mir etwas vorschreiben wollte. Diese Form der Heimat klingt so:
Das haben wir schon immer so gemacht!
Das klappt bei uns sowieso nicht!
Sie sind nicht von hier!
Die haben uns verraten und verlassen!
Die passen hier nicht hin!
Früher war alles besser!
Uns wird vorgeschrieben, wie Heimat ist: Natur, Bergketten mit Wäldern, Heidi, Volksmusik, bürgerliche Küche (ganz schlecht für Vegetarier*innen) und Trachtenkleider. Ja, sagst du jetzt vielleicht, das ist halt ein Klischee. Aber ohne Scheiß: Ich habe einmal einen Konfijahrgang mit sehr coolen Fußballmädels begleitet. Ich war nicht die Pfarrerin vor Ort, weswegen ich manchmal nicht so viel Einfluss hatte. Nebenbei erfuhr ich, dass zu Erntedank die Konfis in Tracht in die Kirche einziehen. Meine Mädels waren wenig begeistert und ich habe versucht, sie zu schützen. Am Ende wurden sie so sehr belabert, dass sie es gegen ihr eigenes Wohlbefinden doch gemacht haben.
Weil aber diese oben genannten Äußerlichkeiten nicht mehr tragen, verbindet sich Heimat mit falschem Lokalpatriotismus, literweise Alkohol und viel Fleisch. Nicht nur an Volks- und Stadtfesten, Kirchweihen oder im Tourismus begegnet uns so ein Bild, auch beim Leistungssport wird ein solches Heimatbild tradiert.
Warum werden solche lächerlichen, völlig verdrehten Heimatbegriffe geprägt? Sie sind das Deckmäntelchen für ganz andere Dinge: toxische Maskulinität, Rassismus und Abschiebeträume, Windkraft-Gegnerschaft und vor allem Beharrungskräfte. Wenn das Label Heimat drauf ist, muss man Verständnis zeigen.
Lustigerweise finden wir in der Bibel eine sehr klare Vorstellung, was Heimat ist. Sie hat nichts mit Lokalpatriotismus zu tun. Im Gegenteil. Die Geschichte vom Volk Israel ist eine Fluchtgeschichte. Immer wieder erinnert man sich gegenseitig daran, dass man selbst heimatlos war. Wenn wir in Deutschland über Geflüchtete sprechen, haben sehr viele Menschen scheinbar vergessen, dass ihre direkten Vorfahren im Krieg sich auf den Weg gemacht haben. Und auch wir Menschen sind ganz schön viel auf der Flucht: vor der Wahrheit, vor uns selbst, vor unseren Ängsten … dafür muss man sich nicht einmal viel bewegen. Der Gedanke, dass man selbst bzw. die Vorfahren einmal auf der Flucht waren, wird bei G*tt aber noch eine Runde weitergedreht, so betet jemand:
Hör mein Gebet, Herr!
Öffne dein Ohr für meinen Hilfeschrei!
Schweig nicht zu meinen Tränen!
Denn ich bin doch ein Gast bei dir.
Ich bin ein Fremder unter deinem Schutz
wie alle meine Vorfahren. (Psalm 39,13)
Die Identität des Betenden ist nicht jemand, der seine Umgebung besitzt, wie man eine Heimat besitzt (Heimat gibt es eigentlich nur mit Possessivpronomen, meine Heimat, deine Heimat usw.). Er ist sehr demütig und stellt sich als Heimatloser dar, der bei G*tt Gast sein möchte. Er sucht nichts Dauerhaftes; eventuell nur einen Ort, um kurz zu verschnaufen. Im Philipperbrief wird dann die Heimat bei G*tt verortet:
Wir dagegen haben schon jetzt ein Bürgerrecht im Himmel.
Von dort erwarten wir auch den Retter. (Philipper 3,20)
Solange wir also bei G*tt sind, haben wir Bürger*innenrecht. Wer Bürger*innenrecht hat, darf seine Umgebung Heimat nennen (auch wenn andere dir das absprechen wollen). Ich verstehe das durchaus nicht erst im Jenseits. Schon hier kann ich bei G*tt sein. Der Himmel verortet sich nicht irgendwo zeitlich und örtlich weit entfernt. Zumindest deutet wohl Jesu Rede vom Reich G*ttes und das Bild eines himmlischen Jerusalems, das zur Erde kommt, so etwas an (mehr dazu in späteren Kapiteln). Ich brauche für mein Heimatgefühl keinen bestimmten Ort, andere schon. Ich halte es da eher nach einer Gruppe auf dem guten alten StudiVZ, die zum geflügelten Wort geworden ist: „Heimat ist da, wo sich das Handy automatisch mit dem WLAN verbindet.“ Oder in meiner Version: „Heimat ist da, wo ich meinen Kaffee aus einer hellblauen Tasse trinke.“
Vielfalt