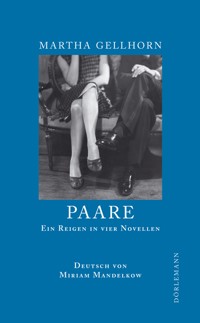14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich sehe Hemingway ab und zu ... Er ist ein komischer Kauz, sehr liebenswert, voller Verve und ein glänzender Geschichtenerzähler. (Bei einem Schriftsteller ist das Phantasie, bei allen anderen Lüge. Das nennt man Genie.) Also sitze ich da und habe gerade das Ms. zu seinem neuen Buch gelesen und gebe dazu furchtbar kluge Dinge von mir; anderer Leute Bücher zu beurteilen, ist ein Kinderspiel, das eigene eine Qual.«Martha Gellhorns Karriere als Kriegsreporterin führte sie an die vorderste Front praktisch jedes bedeutenden internationalen Konflikts, vom Spanischen Bürgerkrieg bis zum Ende des Kalten Kriegs. Sie war in jeder Hinsicht eine leidenschaftliche Frau, so lebte und so schrieb sie. Die liebevollen Briefe an ihre Freunde geben Zeugnis vom intensiven Leben der Schriftstellerin, die stets das harte Leben suchte und doch fast daran zerbrach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Martha Gellhorn
Ausgewählte Briefe
Herausgegeben von Caroline Moorehead
Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow Mit einem Nachwort von Sigrid Löffler
DÖRLEMANN
Die Originalausgabe »Selected Letters of Martha Gellhorn« erschien 2006 bei Chatto & Windus, London. Eine Zeittafel zu Martha Gellhorns Leben und Werk findet sich auf www.marthagellhorn.com. eBook-Ausgabe 2012 Deutschsprachige Erstübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2006 by The Estate of Martha Gellhorn © 2009 by Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Fotografie von Lee Miller: Martha Gellhorn, London 1943, (Ausschnitt), © Lee Miller Archives Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN epub 978-3-908778-10-3www.doerlemann.com
Martha Gellhorn
Die Anfänge 1908–1936
Martha Gellhorn wurde am 8. November 1908 in St. Louis, Missouri, geboren. Ihr Vater, Dr. George Gellhorn, Sohn eines Kaufmanns aus Breslau, war ein bedeutender Frauenarzt und Geburtshelfer, Spezialist für Krebs und Syphilis, der seine Ausbildung in Krankenhäusern in Berlin und Wien erhalten hatte, bevor er um die Jahrhundertwende nach Amerika auswanderte. Ihre Mutter, Edna Fischel, war eine in ihrer Geburtsstadt St. Louis sehr beliebte Frauenrechtlerin. Beide hatten einen jüdischen Elternteil. Martha hatte zwei ältere Brüder: George, 1902, und Walter, 1904 geboren. Ein dritter Sohn, Alfred, folgte 1913. Die Familie war eng verbunden, wohlhabend und glücklich – und glückliche Kinder, pflegte Martha zu sagen, haben wie glückliche Familien keine Geschichte.
Als Martha zwölf war, unterstützten die Gellhorns die Gründung einer – nach dem Naturforscher John Burroughs benannten – fortschrittlichen gemischten Ganztagsschule, um ihren beiden Jüngsten eine interessantere und modernere Erziehung angedeihen zu lassen, als die konventionelleren Schulen von St. Louis boten. Als Martha aufs College Bryn Mawr ging, schrieb sie bereits Gedichte und Kurzgeschichten für die Schülerzeitung und war sowohl Schulsprecherin wie Vorsitzende des Theaterclubs gewesen, zwei Ämter, die ihr nach eigenen Angaben Führungspositionen schmackhaft gemacht hatten. Martha fühlte sich ihrem Vater nah, sie bewunderte ihn und stritt mit ihm, ihre tiefe Liebe jedoch galt ihrer Mutter, die stets ihr »wahrer Norden« blieb, ihre feste Orientierung und bedingslose Liebe bis zu Ednas Tod im Alter von 91 im Jahre 1970. Der erste Brief in Marthas Archiv ist an ihre Mutter gerichtet, geschrieben im Alter von sechs Jahren. »Liebe Mutter. Du bist so hübsch. Mutter, ich liebe Dich. Ich finde, Du bist so nett zu mir.« Die Zuneigung beruhte auf Gegenseitigkeit. Als Martha aufs College ging, schrieb George ihr: »Sie liebt Dich so, daß es mich schmerzt.«
Bryn Mawr und das Collegeleben lagen Martha nicht, und sie gab sich wenig Mühe damit. Durch Nachlässigkeit fiel sie bei einer Reihe von Prüfungen durch, und obwohl sie die folgenden ohne weiteres bestand, war ihr so langweilig, daß sie das College ohne Abschluß verließ. Dennoch hatte sie in Bryn Mawr gelernt, wie aufregend intensive Arbeit sein konnte und welche Zuflucht sie bot, und sie hängte sich Franç0is Mauriacs Maxime über den Schreibtisch: »Travail: opium unique.« Ihr Leben lang beschwor sie diese Worte sich selbst und Freunden gegenüber. Arbeit war Marthas Schlupfloch und ihre Pflicht, dorthin zog sie sich in schwierigen Zeiten zurück. Außerdem hatte Bryn Mawr ihr eine Freundin beschert und – nach den Eltern – ihr zweites Vorbild für eine glückliche Ehe. Hortense Flexner, eine heute kaum noch gelesene, in den 1930er Jahren jedoch bewunderte Dichterin, war Marthas Englischlehrerin gewesen. Sie fingen an, einander zu schreiben, und führten ihren Briefwechsel fort bis zu Hortense’ Tod vierzig Jahre später. Marthas Anrede für sie lautete »Leererin«, und sie unterschrieb mit »Gellhorn«. Sie sagte, die Leererin sei ein Sinnbild an »Ausdauer, Mut und Lebensfreude«, Tugenden, an die sie glaubte.
Als Martha siebzehn war, zeigte Dr. Gellhorn seinen Kindern Deutschland, ein Besuch, der mit weiteren Familienreisen nach Europa in ihr den Wunsch weckte, dorthin zurückzukehren. Nach Bryn Mawr berichtete sie als Volontärin für die Albany Times Union über Frauenclubs und die Schutzpolizei, und als das Volontariat nach einem halben Jahr um war, wußte Martha, daß es Zeit war, Amerika zu verlassen. Sie war einundzwanzig, rastlos, ungeduldig und voller Neugier. Als sie aufbrach, überraschte es niemanden.
Kurz nach Weihnachten 1929 gab Edna ihrer Tochter das Geld für eine Fahrkarte nach New York, dort schiffte sich Martha beim Germanischen Lloyd ein, wo sie für ihre Überfahrt mit einem Artikel über dessen Europa-Verbindungen bezahlte. »Ich wußte«, schrieb sie später, »daß ich nun frei war. Das war meine Show, meine Show.« Dr. Gellhorns Abschiedsworte waren voller Zuneigung: »Ich liebe dich – nicht, weil du meine Tochter bist, sondern wegen deiner Grundehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Unerschrockenheit und Reinheit.«
Als Martha mit ihrer Schreibmaschine, zwei Koffern und 75 Dollar in Paris ankam, war Frankreich die führende Wirtschaftsmacht. Die Stadt war elegant, aufregend, voller Möglichkeiten. In den Kinos liefen die Filme von Buñuel, Cocteau und Man Ray; Josephine Baker war, angetan mit einer einzigen rosa Flamingofeder, die Königin der Musikrevues, freizügiger und aufsehenerregender, als je zuvor gesehen. Paris war die Antwort auf Marthas Sehnsüchte. Sie nahm mehrere Jobs an, als Assistentin in einem Schönheitssalon, als Texterin in einer Werbeagentur, und schrieb gelegentlich Beiträge für eine Nachrichtenagentur. Sie hatte sehr wenig Geld, aber sie war, wenn auch keine Schönheit, so doch außerordentlich attraktiv. Sie arbeitete außerdem an einem Roman, der später unter dem Titel What Mad Pursuit veröffentlicht und von ihr schnell als peinliche Jugendsünde abgetan und unter Verschluß gehalten wurde. Um den Roman zu schreiben, war sie an die Riviera gefahren, hatte sich in einer billigen Pension eingerichtet und sich die Miete mit Modeartikeln für amerikanische Zeitschriften verdient. Ein junger befreundeter Anwalt aus St. Louis, G. Campbell Beckett, fuhr mit ihr in den Urlaub nach Marokko und regelte später ihre Geschäfte; Beckett verliebte sich in sie. Viele Jahre später schrieb Martha über ihn: »Ich war die verwöhnte Freundin, die Empfängerin … Er kümmerte sich um Menschen.«
Im Sommer 1930, wieder in Paris, wurde Martha Bertrand de Jouvenel vorgestellt, einem linken Politikjournalisten, der kurz zuvor sein erstes Buch, L’Economie Dirigée, veröffentlicht hatte. Bertrand war der Sohn des Zeitungsherausgebers und Politikers Henri de Jouvenel, seine Mutter hatte einen Salon im Boulevard St. Germain. Er war mit der zwölf Jahre älteren Marcelle verheiratet und in ganz Frankreich bekannt als der Junge, der im Alter von sechzehn Jahren von Colette, der zweiten Frau seines Vaters, verführt worden war; Colette hatte während der Affäre ihren Roman Chéri geschrieben, die Geschichte eines bildschönen Jungen, der von einer älteren Frau verführt wird. Bertrand war inzwischen sechsundzwanzig, ein schmaler, gutaussehender Mann mit hohen Wangenknochen und in gewissem Licht grünen Augen. Er war außerdem charmant, einfühlsam und klug. Er verliebte sich in Martha. Sie floh an den See von Annecy bei Genf; er folgte ihr.
Die Affäre stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Marthas Eltern und vor allem ihr Vater sträubten sich vehement gegen die Vorstellung, daß ihre Tochter mit einem verheirateten Mann zusammenlebte, auch wenn Bertrand beharrlich versprach und versuchte, sich scheiden zu lassen. In Paris lebten Martha und Bertrand zusammen, doch beide waren häufig unterwegs – Martha schrieb in Bertrands Haus in La Favière an ihrem Roman, während Bertrand seinen Vater als Sekretär auf Dienstreisen begleitete –, und schrieben einander täglich, zuweilen sogar mehrmals. Nach ihrer Trennung von Betrand im Sommer 1931 überredete Martha den St. Louis Post Dispatch, einige Artikel über Amerika herauszubringen, die sie durch Texas, Nevada, New Mexiko und Kalifornien führten; ihre Reise hielt sie in mehreren Briefen an Stanley Pennell fest, später Autor von The History of Rose Hanks, der an der John-Burroughs-Schule ihr Englischlehrer gewesen war.
Aus dieser frühen Phase sind Hunderte von Briefen von Bertrand an Martha erhalten, doch nur wenige von ihr an ihn. Während der knapp vier Jahre ihres Zusammenlebens hegte er für sie die tieferen Gefühle. Martha hatte in dieser Zeit zwei Abtreibungen.
In Frankreich tat Martha das, was sie fortan ihr ganzes Leben tun sollte: Sie machte sich Notizen über alles, was sie sah und hörte, hielt sie in kleinen, gebundenen Aufgabenheften fest und verwendete sie später als Grundlage für ihre Artikel und Kurzgeschichten. Schon damals waren es die Details, die ihre Aufmerksamkeit erregten. »Ich arbeite gern«, schrieb sie, »letztlich ist es das einzige, was mich nicht langweilt, demoralisiert oder mit Zweifeln erfüllt. Das einzige, was nach meiner festen Überzeugung rundum und unwiderruflich, vom Ergebnis unabhängig gut ist.«
An Edna Gellhorn
[Ende 1931]
[Paris]
Liebste Matie;
Danke für Deinen Brief. Schade, daß Du das mit den Stix gemacht hast: denn natürlich werde ich einfach weiter Mrs. sein und als solche angenommen werden. Ein Diplomatenpaß wird die Angelegenheit in Kürze ein für allemal ausbügeln. Meine Vermutung ist, daß die Nachricht früher oder später in die Zeitung kommt, und warum auch nicht. Es wird sowieso alles ungemütlich, wobei die einzige praktische Folge sein wird, daß ich nicht nach St. Louis zurück kann. Ich wünschte bei Gott, Dad und Du würdet nicht so beharrlich klagen und verzagen. Mir scheint doch, die Jahre und meine Zufriedenheit sollten Euch vor Augen führen, daß es klappt mit uns und daß es genau das ist, was ich will und brauche. Sollen die Leute doch annehmen, daß Ihr diese Verbindung nicht gutheißt – das würde niemanden überraschen und trifft zweifellos ohnehin zu. Wir haben – nach einer Weile – den einzigen Ausweg aus der faktischen Zwickmühle der Ehelosigkeit gefunden. Denn eigentlich sind wir verheiratet, die Ehe wird hier fraglos als rechtmäßig hingenommen. Die Freunde in den USA, die davon wissen, nehmen sie ebenfalls hin. Ihr sollt ja nicht lügen, bloß schweigen, obwohl es jetzt wahrscheinlich zu spät ist, weil Ihr nun schlecht hinter Euer erstes Urteil zurück könnt. Tut mir leid, daß ich da so verstockt bin, aber es ist nicht komisch, wenn das sorgfältig errichtete Gebäude so mir nichts, dir nichts eingerissen wird, zumal all unsere Amerika-Pläne von der Stabilität dieses Gebäudes abhängen. Darüber hinaus zeigt die ganze Geschichte einfach, daß Ihr uns so wenig versteht und vertraut wie vor drei Jahren, und das macht mich ziemlich mutlos. Erklärungs- oder Überzeugungsversuche sind offensichtlich nutzlos, und von den Tatsachen laßt Ihr Euch auch nicht beirren. Ich betrachte B. als meinen Ehemann, das habe ich immer getan; meine Freunde sind bereit, ihn als solchen zu akzeptieren – mit oder ohne Trauschein. Wenn Ihr weiterhin davon überzeugt sein wollt, daß mein Leben zerstört sei und ich ein Opfer von B’s brutalem Egoismus, so ist das Euer gutes Recht – nur habe ich für eine solche Haltung kein Verständnis. Sie ist lästig und falsch und für mich ebenso kränkend wie für B. Wäre ich mit B. rechtmäßig verheiratet, würdet Ihr eine solche Haltung nicht mal annehmen, wenn sie Eurem Gefühl entspräche. Ich betrachte mich als verheiratet und mißbillige Eure Sicht auf meinen Mann. Ich werde B. und mich nicht mehr mit Euch diskutieren; es hat keinen Sinn. Auch werden wir Euch nicht mit einem Besuch in St. Louis belästigen; offensichtlich seid Ihr nicht willens, B. als feste Größe in meinem Leben zu akzeptieren, und ich habe keine Lust, allein zu kommen und schon wieder diese Frage aufzuwerfen, die für mein Empfinden abschließend und zufriedenstellend beantwortet ist. Wir haben offenkundig beide unsere Vorurteile und werden einfach weiter an ihnen festhalten. Das ist fruchtlos und schmerzhaft; aber zufällig liebe ich B. nun mal und gedenke, mein Leben mit ihm zu verbringen; keiner außer B. wird mich je davon abbringen können, und ob er es tut, ist zweifelhaft. Und schließlich zu dem »Klatsch«, der Eurer Meinung nach in St. Louis nicht zu umgehen sein wird; der ist mir schnuppe. Hier gibt es keinen Klatsch; wir führen unser Leben so, daß die Menschen uns respektieren und es nicht für geboten halten, zu lästern und zu kritisieren. Jedes Mal, wenn ich nach St. Louis gekommen bin, habe ich mich schmutzig gefühlt und ängstlich: Nirgendwo sonst geht es mir so, deshalb lebe ich anderswo aufrecht und entspannt. Ich werde nie wieder in diese verlogene, ungesunde Atmosphäre der Schrecken und Lügen zurückkehren; natürlich denken sich die Menschen häßliche Geschichten aus, wenn sie das Gefühl haben, man schämt sich und versteckt sich. Dad und Du ward immer der Meinung, ich begehe eine Todsünde; die Belohnung für eine solche Haltung ist kübelweise Klatsch und mehr. Es tut mir leid für Euch; es berührt mich nicht. Seit ich begriffen habe, daß mir die Feigheit, die Verlogenheit und Angst, das Duckmäusertum und das Schielen nach den Nachbarn das Leben zur Hölle macht, und seit ich mich darum nicht mehr schere, fühle ich mich sicher und glücklich. Wie die alten Südstaatenfamilien kann St. Louis gern meinen Bürgerkrieg weiterführen, nachdem er längst beendet und vergessen ist.
Diesen Brief schreibe ich nicht gern; Schweigen wäre wahrscheinlich freundlicher gewesen. Aber Ihr sollt wissen, was ich empfinde und weshalb ich nicht mehr versuche, Euch mein Leben zu erklären. Bitte zeige Dad diesen Brief, er ist für Euch beide. Und es ist wahrscheinlich der letzte Brief dieser Art, den Ihr werdet lesen müssen.
Eure
Martha
An Bertrand de Jouvenel
27. Februar 1933
St-Maxime
Liebster;
Es ist fast wie ein Gespräch – wie die langen Gespräche, die wir manchmal führen (inzwischen seltener, was schade ist) –, einen Brief von Dir zu bekommen und gleich zu antworten. Heute morgen kam ein Brief mit dem verblichen wirkenden Briefkopf des Rond Point, in dem viele wesentliche Dinge stehen, auf die ich sofort und ausführlich eingehen will.
Du hattest Dein Journal Intime gelesen – und dann »nous sommes amusés à dire, au cours de ces derniers mois, que tu étais paresseuse, gourmande, nonchalante. Il n’est pas bon de perpetuer pareille plaisanterie.« Wie überaus wahr, Liebster … »il n’est pas bon«. Ich glaube wirklich, wir sind mehr oder weniger, was wir sein wollen und was sein zu wollen wir uns einbilden. Diese Selbsthypnose oder Suggestion oder wie immer man es nennen will ist so fortdauernd und nahezu unbewußt, daß sie eine bleibende Wirkung auf unsere Persönlichkeit und Lebensführung ausübt. (Verzeih mir die schreckliche Pedanterie dieses Satzes, aber Du weißt, wenn ich einmal ins Philosophieren gerate, werde ich ernst und deutsch.) Als wir uns kennenlernten, sagtest Du mir zum Beispiel, ich sei Superman (ich bin so sehr Superman wie ein dickes kleines Mädchen, das keine größere Leidenschaft kennt als Marshmallow-Eis, aber das tut hier nicht zur Sache). Da Du mich Superman nanntest, darauf beharrtest, es von mir erwartetest, fühlte ich mich natürlich über kurz oder lang unverbrüchlich verpflichtet, Deiner Einschätzung mei-ner Fähigkeiten zu entsprechen. Wäre ich – zur Zeit des Journal Intime – nach Amerika zurückgekehrt, während ich mich als aufgedunsene, nutzlose Krimileserin empfand, hätte ich unter Druck ganz anders gehandelt; hätte ihm nachgegeben; hätte nichts gewonnen aus der nützlichsten Erfahrung, die man als Mensch machen kann: dem eigenen unmittelbaren, intensiven persönlichen (und da persönlich, überdimensionalen) Leiden. Jetzt ist Nachsicht statt Erwartung zum Tenor unserer Beziehung geworden. Und das macht sich sofort bemerkbar. Ich bin nicht stark genug, um den ständigen Fingerzeigen eines Menschen, den ich liebe und ehre, zu widerstehen: Ich habe einen der größten Minderwertigkeitskomplexe, die man überhaupt haben kann, und bin von mir gelangweilt und angewidert. Ich habe mich, mit erheblicher Verminderung der Lebensfreude, mit wesentlich gedämpftem Hochgefühl, allmählich mit diesem Bild von mir als heiterer Bettwärmerin abgefunden. Und schlimmer noch, ich war nie mehr als eine Bettwärmerin – das höchste der Gefühle war, meine Rolle gut zu spielen. Das kann man Dir nicht anlasten: Eins ist sicher im Leben – wir sind für unser Dasein verantwortlich; für unseren Erfolg und unsere Niederlagen. Gewiß hast Du lediglich einen Verfall begünstigt, den ich zugelassen und vorangetrieben habe. Aber einen Verfall. Ich halte Glück nicht für eine Gefühlsduselei oder Leichtsinn. Ich denke mir Glück (sofern ich daran denke) konkret: Für mich ist Glück so etwas wie unsere erste Wanderung – ich erinnere mich an die Busfahrt auf den Petit Saint Bernard, unser »Ertrinken« (so könnte ich heute nicht mehr schwimmen), heiße Nachmittage auf der Straße in Italien. Ich weiß nicht, ob Dir das je aufgefallen ist, aber das Lächeln der Freude ist hell und begierig und so lebendig; das Lächeln der Zufriedenheit ist einfach nur schläfrig … Mea culpa, Liebster, seit Monaten habe ich das Gefühl, meine Jugend zu verraten, meine Liebe und die Träume meines Lebens: Im Rückblick auf die vergangenen zehn Monate finde ich die Hundstage in Saint Louis, als ich wie verrückt gearbeitet und mit dem Gefühl gegen die Verzweiflung angekämpft habe, bis zur Grenze des Erträglichen gegen alles anzukämpfen, gegen das man kämpfen kann, wünschenswerter als meine Trägheit und Mutlosigkeit in Paris.
Manche Menschen werden von der Frage angetrieben, was die Welt von ihnen hält; andere von der Frage, was sie von sich selbst halten. Ich glaube nicht, daß mir die Welt besonders auf die Schulter klopfen muß. Pierres Komplimente sind im großen und ganzen peinlich. In meinem ganzen Leben habe ich die Anerkennung dreier Menschen gebraucht; die meiner Mutter, Deine und meine. Von den dreien brauche ich am dringendsten mein Vertrauen. Ich bin bestimmt nicht Superman, aber ich muß daran glauben, daß mein Leben irgendwie gut und wichtig ist, sonst bin ich verloren. Ich arbeite gerade an dem Kapitel, in dem Charis sagt: »Man muß sich wichtig fühlen, sonst wird man verrückt.« Ein grober, unausgegorener Versuch, auszudrücken, was ich eigentlich sagen will. Es gibt bestimmt keine letztgültige Vision des Universums außerhalb der Wissenschaft (und selbst da gibt es unterschiedliche Meinungen und neue Erkenntnisse, die ein Bild verändern können). Und ganz bestimmt gibt es keine letztgültige Vision unseres eigenen kleinen Winkels in der winzigen Ecke des Universums. Wir schaffen uns unsere eigene Vision; sie wird von anderen entweder angenommen, verändert oder verworfen. Was andere mit der Vision unser selbst anstellen, hat nur ökonomische Relevanz. (Ob ich nun der Meinung bin, daß ich Bücher schreiben kann, oder nicht, das Urteil meines Verlegers bezahlt mir die Schuhe.) Meine eigene Vision meiner selbst jedoch bedingt mein Handeln, solange ich lebe, in dem kleinen Teil der Welt, in dem ich mich einrichte. Und es ist ganz wichtig, daß ich mir sage: Du hast Gaben, die du nutzen mußt, du hast eine ganz eigene Vorstellungskraft, die dir neue Lebensentwürfe eingeben soll, und du mußt den Mut aufbringen, nach ihnen zu leben. Wenn ich auf der anderen Seite sage: Du fühlst dich wohl mit Bertrand, und du kannst bequem so weiterleben – die Annehmlichkeiten des Alltags genießen, ohne mühselig fernere Ziele anzustreben als diese täglichen Freuden –, dann werde ich mir in zehn Jahren mit demselben Entsetzen begegnen müssen, das mich in letzter Zeit in meinen helleren Momenten heimsucht: diese weichbäuchige, nutzlose Person, die von allen alten Fahnen gegangen ist, bin ICH.
Ich arbeite jetzt ohne Freude, aber mit dem steten Willen derjenigen, die eine Aufgabe zu erledigen hat und dies auch zu tun gedenkt. Ich kann mich nicht mit Träumen von Talent betrügen oder ermuntern; das hier ist nicht der Kampf eines Genies. Aber ich danke der grauen Luft, der Kälte und der Einsamkeit dieser Tage, denn sie geben mir etwas zu beißen; etwas zu ignorieren und überwinden. Diese Kapitel sind lang und schlecht; meine Hände zittern vor nervösem Zorn über die Langsamkeit und Stumpfheit meines Verstandes. Und ich werde hier bleiben und diese unendlichen Stunden durchsitzen und dieses Buch beenden. Und dabei kann ich vielleicht die Maske der Genußsucht fallen lassen, die mich so viele Monate schon vor mir selbst verbirgt.
Drei lange Seiten schreibe ich nun schon über mich, als wäre ich vollkommen von Dir losgelöst; eine falsche und unmögliche Annahme. Aber Du sollst all diese Gefühle verstehen. In einem Gedicht mit dem Titel »An Lucasta, als er in den Krieg zog« von einem Hofdichter, der mit leichter Hand überaus ernste Gefühle zu beschreiben verstand, gibt es eine lustige kleine Zeile. Er schrieb seiner Dame: »Ich könnte dich, Liebste, nicht so lieben – liebt ich nicht die Ehre mehr.« Siehst Du, mein Schatz, ich dachte, Du verlangtest mir das schwerste, beste und mutigste Leben ab; ich hielt unsere Freude für so intensiv wie Leiden; ich hielt an Dir fest, fand Dich stets stärker als mich. Indem ich weicher wurde, habe ich Dich weicher gemacht. Das ist auch Dir nicht entgangen. Möglicherweise waren diese Monate entspannter Zufriedenheit eine notwendige Ruhepause nach der vielen Anstrengung; das nehme ich beinahe an. Doch nun sind wir ausgeruht. Wir müssen zu dem zurückkehren, was wir waren, und voranschreiten zu mehr. Wir müssen einen Weg finden, glücklich zu sein und einander zu lieben, ohne uns zu schwächen. Ich war zu glücklich in der Geborgenheit Deiner Liebe, zu glücklich in meiner Liebe zu Dir, um dies aus welchem Grund auch immer aufgeben zu wollen. Doch will ich Liebe und das Streben nach Vollkommenheit verbinden. Man kann wahrscheinlich in allem nach Perfektion streben; für mich ist Perfektion nicht die systematische Abkehr von Freude und Fröhlichkeit, ein fanatisches Verlangen nach Feuerproben. Für mich ist Perfektion vollkommene Lebendigkeit; wach und begierig zu sein, alles zu wollen, was Wachstum und Intensität bedeutet. Alles, was man tut, mit Hingabe zu tun – ob Schwimmen oder Bücherschreiben oder Brotverdienen. Ich will Körper und Geist die Spannkraft bewahren; das geht doch bestimmt beides zusammen? Ich will Dich aktiv lieben, nicht passiv; Dich als Partner im Triumph ganz genießen; nicht ängstlich an Dir festhalten als Schutz vor Einsamkeit und Langeweile. Wir sind noch jung: Ich betrachte die Jugend als Chance, die großen, groben Umrisse einer Granitstatue zu behauen: später, wenn man mehr Technik, aber weniger Kraft besitzt, wird man die Feinarbeit leisten …
Mein Liebster, erledige, was immer Du in Deutschland zu erledigen hast, mit Begeisterung und Bravour. Wir sehen uns in ein paar Wochen, halten an dem Entschluß fest, den uns diese Trennung eingegeben hat, und an der Freude unserer Liebe. Denn ich liebe Dich sehr – das sollst Du wissen.
Auf ewig, glaube ich
Marty
An Campbell Beckett
29.April 1934
Villa Noria La Favière
G. Campbell, mein Lieber:
Ich schreibe Dir heute nur (schlimm, wenn ich Dich benutze?), weil ich nach vier Tagen öder Starre, während der auf der gesamten Halbinsel keine einzige Taste geklappert hat, irgendwie zum getippten Wort zurückfinden muß. Ich habe nämlich mein zweites Buch angefangen, daher ist es für mich entsetzlich entscheidend, ob ich schreibe oder nicht; und jetzt habe ich diesen ermüdenden, halbgaren, ruhelosen Jammer am Hals, bis das verdammte Ding fertig ist– gewiß erst in ein paar Jahren, wenn man die Umformulierungen des Verlegers mitberechnet und den ganzen Leidensweg vom Hersteller zum Konsumenten.
Ich schreibe über Frankreich, mein Lieber. Über Frankreich und die Franzosen und über mich mitten unter ihnen, suchend, verstört, schließlich zynisch. Eigentlich schreibe ich über die Jouvenels; denn ich bin viel zu klug, um über die Franzosen zu schreiben. Ein sehr schwieriges Buch, weil ich versuche, in der ersten Person zu schreiben (ein Experiment), und das ist kein Kinderspiel. Du glaubst gar nicht, wie sich die Welt verengt, wenn man ich sagt statt . Aber es muß sein; denn Schreiben ist mehr als das Aneinanderreihen von Wörtern auf Papier, um die Zeit auszufüllen in der Hoffnung auf Geld und einen Spritzer Ruhm: mehr als eine Tätigkeit, die das Gewissen ob des leeren Vergehens der Zeit beschwichtigen soll. Für mich bedeutet es die Reinigung von Geist und Seele: Es gibt Dinge, deren man sich auf alle Ewigkeit entledigen sollte. Es kommt eine Zeit, da man bestimmte Erinnerungen, bestimmte Aspekte der Gegenwart nicht länger im Kopf mit sich herumschleppen kann. Ich habe das schon einmal gemacht: habe mir eine Menge Zerstörung herausgeschrieben. Mein Vater hat einmal gesagt: Blondinen arbeiten nur unter Zwang. Da muß etwas dran sein. Ich weiß, was für eine Hölle das Schreiben ist. Ich weiß, wie unter dem Druck alles auseinanderfällt, unter der Angst, nicht oder schlecht zum Ende zu kommen. Das hört nie auf, und nie kommt der Augenblick– bis das Ding in fremden Händen landet– der wahren Ruhe. Das Damoklesschwert– das unfertige Kapitel… Ich bin mir sicher, daß ich es nur tue, wenn ich nichts anderes mehr tun kann. Dieser Augenblick ist nun wieder gekommen. Denn ich habe Frankreich wirklich satt; mehr will ich nicht, mehr ertrage ich nicht. Und womöglich habe ich für dieses Leben auch von den Jouvenels genug, vom gesamten Clan.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!