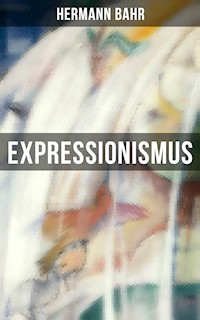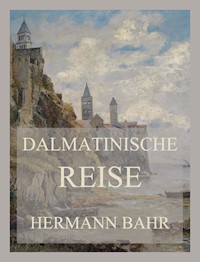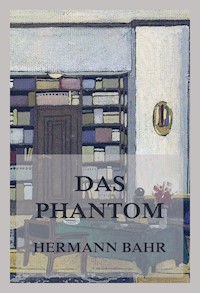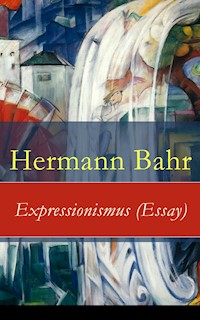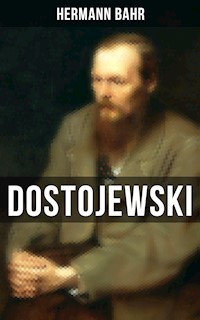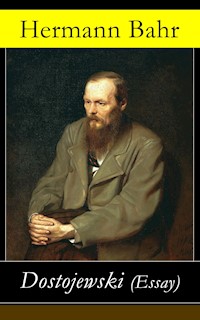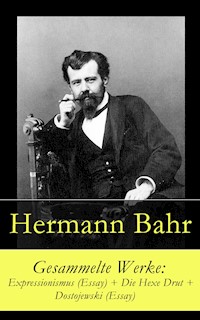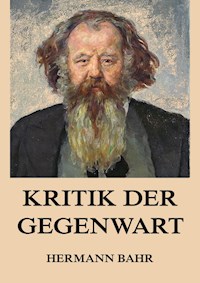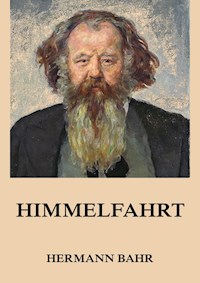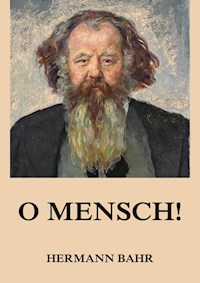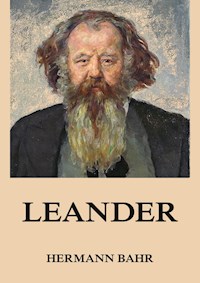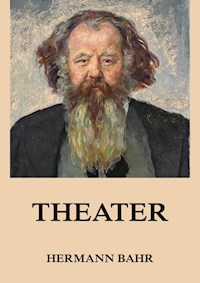0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die 'Ausgewählten Werke' von Hermann Bahr bieten einen faszinierenden Einblick in das Schaffen eines der bedeutendsten Schriftsteller des Wiener Fin de Siècle. Bahr, bekannt für seinen eleganten und anspruchsvollen Schreibstil, nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen menschlicher Emotionen. Seine Werke spiegeln die gesellschaftlichen Umbrüche und kulturellen Strömungen seiner Zeit wider, wobei er geschickt zwischen Realismus und Symbolismus jongliert. Von dramatischen Schauspielen bis hin zu einfühlsamen Erzählungen - dieses Buch ist eine wahre Schatzkiste literarischer Meisterwerke. Hermann Bahr, als führender Vertreter der Wiener Moderne, war ein intellektueller Meistermacher, der die literarische Welt seiner Zeit maßgeblich prägte. Seine vielfältigen Erfahrungen als Schriftsteller, Journalist und Kritiker spiegeln sich in seinen Werken wider und verleihen seinen Texten eine einzigartige Tiefe und Relevanz. Durch seine kritische Auseinandersetzung mit den sozialen Normen und Werten seiner Ära drängt Bahr den Leser dazu, über die Grenzen der Konvention hinauszudenken und neue Blickwinkel einzunehmen. Für alle Literaturliebhaber und Bewunderer der Wiener Moderne ist 'Ausgewählte Werke von Hermann Bahr' ein absolutes Muss. Tauchen Sie ein in die Welt dieses einflussreichen Autors und lassen Sie sich von seinen zeitlosen Erzählungen verzaubern. Ein Buch, das Sie nicht nur unterhalten wird, sondern auch Ihren Geist anregt und zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ausgewählte Werke von Hermann Bahr
Books
Inhaltsverzeichnis
Dostojewski (1914)
Totenmaske Dostojewskis
Einer sagt dem anderen nach, Dostojewski sei, so groß er ist, doch zu sehr Russe, um unmittelbar auf uns wirken zu können. Jeder glaubt es seiner Bildung schuldig, das Totenhaus, den Raskolnikow, allenfalls noch die Karamasoff zu kennen, wird aber abgeschreckt durch irgend etwas Fremdes, grauenhaft anlockend Barbarisches darin, vor dem er lieber noch zur rechten Zeit flieht. Es scheint, daß in diesen Werken das Geheimnis einer Nation enthalten ist, das, wer ihr nicht angehört, ja doch niemals erfühlen wird. Dieser Meinung bin ich jetzt durchaus nicht mehr; ich fand, daß es unser aller Geheimnis ist. Auch auf mich hat er anfangs fremd gewirkt, ganz anders, als wir es von unseren Dichtern gewohnt sind. Ich blieb befremdet, solange ich ihn an dieser Gewohnheit maß. Ich war mit ihm vertraut, sobald ich nicht mehr an die Kunst dachte, sondern an mein Leben. Da erinnerten mich seine Gestalten sehr stark; ich wußte freilich lange nicht, woran. Allmählich besann ich mich und es ergab sich, daß sie mich an Menschen meines Lebens erinnerten. Wo war ich nur dieser Menschenart schon begegnet? nicht bloß in Dalmatien, an Lastträgern in Cattaro, an Schiffern und Fischern der Inseln, an Matrosen unseres Lloyd, sondern auch auf dem anderen Ufer, in Malamocco, in Chioggia. Da ist unser alter Freund, der Blinde, der morgens täglich mit seinen Wassertieren nach dem Lido lahmt und in seiner welken Hand ein paar arme Rosen für meine Frau mitbringt, weil er spürt, daß sie ihn freundlich anblickt; und er hat uns mit seinen Gefährten bekannt gemacht, lauter solchen schweigsamen, dankbaren, ergebenen Alten, einer hat Eier, einer Muscheln, einer Münzen für uns, ich darf ihnen aber nichts dafür schenken, da wären sie beleidigt, aber wenn ich ihnen etwas später was schenke, sind sie nicht beleidigt, es darf nur kein Entgelt sein. Wir können nicht viel mit ihnen sprechen, denn die Mundart ist uns fremd, sie selbst aber gar nicht; sie heimeln uns an, ich würde mich ihnen in Leid und Freud lieber anvertrauen als meinen städtischen Freunden, ja mir ist, als hätten wir irgendein tiefes Geheimnis miteinander. Und an der Nordsee fand ich sie wieder, in Holzschuhen klappernd; und tief im Winter ging ich heuer einmal aus der Ramsau über die Schwarzbachwacht nach Reichenhall, den ganzen langen Weg war da kein Mensch zu sehen, bis ich auf einen alten Bauer kam, der trieb sein Pferd, das einen Schlitten mit Säcken zog, ich schloß mich an, der war auch von Dostojewski. Und so fand ich Menschen Dostojewskis in Hallstatt, an den wunderlichen bösen Zwergen mit den großen Kröpfen, fand sie an Bettelmönchen, fand sie an spanischen Landstreichern und Hexen von der Art, die Zuloaga malt; und überall in Erdenwinkeln an Bauern, Handwerkern, Strolchen, Steinklopfern, Kindern und Narren. Alle diese franziskanischen Gestalten, so verschiedener Rassen, so verschiedener Zonen, so verschiedener Vergangenheit und Gegenwart, haben aber das miteinander gemein, daß ihnen gleichsam nur äußerlich ein Individuum angeschrieben oder aufgeklebt ist, keiner ist eigentlich eine Person, er ist nichts als Mensch, in irgendeine allgemeine Form eingerollt; öffnen wir diese, so sind wir gleich in seiner Tiefe, ja gewissermaßen noch tiefer, nämlich im Urgrund der Menschheit, aus dem empor sich sonst dann erst der besondere einzelne Mensch auferbaut. Der fehlt an ihnen, sie sind bloß Menschenstoff, mit irgendeinem Mantel behängt, aber das besondere innere Gerüste, worauf der Kulturmensch so stolz ist, fehlt. Es fehlt auch in den Versen Walt Whitmans; auch sie sind alle bloß Wellen des Meeres, eine verschlingt die andere, es bleibt nichts davon als das Meer. Solche Wellen der Menschheit, von denen uns nichts als die Menschheit bleibt, sind Aljoscha und der Fürst Myschin und der alte Staretz Sossima; an ihnen ist mir zuerst bewußt geworden, daß ich die Welt Dostojewskis schon kannte, von Malamocco und von meinen Bauern her. Merkwürdig war mir aber nun, daß auch bei seinen anderen Menschen, solchen nämlich, die keineswegs wie jene sozusagen im Urwesen stecken geblieben, sondern ganz persönlich ausgeprägt sind, fast immer ein Augenblick kommt, wo auch sie genau so wirken wie jene, wo ihnen ihr gleichsam nur vorgeschobenes Individuum wieder weggezogen wird und auch von ihnen nichts mehr als der Urstoff übrig bleibt. (Dadurch wirkt ja zum Beispiel die letzte Wanderung und das Ende des Stepan Trophimowitsch, des albernen Intellektuellen in den Dämonen, so überwältigend groß.)
Jeder Mensch enthält die ganze Menschheit. In unseren großen Augenblicken, den Augenblicken der Liebe, der Selbstaufopferung, der Entrückung aus unserer irdischen Enge wird das jedermann inne. Wie könnten wir uns sonst auch in anderen wiederfinden, oft besser als in uns selbst? Wie könnte der Dichter, der Schauspieler, ja jeder Künstler sich so tausendfältig immer wieder in neue Gestalten verwandeln, hätte er sie nicht in sich? Er hört sie sprechen, er sieht sie handeln, und sie sprechen anders als er erwartet hat, sie handeln anders als er will, sie werden anders als er sie geplant hat: sie zwingen ihn, Empfindungen und Handlungen geschehen zu lassen, deren er selbst nicht fähig ist. Aber woher nimmt er solche ihn selbst überraschende und überwältigende Empfindungen und Handlungen, wenn nicht aus sich, aus seinem eigenen unbekannten, tief verborgenen Selbst? Und wie könnte sonst irgendein Mensch an einem anderen teilnehmen, wie ihn verstehen wollen, wie sich anmaßen, jemals anderen gerecht zu werden, wenn er nicht an irgendeiner Stelle selbst schon eben jener andere wäre? Nur indem uns ein anderer Mensch dort berührt, wo wir dasselbe sind wie er, können wir mit ihm fühlen, können wir ihn erkennen, können wir ihn richten.
Jeder Mensch enthält die ganze Menschheit. Indem er sich nun aber formt, sich Grenzen steckt, sich auf einen festen Punkt zusammenzieht, muß er unter seinen eigenen Möglichkeiten wählen, er muß absondern, was er festhalten will, er muß entlassen, was er von seiner Fülle nicht brauchen kann; aus ihr holt er sich heraus wie der Bildhauer aus dem Stein die Gestalt. Jede Gestalt ist ein Verlust, ist Verarmung und Verengung. Aus der ganzen Menschheit wird ein einzelner Mensch gemacht, irgendein Teil unterwirft sich die anderen, diesem Teil wendet sich nun alle Kraft zu. In den Mythen aller Völker ist die Erinnerung an ein Paradies lebendig geblieben, an ein goldenes Zeitalter, das noch keinen Haß unter den Menschen, keinen Krieg kennt, an die Seligkeit jener Urzeit, da jeder Mensch noch die ganze Menschheit war. Und in allen Völkern ist immer noch die Sehnsucht nach einer Wiederkehr jener hellen Jugendzeit lebendig, als ob es der Mensch irgendwie tief in sich wüßte, daß er zwar, um Gestalt anzunehmen, dem ganzen Menschen entsagen, sich absondern, sich in einen Teil, ein bloßes Stück von sich, ein Fragment zusammenziehen muß, daß aber dies für ihn bloß eine Prüfung ist, die er überwinden wird, um dann mit gesammelter Kraft, mit errungener Gestalt wieder zum ganzen Menschen zurückzukehren. Dies meint der ewig die Menschheit sanft begleitende, in starken Zeiten ungeduldig hervorbrechende Glaube an das dritte Reich der Verheißung.
Jeder Mensch enthält die ganze Menschheit. Aber aus diesem Stoff holt er nun seine Gestalt hervor, sie scheint ihm des Lebens höchste Lust und letzter Sinn, doch gerade sie will er keinem anderen gewähren, von jedem anderen fordert jeder, daß er nicht bloß eine einzelne Gestalt der Menschheit, sondern die ganze Menschheit sei. Wir messen unseren eigenen Wert daran, wieviel von uns wir zur Gestalt bringen, und wir messen jeden anderen daran, wie wenig er von der ganzen Menschheit verliert. Persönlichkeit achten wir an uns am höchsten, und Persönlichkeit lassen wir an anderen nicht gelten. Jeder will selbst ein einziger sein, ein einmaliger Mensch, wie noch keiner je war und keiner je mehr sein wird, jeder rühmt sich seiner Eigenheit und hegt sie, jeder liebt an sich, was ihn von den anderen unterscheidet, das macht ihn stolz und froh, aber eben das haßt jeder an anderen. Man gefällt anderen bloß gerade soviel, als man ihnen gleicht, und alle Weltklugheit läuft ja bloß darauf hinaus, daß wir die anderen nicht merken lassen, worin wir anders sind als sie, und eben das also verbergen lernen, was uns an uns selbst im stillen für das Höchste, für das Liebste gilt, ja wodurch und wofür allein wir zu leben glauben. Nichts empört den erwachenden Jüngling so, als daß man ihm nicht gönnen will, dieser ganz besondere, nie dagewesene, bloß in diesem einen Exemplar vorhandene Mensch zu sein, zu dem er sich bestimmt fühlt, und gegen nichts wehrt er sich dabei so, als wenn auch noch ein anderer ebenso besonders und einzig sein will. Erst wer älter wird, vieles erlebt hat und anfängt, an seiner Weisheit irre zu werden, kommt allmählich darauf, daß die anderen vielleicht ganz recht haben, ihm seine lieben Eigenheiten zu verdenken, ja, daß vielleicht bloß dieser ihr Widerstand allein ihn bewahrt hat. Goethe läßt den Geistlichen, zu dem Wilhelm Meister seinen Harfenspieler bringt, über »die Mittel, vom Wahnsinn zu heilen«, sagen: »Es sind eben dieselben, wodurch man gesunde Menschen hindert, wahnsinnig zu werden. Man errege ihre Selbsttätigkeit, man gewöhne sie an Ordnung, man gebe ihnen einen Begriff, daß sie ihr Sein und Schicksal mit so vielen gemein haben, daß das außerordentliche Talent, das größte Glück und das höchste Unglück nur kleine Abweichungen von dem Gewöhnlichen sind, so wird sich kein Wahnsinn einschleichen, und wenn er da ist, nach und nach wieder verschwinden ... Es bringt uns nichts näher dem Wahnsinn, als wenn wir uns vor anderen auszeichnen, und nichts erhält so sehr den gemeinen Verstand, als im allgemeinen Sinne mit vielen Menschen zu leben.« Einen Geistlichen läßt Goethe dies aussprechen, denn es ist eine christliche Wahrheit: dem Christentum ist jeder Mensch heilig, weil er die ganze Menschheit enthält, und jeder ist ihm sündig, weil er von der Menschheit zu sich abirrt, und jeder kann erlöst werden, wenn er aus sich wieder zur ganzen Menschheit zurückkehrt, wenn er, wie es Heinrich Suso nennt, »sich entbildet von der Kreatur«, wenn er »sich entwird«. Der tiefste Begriff des Christentums ist der der Erbsünde: dadurch, daß ein Mensch geboren wird, ist er schon schuldig, dadurch, daß er sich absondert und für sich sein will (wie es bei Heinrich Suso heißt: der Teufel hat Eva verlockt, daß sie »etwas sein wollte«); Gott muß Mensch werden und selbst das Menschenleid auf sich nehmen, das Leid der Individuation, um die Menschenschuld abzubüßen, aber seitdem verlischt die Hoffnung nicht mehr, daß der Mensch sich überwinden, von sich erlösen und so mit Gott vereinen kann.
Jeder Mensch enthält die ganze Menschheit, freilich weiß er es aber nicht, denn nur einen geringen Teil von uns haben wir inne. Erziehung, Gewohnheit, Beispiel, Umgebung, Beruf, die Nötigung, andere über uns zu täuschen, ja auch uns selbst, der Wunsch, mit den Forderungen, die die Welt an uns stellt, übereinzustimmen, das Bedürfnis, uns bequem handhaben zu können, alles wirkt zusammen, um uns eine besondere Rolle zuzuweisen und uns so darin zu bestärken, als wären wir wirklich nichts anderes mehr. Nur ein starker Schlag des Schicksals, ungeheures Glück oder tiefstes Leid, reißt zuweilen für einen Augenblick unser Inneres auf und läßt uns vor dem Getümmel von Menschen erschaudern, das wir sind. Dann erkennen wir, einen Augenblick lang, was alles in uns versammelt ist, unfaßlich für das winzige Ich, das wir uns herausgefischt haben, erkennen es und – wenden uns ab; wir können den furchtbaren Anblick nicht ertragen, wir wenden uns ab und verkriechen uns in unserer Enge wieder. Wie ein solches großes Schicksal tritt Dostojewski seine Gestalten an und sprengt ihre Form, reißt ihre Tiefen auf und stößt sie in das Chaos zurück, dem sie sich entwunden haben; er stellt den Urzustand wieder her.
Im Gebet geschieht es, daß der einzelne sich zerfließen fühlt, und so spiegeln Dichter der Entrückung solches Verschweben aus der Individuation wider: der heilige Franziskus, wenn er die Sonne grüßt, oder Novalis in den Hymnen an die Nacht, Wagner im Tristan. Aber bei Dostojewski wirkt es mit einer grauenhaften, fast nicht mehr zu ertragenden Gewalt, weil diese Gestalten, die er auflöst, in Erz gegossen sind. Er hat den höchsten Sinn für Gestalt, die höchste plastische Kraft, das höchste Gefühl für die absurde Verknüpfung, die einen Menschen eben zu diesem einen, einmaligen, in aller Vergangenheit und aller Zukunft beispiellosen Menschen macht. Denn das, woran wir einen erkennen, das »Unterschiedliche«, wie Meister Eckhart sagt, ist immer etwas Unbeschreibliches, unseren Sinnen Unfaßliches, unserem Verstande durchaus Absurdes. Wenn wir einen in seine sämtlichen Eigenschaften zerlegen und diese dann wieder zusammenfügen, erhalten wir ihn nicht, es fehlt noch etwas: er nämlich fehlt. Die Summe seiner sämtlichen Eigenschaften ergibt ihn nicht, er ist mehr. Damit aus ihnen er werde, muß, indem sie verknüpft werden, noch irgend etwas dazu kommen, was den menschlichen Verstand übersteigt, ja auf ihn, wenn er es ahnt und sich nicht davor in Ehrfurcht rettet, aufreizend lächerlich wirkt. Das erbittert ja Freunde gegeneinander so, denn der Freund ist alles, was wir an ihm verstehen, aber er nimmt sich heraus, dann noch etwas dazu zu sein, etwas was wir immer, immer wieder fühlen müssen, aber niemals, niemals erkennen können, weil es keinen Zugang für den menschlichen Verstand hat. So kann man sagen, daß jeder unerkannt durchs Leben geht, unerkannt ins Grab sinkt; und auch er selbst erfährt sein eigenes Geheimnis nie. Dieses Geheimnis, diese innerste Verknüpfung und Verknotung, dieses Absurde des Einzelmenschen stellt Dostojewski mit einer Kraft dar, wie nur noch Shakespeare und Balzac. Jede Gestalt dieser Dichter ist ein Unikum, auch ihrem eigenen Schöpfer gegenüber, wodurch sie sich z. B. von den Gestalten Goethes unterscheiden: auch diese sind mehr als ihre sämtlichen Eigenschaften, aber was noch dazu kommt, ist Goethe, sie haben alle Goethes Augen, wie alle Lippen, die Leonardo malt, das Lächeln Leonardos haben. Aber Shakespeares, Balzacs und Dostojewskis Gestalten wissen von ihrem Schöpfer nichts mehr. Und nun geht aber Dostojewski her und schlägt ihren Knoten durch. Er löst sie auf, läßt ihnen aber dabei das Unauflösliche jeder Erscheinung. Er nimmt ihnen einen Augenblick ihr Antlitz ab, aber gleich darauf bindet er es ihnen wieder vor.
Stendhals Julien oder Balzacs Rubempre oder Ibsens Hjalmar haben kein geringeres Leben als irgendeine Gestalt Dostojewskis, aber der Unterschied ist: sie bleiben in ihrer Gestalt eingeschlossen und können nicht mehr heraus; aus dem ewigen Flusse geschöpft, durch die bildende Kraft des Künstlers geballt, stehen sie dann in ihrer Form still und wir hören nur allenfalls, wie das Element, gefangen, gebändigt, leise zuweilen noch glucksend an die starre Wand schlägt. Dieses innere Klopfen der Gestalten an ihrer Form ängstigt uns oft bei Hauptmann so, gar am Emanuel Quint: jetzt und jetzt fürchten wir, daß die Form davon zerbrechen wird, und wissen nicht, warum wir es aber doch zugleich auch fast wünschen. Wagner freilich führt seine Gestalten durch die Macht der Musik aus der Enge der Gestalt hervor und erlöst sie von sich selbst, ihr Wesen überwogt ihre Form, die Gestalt zergeht in ihre Essenz, Isolde wird zur Liebe, Kundry zur Buße, nichts als Liebe bleibt von Isolden, nichts als Buße von Kundry zurück, des Meisters Eckhart leuchtendes Wort wird Ereignis: »Auf denn, edle Seele, so geh denn aus dir, so weit, daß du gar nicht wieder zurückkommst, und geh ein in Gott, so weit, daß du gar nicht wieder herauskommst!« Aber bei Dostojewski kommt sie wieder heraus, sie kehrt zu sich zurück: das ist es, wodurch Dostojewski die Menschheit auf einen neuen Weg, wodurch er uns ins Freie bringt, das ist es, wodurch er uns in der größten Krise des europäischen Gewissens die einzige Rettung zeigt.
Erzene Gestalten löst Dostojewski wieder in die ganze Menschheit auf und zieht dann aber im nächsten Augenblick die ganze Menschheit wieder in dieselbe Gestalt ein: fortwährend nimmt bei ihm unter unseren Augen das Chaos Gestalt an, es wird hart, gleich aber erweicht sich die Gestalt und zerfließt, aber schon gerinnt der Fluß wieder, und in solchem unablässigen Wechsel scheint bald die Menschheit in einer Gestalt, bald wieder die Gestalt in der Menschheit zu verschwinden, die Menschheit atmet Gestalten ein und aus, jede Gestalt Dostojewskis ist ein ununterbrochener Zug von Geburten, Toben und Wiedergeburten. Daraus erklärt es sich auch, warum er so stark erotisch wirkt, denn eben dieses Entweichen und Wiederkehren der Gestalt, die von ihrem austretenden Inhalt überschwemmt wird, dann aber aus den absinkenden Fluten wieder emportaucht, erleben wir sonst nur in den Augenblicken der Liebeslust, wenn der Liebende, wenn die Geliebte nichts mehr als Verlangen sind, alles Eigene verlischt und uns aus den vertrautesten Zügen das Urgesicht der Menschheit fremd und ungestalt anstarrt, bis dann allmählich erst, von der seligen Selbstvergessenheit erwachend, aus dem Urweibe wieder die verschwundene Gestalt der Geliebten erscheint und staunt, an ihrer Seite den wiedergeborenen Freund zu finden. Der schrecklichsten Gewalt solcher Augenblicke erinnern wir uns unwillkürlich bei Dostojewski, denn er verfährt wie Eros: er taucht seine Gestalten in den Urgrund des Daseins hinab, ins Grenzenlose, Uferlose, wo noch nichts Form hat, in die tiefe Nacht, und wenn sie dort erloschen sind, hebt er sie drüben wieder empor und läßt es wieder tagen.
Gestalten ganz scharf abzuheben, fest einzugrenzen und in ihrer ausschließenden Einzigkeit darzustellen, dann aber einem Schicksale zuzutreiben, das ihre Form zersprengt und sie wieder in das Element auflöst, bis auf einen letzten Faden, an dem sie sich zu sich selbst zurückziehen, ist Dostojewskis Art. Damit sagt man schon, daß er das Problem unserer Zeit darstellt. Während wir nämlich eben noch in Persönlichkeit schwelgten, jeder seiner Besonderheit stolz, anders als die anderen, in sich verbohrt, ist uns plötzlich darin zu enge geworden, wir finden uns verarmt, wir fürchten auszutrocknen, und dieselbe Leidenschaft, mit der wir uns eben noch immer mehr einzogen und verengten, ergreift uns jetzt nach Ausdehnung, Enteignung und Ergießung. Wir spüren ein stärkeres Leben in uns, als unsere Gestalt fassen kann, zu ihm wollen wir aus ihr hinaus, über den geringen Teil von uns hinweg, in dem wir gefangen liegen. Das kündigen jene seltsamen, überall aufleuchtenden Zeichen einer neuen Religiosität an; Züge des dreizehnten und des vierzehnten Jahrhunderts hat unsere Zeit, mit ihrer irren Sehnsucht, die nach jeder Mystik greift, um Expansion, Explosion, Effusion. Aber solche Zeiten, wo jeder aus sich wegstürzt, um drüben ins wahre Wesen unterzutauchen, gewahren schaudernd, eben wenn sie das Wesen zu berühren glauben, daß sie ins Wesenlose fallen: dieser Schwindel erfaßt uns schon! Indem nun Dostojewski niemals größer ist, als wenn seine Gestalten auf der Flucht aus ihren Grenzen, von ihrem Inhalt überströmt, in ihm verschwindend, sich selbst entsunken, plötzlich aus dem Element wieder emporgespült und in ihr armes Ich zurückgeworfen werden, läßt er uns das tiefste Geheimnis des irdischen Zustands ahnungsvoll berühren, nämlich daß alles Leben größer ist als jede Gestalt, in die es sich drängt, daß es aber nur an Gestalten erscheinen kann, daß es also, die Gestalt verlierend, damit auch sich selbst verlieren muß, daß alles Werden immer wieder ins Sein flüchtet, daß alles Lebendige zur Gestalt verdammt bleibt, daß wir niemals »hinüber« gelangen können, ohne uns und unsere ganze Welt zu vernichten, und daß unsere wirkliche Existenz am innersten Rande des Ichs ist, noch vom Ich gehalten, aber den Blick schon im Abgrund – dieses Schweben ist der Mensch. Alle lebenssicheren Zeiten haben das im inneren Gebrauch. So geben die Griechen dem Apoll den Dionysos mit. So kehrt der heilige Franziskus aus Verzückungen zu seinen zärtlich gehegten Tieren heim. So genießt der spanische Dichter in mönchischer Einsamkeit alle Lust und Laune der verschränkten Sündenwelt; eines seiner Stücke nennt er »In diesem Leben ist alles Wahrheit und alles Lüge«, eben in diesem Gefühl, daß es ein Leben am Rande ist, mit dem Fuß noch im Trug, doch schon hinüber gebeugt. Kant hat das dann formuliert, Goethe hat es bewußt gelebt. Es geht nur den Menschen immer wieder verloren, und erst wenn die Not am höchsten ist, findet es einer wieder. Höher kann unsere Not nicht mehr steigen und siehe, da steht schon Dostojewski für sie bereit.
Ich weiß nicht, was Dostojewski für die Russen bedeutet. Ich weiß nur, was er im ganzen der Weltliteratur ist: der letzte (denn er war ja jünger wie Wagner), der in seiner Kunst dargestellt hat, was es mit unserem Leben ist und wie wir möglich sind. Tolstoi ist ja, solange er in der Kunst blieb, niemals ins Innere des Lebens eingedrungen, und als er es fand, nicht mehr in den irdischen Trug zurückgekehrt; er war immer entweder ganz hier oder ganz dort, niemals in der Schwebe dazwischen, die den ganzen Menschen gibt. Kunst in diesem höchsten Sinne genommen als Darstellung der Zwienatur des Menschen, sind Wagner, Whitman und Dostojewski unsere letzten Künstler gewesen. Und mit einer notwendigen und unvermeidlichen Übertreibung kann man sagen, daß Dostojewski der Dichter ist, an dem allein jetzt Europa sich wiederfinden und aufrichten kann.
Was vom Individuum gilt, gilt ebenso für die Nation. Auch in ihr verkürzt und verengt sich die Menschheit und verarmt, auch im Wesen der Nation ist es, absurd zu sein. Und wie jedes Individuum zwischen Ausdehnung und Einziehung schwebt, drängt es jede gesunde Nation bald zur Menschheit hinaus, bald wieder in sie selbst zurück. In sich selbst allein vertrocknet sie; sie muß immer wieder an der Menschheit Atem holen. Entfernt sie sich dabei zu weit von sich und verliert den letzten Faden, an dem sie dann wieder zur Beruhigung in sich selbst zurück kann, so zerrinnt sie. Individuen und Nationen sind gleich trügerisch, aber ein der Menschheit unentbehrlicher Trug, denn sie sind es, woran allein die Menschheit erscheinen kann. Es war der Irrtum des Rationalismus, dies zu verkennen. Indem er von der Nation absah, zog er dem Menschen, während er ihn über die Wolken zu heben glaubte, nur unter den Füßen den Boden weg. Die russischen Rationalisten werden Westler genannt. Dostojewski mußte, mit seiner tiefen Einsicht in die Zweifaltigkeit des menschlichen Wesens, ihnen notwendig widerstreben und geriet dabei in, die Gesellschaft der Nationalisten, die freilich die menschliche Natur ebenso mißverstehen, bloß auf der anderen Seite. Das Individuum wie die Nation lebt nur im Gleichgewicht von Expansion und Konzentration. Da es damals die Westler waren, die dieses Gleichgewicht störten, konnte Dostojewski, vor Angst, die losgerissen im Winde treibende Seele seines Volkes müsse verströmen und entdampfen, übersehen, daß sie, von den Nationalisten in die Enge getrieben, in sich ersticken muß. übrigens meint er, wenn er wider das Ausland für Rußland spricht, im Grunde stets einen anderen Gegensatz: den zwischen Verstand und Gefühl. Leben ist zu tief, um ausgedacht zu werden. Es setzt sich in Gefühl um, vor dem der Verstand ratlos steht; er kommt ihm mit seinen Wahrheiten nicht bei. Sie sind unbrauchbar zur Tat, sie bringen nichts hervor. Was uns tätig macht, wodurch wir bewegt und bestimmt werden, was in uns treibt, diese geheime Kraft gibt sich uns unmittelbar kund. Wir haben eine innere Notwendigkeit, die uns diese Handlung gebietet, jene verwehrt, ohne wahrnehmbaren Grund. Verletzen wir dieses Gesetz, so leiden wir noch in der Erinnerung daran; ihm zu gehorchen macht uns froh, selbst bei bösen Folgen für uns; insgeheim stimmen wir alle Goethes vermessenem Wort zu: »Lieber schlimm aus Empfindung als gut aus Verstand!« Dieses innere Gesetz läßt sich erst gar nicht mit uns ein, es fragt uns nicht erst, es wirkt, wenn wir uns genau beobachten, wie eine von außen uns zusprechende, uns anherrschende Stimme gleichsam eines höheren Genius oder des Geistes unserer Ahnen oder der Volksseele, wie man nun immer sagen will; als ein übermächtiges Wesen empfinden wir es. Erfahrung zeigt aber, daß in Menschen, die sich dagegen taub stellen, um lieber auf das Urteil des Verstandes zu hören, wirklich mit der Zeit diese innere Uhr verstummt; dann schlägt in ihnen gar nichts mehr, der Verstand kann es nicht ersetzen. In ihrer Not sehnen sich solche gewichtlose, unversicherte, jedem sinnlichen Eindruck wehrlos preisgegebene Menschen nach jener Festigkeit und Gewißheit der Entschließungen zurück, die der Intellekt nicht gewahren kann. An wen aber sollten sie sich da wenden als an die noch unverfehlten Schichten, die man das Volk nennt? Volk nennt man, was noch nicht vom Intellekt angefressen ist, was noch unverbrauchte Kraft hat, was noch unmittelbar aus der Empfindung lebt. Alle großen geistigen Krisen enden so immer mit einer Flucht ins Volk. (Dante! Goethe, Herder mit dem Sturm und Drang! die Romantik!) Natürlich geht der Intellektuelle, der den Rest seiner lebendigen Kraft vor dem Intellekt retten will, in das Volk, das er zunächst hat: in sein eigenes. So entsteht das Mißverständnis aller Nationalisten, der russischen, wie der deutschen, wie der lateinischen, als ob gerade nur in ihrem eigenen, in diesem einen Volk die Heilkraft verborgen wäre. Sie ist in allem Volk. Man läßt sich nur durch den Doppelsinn dieses Namens verführen, der bald das Ganze der Nation, bald den vom Intellekt unberührt, in seiner Empfindung unversehrt gebliebenen, das angeborene Gesetz bewahrenden Teil bezeichnet. Diesen muß der Intellektuelle finden, um zu gesunden. Der Franzose Gauguin findet ihn auf Tahiti. Richard Wagner erfrischt sich in Venedig mit Gondolieren. Dostojewski wundert sich in Florenz, wie sehr italienische Bauern seinen Russen gleichen. Daß es gemeine Leute sind, daß sie noch das Gleichgewicht der inneren Kräfte haben, daß sie Volk sind, darauf kommt es an; der nächste Gassenbub tut es auch. Nun aber die heilende Kraft, die in allem Volk ruht, dem einen zuzuschreiben, an dem gerade man sie selbst gefunden hat, ist der Irrtum aller Nationalisten, des Dostojewski wie des Lagarde wie des Barrès (ich nenne diese drei, weil sie in ihrer politischen Gesinnung einander oft geradezu bis aufs Wort gleichen). Dostojewski muß dies übrigens irgendwie selbst insgeheim empfunden haben, an manchen Stellen seiner Puschkin-Rede ist er schon ganz nahe daran, es auszusprechen, daß wir bloß ins Volk einkehren müssen, ganz gleich in welches. Sein Nationalismus haßt nicht. Vom russischen Volk erwartet er vielmehr, daß es den anderen die »Allversöhnung« bringen wird. Er rühmt die »hohe synthetische Begabung« der Russen. Er findet im russischen Volk noch das Gefühl lebendig, daß der Mensch »nicht wie ein gewöhnliches Erdentier nur sein Leben friste, sondern mit anderen Welten und der Ewigkeit verbunden sei«. Das fehlt ihm im übrigen Europa, das er in Erwerb und in Genuß versunken sieht, und in Zwietracht. »Sowohl der Franzose wie der Engländer sieht in der ganzen Welt nur sich allein und in jedem anderen ein Hindernis auf seinem Wege; und ein jeder will bei sich allein das vollbringen, was nur alle Völker mitsammen vollbringen könnten, mit vereinten Kräften.« Er bemerkt nicht, daß er von den Franzosen, von den Engländern eben nur die Intellektuellen kennt und daß sein Kampf gegen die »Westler« doch überall in Europa gekämpft wird, ganz ebenso, wenn auch unter anderen Namen, überall lösen sich einzelne vom allgemeinen Schicksal los, verleugnen die inneren Stimmen und trauen sich zu, aus dem bloßen Verstande zu leben; überall setzt sich ihnen die Lebenskraft des unversehrten, seine inneren Gewißheiten ehrfürchtig bewahrenden Volkes entgegen; und überall wird sich, wo nur irgendein Volk zu sich selbst kommt und sein inneres Gesetz erfüllen lernt, dieselbe »synthetische Begabung« offenbaren. Wie wir aus unserer inneren Anarchie gerettet werden könnten, das ist heute das Thema Europas. Es ist das einzige Thema Dostojewskis. Er glaubt bloß zu Russen zu sprechen, doch er spricht von uns allen. Denn jene allversöhnende Gemeinsamkeit, auf die er in seinen reinsten Gesichten, in, wie er sie nennt, »unseren Stunden Christi« gehofft hat, ist ja schon da: in der schöpferischen Sehnsucht aller Nationen, Volk zu werden.
Salzburg, 2. August 1913.
Expressionismus (1916)
Inhalt
Alfred Roller in herzlicher Verehrung
Salzburg
Himmelfahrt 1914
Idol. Holzfigur aus Deutsch-Ostafrika
Trost in Goethe
Diese Schrift hat sich gewissermaßen selbst geschrieben. Es erging mir seltsam mit ihr. Ich hatte sie nicht vor und staune noch, wie sie mich auf einmal überkam.
Ich spreche seit Jahren gern in Danzig. Diese Menschen sind mir lieb geworden. Sie hören gut zu und bringen dem Redner etwas entgegen, das ihn produktiver macht, als er in gemeinen Stunden ist. Ihre Teilnahme steigert ihn, ihre Gunst holt alle Kraft aus ihm heraus, und indem er sie, so leicht sie sich bewegen, so gern sie sich verlocken lassen, dabei doch kritisch aufmerksam, ja beim ersten Anlaß gleich zum Spott bereit merkt, muß er auf der Hut sein, nimmt sich zusammen und übertrifft sich selbst. Es ist mir dort geschehen, daß ich bei Vorträgen, die mir längst geläufig, ja durch Übung und Gewohnheit schon fast mechanisch geworden waren, Wendungen, Einfälle, Lebendigkeiten fand, die ich mir gar nicht anmaßen durfte, sondern, fast mit Neid, eigentlich diesen Zuhörern und ihrer geheimnisvoll mich belebenden Kraft zusprechen mußte. Darum ist es mir auch, wenn ich einen Vortrag zum erstenmal halten soll, in Danzig am liebsten. Wenn ich nämlich über etwas zum erstenmal spreche, weiß ich zwar ein und aus, ich weiß, woher und wohin, ich weiß, was ich sagen will, und auch ungefähr wie, doch liegt das alles höchst ungewiß im Schatten, es ist noch ganz ungestalt, und gar nicht weiß ich, wieviel sich davon ergreifen, festhalten, gar aber formen lassen wird. Ich bin selber immer sehr neugierig. Wenn ich nämlich nichts sage, als was ich vom Anfang an sagen will, das genügt mir nicht, sondern es muß, indem ich spreche, noch etwas dazu kommen, was mich selber überrascht, ja mir oft im ersten Augenblick gar nicht recht geheuer ist, bis es sich dann auf einmal doch als eben das zu erkennen gibt, worauf ich insgeheim immer schon aus war; in guten Gesprächen geht's einem ja auch so: bloß dadurch, daß man einen Zuhörer hat, findet man dann, was man immer schon gesucht, aber vergeblich, solang man mit sich allein war. Nur muß der Zuhörer auch danach sein. In Danzig ist er es mir.
Nun bot mir Stadtrat Goeritz, der Leiter des Vereins, in dem ich immer spreche, das letzte Mal an, mich jetzt einmal über die neueste Kunst auszulassen; über Expressionismus, Kubismus, Futurismus. Goeritz, der selbst einen ganz entschiedenen Geschmack, ein ganz zuverlässiges Kunstgefühl hat, sich also sicher weiß, kann es sich erlauben, auf alles einzugehen, ohne Angst, dadurch verwirrt zu werden. Und seine Leute stehen in einer starken Überlieferung so fest, daß er auch für sie nichts zu fürchten hat; die bläst so bald kein Wind um, woher er auch kommen mag. Den Stadtrat scheint's eher zu freuen, wenn er sie von Zeit zu Zeit einmal gehörig aufschütteln und zerzausen kann. Es ist ein gut versicherter Menschenschlag, dem man getrost zumuten darf, was ungewissen Geistern vielleicht gefährlich würde. Sie haben einen vortrefflichen Magen, sie werden auch den Futurismus verdauen! Und mein Goeritz hält darauf, seine Stadt mit allem zu versehen, was gut und teuer ist; es soll keiner erst nach Berlin fahren müssen, um das Neueste zu haben. So sprach er mir Mut zu, mich ja nicht zu schonen, und ich sah seinen munteren klugen Augen das Vergnügen an, einen solchen Sauerteig an mir zu haben. Als ich ihm aber zugesagt hatte, fiel es schwer auf mich, denn ich mußte ja jetzt vor allem erst einmal darüber nachdenken, wie ich denn eigentlich selbst vom Expressionismus denke. Mit dem Impressionismus bin ich aufgewachsen. Ich war Impressionist, bevor ich einen kannte. Wenn ich mich dann für den Impressionismus schlug, war es für mein eigenes Leben. Und als ich ihn nun plötzlich aber nicht mehr von den Alten, sondern von einer neuen Jugend bedroht sah, das mahnte mich daran, daß es Abend für uns wird. Ich schloß daraus zunächst nur, es sei Zeit, daß ich mit Anstand alt werden lerne. Die mit mir jung gewesen waren, wollten das aber nicht, und es verdroß mich, sie gegen die Jugend nun selbst wieder genau so töricht und ungerecht zu sehen, wie vor dreißig Jahren die Alten gegen uns. Ich schämte mich für uns alle. Die Folge war zunächst, daß ich vermied, Expressionisten zu begegnen. Mir scheint, ich hatte fast Angst, am Ende vor ihnen auch so dumm zu sein wie meine Freunde. Doch überwand ich das allmählich wieder und sagte mir: Du mußt dich darein finden lernen, daß du jetzt nicht mehr mitzutun hast, neue Menschen sind da, sie bringen der Zeit, was sie braucht; immerhin aber kannst du dir es ja ansehen! So tat ich, verstand nicht alles an ihnen, fand aber nichts, was mich erzürnt hätte: ich sah großen Willen mit reiner Leidenschaft am Werk und hatte, wenn ich es mir auch nicht immer ausdeuten konnte, doch ein starkes Gefühl schönster Verheißungen. Weiter war ich eigentlich noch gar nicht, als ich damals nachzudenken begann, was ich den Danzigern sagen sollte. Genügt denn das aber nicht? Muß denn alles gleich »erklärt« werden? Ja kann Kunst überhaupt »erklärt« werden? Was geht es meine Danziger schließlich an, ob mir der Expressionismus gefällt oder mißfällt und aus welchen Gründen? Welchen Sinn hat es, für eine Kunst zu werben oder vor einer Kunst zu warnen? Hat es überhaupt einen Sinn, daß man über eine Kunst urteilt? Ich will den Danzigern lieber einfach zeigen, in welcher merkwürdigen Situation sich der ratlose Kunstfreund heute sieht, wie diese neueste Kunst auf ihn wirkt, was ihn an ihr empört, warum er sich und was er von ihr bedroht glaubt, und was sie will, warum sie das will und ob sie damit nicht vielleicht etwas will, was jetzt gewollt werden muß, ja vielleicht etwas, was längst schon gewollt worden ist, so daß in diesem Allerneuesten vielleicht Allerältestes der Menschheit wieder erkannt werden könnte. Diese Fragen hatten sich mir aufgedrängt, ich wollte sie nun auch den Danzigern stellen und ihnen bei der Antwort helfen. Ich war selber neugierig darauf. Und auch diesmal enttäuschten sie mich nicht, ich spürte wieder stark, wie sie mir halfen, meiner eigenen Gedanken erst selber Herr zu werden. Es wirkte stark und als ich gewahr wurde, daß sich viele dadurch wirklich gefördert, ja geradezu wie befreit fühlten, beschloß ich, es niederzuschreiben, es mochte vielleicht auch anderen behilflich sein. Ich wollte hinschreiben, was ich gesprochen hatte. Damit aber erging es mir höchst seltsam! Denn indem ich einfach niederzuschreiben glaubte, was ich in Danzig gesagt hatte, fand ich mich bald unversehens weggelockt, so weit weg, daß ich einhalten, umkehren und noch einmal von vorn anfangen mußte. Kaum aber war dies geschehen, als ich mich gleich wieder auf einem Abweg sah, und so fort und immer wieder, und ich hatte dabei noch immer das, was ich meinte, nicht herausgesagt! Mein Vortrag war schließlich mit diesen Extratouren so verflochten und umwunden, daß ich selber seine Züge kaum mehr erkennen konnte. Es wäre freilich am Ende ja nicht so schwer gewesen, ihn wieder herzustellen, ich hatte dazu nur resolut wegzustreichen oder doch die Ranken meiner Digressionen abzubiegen. Aber indem ich dies versuchte, war es mir fast wie eine Unehrlichkeit. Denn ich konnte mir nicht helfen: gerade das, was offenbar nicht recht dazu gehörte, schien mir doch eigentlich vielmehr erst recht dazu zu gehören. Klar war ja jener kahle Vortrag, auch ging er geradeaus und hielt sich nicht auf, im Niederschreiben aber belaubte sich alles und umdunkelte sich, es wurde kraus. Ja in unmutigen Augenblicken gestand ich mir ein, daß es ein Herumreden um die Sache war. Aber ich konnte mir nicht helfen: so herumzureden um die Sache schien mir ehrlicher als jene Klarheit und wenn ich undeutlich wurde, so war ich desto wahrer und wenn ich nicht leugnen konnte, daß ich mich wiederholte, ja mit fast ebendenselben Worten, kam es mir vor, als hätten dieselben Worte doch jedesmal einen anderen Sinn, und erst, oft genug wiederholt, den vollen. Ich konnte mir nicht helfen, es mußte schon so bleiben, ich ließ es stehen, wenn ich auch dabei kein ganz reines Gewissen hatte.
Aber auch mein Gewissen beruhigte sich, als ich mich plötzlich eines Kapitels der Wanderjahre erinnerte, das mir immer schon geheimnisvoll nahegegangen war, jetzt aber noch eine neue Bedeutung erhielt. Es ist das elfte Kapitel im zweiten Buch. Wilhelm schreibt an Natalien, er hat etwas auf dem Herzen und siehe, da geht's ihm wie mir! Er beginnt von einem Jüngling, der, am Ufer des Meeres spazierend, einen Ruderpflock findet und bloß dadurch, daß er alles sucht, was dazu gehört, sich am Ende, er weiß selbst kaum wie, als Herrn eines mächtigen Fahrzeugs und hochberühmt unter den Seefahrern findet. Als es aber soweit ist, hält Wilhelm im Schreiben ein und muß bekennen, daß »diese artige Geschichte nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, dasjenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe«. Er holt also von neuem aus und beginnt von vorne, doch nur um im nächsten Augenblick wieder zu gestehen: »Da dieses aber auch nicht ist, was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mitteilungen von irgendeiner anderen Seite näher zu kommen suchen.« So beginnt er zum dritten Mal und erzählt jetzt von seiner Kindheit, erzählt die Begegnung mit dem schönen Knaben des Fischers, mit der sanftmütigen Tochter des Amtmanns und wie ihn da in einem Augenblick das Vorgefühl von Freundschaft und Liebe ergriffen. Schon aber stockt er wieder, denn er merkt mit einem Male, daß er ja wieder nicht sagt, was er sagen will! Und ärgerlich, fast verzagend klagt er: »Wenn ich nun aber nach dieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allenfalls hätte ich folgendes vorzubringen: Wenn es den Humoristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu werfen, wenn er kecklich seinem Leser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung endlich aufzufinden, sollte es dem Verständigen, dem Vernünftigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise ringsumher nach vielen Punkten hinzuwirken, damit man sie in einem Brennpunkte zuletzt abgespiegelt und zusammengefaßt erkenne?« Er kann sich nicht anders helfen und sie, an die er schreibt, sie muß sich »eben in Geduld fassen, lesen und weiterlesen; zuletzt wird denn doch auf einmal hervorspringen und ganz natürlich erscheinen, was, mit einem Worte ausgesprochen, dir höchst seltsam vorgekommen wäre.« Das war mir nun ein rechter Trost, wenn ich auch freilich, im selben Atem noch, mich gleich wieder fragte: Ist denn das ein Trost? Ist es denn nicht der alternde Goethe vielleicht? Ist es nicht vielleicht ein Zeichen des Alters, das um seine Gedanken nur noch in Gleichnissen schweifend kreisen kann, statt sie mit scharfen Worten tapfer aufzuspießen? Aber nein! Ging es denn dem jungen Goethe besser? In einem Briefentwurf Kestners an Hennings vom 18. November 1772 heißt es: »Im Frühjahr kam hier ein gewisser Goethe aus Frankfurt, seiner Handthierung nach Dr. Juris, 23 Jahre alt, einziger Sohn eines sehr reichen Vaters, um sich hier – dies war seines Vaters Absicht – in Praxi umzusehen, der seinigen nach aber, den Homer, Pindar usw. zu studieren, und was sein Genie, seine Denkungsart und sein Herz ihm weiter für Beschäftigungen eingeben würden.« Und weiter: »Er hat sehr viel Talente, ist ein wahres Genie, und ein Mensch von Charakter, besitzt eine außerordentlich lebhafte Einbildungskraft, daher er sich meistens in Bildern und Gleichnissen ausdrückt. Er pflegt auch selbst zu sagen, daß er sich immer uneigentlich ausdrücke, niemals eigentlich ausdrücken könne: wenn er aber älter werde, hoffe er die Gedanken selbst, wie sie wären, zu denken und zu sagen.« Der junge Goethe gesteht also nicht bloß, daß er sich immer nur »uneigentlich« ausdrückt, niemals »eigentlich« ausdrücken, niemals die Gedanken selbst, wie sie sind, sagen kann, er gesteht noch mehr, er gesteht, daß er die Gedanken selbst, wie sie sind, nicht einmal denken kann, daß er also schon »uneigentlich« denkt. Erst wenn er einmal älter sein wird, hofft er, daß er die Gedanken selbst, wie sie sind, wird denken und sagen können. Als er aber alt geworden war, hat er erkannt, daß all unser irdisches Denken und Sagen immer »uneigentlich« bleibt: die Wahrheit ist zugegen, aber verborgen. Jenes Geständnis des jungen Goethe wirkt noch merkwürdiger, wenn man es fast aufs Wort beim jungen Augustinus wiederfindet: »Nun stand ich in meinem dreißigsten und steckte noch immer in dem gleichen Schlamme, begierig nach den flüchtigen und zerstreuenden Gütern des Augenblicks und zu mir sprechend: morgen werde ich es finden, deutlich wird es sich kundgeben, und ich werde es festhalten.« Als aber dann die Wahrheit dem heiligen Augustinus von Gott dargereicht wurde, in jener erhabenen Stunde mit seiner Mutter Monika, da diese beiden gesegneten Menschen »die Weisheit, durch welche alles besteht, in einer Verzückung des Herzens leise berührten«, da hat auch er erkannt, daß vor ihr alles verstummt, »jede Sprache und jedes Zeichen!« (Hertling »Augustin«, bei Kirchheim in Mainz, Seite 28 und 55). Und so gering und unscheinbar auch irgendeine Wahrheit sein mag, sie hat, um wahr zu sein, dies mit der höchsten gemein, daß sie größer ist als alles Denken und Sagen der Menschen. Sie schwebt über uns und ist uns schon entschwebt, wir können ihr nur eilends winken. Und wer in unverdrossenem Bemühen auch nur den Schatten auch nur der kleinsten Wahrheit berührt, dem versagt die Rede; da steht er und muß mit der Mechtild von Magdeburg klagen: Nun gebricht mir mein Deutsch! Was reden wir dann noch? Was schreiben wir gar? Wäre das am Ende nur ein atavistisches Übel? Aber vielleicht ist alles Reden, alles Schreiben nur ein Händeringen unserer inneren Not. Und jeden tröstet es doch, wenn er auch den anderen die Hände ringen sieht.
Geschmack
Selig sind, die Geschmack haben, auch wenn es ein schlechter Geschmack ist, sagt Nietzsche. Aber wer kann sich heute dieser Seligkeit rühmen? Geschmack hat, wer auf einen Reiz ganz unüberlegt antwortet; er mag nachher aus seinem Verstande Gründe dafür beibringen, aber diese rechtfertigen sein Urteil bloß, sie veranlassen es nicht, und es kann auch sein, daß jene Antwort sich durchaus vor dem Verstande nicht zu behaupten weiß. Geschmack hat, wer unmittelbar ja oder nein sagt, bevor er noch selber weiß, warum. Geschmack hat, wer von Behagen oder Ekel überwältigt wird, ohne daß er sich helfen könnte. Aber das ist doch den »Gebildeten« allmählich ganz abhanden gekommen. Ja wir haben eine eigene Vorrichtung, um es auszutreiben: die sogenannte künstlerische Erziehung. Das Kind wird, bevor ihm noch irgendein Werk gefällt oder mißfällt, schon darüber belehrt, was ihm gefallen, was ihm mißfallen soll, so daß sich dann das eigene Gefühl gar nicht mehr hervorwagt, sondern immer erst beim Verstände, bei den anerzogenen Grundsätzen anfragt, ob es denn auch erlaubt ist. Das Kind glaubt dem Lehrer, der ihm ein schönes Bild zeigt. Es merkt sich, wie dieses schöne Bild aussieht, und wenn dann später irgendein anderes Bild es irgendwie daran erinnert, schließt es daraus, daß auch dieses Bild schön sein muß. Das Kind hat an Beispielen gelernt, was ihm zu gefallen hat, und so oft es später durch irgendein Werk an ein solches Beispiel erinnert wird, folgert es daraus, daß ihm auch dieses Werk zu gefallen hat. Was wir heute Geschmack nennen, besteht bloß aus solchen Erinnerungen. Gerät einer aber nun plötzlich an ein Werk, das ihn an nichts erinnert, so erschrickt er. Und wenn er gar dabei selbst etwas empfindet, erschrickt er noch mehr. Seiner eigenen Empfindung traut er ja nicht; das ist ihm abgewöhnt worden. Er fragt also den Verstand nach Gründen. Aber auch den Gründen traut er nicht mehr. Denn davor warnt den »Gebildeten« unserer Zeit das traurige Beispiel seiner Eltern. Er hat Angst, sich auch so zu blamieren. Er hat nämlich in jungen Jahren erlebt, daß das Urteil der Kenner in allen Künsten versagte. Es ächtete Wagner, es ächtete Brückner und Hugo Wolf, es ächtete Mahler, Reger und Strauß, alle, die er heute als Meister verehrt sieht. Er hat dasselbe mit Hebbel und Ibsen, mit Hauptmann und Dehmel erlebt. Er weiß, daß Napoleon dem ersten Bilde Manets, daß sich öffentlich zu zeigen wagte, voll Abscheu den Rücken kehrte, die Kaiserin aufschrie und der ganze Hof sich vor Lachen wand, und er weiß, daß heute jedes Museum einen Manet haben muß, und er weiß auch die Preise. Er weiß, das Millet für seinen Angelus ein paar tausend Franken erhielt, und daß man denselben Angelus dann mit achtmalhunderttausend Franken bezahlt hat. Er kann die Blamage seiner Eltern ziffernmäßig belegen. Er möchte vor seinen Kindern nicht auch einst so dastehen. Davor hat er Angst. Geschmack aber, eigenes Gefühl, das unmittelbar antwortet, ohne Gründe zu brauchen und ohne nach den Folgen zu fragen, fehlt ihm, das hat ihm die Kunsterziehung ausgetrieben. Auf Grundsätze und Regeln mag er sich auch nicht verlassen noch Autoritäten glauben, das verbietet ihm das warnende Beispiel der Eltern. Was soll er tun? Es bleibt dem Ärmsten nichts übrig als jene Angst. Auf ihr beruht, ja man kann sagen: aus ihr besteht sein Verhältnis zur Kunst. Wenn er ein Angstgefühl hat, das hält er für das Zeichen, wodurch sich ihm ein Kunstwerk ankündigt. Was ihm gefällt, hält er für unkünstlerisch, schon weil es ihm gefällt, und er wird also um keinen Preis eingestehen, daß es ihm gefällt. Wenn er zugeben soll, daß ihm etwas gefällt, muß es ihm vor allem mißfallen. Daran, daß es ihm mißfällt, glaubt er zu erkennen, daß es ein Kunstwerk ist, und so hält er sich für verpflichtet, daß es ihm gefalle. Kunst ist ihm, was ihn unruhig macht, was ihn beleidigt, was er scheußlich findet. Er sagt sich dann: Das wirkt auf mich genau so wie Wagner, Ibsen, Manet auf meine Eltern, folglich wird es in dreißig Jahren anerkannt, und ich will dann nicht der Dumme gewesen sein!
Daher kommt es, daß unsere Zeit ein Vorurteil für alles Neue hat; dadurch unterscheidet sie sich von allen Vergangenheiten. Der Bildungsphilister ist von Grund aus umgekehrt worden: er stand früher nach gestern hin, er steht heute gegen morgen zu; sein Hauptmerkmal war einst der Widerstand, sein Hauptmerkmal ist heute die Wehrlosigkeit. Man erkannte ihn sonst daran, daß er nicht vorwärts zu bringen war, man erkennt ihn jetzt daran, daß es ihm nie geschwind genug geht. Er setzt jetzt seinen Stolz darein, daß er sich bemüht, jeder neuen Erscheinung gerecht zu werden. So nennt er das; aber es bleibt freilich die Frage, ob ihr gerecht wird, wer sie nur nach ihrer Neuheit schätzt. Und das ist ja das einzige Kennzeichen, nach dem er sich an Kunstwerken orientiert. Er ist dazu erzogen worden, für ein Kunstwerk bloß gelten zu lassen, was ihn an ein Schulbeispiel erinnert; das hat er, aus Angst, sich zu blamieren, überwunden, und so läßt er seitdem für ein Kunstwerk bloß gelten, was ihn an nichts erinnert. Es muß noch nie dagewesen sein, und das bemerkt er an seinem eigenen Entsetzen. Er ist darum auch dem Werke, für das er im Augenblick schwärmt, schon im nächsten wieder untreu, weil er ja nur dafür schwärmt, solange es das Neueste bleibt, und weil er immer Angst hat, daß inzwischen vielleicht schon wieder ein noch Neueres das Neueste verdrängt hat. Daher auch seine Gereiztheit, weil er das Gefühl hat, doch immer betrogen zu sein: er will ja stets das Letzte, und keins bleibt je das Letzte, morgen muß er es wieder verleugnen. Daher auch die Eifersucht der Bildungsphilister untereinander, in ihrem Wettrennen. Sie wird noch verschärft dadurch, daß keiner mehr glaubt, dem andern gefalle das wirklich, sondern jeder bei sich jeden für einen Schwindler hält, sich selbst aber vor seinem eigenen Gewissen damit entschuldigt, man dürfe doch »nicht hinter seiner Zeit zurückbleiben«, man müsse doch »mitkommen«. Es ist niemals so schwer gewesen, so anstrengend, ein Bildungsphilister zu sein.
Was empört sich?
Wie stimmt damit nun aber, daß sich jetzt auf einmal der »Gebildete« doch wieder empört? Nachdem wir alle die letzten Jahre, zum Staunen Europas, das unser sonst eher bedächtiges, sich mühsam vorwärts arbeitendes Volk nicht wiedererkannte, und zum besonderen Vergnügen der Pariser Kunsthändler, mit Haut und Haaren stets dem Allerneuesten verfallen waren, scheinen wir nämlich plötzlich wieder entzaubert, jenes Vorurteil für alles Neueste wankt, der Wehrlose widersteht wieder, es gibt wieder Werke, über die man sich entrüstet, es wird endlich wieder tapfer geschimpft, ja sogar aller Moden Ankündiger, Ausrufer und Zutreiber von Beruf erschrecken, flüchten, fallen ab, stoßen Warnungen aus und geben das Notsignal. Was ist geschehen? Wie haben diese Kubisten, Futuristen, Expressionisten das erreicht? Wodurch entfachen ihre Bilder solchen Zorn, da man doch schon ganz verlernt hatte, sich über Bilder auch nur noch zu wundern? Wenn es doch längst Geschmack gar nicht mehr gibt, wie kann er sich empören? Oder was empört sich also? Es scheint gar nicht eine Empörung des Geschmacks, es scheint mehr eine moralische Empörung. Künstlern will man alles zugestehen, aber nicht Schwindlern! Selbst liebe Freunde meiner Jugend hör ich dies sagen. O Freunde meiner Jugend, wie wird mir da!
Leute, die seit zwanzig Jahren meinem Urteil über Maler vertrauen, sind jetzt auf einmal wütend auf mich, weil ich auch den Expressionismus zu verstehen trachte, aber das soll ich nicht dürfen! Es ist sehr komisch, wenn auch von einer etwas versalzenen Komik, sie dabei mit genau denselben Argumenten hantieren zu sehen, die vor zwanzig Jahren, als sie noch jung waren, von den Alten gegen sie gebraucht wurden. Sie bemerken nicht, daß nun sie die Alten sind. Ich aber will jung bleiben, wenigstens darin, daß ich noch immer nicht glauben kann, die Welt müsse plötzlich stillstehen. Es ist sonderbar, daß jeder Geschichte bloß bis auf sich selbst gelten lassen will; bloß bis zu seiner Geburt darf sie dauern. Sie scheint vom Anfang an nur den Zweck gehabt zu haben, ihn hervorzubringen; ist aber dieser Zweck erreicht, dann soll sie aufhören. Daß sie noch weiter will, ja gar über ihn hinaus, findet er unverschämt. Und da streiten wir nun, wer von uns eigentlich der Verräter ist. Ich beschuldige sie, ihrer Jugend untreu geworden zu sein: die hat stark ihren eigenen Ausdruck verlangt, und so verlangt jetzt eine neue Zeit wieder den ihren. Und sie beschuldigen mich, den Widersachern des Impressionismus anzuhängen, für den ich eben noch war. Aber ich bin noch immer für ihn. Seine Kunst gilt mir heute noch für den höchsten Ausdruck, den sich der Geist meiner Generation erschaffen hat. Ja für die Vollendung aller klassischen Kunst gilt sie mir. Bloß darin unterscheiden wir uns, daß ich mir nicht denken kann, meine Generation sei die letzte der Menschheit. Wenn aber nach ihr noch eine kommt, so muß diese wieder anders sein. Solange die Menschheit nicht ausstirbt, erneut sie sich, und kein Sohn wird sich je beim Werke des Vaters beruhigen. Der Freitag hat ein anders Pensum als der Donnerstag, sagt Lagarde. Das mußten auch wir uns damals von den Alten erst ertrotzen. Erinnert ihr euch denn gar nicht mehr? Und jetzt kommt eine neue Jugend und fordert wieder dasselbe Recht auf ihr eigenes Pensum. Ihr aber wollt, ganz wie damals jene, daß es immer Donnerstag bleibe. Jede Generation, scheint's, will ihren eigenen Augenblick verewigen. Und so steht ihr jetzt ebenso vor der Jugend wie damals das Alter vor euch und bringt selber wieder eben die nämlichen Dummheiten gegen sie vor, die euch damals an den Alten so erbitterten. Keine fehlt. Sogar, wenn ihr schließlich gar nichts anderes mehr wißt, die läppische Verleumdung nicht, es sei den Jungen ja nicht »ernst«, sondern bloß darum zu tun, aufzufallen um jeden Preis, den Bürger zu verblüffen, Ärgernis zu geben, sie seien nicht einmal Narren, sie seien Schwindler.
Tiger. Bronzerelief aus Benin.
Es gibt in der Kunst stets auch Schwindler.
Vielleicht mehr als Künstler. Wer den Begriff weit genug und die Forderung der Echtheit sehr strenge nimmt, kann mit einem gewissen Schein von Recht auch Praxiteles einen Schwindler zu nennen wagen, und wenn man ihn etwa an der Innerlichkeit Botticellis oder Grecos mißt, auch Raffael. Ja der richtige Puritaner der Kunst könnte finden, daß, wer überhaupt Inneres äußert, immer schon bis zu einem gewissen Grade »schwindeln« muß. Und so wird das wohl auch unter Impressionisten ja zuweilen vorgekommen sein. Keine Schule, keine Richtung ist davor sicher, in allen wird geschwindelt, aus Eitelkeit, aus Bequemlichkeit, aus Prahlerei, aus Übermut, ja oft auch aus einer Art Schadenfreude. Ich weiß nicht einmal, ob überhaupt irgend ein Künstler jemals ganz davor sicher war. Keiner ist immer in der Fülle. Den erhabenen Stunden folgen Ermattungen, Versagungen. Die schaffende Kraft tröpfelt dann nur, da hilft er ihr denn ein bißchen nach. Es ist auch gar nicht ausgemacht, daß er nicht recht hat, ein bißchen nachzuhelfen, ein bißchen zu schwindeln. Goethe hat nie geschwindelt, fast nie. Wenn es bloß tröpfelte, ließ er es eben bloß tröpfeln, unverhohlen. Es wäre zuweilen aber vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn er lieber ein bißchen geschwindelt hätte. Es wäre für das Werk gewiß oft besser gewesen. Und man muß schon Goethe sein, um sein eigenes Werk so gering achten zu dürfen, daß einem wichtiger ist, nur sich selber stets ganz rein zu halten; den mittleren und gar den kleinen Künstlern geht das Werk vor, um seinetwillen fälschen sie sich und machen mehr aus sich, als sie sind, oder doch mehr, als sie gerade jetzt sind, mehr, als ihnen der Augenblick gibt. Ja je länger man darüber nachdenkt, was denn eigentlich in der Kunst schwindeln heißt, je strenger man die Frage nach der Gesinnung des Künstlers stellt, desto problematischer wird alles.
Zunächst ist es einmal gewiß, daß höchstens der Künstler selber sagen kann, ob er geschwindelt hat, und wo. Auch der Künstler selbst wird es nicht immer sagen können. Und wenn er es sagen kann, ist es unwichtig; denn wenn es ihm nur erst einmal bewußt wird, daß er schwindelt, leidet er ja viel weniger daran, als wenn er unbewußt schwindelt. Sehr oft aber sieht wie geschwindelt aus, was vielmehr Hilflosigkeit ist, und zwar eine Hilflosigkeit aus innerem Überschuß. Arme Künstler haben es selten nötig: aber wen die Fülle der inneren Forderungen überdrängt, der kann sich in der Hast, alles zu fassen, in der Angst, nur ja nichts zu verlieren, vor lauter Empfindung bisweilen bloß mit einer Verworrenheit helfen, und es wirkt dann als Flüchtigkeit, was Flucht ist: Flucht vor dem zu reichen Segen; es wirkt als Untüchtigkeit, was gerade die reinste Gesinnung ist, die sich nichts, aber auch gar nichts schuldig bleiben will. Das kann kaum der Künstler selbst seinem eigenen Werk ansehen. Wie will es erst ein anderer, von außen? Jedoch die Frage geht noch tiefer; es muß nämlich erst auch noch untersucht werden, ob wir nicht überhaupt, was das Kunstwerk betrifft, die Gesinnung des Künstlers überschätzen. Der andächtige Künstler ist uns wert, er verdient es auch menschlich. Dürfen wir aber deshalb auch das Werk nach der Andacht seines Künstlers bewerten? Es gibt nichts Andächtigeres als Hausmusik, wie Dilettanten sie noch in kleinen Städten pflegen; Beethoven wird da mit Tränen in den Augen gespielt. Der Virtuose, der in der großen Stadt konzertiert, weint höchstens über die Konkurrenz. Jene haben gewiß die reinere Gesinnung, aber dieser hat die besseren Finger. Es gibt weihevolle Schauspieler, denen aber die Rührung im Halse stecken bleibt, und Windhunde, die, während ihr leidumflorter Blick den Zuschauer unten betörend entrückt, sich damit unterhalten, ihren Partner oben, gar wenn es einer von den weihevollen ist, mit Witzen aus dem Text zu bringen. Ich möchte wetten, Liebermann hat sein ganzes Leben noch nichts von der Ergriffenheit gespürt, mit der irgendein ungeschicktes Mädl Blumen für die Großmama, die bange Braut ein Kissen, »Nur ein Viertelstündchen!«, für den Geliebten stickt. Wer ist nun der Echte: der Beethoven beweinende Dilettant oder der Virtuose, der dabei schon an die Abrechnung mit dem Agenten denkt, der Weihevolle oder der Windhund, die Braut oder Liebermann? Was ist überhaupt »echt«? Und wann hat der Künstler echt zu sein? Im fruchtbaren Augenblick des ersten Einfalls oder in den langen Stunden der Ausführung? Aber wo hört denn der Einfall auf, wann wird er zur Ausführung, und muß die Ausführung nicht immer wieder von neuem zum Einfall werden?
Wir sind immer schon mißtrauisch, wenn ein Künstler auf einen äußeren Anlaß hin schafft. Aber Goethe, der Dichter der Gelegenheit – ? Es widerstrebt uns, daß ein Künstler auf Bestellung schafft. Aber Raffael und Michelangelo, Greco und Velasquez, Rubens und van Dyck haben auf Bestellung geschaffen! Mit der Echtheit wird heute eine schreckliche Verlogenheit getrieben. Wir sind ja schon so weit, es dem Künstler zu verdenken, wenn er sich überhaupt etwas vornimmt. Ganz unbewußt wollen wir ihn, nachtwandelnd, von Gesichten überfallen; nur den Rauschkünstler, den Traumkünstler, den Wahnkünstler wollen wir! Aber der Rausch-, Wahn- und Traumkünstler Wagner, in so vielen Hoffnungen getäuscht, müde, bloß immer »stumme Partituren« zu schreiben, in seiner Verzweiflung fast daran, sich aufzugeben, entschloß sich eines Tages, mitten in der Arbeit am Ring, lieber einmal eine »Oper für die Italiener« zu machen, ein »leichter und eher aufführbares Werk zu liefern« und – es wurde der Tristan daraus. Was daraus wird, entscheidet. Was der Künstler bewußt »liefern« will, ist gleichgültig, wenn dann der Tristan daraus wird. Es kommt offenbar nicht so sehr darauf an, die rechte Gesinnung zu haben, als eine Kraft, der auch eine schlechte Gesinnung nichts anhaben kann.
Vor dem Zulauf der Anschmecker, der immer Aufgeregten, der Lüsternen, kann sich der Expressionismus so wenig schützen, als es der Impressionismus konnte. Sie sind überall dabei, das bleibt keinem erspart. Die Prüfung zu bestehen, muß er stark genug sein. Warum aber laufen sie jetzt dem Expressionismus zu, und nicht mehr dem Impressionismus? Sie sind unerfreulich, doch eins haben sie: sie wittern die Zeit, sie spüren es in den Knochen, wenn das Wetter umschlägt. Und Freunde, das Wetter schlägt um, der Mensch schlägt wieder einmal um: er stand lange nach außen, jetzt kehrt er sich wieder nach innen. Ihr möchtet euch einreden, es sei bloß eine Mode. Das scheint es in den großen Städten nur. In den großen Städten erscheint alles zunächst als Mode. Aber seht euch die Jugend im tiefen Deutschland an, die von keinen Moden weiß! Es ist noch gar nicht lange her, da kam ich in eine ganz kleine deutsche Stadt, und bei mir erschien ein junges Mädchen mit der Bitte, mir ihre Bilder zeigen zu dürfen. Sie sei keine Malerin von Beruf, sie male nur aus Lust, die Eltern hätten auch eigentlich nichts dagegen; aber was sie male, das empöre die ganze Verwandtschaft so, daß der Vater nun darauf dringe, eine so beschämende, sie selbst und die ganze Familie nur dem Gelächter preisgebende Beschäftigung einzustellen; es sei denn, daß sie verspreche, fortan vernünftig zu malen, was sie doch aber nicht könne; denn sie könne beim besten Willen nicht anders malen und so wünsche sie, schon an sich ganz irre geworden, ja fast verzweifelnd, einmal von einem Fremden zu hören, ob sie denn wirklich wahnsinnig sei! Ich kam in ihr Atelier, und es war mir seltsam, in dieser fernen kleinen Stadt im Osten plötzlich wie mitten in Paris zu sein: die junge Dame malte Matisse, ja fast bis zu Picasso hin. Sie war niemals aus ihrer Heimat fort gewesen, sie kannte die neue Malerei bloß aus Kunstzeitschriften. Sie machte sich gar keine besonderen Gedanken darüber, sie hatte nicht vor, modern zu malen. Sie malte, wie sie malen mußte, sie konnte nicht anders. Sie hätte so gern den Eltern zuliebe gemalt, es gelang ihr aber nicht, zu ihrer hellen Verzweiflung. Da sprach ich ihr Trost zu. Zwar stehe mir kein Urteil über ihr Können zu, dies eine jedoch wüßte ich: ein Maler ist, wer malen muß, nicht anders malen kann, als er malt, und sich dafür, wie er malt, hängen zu lassen bereit ist. Ja das sei sie, sagte sie, mit einem wehmütigen Lächeln. Dieses Lächeln kann ich nicht vergessen. Daß einer in der großen Stadt alles versucht, um aufzufallen, Lärm zu schlagen, Widerspruch, Spott, Erbitterung und dadurch Aufsehen zu erregen, daß er deshalb schließlich nur um jeden Preis ganz anders malt, als bisher je gemalt worden ist, und daß er also auf den Einfall kommt, den Impressionismus einfach einmal umzudrehen, das wäre diesem ungefährlich. Aber dieses liebe stille Menschenkind im Norden, das ja mit seiner Malerei gar nichts will, das bloß für sich malt, das nicht an Ruhm und Reichtum denkt! Es hätte vor zwanzig Jahren impressionistisch malen müssen. Heute muß es expressionistisch malen, es muß.
Warum? Das überlegt einmal, Freunde! Dann werdet ihr den Expressionismus erkennen.
Ortenberger Altar. Mittelrheinisch um 1415