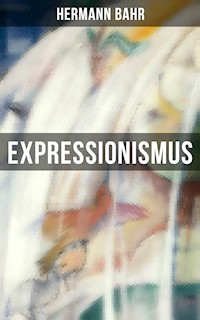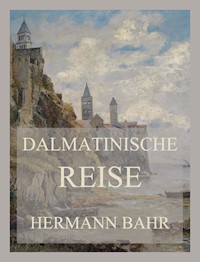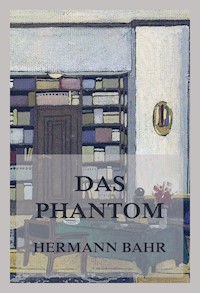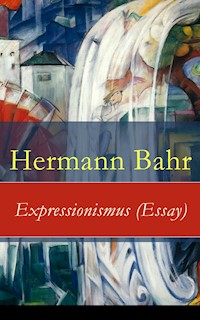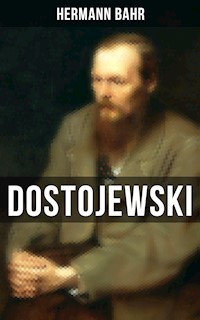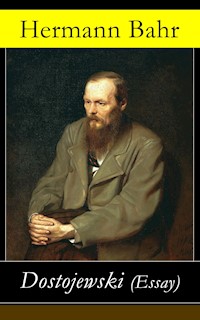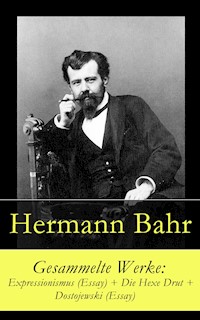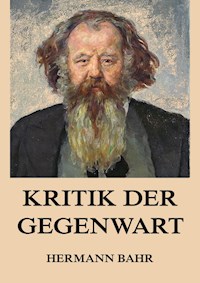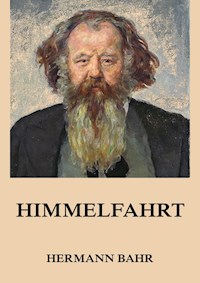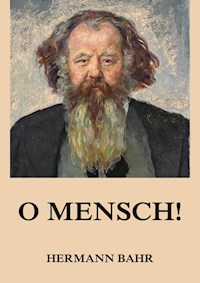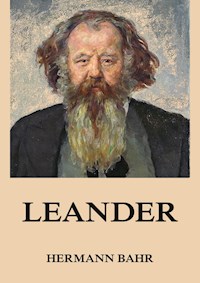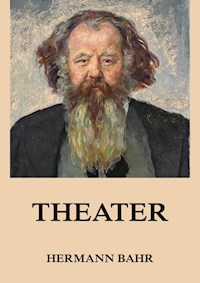0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
In 'Die Hexe Drut' taucht der Leser in eine faszinierende Welt voller Mystik und Magie ein. Hermann Bahr entführt den Leser in eine zeitlose Erzählung über die Hexe Drut, die in einem kleinen Dorf lebt und von den Bewohnern gleichermaßen gefürchtet und bewundert wird. Bahr verwebt geschickt Realität und Fantasie, wodurch eine düstere Atmosphäre entsteht, die den Leser in ihren Bann zieht. Durch seinen bildhaften und detailreichen Schreibstil erschafft Bahr eine Welt, in der das Unglaubliche zur Normalität gehört und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die Hexe Drut
Books
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
Hermann Bahrs Leben und Werk sind reich an Wandlung, nicht minder reich an Geist, Größe und Kraft in allen Phasen dieses Wandlungsganges. Immer und überall war sein Leben Voraussetzung für sein Werk, war er ein werbender Streiter für seinen Glauben, nämlich für das, woran er glaubte und wofür er kämpfte. Wie stark muß eine Begabung sein, die niemals über den Dingen steht, sondern mitten unter ihnen, die ihrem Schaffen stets wesensnah und herzensverwandt ist, und auf dem beschwerlichen Wege des warmblütigen subjektiven Erlebens oder Erfühlens zur objektiven dichterischen Gestaltung gelangt; wie gefestigt eine Persönlichkeit, die alle diese Wandlungen innerlich rein und äußerlich heil zu überwinden und zu überstehen vermochte.
Hermann Bahrs Leben: Als Sohn schlesischer Eltern im Juli 1862 in der oberösterreichischen Donaustadt Linz geboren, in jungen Jahren vielgereist, bald als Schriftsteller und Journalist am Leben seiner Zeit rege Anteil nehmend, verbrachte er zwei Jahrzehnte in Wien, wo er vornehmlich als Dramatiker, insbesondere als Lustspieldichter, zu Erfolg und Ansehen gelangte, bis der Fünfzigjährige sich noch vor dem Kriege zunächst nach Salzburg wandte, um sich dann endgültig in München niederzulassen, wo er heute noch, fern dem literarischen Marktgetriebe, in größter Zurückgezogenheit lebt und wirkt. Seine künstlerische Wandlung führt von der Verkündung des Naturalismus über die Neuromantik, später an realistischen Anklängen vorbei, zur psychologischen und schließlich zur ethischen Dichtung, getragen von tiefem religiösen Glauben, beherrscht von bekenntnishaftem Drang nach Verinnerlichung. Die politischen Wandlungen reichen vom Sozialismus am Beginn, über anarchistische Sympathien hinweg, an nationalen und aristokratischen Bestrebungen vorbei, bis sie über den Humanismus auslaufen und münden in strenggläubigen Katholizismus, zu dem sich der geborene Katholik und spätere Freigeist im Jahre 1912 endgültig bekennt. Von diesem Leben läßt sich sagen, daß es wahrlich ein weites Feld erfaßt und durchdringt.
Hermann Bahrs Werk: Von der Herausgabe einer Wochenschrift in Wien, über Aufsätze und Flugschriften, über Gründung einer Kunstzeitschrift, über Studien und Tagebuchaufzeichnungen, zu einem der geistreichsten und tiefsinnigsten Essayisten seiner Zeit. Vom Regisseur am Deutschen Theater in Berlin und späteren Burgtheaterdirektor in Wien zu einem der erfolgreichsten und begehrtesten Bühnendichter eingangs des Jahrhunderts, dessen Komödien über fast alle deutschen Bühnen gingen und von denen hier nur »Das Konzert«, »Der Star«, »Der Krampus«, »Die gelbe Nachtigall« erwähnt seien. Ein Kenner und Könner des Theaters, stellte er vielfach Stoffe aus dem Bühnenleben in den Umkreis seiner Betrachtung und Befassung. Auch sein trefflicher Roman »Die Rahl«, der erste in der Folge des zur Lebensaufgabe gestellten großen Romanzyklus, erwählt in der Titelheldin eine große Schauspielerin zur tragenden Gestalt, um die Welt des Theaters einer nicht minder verkleideten Umwelt gesellschaftlicher Kräfte im alten Österreich entgegenzustellen.
Die vielseitige Entwicklung dieses Dichters in mannigfachen Kunstzweigen war aufzuzeigen und nachzuzeichnen, wenn auch nur flüchtig und andeutungsweise, um zu seinem Hauptwerk zu gelangen – zu dem auf zwölf Romane bemessenen Zyklus, wovon bisher die Hälfte, also sechs Romane, vorliegt – und um damit den Leser zum tieferen Verständnis des vorliegenden Romans einfühlend zu geleiten, »Drut« ist der zweite der bisher erschienenen Romane, die völlig unabhängig voneinander jeder für sich bestehen, übrigens auch in Stoffwahl, Problemstellung und Weltanschauung durchaus verschieden sind, zeitlich, räumlich, gedanklich den Wandlungen ihres Schöpfers angepaßt. Der ursprünglichen Absicht, ein zusammenfassendes Kolossalgemälde österreichischer Kultur und Sitte im Brennpunkt einer entscheidenden Epoche zu schaffen, traten äußere und innere Umstände wenig förderlich entgegen: Österreich und das darin geschilderte Zeitalter versanken aus flammender Gegenwart, die dem Dichter und seinem Werk als stärkster Antrieb diente (und darum beider Wert erhöht}, in erloschene Vergangenheit; – der Dichter aber und sein Werk gelangten seither von der Schilderung einer Kultur zur Verkündigung einer Religion, die wie jeder Glaube eine innerliche Umstellung fordert (und darum beider Wert nicht mindert).
Der Roman von der Hexe Drut vermittelt in künstlerischer Vollendung ein unübertreffliches, in der Literatur unserer Tage jedenfalls unübertroffenes Kulturbild des alten Österreichs im Zeitalter des Verfalls, wie es in unser aller Gefühl heute noch nachklingt, in seinen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen das gesamte Deutschland berührt. Mit unheimlicher Voraussicht wird in diesem Roman der damals bevorstehende und seither eingetretene Zusammenbruch in Gestalt einer altösterreichischen Beamtentragödie erlebt und erlitten. Ein zur herrschenden Schicht zählender Staatsbeamter, jung und hoffnungsreich, verstrickt sich durch eine reine Liebe in das tödliche Netz einer dünkelhaften, dummdreisten Staatsbürokratie, die Land und Untertan zu Tode regieren durfte. Der Untergang des Opfers, behaftet mit den Vorzügen und den Schwächen des österreichischen Menschen, der ein Spielball dunkler Mächte wird, ist vom Zauber der österreichischen Landschaft umflossen. Dahinter die meisterhafte Schilderung des edelsten Zuchtgewächses einer angefaulten Staatsgewalt: die Fratze des österreichischen Hofrats, unsterblicher Typ, der aus der Zeitgeschichte in die Weltgeschichte eingeht. »Der Hofrat«, so könnte dieser Roman vom österreichischen Leben und Sterben in leuchtenden Lettern überschrieben sein; denn er gibt Begriff und Geschmack einer Gattung, die, wenn schon nicht in Ansehung ihrer Verdienste als Totengräber einer alten Kultur, so doch um des bleibenden Wertes dieses ihres Romans wegen, den Schritt vom Lächerlichen zum Erhabenen vollzieht. Das unvergängliche Abbild dieser Gattung konnte nur ein Dichter mit einer großen Liebe im Herzen zeichnen.
»Drut« entstand im Jahre 1908 und ist 1909 erschienen, ohne daß dieser beste Roman Hermann Bahrs – ich wage zu behaupten: einer der besten und schönsten der zeitgenössischen deutschen Literatur überhaupt – bisher neu aufgelegt wurde. Darin liegt ein nicht weiter verwunderliches Symptom einer Zeit, die hinter dem Flüchtigen herjagt. Nach einer Pause von zwei Jahrzehnten, nach beinahe ebenso langer Vergessenheit, wird der Roman unter dem Titel »Die Hexe Drut« im Rahmen dieser Buchreihe, die sich ausschließlich in den Dienst lebender Dichter stellt und um die Verbreitung ihrer Meisterwerke in billigen und dabei würdigen Ausgaben bemüht ist, gleichzeitig mit dem Roman von Arthur Schnitzler, des anderen großen österreichischen Dichters, als Ergänzung der zunächst vorgesehenen Reihe deutschsprachiger Werke und in einer für Deutschland ungewöhnlich hohen Erstauflage herausgebracht. Das Wagnis besteht, das Ergebnis ist ungewiß. Doch ich hege den festen Glauben, daß allein das Gute sich auch im Schrifttum durchsetzen und früher oder später recht behalten wird.
Die »Bücher der Epoche« gehen nicht auf den schreienden Tageserfolg aus. In den bleibenden Werten, die sie vermitteln dürfen, suchen sie Geltung und Bewährung. Verlag und Herausgeber sind sich des neuartigen Versuches bewußt, ihren Nutzen an dem inneren Gewinn des Lesers aus ihren Darbietungen messen zu wollen. Dieser Gewinn wird im vertrauten Umgang mit dem vorliegenden Roman des jungen Hermann Bahr wahrlich nicht gering sein.
Berlin, im September 1929.
Lyonel Dunin.
Vorwort zur neuen Ausgabe.
»Den Zorn des Achill singe mir!«, fleht Homer zu Beginn der Ilias, und wenn er dann an die Odyssee geht, bittet er auch zunächst wieder die Muse: »Den Mann nenne mir, den vielgewandten!« Beidemal gesteht der Dichter also ein, daß er selbst nichts zu sagen hat, es muß ihm erst eingesagt werden, eingesagt von oben. Auch Dante versichert sich zunächst beim Eingang zu seiner »Monarchie«, keiner Dichtung, sondern einer gelehrten, einer politischen Schrift, der Hilfe von oben, er gesteht:
»Arduum quippe opus et ultra vires aggredior, non tam de propria virtute confidens quam de lumine Largitoris illius, qui dat omnibus affluenter et non improperat.«
Die Dichter aller Zeiten wiederholen das Zitat aus Cicero, der mit Berufung auf Demokrit und Plato verneint, »sine inflammatione animorum existere posse et sine quodam afflatu quasi furoris« – ohne Furor, ohne den Anfall einer gewissen Raserei, ohne Geistesentflammung gibt es keinen Dichter! Aber auch schon der platonische Sokrates erklärt im Phädrus alle Bemühungen des Dichters für ohnmächtig, »der bloß durch die Kunst allein, ek technes«, dichten zu können meint, dazu »Mouson mania«, ohne, wie Wieland übersetzt, »Musenwut«; denn immer, versichert Sokrates, bleibt das Gedicht »tu sophronuntos«, das Gedicht des Bewußten, weit hinter den Gedichten der »Rasenden« zurück! Und wenn William Blake einmal versichert: »Ich bin nur der Sekretär, die Autoren sind in der Ewigkeit«, so spricht er damit das Gefühl aller Schaffenden aus: diktiert wird ihnen, sie können nichts dafür, sie haben es bloß aufzunehmen und weiterzugeben; Dolmetsch ist der Künstler, ein Stromleiter, ein Draht, durch den »das Geschenk von oben« den Sterblichen zugeführt wird. Der Künstler wird selber davon ganz unversehens überfallen, es überkommt ihn, überwältigt ihn, und bevor er es noch recht weiß und sich von seinem Staunen, ja Schrecken kaum erholt, kaum wieder auf sich besonnen hat, ist er schon ergriffen; dann aber kommt es freilich noch darauf an, daß er nun aber auch zugreift, daß der Ergriffene nun selber ausgreift, nach seiner Ergriffenheit greift, um sie festzunehmen und festzuhalten. »Dreingreifen, packen ist das Wesen jeder Meisterschaft«, heißt in jenem herrlichsten Jugendbrief Goethes an Herder. Ganz Demut ist er da, mit dankbar gefalteten Händen, denn er weiß, es muß von oben kommen, selber vermag er nichts; zugleich aber taumelt seine Demut vor Stolz im Rausch des eigenen Kraftgefühles: »Über den Worten Pindars »epikratein dynasthai« ist mir's aufgegangen!« So hat er nun die beiden Elemente der Kunst in seiner Empfangenes gestaltenden Hand. Er war zweiundzwanzig, als er dies schrieb, aber aus seinem dreiundachtzigsten Jahr haben wir ein Briefkonzept, worin es heißt: »Die wahre Produktionskraft liegt doch am Ende immer im Bewußtlosen, und wenn das Talent noch so gebildet ist – freilich alsdann desto besser.« Was der heiße Jüngling stürmisch ahnte, wiederholt bedächtig der erfahrene Greis. Des Menschen eigenes Inneres hat er immer als »unvollständig« erkannt. Es vermag nichts ohne die »Gabe von oben«, ohne das »unerhoffte Geschenk von oben«, es ist dabei selber nur »als ein Werkzeug einer höheren Weltregierung zu betrachten, als ein würdig befundenes Gefäß zur Annahme eines göttlichen Einflusses«. Aber freilich sind solche Werke, worin dem, was der Dichter empfängt, die gestaltende Kraft genau so zugewogen ist, daß alles Empfangene sich in Gestalt verwandelt und kein Überschuß der gestaltenden Kraft müßig zurückbleibt; solche vollkommenen Werke sind sehr selten. Das höchste Beispiel eines bloß das Diktat von oben auffangenden Gedichtes, in dem der Wille des Dichters durchaus verstummt, ja selber sozusagen gar nicht mehr vorhanden, sondern der Dichter nur noch eine Traufe für den zuströmenden Einfall ist, haben wir an Rimbauds »Bâteau ivre«, vielleicht dem schönsten Gedicht französischen Lautes. Der Dichter selber regt sich darin gar nicht, er ist zum Diktaphon geworden. In seiner Straßburger Zeit hätte Goethe sich für ein Gedicht in der Art des »Bâteau ivre« gar nicht laut genug begeistern können. Erst allmählich ward er inne, daß wenngleich »jede Form, auch die gefühlteste, etwas Unwahres hat«, Form dennoch unentbehrlich ist, denn »sie ist ein für allemal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben wird, wird's nicht erjagen; es ist, wie der geheimnisvolle Stein der Alchimisten, Gefäß und Materie, Feuer und Kühlbad. So einfach, daß es vor allen Türen liegt, und so ein wunderbar Ding, daß just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon machen können.« Grillparzer hat einmal gesagt; »Der rechte Dichter ist nur der, in dem seine Sachen gemacht werden.« Wenn aber dann, früher oder später, die Sachen von selbst gemacht zu werden aufhören, wenn alles »Simulieren«, wie Grillparzer diesen Zustand der Erwartung des Segens von oben zu nennen pflegte, nichts mehr hilft, dann wird der Dichter gewahr, wie gering sein eigenes Verdienst und daß er bloß ein Empfänger ist. »Meine Gottheit ist die Inspiration«, versicherte Grillparzer immer wieder, und er wurde zum mürrischen Hypochonder, als es von Inspiration in ihm nur so tröpfelte. Laube konnte nicht verstehen, warum Grillparzer jedes Gespräch über sich und seine Dichtungen abwies. Wenn er sich doch einmal darauf einließ, so sprach er, als ob er in Person mit dem Dichter Grillparzer gar nichts gemein hätte. Den Theatermann Laube befremdete das, jeder Dichter aber weiß, daß er bloß ein Gefäß der Inspiration und für diese nicht verantwortlich ist. Der Dichter hat vor den andern gar nichts voraus, als daß ihm zuweilen etwas einfällt: es fällt in ihn hinein, er kann nichts dafür, es ist nicht sein Verdienst. Er muß nur mit dem Einfall dann auch etwas anzufangen wissen, bevor Besuch der Inspiration sich wieder entfernt.
Hermann Bahr.
Erstes Kapitel.
Der neue Bezirkshauptmann hielt in der Türe noch einmal, sah forschend auf den alten Amtsdiener zurück und sagte: »Ja, daß ich nicht vergess'! Sagen's einmal! Können Sie ein Radl putzen?«
Der Amtsdiener antwortete gekränkt: »Aber Herr Baron! Die Herren haben doch ein jeder ein Radl. Wär' net übel!«
»Also da kommen's dann zu mir, heute noch, Kreuzgasse vier –«
»Ich weiß«, bestätigte der Diener. »Ich weiß, Herr Baron.«
»Holen's das Radl, richten Sie's ordentlich her und stellen Sie's hier ein. Verstanden?«
»Jawohl, Herr Baron«, sagte der Diener.
Der Bezirkshauptmann trat auf ihn zu, tippte mit dem Finger auf seinen Kragen und blies ihm den Staub weg. Und er sagte: »Und dann noch etwas! Hören Sie zu! Wie haben Sie gesagt, daß Ihr Name ist?«
Der Amtsdiener meldete: »Pfandl, Herr Baron! Johann Pfandl.«
Der Bezirkshauptmann sagte: »Also, mein lieber Pfandl, merken Sie sich, daß ich hier kein Herr Baron bin, sondern der Herr Bezirkshauptmann. Im Amt gibt's keinen Baron und keinen Grafen, das könnten's schon wissen. Verstanden?«
»Jawohl, Herr Bezirkshauptmann!« sagte der Diener. »Ich habe nur gemeint, weil –«
»Meinen's nix, verehrter Herr Pfandl«, sagte der Baron. »Das müssen Sie sich bei mir abgewöhnen. Meinen's nix, sondern tun's, was man Ihnen sagt. Dann werden wir ganz gute Freunde sein, lieber Pfandl. Verstanden?«
»Jawohl, Herr Bezirkshauptmann«, sagte Pfandl.
»Und jetzt geben's mir noch ein Feuer,« fuhr Baron Furnian fort, »und dann sagen's den Herrn, daß ich morgen in der Früh um sieben komm'.«
»Um sieben?« fragte Pfandl bestürzt.
Der Baron zündete seine Zigarette an und, Ringel blasend, wiederholte er: »Um sieben, Morgenstund' hat Gold im Mund, lass' ich den Herrn sagen. Servus!«
Die Frau Pfandl fragte ihren Mann aufgeregt: »No, wie is er?«
Der Herr Pfandl sagte, gefaßt: »Wie's halt im Anfang alle sind. Da glaubt ja ein jeder, jetzt muß alles anders werden. Abwarten. Wird's auch noch billiger geben. Mir is gar net bang.«
Die Frau Pfandl sah durchs Fenster. Als der Baron auf die Straße trat, schlug sie die Hände zusammen. »Jessas! So ein schöner Mensch! Nein, so ein schöner Mensch!«
»Kurze Hosen und Wadelstrümpf', ein grünes Hütl und eine scheckige Westen,« sagte Herr Pfandl, »da seid's halt gleich verloren. Weiberleut, Weiberleut! Schad't aber gar nix, wenn für die Fremden einmal ein biss'l was g'schieht. Der kann eine Attraktion für den ganzen Ort werden. Der hat's dazu. Der wird's aufmischen. Und wir können's brauchen.«
»So ein schöner Mensch«, wiederholte Frau Pfandl, dem neuen Bezirkshauptmann nachsehend, der langsam die Straße hinaufschritt, dann aber, wo der Weg sich verengend, zur Brücke biegt, an der Ecke hielt und, die Beine gespreizt, die Hände in die Hüften gestemmt, rauchend stand. »So ein schöner Mensch! Um den wird's gut zugeh'n, Jessas! Und wär doch wirklich schad', wenn's ihn einfangen möchten.«
Der Herr Pfandl lachte. »Da wär' manche, die möcht'. Armer Kerl! Schaut mir aber nicht aus, als ob er aus der Hand fressen tät. Um sieben in der Früh, ujäh! No, unseren zwei Hascherln gönn ich's. Und in acht Tagen is ja doch alles wieder, wie's war. Das kennt man schon.«
Die Frau Pfandl, immer noch zum Fenster hinaushängend, sagte: »Der kann doch noch keine dreißig sein! Ein G'sichtl wie ein Student.«
»Zweiunddreißig«, sagte Herr Pfandl.
»Net möglich«, rief Frau Pfandl.
»Zweiunddreißig«, wiederholte Herr Pfandl. »Ich weiß's von den Hascherln. Die sind schön bös. Der Graf Sulz schimpft den ganzen Tag: Ein ganz gewöhnlicher kleiner Baron, bloß weil er die rechte Hand vom Minister ist, Hanba! Und dann haben's gesagt, man sieht eben, daß wir schon mitten in der Revolution sind. Und an allem ist der verflixte Döltsch schuld. Aber der Kleine hat gelacht und hat gesagt, daß es nichts macht, weil in Österreich noch nie ein Baum in den Himmel g'wachsen ist, das gibt's nicht! Jetzt mußt aber auch nur wissen: Zwanzig Vordermänner hat er übersprungen, dank schön. No, wird sich halt erst zeigen, ob er so weiter springt. Warten wir's ab. Da verstaucht sich einer leicht.«
»Ein so ein schöner Mensch«, jammerte die Frau Pfandl, das Fenster schließend, da der Baron jetzt um die Ecke ging, zur einsamen Promenade hin.
Es war Mai. Der Ort lag noch ganz still. Die Villen zu, die Wege leer, der Wald stumm. Nur die alte Exzellenz Klauer ging spazieren, ganz allein Aber der Postverwalter Wiesinger, der hiesige Schöngeist, sagte fein: Der Klauer ist jene Schwalbe, die noch keinen Sommer macht. Manchmal drangen ein paar Touristen ein, stiegen in der Post ab, langweilten sich und entflohen. So blieb's, bis es heiß wurde, die Schulen geschlossen waren, die Städte verödeten. Wenn dann im August der Kaiser kam, wurde hier drei Wochen Residenz gespielt. Und im September war alles wieder aus. Dann tauchten behutsam die Hiesigen wieder aus ihren Verstecken auf, in welche sie sich vor dem Lärm und Taumel und Schwulst der Fremden ängstlich, mißtrauisch und neidisch verkrochen hatten. Und wenn es dann einer wagte, wieder getrost über die Gasse zu gehen, öffneten sich nun wieder alle Fenster: man hatte seinen Schritt gehört und sah nach, wer es wäre.
Der neue Bezirkshauptmann ging über den Platz, zur Promenade hin, den Fluß entlang. Wie verwunschen lag der Ort. Der Fluß rauschte, die Wiesen rochen, der Wind war hell und herb. Und Furnian ging, und es war ihm seltsam, so zu gehen, gemächlich vor sich hin. Und er sagte sich: Aber wenn du willst, kannst auch umkehren, oder setz' dich dort auf die Bank, wenn du willst, um ein bissel auszuruhen, oder du gehst jetzt gleich den ganzen Ort ab, du bist ja jetzt sein Herr, es gehört ja rundherum alles dir, moralisch wenigstens, und du kannst jedenfalls endlich einmal machen, was du willst, es hat dir hier kein Mensch was zu sagen, Herr Bezirkshauptmann! Und er ging und freute sich, wie beflissen man, als er vorbeikam, aus den Ländern schoß, der Apotheker Jautz und der Herr Riederer, Kaufmann und Bürgermeister, und der reiche Fleischer Fladinger, mit eiligen Buckerln alle: Die Ehre, Herr Bezirkshauptmann, habe die Ehre! Und er ging und freute sich, wenn über ihm ein neugieriges junges Gesicht ans Fenster fuhr, mit den Augen nach ihm schnappend, um gleich wieder, erschrocken, daß er es sah, lachend zu verschwinden. Der Fluß rauschte, die Wege glänzten, tanzend war der Wind, und die jungen Wiesen rochen so gut und die geschäftigen Menschen grüßten so tief und das Lachen hinter den Fenstern klang so froh. Er ging und freute sich.
Da hörten schon die Häuser auf. Solche Wiesen, in ihrer ersten jungen Kraft, sah er noch nie! Mit frechen gelben Ranunkeln, feierlichen Glockenblumen und den dichten, nickenden, schwirrenden, surrenden, hohen Gräsern. Und ein leises Klingen ging mit ihm, vom Walde kam ein Rauschen her, und Flur und Feld und dieses ganze Land, in der Sonne glänzend, schien ihn zu grüßen. Er blieb stehen und sah auf den lieben kleinen Markt zurück. Er hatte das Gefühl, es wird ganz hübsch sein. Und in ein paar Wochen kommen ja die Fremden. Geputzte Wienerinnen, lustige Gouvernanten, Amerikanerinnen mit wehenden Schleiern. Wer weiß? Und dann kommt der Hof. Wer weiß? Er muß lachen. Der Döltsch hatte ihm noch beim Abschied gesagt: »Die Hauptsache ist aber, gehen Sie nie ohne Regenschirm aus! Es regnet dort immer. unversehens, und wenn Sie ein biss'l Glück haben, steht plötzlich der Fürst von Bulgarien vor Ihnen, hilflos naß, und Sie bieten ihm den Schirm an und es wird bekannt, daß Sie ein umsichtiger Beamter sind. Mit den Orden geht's aber wie mit den Millionen: nur der erste ist schwer. Also schauen Sie, daß Sie einen Regenschirm und Glück haben. Dann kann's Ihnen nicht fehlen.« Ja, er versteht, was der Minister meint. Und er wird es sich wahrlich nicht fehlen lassen. Das hat er ja gelernt. Schöne Frauen und der Hof, es kommt jetzt nur auf ihn an: ob er es versteht, Glück zu haben. Aber das Glück ist ein Weib, man muß es nur nehmen. Das will freilich auch gelernt sein. Er wird sich eben jetzt ein bißchen üben, im Nehmen. Schon, um sich die Zeit zu vertreiben. Denn, sagt er sich übermütig, wir sind ja unter uns, Herr Bezirkshauptmann, gestehen Sie, daß Sie von Geschäften keinen Dunst haben, was auch gar nicht Ihre Absicht ist, sondern Sie wollen Karriere machen, und dazu, hat Ihnen der Minister ausdrücklich gesagt, wird es noch am besten sein, wenn Sie sich bemühen, die Selbstverwaltung möglichst wenig zu stören! Nun, das kann man ja. Freilich, im Winter wird's etwas trist werden. Die zwei jungen Herren, die ihm zugeteilt sind, der böhmische Graf Sulz und der freche Derzer, kleiner Bierbaron mit großem Rennstall – nein, danke; den hochmütigen Schlag kennt er: das macht Dienst als Amateur, wie's nach Monte Carlo oder auf die Löwenjagd fährt, um dabei gewesen zu sein, der Dienst gehört ja zu den noblen Passionen. Nein, danke. Und der Herr Bürgermeister und der Herr Apotheker und der Herr Notar und der Herr Postverwalter und der Herr Salinendirektor und gar ihre Damen, mit solchen Hüten, wie sie vielleicht in zwanzig Jahren wieder einmal modern sein werden, weil die Mode doch ein Rad ist – na, sehr aufregend kann er sich das auch nicht denken. Aber schließlich, er wird rodeln, er wird Ski laufen, und wenn dann die stillen langen Abende sind, nimmt er ein Buch und legt sich hin und liest, draußen schneit's und im Ofen knackt's. Das hat er doch noch nie gehabt. Und wenn's ihn freut, liest er die ganze Nacht, und wenn's ihn nicht mehr freut, hört er auf, und er tut überhaupt nur, was ihn freut. Er kann ja jetzt tun, was er will. Zum erstenmal. Er ist ja jetzt frei. Er ist sein eigener Herr. Zum erstenmal. Er kann's eigentlich noch gar nicht glauben. So seltsam ist es ihm. Fast ein bißchen unheimlich sogar. Er sagt es sich immer wieder vor. Sein eigener Herr und frei; und kann sich sein Leben einrichten, wie er will. Zum erstenmal. Auf der ganzen Fahrt, nach diesen öden Tagen beim Vater, hat er es sich vorgesagt. Und jetzt ist es wirklich wahr. Und er bleibt wieder stehen, sieht sich um, ob es niemand hört, und dann spricht er es aus, mit lauter Stimme: Frei bist und bist jetzt dein eigener Herr, und jetzt fängt das Leben an! Und er weiß, daß ihn niemand sieht, zwischen den nickenden Wiesen am rauschenden Wald, und so nimmt er sein grünes Hütl ab, wirft's, fängt's auf, schwingt's und juchzt und hört's aus dem schallenden Berge wieder. Und erschrickt und sieht das Hütl in seiner Hand und schämt sich eigentlich. Und muß lachen: Aber Herr Bezirkshauptmann! Er kennt sich gar nicht mehr. Wenn ihn jetzt der Döltsch gesehen hätte! So war er nie. Er war ja noch nie wirklich froh. Ausgelassen, spöttisch, frech, ja. Doch nie so bei sich im Herzen froh. Nie mit diesem Wunsch wie jetzt: So sollt's bleiben, wenn's möglich ist! Nein. Das hat er sich sonst noch nie gewünscht. Bisher hat er sich immer nur gewünscht: Wenn bloß das erst vorüber wär! Bisher hat er nur immer gehofft: Später, vielleicht später einmal! Bisher war ja sein einziger Trost: Der Tag geht auch vorbei! Und dann schlafen und ein paar Stunden vergessen, aber bis in den Schlaf hinein noch von Angst verfolgt, Angst vor dem Erwachen, wo's wieder anfängt. Schon als Kind, noch daheim, wenn nebenan die Mutter in Krämpfen schrie, während er vom anderen Zimmer unablässig den ruhelosen Schritt des Vaters vernahm: Wenn ich nur erst draußen wäre! Und dann endlich draußen, in Kalksburg, bei heuchlerischen Lehrern und hoffärtigen Schülern, diese ganzen bangen acht Jahre, wieder; Wenn nur erst die Matura vorüber ist! Und dann wieder, als verschämt armer Student, häßlichen Hofratstöchtern hofierend: Später, später! Und noch im Präsidialbureau des Ministers, in Neid und Eifersucht von Kriechern und Strebern – warum? War er denn mehr als ein Kammerdiener ohne Livree? Ach, irgendwo draußen sein, draußen und sein eigener Herr und frei! Und eigentlich hatte er's ja gar nicht mehr geglaubt. Es war ihm schon der Mut entsunken. Jetzt aber steht er wirklich da, hat sein grünes Hütl in der Hand und schreit den Berg an, und der Berg muß antworten und die hohe Wiese wogt und der tiefe Wald rauscht, und alles ist vorbei, und er ist mit zweiunddreißig Jahren Bezirkshauptmann und mit vierzig wird er Hofrat und mit fünfzig Exzellenz sein, er, der arme kleine Klemens Baron Furnian, mit dem Unglück seines Vaters! Bloß, dies alles schließlich bloß, weil er einmal den Hofrat Wax getroffen und der Hofrat Wax sich erinnert hat, daß ja die Tochter des Generals Huyn, bevor sie seinen Vater, den späteren Obersten Furnian, heiratete, eine Freundin der Baronin Döltsch, der Mutter des Ministers, und es also jetzt nur noch die Frage war, ob es dem Minister gerade passen würde, daß sich auch seine Mutter daran erinnerte. Und es hatte dem Minister gepaßt, und so hatte die Baronin sich erinnert, und in die stille Hand dieser gütigen alten Frau war seitdem sein junges Leben gelegt. Und seitdem weiß er, daß ihm jetzt nichts mehr geschehen kann: Döltsch hält seine Leute. Schon aus Hochmut, aus Trotz, weil er nie zugeben würde, daß er sich auch einmal irren kann. Und er hat mit jedem seinen Plan, und wenn auch einer einmal eine Zeit in der Ecke steht, die Reihe kommt schon wieder an ihn, nur nicht ungeduldig werden, es ist wie in einem Schachspiel, an jeden kommt der Zug. Nur nicht ungeduldig werden, schön die Selbstverwaltung möglichst wenig stören und auf den Wiesen, in den Wäldern einstweilen spazieren, das Spiel des Ministers steht nicht still. Und Klemens muß lachen, sein letztes Gespräch mit dem Döltsch fällt ihm ein. Da hat ihm der dieses Schach erklärt. Und dann noch, beim Abschied, mit seiner Aufrichtigkeit, die die gereizten Journalisten so zynisch finden: »Also vergessen's nicht, Sie sind ein Rößl. Aber sein's deswegen kein Roß! Das ist nämlich nicht dasselbe, und dann geht's auf einmal nicht zusammen, geben's acht!«
Klemens war nun am Walde. Er wendete sich, um noch einmal zurück über das glänzende Tal zu sehen. Die lieben stillen Häuser! Und alle fromm an die kleine weiße Kirche gerückt! So was Liebes hatte das, so was brav und altväterisch und töricht Liebes! Wie ein gutes Haustier, das weiß, daß es dem Menschen gehört, lag die ganze Gegend da. Als ob diese Wiesen nur blühten, mit dem einzigen Gedanken, den weidenden Kühen zu schmecken, und diese Kühe nur weideten, mit dem einzigen Wunsch, treu sich mühende Menschen zu nähren, und diese Menschen sich nur nährten, um wieder anderen zu dienen, so daß schließlich alles, Feld und Flur, Gras und Kuh, Haus und Volk, alles einem einzigen geheimnisvoll verwobenen Plan gehorsam wäre, in welchem zuletzt irgendwo, die Fäden ziehend, der Minister Döltsch sitzt und irgendwie seine Rößln springen läßt. Warum? Wozu? Offenbar ist's eben der Welt auferlegt, daß die eine Hälfte dient, sie weiß nicht warum, und die andere Hälfte herrscht, sie weiß nicht wozu; und am besten wird wohl auch sein, sie fragen nicht erst. Wie diese liebe, stille Gegend nicht erst fragt, sondern sich freut, untertänig zu sein. Er war ganz gerührt, Das kam manchmal so stark über ihn. Oft, wenn er in Wien durch eine der einsamen alten Gassen ging, mit solchen engen grauen Häusern; und aus dem Tor weht's dumpf, kahl ist die Wand und durch geschwärzte Gitter hängen rote Fuchsien herab. Oder auch, wenn er geschwind im Michaeler Bierhaus sein Nachtmahl nahm und so ein Gottscheer mit seinem gehorsamen guten mühevollen Gesicht an den Tisch trat. Dann hatte er dies oft zum Weinen stark, eine solche dumme, zärtliche, wehmütige Rührung über Österreich. Der Döltsch lachte ihn aus, als er es ihm einmal gestand. »Habn's schon einmal einen Kapellmeister über die Musik gerührt gesehen, die er dirigiert? Aber das ist echt, da sind wir alle gleich. Und dann wundert man sich, wenn alles aus dem Takt kommt.«
Klemens nahm den Weg durch den Wald, um über den Berg ins andere Tal zu gehen und durch dieses, am kaiserlichen Park vorbei, heimzukehren. Er stieg langsam, immer wieder ruhend, lauschend. Seltsam war ihm die schreiende Stille des Waldes. Denn wirklich wie ein Schreien war's oft. Aber wenn er dann stehenblieb und horchte, schwieg der Wald. Kaum schritt er wieder und die Zweige neigten sich und der Abendwind ging, da schien's ein Rufen wie von tausend durch die Fichten fliegenden Stimmen. Eine Tiefe war, wie von einem, der zornig ist und flucht und die alte Hand hebt, um zu schlagen. Das schienen die anderen zu fürchten und duckten sich, da war es wieder still; auch der Wind schwieg, erschreckt. Aber ganz leise, ganz fein fing jetzt eine boshafte hämisch zu kichern an, und nun war es ein Rascheln und Huschen und Rauschen überall, das stieg und schwoll, lachend und höhnend und murrend, bis zuletzt der ganze Wald laut zu zanken begann. Und die Sonne sank, es dunkelte schon im Dickicht, sein Fuß glitt auf den nassen Wurzeln; und überall schien im schleichenden Dunkel lauerndes Leben versteckt, drohend oder spottend, und wenn ein hängender Ast sich im Winde bog, saß ein altes Gesicht mit bösen Augen darin, und ihm war, als streckten überall Haß und Hohn ihre greifenden Hände nach ihm aus. Er lachte sich aus. Wie kann man nur so kindisch sein! Der Wind war's, in die schweren Fichten fahrend, und Wurzeln, naß aus dem Dunkel glänzend, und das Knistern in der Streu! Doch half es ihm nichts, sich dies vorzusagen. Immer waren diese zornigen und höhnischen Reden des Waldes wieder da. Er fing zu laufen an, Angst trieb ihn. Immer schneller trieb es ihn, immer schneller lief er, keuchend, gleich einem Dieb, der flieht, atemlos und heiß. Und hielt erst, als er in die Lichtung kam und nun oben, aus dem Holze tretend, unter sich das friedlichste Tal mit weiß aus tiefen Gärten winkenden Häusern sah. Er schämte sich. Es war doch auch zu dumm! Er hatte wieder einmal ganz den Kopf verloren! Und nachdenklich schritt er langsam hinab, auf die Bank zu, an der der Waldsteig in einen breiten Feldweg fällt. Hier saß er dann, in das liebe Tal blickend, das drüben der ernste kaiserliche Park mit seinem großen Schatten schloß. Er saß und wagte nicht zurückzusehen, nach dem Wald. Er hatte noch immer diese Furcht in allen Sinnen. Und er war doch wirklich nicht feig! Er wußte, daß er nicht feig war! Er hatte Beweise. Damals schon, vor Jahren, noch in Kalksburg, als es nachts brannte; er aber allein im Wirrwarr verschlafen flüchtender Kinder tapfer und rettend. Und wieder, noch voriges Jahr, im Automobil mit dem Minister, beim Stoß in den sausenden Fiaker. Döltsch sagte noch: Wenigstens haben Sie Courage, das ist schon etwas! Das erste Lob, das er von ihm gehört. Nein, er war nicht feig. Er fürchtete keine Gefahr. Es war ihm eher eine Lust, sich mit ihr zu messen. Es mußte nur eine sein, die wirklich da war, die sich einem stellte, die man vor sich hatte, Aug in Aug, so daß man sie bei den Hörnern nehmen konnte. Wenn aber, wie jetzt dort im Wald, nichts Wirkliches, sondern Einbildungen ihm auflauerten, Wahn und Spuk, den sein eigenes Hirn spann, dann entwich ihm der Mut. Vor Räubern hätte er sich sicher nicht gefürchtet, aber er fürchtete sich vor dem wehenden Wind. Er fürchtete keine Gefahr, er fürchtete nur seine Furcht. Und die war schon immer da. Die trug er bei sich mit. Die war sein Schatten. Da half nichts. Wie oft, im Vorzimmer des Ministers, wenn er wartete, die langen Abende! Was gab es dort, in der stillen Herrengasse, sich zu fürchten? Und doch! Er durfte gar nicht daran denken. Nein, er wußte, daß er nicht feig war. Er wünschte sich Gefahren, er fühlte sich da ganz sicher. Aber er durfte nur nicht in Gedanken mit Unbekanntem allein sein. Dies war es: das Unbekannte. Das lag schwer und drohend auf seinem Leben, immer schon. Er erinnerte sich, wie furchtbar es schon dem Knaben war, in einen fremden Kaufladen einzutreten; lieber ging er stundenweit, um einen zu finden, wo er bekannt war. Und er mußte sich heute noch sehr überwinden, um einmal anderswo zu speisen. Es war ihm schrecklich, erst einen Tisch zu suchen und in das neue Gesicht eines ungewohnten Kellners zu sehen. Er brauchte das: bekannt zu sein. Weshalb es ihm ja auch so wohl getan hatte, unten, auf der Promenade, daß es gleich überall hieß: Die Ehre, Herr Bezirkshauptmann, habe die Ehre! So war er auch gewiß, sich morgen im Walde sicher nicht mehr zu fürchten. Und er mußte plötzlich lachen, denn jetzt fiel ihm ein, daß er eigentlich ja noch nie durch einen Wald gegangen war; heute war's zum erstenmal. Daher! Es traf ihn seltsam. Er dachte weit zurück. Nein, wirklich noch nie, noch nie war er durch einen Wald gegangen. Denn von Rodaun zur Mühle, aber das war ein Park, und sie gingen auch immer im Rudel. Aber allein durch einen Wald, einen wirklichen Wald, so einen Wald, der manchmal plötzlich aufschreit, plötzlich wieder sprachlos starrt, war er noch im Leben nie gegangen. Er wendete den Kopf ein wenig, langsam, als ob die Furcht noch immer ihre Hand auf ihm hätte, und sah zurück, den Wiesenhang hinauf, zum Walde. Aber war denn das sein Wald? Seltsam stand er. Eine starre schwarze Wand. Wie das Ende. Als hätte dort alles Leben und der Mensch kein Recht mehr. Tief in Geheimnis stand der Wald jetzt abgesperrt. Unter ihm aber die schrillen Ranunkeln, im nassen Gras, bei blauen Rapunzeln und purpurnen Lamien.
Aber schließlich, dachte Klemens, sich auf der Bank ausstreckend und den Abend einatmend, schließlich bin ich jetzt mein eigener Herr, und wenn's mir nicht paßt, muß ich gar nicht in den Wald, und überhaupt geschieht jetzt nur noch, was mir paßt! Er war vergnügt und nahm sich auch noch vor, vergnügt zu sein. Bezirkshauptmann mit zweiunddreißig Jahren! Er sah den Kollegen den Neid an den Nasen des böhmischen Grafen und des kleinen Bierbarons an! Ja, Glück muß man haben! Er lachte wehmütig. Sein Glück! Wenn sie gewußt hätten! Wenn er sich erinnerte! Das Andenken seines Großonkels, ja, das war noch das einzige. Das klang und galt. Aber dieser allmächtige Hofrat war lange tot, und sein armer Vater hatte wahrlich für ihren Namen nichts getan. Es war freilich nicht seine Schuld, er konnte ja nichts dafür. Aber schließlich hatte Döltsch recht: »Pech haben ist die ärgste Talentlosigkeit, die einzige, die man bei uns nicht verzeiht!« Der Vater tat ihm ja leid. Er zwang sich, gerecht gegen den Vater zu sein. Er sagte sich immer wieder: Der Vater kann ja nichts dafür. Aber es antwortete in ihm: Und du, was kannst denn du dafür, welche Schuld hast denn du, die dein ganzes Leben abbüßen muß? Ihm graute, wenn er an seine Kindheit dachte. Immer und überall diese tragische Lächerlichkeit, die seitdem ihrem Namen eingebrannt war! Immer und überall dieses boshaft mitleidige Lächeln, wenn er sich vorstellte! »Wohl ein Sohn des Obersten Furnian?« Und ein neugieriger Blick, und ein verlegenes Schweigen, als hätte man schon zuviel gesagt, etwas Unpassendes, einen unanständigen Witz, und wieder dieses grausam mitleidige Lächeln; und dann war man so gütig, von etwas anderem zu sprechen, und ließ es ihn fühlen, wie gütig das war! Und in der Schule, als sie zum bosnischen Krieg kamen, diese hämische Nachsicht des Lehrers, den Marsch der Brigade Schluderer auf Stolac ganz wegzulassen, während alle Buben mit ausgestreckten Augen auf ihn stießen. Und noch bei seiner Promotion sub auspiciis, als sein Name verlesen wurde und durch den Saal wieder das höhnisch heitere Lächeln glitt. Immer und überall! Und er hatte manchmal eine solche brennende Lust, einmal loszuspringen und aufzuschreien: »Ja, der Sohn des Obersten Furnian! Desselben Obersten Furnian, der vor Stolac, ein alter Mann, des Kriegs nicht mehr gewohnt, durch Entbehrungen geschwächt, jenen Anfall von Cholera bekam! Desselben, von dem Sie die tausend Karikaturen kennen, ja, des berühmten Obersten mit dem Bauchweh! Und? Und? Wem paßt das nicht? Wem ist da was nicht recht? Der mag es nur sagen?« Tausendmal nahm er sich das und immer wieder, immer wieder vor. Ja, wenn sie nicht daheim dem Kind schon alle Kraft zerbrochen hätten! Wenn er nicht schon mit diesem schlechten Gewissen erzogen worden wäre, zur ewigen Demut und Ergebenheit! Wenn nicht das Kind schon jeden Tag wieder und wieder gehört hätte, welches Unglück auf dem Hause lag, das es gutzumachen da sei! Er war nur froh, daß niemand wußte, was er litt. Er hatte bald sich verstellen gelernt. Überall hieß er, schon in der Schule, jetzt bei den Kollegen der »freche Kle«. Das war noch sein Trost. Und es merkte niemand, daß er doch nur aus Angst so frech war, wie mancher singt oder pfeift und Lärm schlägt, um seine Furcht nicht zu hören. Einer hatte das gemerkt. Als er zum erstenmal vor dem Minister stand und zum erstenmal in diese großen grauen Augen sah und zum erstenmal in der Gewalt dieser klaren kalten Stimme war, sagte Döltsch: »Es ist ganz gut, daß Sie so frech sind. Sie haben's nötig.« Dann war ein langes Schweigen, der Minister schien ihn zu vergessen, in Akten lesend. Eine unendliche Minute lang. Bis er, mit dem harten Lächeln in seinem kahlen Gesicht eines Schauspielers oder Pfaffen aufblickend, sagte: »Aber der Pizarro hat sich auch eine merkwürdige Gesellschaft mitgenommen.« Da wußte der junge Mensch, daß er diesem nichts verbergen konnte. Der sah durch ihn bis auf den Grund und erkannte sein Herz. Und dem jungen Menschen wurde zum erstenmal leicht, und er wagte zum erstenmal zu hoffen. Und er wußte, daß er fortan diesem stillen Mann mit den versteinten Augen zugehörte, für alle Zeit. Denn er wußte, daß er jetzt gerettet war, auch vor sich selbst. Und er dachte seitdem oft, daß es wohl dies gerade war, was den Minister reizte, es mit ihm zu wagen. Zunächst vielleicht bloß die Lust, wieder einmal ein Vorurteil herauszufordern und wieder einmal zu zeigen, daß er der Stärkere war. Dann aber dies Gefühl, daß hier ein Mensch durch ihn erst zu leben begann. Denn so war es wirklich: er fühlte sich von Döltsch erst wie durch einen Zauber auferweckt. Es ging ja den anderen ebenso, der ganzen »Schutztruppe«, den »kaiserlich königlichen Prätorianern« des Ministers, wie sie der alte Klauer in seinem verkniffenen Grimm hieß. Und sie hatten ja wirklich was von übermütigen Soldaten in einer eroberten Stadt. Draußen nämlich, vor den Leuten. Bis zum Vorzimmer des Ministers. Aber vor seinen undurchsichtigen Augen wurden alle klein. Augen waren es, die nichts durchließen; sie sahen heraus, man sah nicht hinein. Er deckte sich mit diesen Augen zu. Diese Augen waren wie Scharten, aus welchen er schoß; nichts drang ein. Alle fürchteten diese Augen, die, still, unbewegt, ohne Furcht, ohne Zorn, ohne Lust, wesenlos, gegen die Menschen standen. Und vor diesen Augen mußte man warten. Er hatte die Gewohnheit, einen anzusehen und nichts zu sagen. Endlich begann er, und in seiner kalten Stimme schwammen die schnellenden Worte wie Forellen. Und alle standen da wie vor ihrem Richter. Obwohl er gar nicht feierlich war, nichts auf Formen gab und Spaß verstand. Nur wenn einer einmal, aus Verlegenheit und Verwirrung mehr als mit Fleiß, ihm zu nahe kam, sah er auf und schwieg. Dieses Schweigen fürchteten sie. Der andere wartete, er schwieg. Beklommen begann endlich der andere wieder, er schwieg. Er schwieg und sah ihn an. Dieses Schweigen, kaum eine Minute lang, aber dem anderen, der wartend vor seinen grauen Augen saß, eine Ewigkeit, dieses gleichsam durch den Saal hallende Schweigen, von solchen Verachtungen voll, dieses Schweigen, in welchem die Zeit stillzustehen und einzufrieren schien, war unerträglich. Und dann fragte Döltsch plötzlich: Haben Sie noch etwas? Oder er schien auch plötzlich ganz verwundert, einen noch vorzufinden, und sagte sehr höflich: Danke schön! Und man war entlassen. Man war, wie sie's nannten, »weggestellt« oder »abgelegt«. Sie hatten nämlich alle das Gefühl, daß die Menschen ihm bloß Steine waren, die er aus dem Baukasten nahm, um eine Zeit mit ihnen zu spielen, bis er sie ungeduldig wieder zusammenwarf. Und das Schlimme war: man wußte nie, was er von einem hielt. Es kam vor, daß er mitten im Gespräch aufstand, um einen Akt zu holen, die Schnur zu lösen und zu sagen: »Da schauen Sie sich einmal an, was Sie in den letzten drei Jahren geleistet haben! Nicht ein einziges brauchbares Stück ist dabei. Nehmen Sie's mit!« Und band es wieder zusammen und warf es einem hin. Was übrigens nicht ausschloß, daß man sich am nächsten Tag auf einen beneideten Posten berufen fand. Nur war das noch gar kein Beweis seiner Achtung. Einen ließ er neulich rufen, um ihm seine Ernennung anzukündigen. »Den Lederer, der wirklich ein ungewöhnlich fleißiger und fähiger Beamter ist, sekkieren sie mir nämlich dort zu viel. Jetzt sollen die Herrschaften einmal sehen, was sie mit einem so unfähigen und unbegabten Beamten anfangen werden, wie Sie sind.« Er hatte ja die Theorie, daß es unbrauchbare Menschen überhaupt nicht gebe; man muß nur wissen, wohin einer gehört. Und es reizte ihn, manchmal verblüffende Beweise dafür zu finden. Doch war ihm auch darin wieder nicht ganz zu trauen, weil er noch eine andere Theorie hatte, nämlich, daß es eine Dummheit sei, wenn man immer nach seiner Theorie handeln will. Weil sie nun also nie sicher waren, an welche er sich gerade hielt, und während er sie heute mit den höchsten Anforderungen maß, es ihm morgen einfallen konnte, den ganzen Staat mit Dummköpfen zu besetzen, was schließlich nur seiner Meinung, daß man sich in Österreich immer fragen muß, was das Vernünftigste wäre, dann aber das Gegenteil tun, und seiner Lust, jedes Experiment zu machen, entsprochen hätte, so kam jeder jeden Tag mit neuer Furcht und neuer Hoffnung ins Amt. Der grollende Klauer sagte ja von ihm überhaupt: Das ist keine Regierung mehr, das ist eine Lotterie! Und wirklich schlug jedem täglich das Herz, ob er nicht über Nacht das große Los gezogen hätte. Sie waren in der ewigen Aufregung von Spielern, immer zwischen Himmel und Hölle hängend. Gar nun Klemens, dem es immer schon eigen war, aus höchsten Hoffnungen in tiefste Verzweiflungen zu stürzen. Was vielleicht auch von seiner Kindheit kam. Denn während es des Vaters Art war, alle Schuld und alles Mißgeschick, woran sie litten, auf den Sohn zu legen, daß er es wie ein Kreuz tragen und durch Ergebung, Demut und Gehorsam abbüßen sollte, lud die Mutter, voll Leidenschaft, unversöhnlich mit dem Schicksal, nach Vergeltung lechzend, ihm allen Zorn und allen Haß auf, mit welchen sie vom Leben und von den Menschen angefüllt war. So vom Vater zum Opfer, von der Mutter zum Rächer bestimmt, schlug er aus Anfällen einer grenzenlosen Verwegenheit, in welchen er sich kindisch vermaß, nach jedem Abenteuer, selbst nach dem Verbrechen zu greifen, in Krämpfe jener wütenden Angst um, in welchen er völlig jede Beherrschung verlor. Wirklich war ihm oft, als würden in ihm der zornige Geist seiner rächenden Mutter und der mutlose des geschlagenen Vaters um ihn ringen. Bald war er von ihr, bald von ihm besessen, sie wechselten in ihm. Es ging gleichsam plötzlich die Türe auf, er kam herein, sie verließ ihn, fast mit der einfleischenden Kraft einer Halluzination: wie wenn wirklich, wirklich, während er eben noch vergnügt in guten Gedanken saß, hinter seinen Stuhl plötzlich leibhaftig der Vater träte, mit seinem großen herabhängenden Gesicht und dem schwimmenden Blick der wässerigen Augen, ganz wie er so oft an den Tisch des Knaben getreten war, seine Aufgaben nachzusehen. Besonders abends geschah ihm das zuweilen, in jenen langen Stunden, wenn ihn der Minister warten ließ und dann die Zeit vergaß. Um sieben hatte der Minister gesagt: Ich werde Sie heute wohl kaum mehr brauchen, übrigens warten Sie halt noch einen Moment, ich gehe ja auch sofort. Und seitdem wartete Klemens. Er wußte ja schon, was es hieß, wenn der Minister sagte: Sofort. Auf zwei Stunden wenigstens konnte man rechnen. Und da saß er nun und wartete. Er hatte nichts zu tun. Er hätte ja lesen, für sich arbeiten, Briefe schreiben können. Er nahm sich das auch immer vor, es ging aber nicht. Er las eine Seite, auf der zweiten wußte er schon den Sinn nicht mehr. Vier- und fünfmal fing er einen Brief an und warf ihn wieder weg. Es ließ ihn nicht sitzen, er ging auf und ab, aber das Zimmer war schmal, die Wände drückten ihn, er wurde müd. Er trat ans Fenster und sah den Leuten zu, die vom Konzert aus dem Bösendorfer kamen. Eine Karosse fuhr, mit einer alten Fürstin oder Gräfin, der bärtige Portier schwenkte den großen Stock und zog tief den Hut, wie's vor hundert Jahren Sitte war, den Stock zu schwenken und den Hut zu ziehen. Die schweren Rosse schnaubten, demütig harrten die Leute, die alte dicke Dame im Wagen, fröstelnd, eingehüllt, mit einem zuckenden leeren Lächeln um den wulstigen rotgeschminkten Mund, nickte vor sich hin. Wie vor hundert Jahren. Und erst wenn der feierliche Wagen aus dem Hof langsam durch das Tor gerollt und langsam in die Gasse gelangt war, gab der bärtige Portier ein Zeichen mit dem großen Stock, und die Polizisten öffneten, und die staunenden Passanten durften sich wieder bewegen. Und immer mußte Klemens denken: Wie vor hundert Jahren. Er fand einen solchen Zauber darin, er hätte gleich weinen mögen, so rührend war es ihm. Er hatte überhaupt eine Leidenschaft für die Herrengasse. Döltsch sagte gern: der Österreicher kommt auf die Welt, um in Pension zu gehn. Dies fiel ihm in solchen Gassen immer ein, in der Herrengasse, auf dem Graben, auf der Freiung; man sah es ihnen an und wer hier ging, nahm unwillkürlich den Schritt bedächtiger, und unwillkürlich wurden die Hände auf den Rücken gelegt. Wunderliche Stadt der tiefen Ruhe mit ihren ruhelosen Menschen! Da schrak er zusammen, er glaubte den Spott des Ministers zu hören, der ihm immer sagte: Furnian, rotten Sie den Feuilletonisten aus, der in Ihnen steckt, oder gehn's zum Klauer, ich habe keine Verwendung! Aber jetzt waren die zwei Stunden doch längst vorbei. Klemens kannte das. Der Minister vergaß; er wollte fort, sah nur noch ins Abendblatt, fand einen Namen, der ihm fremd war, schlug nach, geriet ins Lesen, kam immer weiter, von Ländern zu Völkern, von Menschen zu Dingen, ins Suchen verstrickt, und so konnte man ihn, der auf seinem Tisch pedantisch keine Unordnung litt, nach Stunden zwischen Landkarten, Hilfsbüchern und alten Schriften auf der Erde finden, ganz verwundert, wenn die Türe ging. Und ganz verwundert fragte er dann: Haben Sie's so eilig? Und Klemens redete sich aus: Ich habe gedacht, Exzellenz hätten geklingelt. Und er wußte schon, daß es dann hieß: Sie denken zuviel, lieber Furnian, das ist gar nicht Ihr Beruf! Und ein Nicken und das harte Lächeln an den dünnen Lippen und dann das eiskalte Schweigen. Und Klemens schlich fort. Und wartete wieder im schmalen Zimmer. Und wieder auf und ab. Und wieder zum Fenster; in der Herrengasse ging kein Mensch mehr. Und dann saß er halb im Schlaf, die Augen schmerzten ihn. Und trat wieder zum Fenster und rieb sich an den Scheiben. Und unten war eine Gestalt im Mantel, huschend. Junge Menschen gab's, die liefen durch die Nacht nach Abenteuern. Und er sehnte sich, und oft, wenn er dann so saß, die Hände vor sich auf dem Tisch gekreuzt, den müden Kopf in den Händen, kam ein solcher Zorn über ihn, gegen den da nebenan, und eine solche Gier nach der Nacht da draußen, und ein solcher Trotz, aufzuspringen und hineinzugehen und dem da zu sagen, daß er ein junger Mensch war, der auch sein Recht hatte und den es auch in die Winternacht lockte und der dies alles nun nicht mehr ertrug! Und da war es dann, daß oft plötzlich sein alter Vater vor ihm zu stehen und ihn mit seinen armen leeren Augen anzublicken schien. Und er verging vor Angst, und da stand dann dieser namenlose, sinnlose, grundlose Spuk in seinem faselnden Hirn auf, von brennenden Häusern, durchgehenden Pferden, entgleisenden Zügen, Blitzschlägen, Fensterstürzen, Wolkenbrüchen, höhnisch um ihn kreisend, eine wüste Hölle, wie solchen Schundromanen entqualmt, die schon über den Knaben eine lächerliche Macht hatten, welcher sich auch der Jüngling noch nicht immer erwehren konnte. Er saß dann und sagte sich immer vor: Es ist ja nicht wahr, es ist ja zu dumm, du träumst es ja bloß, aber nein, es ist ja nicht einmal ein Traum, du träumst es nicht einmal, du bist doch wach, du bist in deinem Zimmer wach und nebenan ist der Minister, der auf der Erde liegt und in einer alten Chronik liest und die Zeit vergißt, und du weißt, daß du wach bist und daß dir nichts geschehen kann und daß das alles nicht wahr ist und daß es nur Blasen aus deinen schläfrigen Gedanken sind und daß du ja nur aufzustehen und es abzuschütteln brauchst und der Schaum zergeht, und sie sind weg und du wirst lachen, du weißt es doch, du brauchst bloß aufzustehen, so steh doch auf, was stehst du denn nicht auf?, du weißt es doch, was stehst du denn nicht auf, was fürchtest du dich denn? So sagte er sich vor und hätte gern den müden Kopf aus seiner Hand gezogen. Und ließ ihn doch und stand nicht auf, er konnte nicht. Es war zu stark; und war ja doch auch wieder eine Lust, die er nicht lassen konnte, sich so zu fürchten, insgeheim dabei gewiß, daß nichts zu fürchten war. Er wußte, daß er dies auch aus seiner Kindheit hatte, von der Mutter her, die seit jenem Tag, der ihren Stolz zerbrach, oft wochenlang nicht mehr aus ihrem Zimmer wich, laut mit sich redend, auflachend und wieder leise weinend auf dem alten Diwan, aber nebenan saß das bange Kind allein und zitterte vor Angst, wenn sie schrie, während es in der anderen Stube den ruhelosen Schritt des Vaters vernahm, immer auf und ab, immer bis zum Fenster, wo er sich knarrend drehte, und wieder zur Türe zurück, immer dieselben langsamen harten stechenden zehn Schritte, gleichmäßig hin, und dort, am Fenster, das leise Knarren, und dann wieder dieselben mühsamen schweren bohrenden zehn Schritte gleichmäßig zurück.
Furnian fuhr auf. Und sah erstaunt um sich. Und wunderte sich, die Bank zu sehen, auf der er saß, und dort den geschlossenen schwarzen Wald mit dem grünenden Hang und unten das von Bächen schillernde Tal, aus dem die Sonne schied. Und fand sich gar nicht gleich wieder und mußte sich langsam erst besinnen, bis er allmählich begriff, daß dies ja doch jetzt alles weg war. Dies war jetzt alles weg. Dies alles kam nicht mehr zurück. Nein, er wollte gar nicht mehr daran denken. Und er nahm sein grünes Hütl vor sich ab und sagte: Nein, Herr Bezirkshauptmann, das geht jetzt nicht mehr, Herr Bezirkshauptmann haben jetzt andere Sorgen, vergessen Herr Bezirkshauptmann nicht, daß das Wohl und Wehe der Ihnen von Seiner Majestät anvertrauten Bevölkerung in Ihren werten Händen liegt! Und er verbeugte sich feierlich und lachte. Er hatte noch so wenig gelacht in seinem Leben. Jetzt wird er's nachholen. Als Kind war er nie kindisch, er durfte ja nicht. Er durfte ja nichts, nie, die ganzen Jahre her. Jetzt wird er's nachholen. Jetzt fängt's ja doch überhaupt erst an. Alles fängt jetzt erst an. Und ihm war, als wenn er eine neue Haut hätte. Es fiel ihm ein, einmal gelesen zu haben, daß der Mensch sich alle fünfzehn Jahre körperlich völlig erneue. Da käme also jetzt Klemens Numero drei daran! Und er verbeugte sich wieder, grüßend: Sehr angenehm! Und übrigens: wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand, und so ist es nur konsequent, daß er ihm auch die Haut gibt. Die alte aber mag Gott befohlen sein! Und er neigte sich über die Bank mit einer Gebärde, als wenn er seinen abgestreiften Menschen Numero zwei damit hinlegen und zurücklassen würde.
Er schritt ins Tal nieder. Es war anders als das drüben hinter dem Wald, wo er geruht hatte, bevor er emporstieg. Hatte jenes ihn durch den stillen Ernst emsig waltender Tätigkeit gerührt, so war er nun vom Anblick reichsten Behagens entzückt. Dort überall Äcker und Fluren bis an den geschäftigen Ort, überall die Spur der sorgenden Menschenhand, überall Fleiß. Hier alles in Gärten, festlich spielend, überall Lust. Und er freute sich, daß das hier so schön ordentlich eingeteilt und abgeteilt war, links die Sorge und rechts das Vergnügen, da die Arbeit und dort der Reichtum, und jedes hat sein eigenes Kastl für sich und eins hört und sieht vom anderen nicht viel, was immer das gescheiteste ist. Er dachte vergnügt: Mein ganzer Staat hier steht offenbar auf einer sehr gesunden Basis. Er wunderte sich nur, nirgends die großen Salinen zu sehen; sie lagen versteckt. Was ihm auch wieder sehr gefiel. Er hatte ja gewiß nichts gegen den Stand der Arbeiter. Im Gegenteil, wer ist denn heute nicht Sozialist? Aber er sah lieber nichts von ihnen. Es war ihm unheimlich, wenn er zufällig einmal in einen Trupp geriet. Er fand, daß sie doch eigentlich etwas Barbarisches hatten. Dies mochte sich vielleicht bis zur Größe, bis in eine Art von Heldentum steigern lassen, er verkannte das nicht. Nur kam er nie von der Empfindung los, daß es doch so gar nicht in unser Österreich paßte. So war, wenn er's überlegte, sein Gefühl am besten ausgedrückt: er wollte gewiß nicht ungerecht gegen das Proletariat sein, fand es aber eigentlich unpassend für Österreich. Wie er im Grunde schon auch jede Fabrik eigentlich unpassend fand. Schon rein ästhetisch: ich kann mir nicht helfen, eine Fabrik steht unserer Landschaft nicht, unserer Landschaft der malerischen Burgen und barocken Schlößln, zu denen ein braves Bauernhaus und so ein liebes, ein bissel zopfiges, gelbes Herrenhaus gehört, und sonst nichts! Irgend was sehr Tiefes und sehr Starkes in ihm fühlte sich von den Arbeitern bedroht und wehrte sich. Sie störten ihm seine zärtlich gehegte Rührung über Österreich.
Nun bog der abfallende Weg in einer weiten Schlinge bis an die Mauer des kaiserlichen Parks aus. Da sah er, landeinwärts, kaum eine kleine Stunde weit, im letzten Winkel des Tals, unter einer Halde, von der dann steil der graue Fels aufsprang, ein Dutzend winziger weißer Häuschen liegen. Wirklich wie Lämmer waren sie, um den langen schmalen Turm gedrängt, der wie der Hirt mit seinem Stab stand; und neben ihm ein niedriges, breites, dunkles Dach, des Pfarrhofs wahrscheinlich, das war der Hund; und einige hatten sich bis an die Halde, bis unter den Fels verlaufen. Es klang das Abendläuten her. Klemens stand und schaute. Ihm war's wie ein vergilbtes altes Bild, wie ein vergessenes altes Lied. Er sagte sich zärtlich: Das gibt's noch! Und da leben Menschen, gehen mit der Sonne schlafen, stehen mit ihr auf, haben ein paar Hühner und eine Kuh und lassen den lieben Gott sorgen, im Winter ist's kalt, im Sommer wird's warm, sonst bleibt alles immer gleich, glückliche Menschen! Und es kam über ihn wie schon über den Knaben oft, wenn er abends saß und in stillen alten Geschichten las; da wünschte er sich immer: Wenn doch das Leben noch so wär! Jetzt fiel's ihm wieder ein. Dort im Winkel oben so ein kleines weißes Häusl haben und nichts mehr wissen und alte Geschichten lesen und nur manchmal ans Fenster gehen und denken: Da drunten ist der kaiserliche Park und drüben ist die weite Welt! Dann aber nahm er sich zusammen und dachte: Später, später! Erst durch die weite Welt! Wir haben ja jetzt das Billett, Herr Bezirkshauptmann! Und er wendete sich, im Abendläuten nach dem Ort zurückzugehen. Langsam schritt er, immer noch wieder einmal in das kleine weiße Dorf hinaufsehend. Er konnte sich gar nicht trennen. Einen solchen Zauber hatte das kleine weiße Dorf im Winkel. Er nahm sich vor, bald einmal hinzugehen. Und immer, wenn es einmal geschieht, daß er sich ärgern muß, wird er einfach in sein kleines weißes Dorf gehen, und gleich wird der Ärger aus sein. Einen lieberen Trutzwinkel konnte man sich nicht denken. Er stand wieder und sah noch einmal zurück. Ganz geheimnisvoll zog es ihn hinauf. Endlich riß er sich los. Es war Zeit, heimzukehren.
Die lange Mauer des kaiserlichen Parks entlang, an der Lehne des sanften Hügels, war ein Saum von Villen. Tiefe Gärten mit Kieswegen, Rasen, Beeten, Baumgruppen, Ziersträuchern, Springbrunnen und Lauben. Eine war seltsam, mehr einem griechischen Tempel gleich; rings eine Halle mit zierlichen jonischen Säulen, die Stufen in Marmor; und ein sterbender Achill, kletternde Klematis. Das war die Villa der Rahl. Und Klemens erinnerte sich, wie er oft im Parterre, lahm vom langen Stehen, schaudernd unter den Hieben ihrer wilden Kunst, in einer unsäglich beglückenden Qual, aufgestöhnt hatte, vor Lust und Leid zugleich. Und nun, wenn sie im Sommer kommt, ladet sie ihn vielleicht ein; er ist ja der Herr Bezirkshauptmann und sie ist eine Frau Gräfin, sie gehören doch zusammen, und er wird an ihrem Tisch sitzen und sie plauschen miteinander, ganz so, er der freche Kle, mit ihr, der geheimnisvoll entrückten Frau, ganz als wenn das so sein müßte; das Leben ist schon wunderbar. Er rief den Gärtner an. »Sie! Sagen's, wann kommt denn die Gräfin?« Der alte Gärtner zog das Käppchen und sagte still: »Ich weiß nicht.« Klemens wurde ungeduldig, »Es muß doch hier jemanden geben, der weiß, wann sie kommt. Fragen's halt!« Der Gärtner schüttelte den alten Kopf. »Nein. Man weiß es nie.« Klemens lachte. »Da ham's ein Zigarl, damit's ein bissl munterer werden.« Und warf es ihm über den Zaun zu. Der Alte sah ihn verwundert an und dankte still. Klemens grüßte noch, einen Finger an sein grünes Hütl legend, und ging. Es machte ihm Spaß, daß der gute Alte offenbar noch gar nicht wußte, wer er war. Und so, in seinem Inkognito vergnügt, schritt er lässig an den Villen weiter. Da war eine mit einem chinesischen Turm, dann kam eine, die einer ägyptischen Gruft glich; aber die nächste war ein Schweizerhaus. Warum wohnten die reichen Schneider wie Chinesen, Jobber wie Pharaonen und alte Fürstinnen wie auf der Alm? Döltsch hatte gesagt: Sie sehen wieder, wenn sich die Polizei nicht in alles mischt, geschieht gleich ein Unglück! Immer mußte er dies denken: Was würde Döltsch hier sagen, was würde Döltsch da tun? Es verfolgte ihn. Und er freute sich, schon in allem ein kleiner Döltsch zu sein, und übte sich darin. Sie taten's um die Wette, die ganze Leibgarde, wie der verschnupfte und verschleimte Klauer sie nannte. Er aber war doch immer noch allen vor. Und wer weiß, wenn es ihm erst gelang, sich in des Ministers Art ganz einzudenken, einzufühlen, einzuleben! Der hatte doch auch einst arm und unbekannt angefangen, von scheelen Augen umringt. Und wer weiß, in zwanzig Jahren!