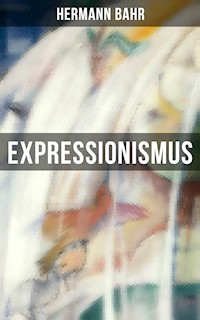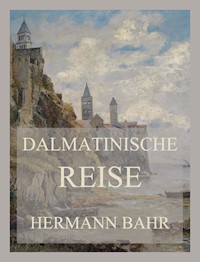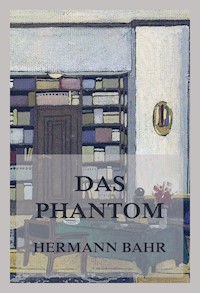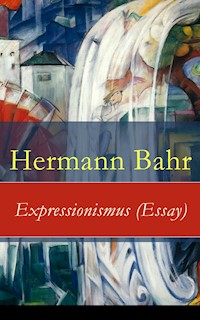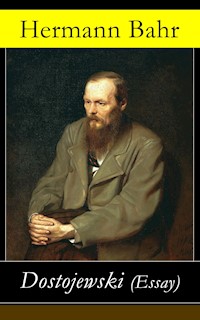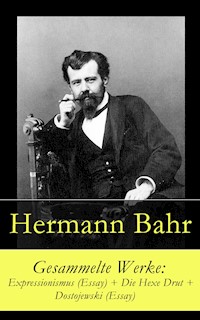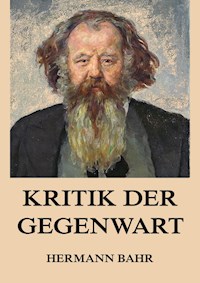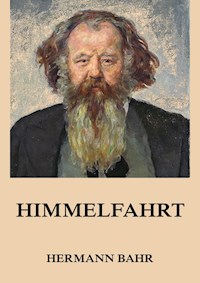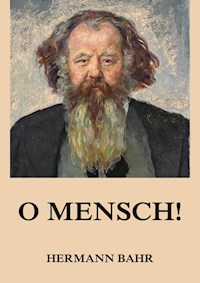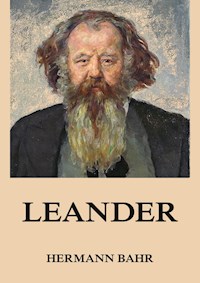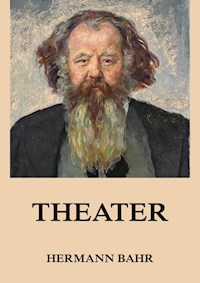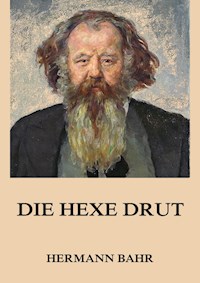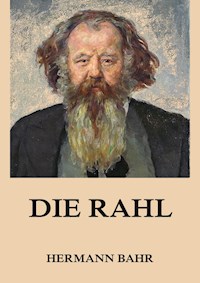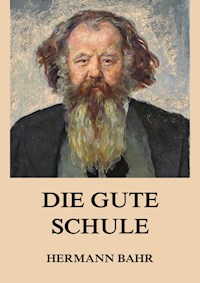1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hermann Anastas Bahr war ein österreichischer Schriftsteller, Dramatiker sowie Theater- und Literaturkritiker. Er gilt als geistreicher Wortführer bürgerlich-literarischer Strömungen vom Naturalismus über die Wiener Moderne bis hin zum Expressionismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hermann Bahr
Austriaca
Impressum
Instagram: mehrbuch_verlag
Facebook: mehrbuch_verlag
Public Domain
(c) mehrbuch
Inhalt
1
Lueger ist geheimer Rat worden. Das ist ein historischer Moment. Denn es bedeutet: der Greißler ist Exzellenz geworden. Die Wiener Situation von 1890 war: die Verlassenheit des Greißlers. Unsere alten Liberalen, immer volksscheu, mit dem österreichischen Wesen unbekannt, nur vom Gehirn lebende Leute, die nichts als eine schöne kleine Sammlung von Gedanken hatten, aus dem Westen importierten Gedanken, mit welchen sie nun alles zu bestreiten meinten, waren unfähig, irgend ein Bedürfnis zu verstehen, das sie nicht in dem allgemeinen Schema der bürgerlichen Doktrin verzeichnet fanden. Sie hatten keine Ahnung, daß dieses österreichische Leben, seit Jahrhunderten abgewendet von Europa, sich nun nicht einfach über den Kamm der westlichen Entwicklungen scheren ließ. Das Volk, in seiner Vorliebe für große, klare Vereinfachungen, nannte sie deshalb: Advokaten. Sie vergalten es ihm, indem sie verächtlich sagten: Diese Greißler! Und statt, wie die klugen Franzosen den épicier zu radikalisieren, wodurch er nicht intelligenter, aber der Intelligenz dienstbar wird, ließen sie es darauf ankommen, daß der Zank zwischen den Advokaten und den Greißlern öffentlich ausbrach, wobei der Ausgang von vornherein nicht zweifelhaft sein konnte, da doch der Greißler immerhin ein Stück wirkliches Leben, eine Realität ist, während der Advokat aus Rhetorik besteht. Und jetzt begab es sich, daß einer von den Advokaten, der junge Doktor Karl Lueger, innerlich ganz ein Advokat wie die andern, nur gescheiter, beweglicher und mit einer vorstädtischeren Rhetorik, auf den Einfall geriet, den unbefriedigten Greißler für seinen lauernden Ehrgeiz auszunützen. Zunächst geschah ihm, was später bald im Großen geschah: es zeigte sich, daß der Greißler stärker war als der Advokat, der Bauch stärker als das Hirn, und der junge Advokat wurde mit Haut und Haaren vom Greißler verschluckt, Lueger wurde assimiliert. Er hatte gedacht, sie zu seinen Trabanten zu machen, aber sie machten ihren Trompeter aus ihm. Und als nun dieser Trompeter blies, kamen alle gierig herbei, die seit Jahren den Advokaten nicht mehr trauten. Der Hausherr vom Grund und der Kaufmann von der Ecke und der kleine Fabrikant, nervös geworden, immer nur von tönenden Ideen zu hören, statt von ihren brennenden Sorgen, kamen und boten sich dem Greißler an, denn der Greißler war wenigstens eine Wirklichkeit, und dies empfanden alle dumpf in ihrer Not, daß es galt, ihre Wirklichkeit durchzusetzen und doch endlich einmal sozusagen erst auf die Welt zu kommen. Es war ein Aufstand der Wirklichkeit, dies darf man ja nicht verkennen; das Bedürfnis der kleinen Leute machte den Mund auf, das war der Lueger. Wäre er es geblieben, wäre er dabei geblieben, die Wirklichkeiten, die er hinter sich hatte, mit dem fröhlichen Mut seiner Jugend, mit seiner ungemeinen Begabung für den kleinen Kampf im Wirtshaus und auf der Gasse, mit seinen guten Ohren für die so beweglichen Launen der Wiener zu führen, wäre er der Greißler geblieben, zu dem er sich resolut gemacht hatte, er wäre heute noch der Herr von Wien, den er jetzt, mit ängstlich zitternden Späßen, nur noch mühsam mimt. Aber es zeigte sich, er hatte doch den Greißler bloß gespielt, aus dem nun, in den Stunden der Entscheidung, wieder der kleine Advokat mit seinem dürftigen Ehrgeize kroch. Es zeigte sich, daß er selbst doch ganz ebenso unwirklich war wie jene alten Liberalen damals. Dies zeigte sich: in seinem Verhältnis zum Hof, in seinem Verhältnis zur Macht, in seinem Verhältnis zu den Arbeitern. Zu den Arbeitern steht er genau so wie jene alten Liberalen damals zum Greißler. Er sieht überall nur bösen Willen hält alle für verhetzt und verführt und glaubt, wenn er die Wahlen fälscht und nur im Augenblick ein paar Stimmen fängt, durch solche kleine Ränke der alten Taktik die Weltgeschichte abzusperren und auszudrehen. Und genau wie jenen alten Liberalen gilt auch ihm längst die Macht weit weniger als ihr Schein. Nur vor allem sich mächtig zu zeigen, mit der goldenen Kette geschmückt, der Held rauschender Feste, von schwärmenden Frauen umdrängt und in der Tat schon einem kleinen Potentaten gleich, der überall seinen Namen in goldenen Lettern, sein Bild bekränzt findet, dem mit fürstlichen Ehren gehuldigt wird, den der Jubel der Gasse wie das freundliche Nicken der Großen, von Prälaten, Ministern und Erzherzogen, überall empfängt, ist ihm das Höchste. Und für diesen Schein, in dem er schwelgt, hat er Stück für Stück von seiner wirklichen Macht hergegeben, bis es soweit ist, daß er jetzt schon seinen eigenen Leuten lächerlich wird und sich am Ende jetzt von wirklich Ehrgeizigen, denen es darum zu tun ist, zu herrschen, nicht zu glänzen – um das Gefühl und um die Wirkungen der Macht, nicht um ihren leeren Schein – ungeduldig weggeschoben und um seinen Lohn betrogen sieht. Und er, der noch vor zehn Jahren der Schrecken der Hofburg war, steht jetzt mit submissen Bücklingen da, auch darin jenen alten Liberalen gleich, die es auch immer vorzogen, Freiheiten und Rechte devot im Gnadenwege zu erwarten. Und so hat man endlich jetzt auch oben eingesehen, daß er ja doch garnicht anders ist als die anderen auch, und daß er auch nichts anderes will als alle, nämlich halt ein kleines gutes Platzerl für sich an der Sonne; wenn man das nur schon vor zehn Jahren gewußt hätte, hätte man sich gegenseitig manchen Verdruß erspart! Immerhin ist man ganz froh und macht gern dem alten Herrn eine Freude, und so wird er Geheimer Rat, die wirklich Ehrgeizigen gönnen es ihm, ihnen schadets ja nicht, und boshaft schmunzeln in den Ministerien die schlauen, alten Hofräte: Man hat in ihm die ganze Partei gekrönt, es ist sozusagen ein Symbol, denn in ihm ist der Greißler jetzt Exzellenz geworden. – Was mag sich nur unser alter Kaiser manchmal denken! Er hat in seinem langen Leben so viele trotzig aufrechte Männer des Volks gesehen. Und immer kommt dann ein Tag, da geht die Türe weit auf, und der Volksmann erscheint, um sich zu bedanken, und lallt vor Rührung, nun auch Exzellenz zu sein.
Der Herr Baron Aehrenthal mag, wenn er ein bißchen Anlage zu philosophischen Betrachtungen über das Wesen der Menschen hat, jetzt zuweilen sehr heiter sein. Es ist noch keine drei Monate her, daß er mit Bismarck verglichen wurde. Der österreichische Bismarck hieß er. Er muß sich selbst gewundert haben, wie schnell man das wird. Und jetzt kann er es von allen Bierbänken schallen hören, in unserem geliebten Wienerisch: Der Herr soll z' Haus bleib'n, wann er nix kann! Und irgendwo stand neulich gar zu lesen, jeder Attachee hätte das besser gemacht. Besser als der Bismarck vom Oktober. Mobilium turba Quiritium, mag er denken, wofern er im Zitieren so tüchtig ist wie der deutsche Kollege. Nun, ich weiß nicht, ob er ein Bismarck ist, ich kenne den Attachee nicht, der ihn ersetzen soll, ich kann es abwarten. In aller Ruhe muß ich aber doch sagen, als gelassener Zuschauer: Hier ist jedenfalls einmal einer in Österreich, der den Mut hat, an Österreich zu glauben oder doch so zu tun, wozu auch schon Mut gehört! Die schlimme Gewohnheit unserer Staatsmänner, gleich zu erschrecken, wenn es je notwendig scheint, irgend etwas zu tun, hat er offenbar nicht. Er hat Vertrauen, in sich selbst und in sein Land, er hat Ehrgeiz, für sich selbst und für sein Land, und es scheint fast, als hätte er einen Willen. Einen Willen haben wir in Österreich lange nicht gespürt, bei den sogenannten Staatsmännern. Darin scheint er fast irgendwie mit unserer neuen Generation entfernt verwandt zu sein, irgendwie von weiten. Das Grundgefühl unserer neuen Generation in Österreich: ihre Verwunderung und Empörung, warum denn der Österreicher ausgeschlossen von Europa sein soll, dem er sich doch geistig und wirtschaftlich zugehörig weiß, ihre Leidenschaft, zu beweisen, daß wir auch noch da sind, ihre Bitterkeit und Scham, wenn uns zugemutet wird, überall zurückzustehen, immer nur an den Türen der anderen zu horchen und höchstens einmal, wie's der Deutsche Kaiser genannt hat, brav »sekundieren« zu dürfen, dieses Grundgefühl der Generation, die sich das allgemeine Wahlrecht ertrotzt hat, scheint auch in ihm zu sein. Das glauben manche, die seit Jahren ungeduldig nach einer Politik des Mutes, und wär's bis zum Hochmut, nach einer Politik, die nicht mehr immer nur hinter den anderen herläuft, nach einer eigenen Politik verlangt, in ihm zu spüren, und haben so eine vage Neigung für ihn bereit, die freilich, wieder enttäuscht, arg umschlagen kann, da auch in jenen Österreichern, die sich aufgerafft haben, wieder zu hoffen und an sich zu glauben, doch der alte Hang zum Zweifel, zum Spott, zum Argwohn immer noch lauert. Ob er enttäuschen wird? Ob es ihm glückt? Dabei kommt's wohl nicht bloß auf ihn an.
Seine Freunde sagen ihm die Kraft zu, eine österreichische Politik im großen zu versuchen. Nehmen wir an, er wäre der Mann dazu. Dann bleibt noch immer die Frage: Hat er auch die Mittel dazu? Nehmen wir an, einer wäre ein großer Stratege, was hilft's ihm, wenn er kein Heer hat? Das Heer aber, das einer braucht, um eine österreichische Politik im großen zu versuchen, ist eine moderne Verwaltung und eine moderne Diplomatie. Die muß er sich schaffen, weil wir sie nicht haben, weder eine Verwaltung, die fähig wäre, die Bedingungen unserer Landwirtschaft, unserer Industrie, unseres Handels und ihre Bedürfnisse und ihre Sorgen zu kennen und also zu wissen, was jede Maßregel der äußeren Politik im Innern ergeben wird, wie sie auf den Markt wirkt, ob sie die Wirklichkeiten der arbeitenden Menschen stärken oder schwächen wird, noch eine Diplomatie, die fähig wäre, ihm die Stimmungen der Völker, ihren wirklichen Willen und also ihr notwendiges Verhalten zu unseren Zwecken der Wahrheit gemäß zu berichten. Es zeigt sich ja schon jetzt in der bosnischen und der serbischen Angelegenheit, daß er weder die Wirkungen seiner Politik auf unseren Markt, noch die Stimmungen der anderen Staaten vorausgesehen hat. Er ist falsch informiert gewesen. Er wird nie wahr informiert sein, solange er sich nicht eine neue Verwaltung und eine neue Diplomatie schafft. Unsere Verwaltung ist die schlechteste und unsere Diplomatie ist die dümmste. Unsere Verwaltung besteht aus näselnden Herren mit langen Nasen und hohen Stiefeln, die auf die Jagd gehen und, wenn sie am achtzehnten August den Toast auf den Kaiser gehalten haben, einen Urlaub nehmen müssen, um sich von der geistigen Anstrengung zu erholen; es sind gute Menschen, die Ruhe brauchen. Unsere Diplomatie besteht aus Tänzern, Tennisspielern und Sherlock-Holmes-Lesern, die in jedem Lande die Hotels und die Bordelle kennen, eine Amerikanerin heiraten wollen und nie gelernt haben, mit einem wirklichen Menschen zu Verkehren und eine wirkliche Meinung anzuhören. In Konstantinopel sitzt ein Markgraf, als ob er auf dem Monde säße; jedes kleine Handlungshaus hätte einen solchen Kommis schon weggejagt. Jeder Pariser Korrespondent einer Wiener Zeitung weiß von Frankreich mehr als unser Botschafter dort, der alles erst aus der »Neuen Freien Presse« erfährt, aber nicht die Gabe hat, sie wenigstens richtig zu lesen. Und so konnte es geschehen, daß Aehrenthal sich in seinem Kalkül auf den deutschen Freund verließ; keiner unserer diplomatischen Kundschafter hat ihn gewarnt, daß der deutsche Freund froh sein muß, sich der eigenen Nöten zu erwehren, und es, wenn wir sein Schwert anrufen, bei einigen artigen Versicherungen angestammter Sympathie bewenden lassen wird. Jeder österreichische Reporter in Berlin, jeder Wiener Volontär bei einer Berliner Bank, und wer von uns nur je zwei Wochen in einem Berliner Café saß, hätte ihm das sagen können. Jetzt aber hat er es und soll mitten darin auf einmal die Politik des Reichs nun plötzlich, wie man's nennt, anders orientieren: nach der englischen Seite hin. Wie will er sich da, so lange wir hier ohne Verwaltung, draußen ohne Diplomatie sind, einer Politik im großen vermessen, aus dem Leeren, ins Blaue?
Und wie soll es ihm gelingen, sich den Apparat, den er braucht, zu schaffen, eine Verwaltung und eine Diplomatie, solange diese doch für unseren Adel reserviert sind, der es als sein historisches Recht ausspricht, von Staats wegen versorgt und ausgehalten zu werden? Hat er wirklich den Glauben an ein neues Österreich und den Mut dazu, so muß dieser Glaube, muß dieser Mut ihn zwingen, die Folge des allgemeinen Wahlrechts zu ziehen, und nun auch die Verwaltung, auch die Diplomatie zu demokratisieren. Schon scheint der Graf Thun, der bei weitem nicht so dumm ist, als er sich gern öffentlich stellt, dies zu merken und legt insgeheim seine Schlingen.
Zwei Worte, die man sich merken mag, hat der letzte Monat noch gebracht. Aus irgendeinem seiner sausenden und brausenden Feste hat der Bürgermeister ausgerufen: Gott vernichte alle Feinde des Kaisers! Der alte Lueger scheint seine Vergangenheit schon ganz zu vergessen. Weiß er nicht, daß dieser Gott, den er angerufen hat, der Gott des Zorns und der Rache, der vernichtet, daß das der Gott des alten Testaments ist, der Gott der Juden? Christen haben einen anderen, hört man wenigstens von allen Kanzeln predigen. Und ein anderer von dieser ehemals christlichen Partei des Lueger hat sich in offener Sitzung über die Zudringlichkeit der Armen beklagt und hat erzählt, daß er stets, wenn er als Armenrat mit Armen verkehren muß, einen Revolver auf dem Schreibtische liegen habe, und hat dann noch gesagt: »Ich wünschte nur, daß die Armenräte uniformiert werden, und jeder soll eine ordentliche Hundspeitsche in die Hand bekommen, damit er sich vor dieser Sippe hüten kann.« Das war die Bergpredigt im Wiener Gemeinderat.
2
Viktor Adler hat neulich einmal gesagt, auch ein guter Monarchist könnte sich doch mit einem Monarchen begnügen, zwei wären mehr als nötig. Ich denke, er hat damit nicht auf den Thronfolger gezielt, sondern auf die fleißigen Leute, die mit diesem jetzt denselben Mißbrauch treiben, der seit Jahren unter dem Namen des Kaisers getrieben wird. Unser Kaiser spricht nicht gern, und man weiß nie, was er sich eigentlich denkt. Im Deutschen Reich werden wir darum sehr beneidet. Es hat aber auch seine Nachteile. Einige benützen es nämlich, um ihren Meinungen und Absichten eine geheimnisvolle Macht und sich ein Ansehen zu geben, das ihnen aus Eigenem nicht zukommt, indem sie behaupten, irgendwie des Kaisers verborgene Wünsche zu kennen. Was sie wollen, verlangen sie mit der geheimen Versicherung, daß es der Wille des Kaisers sei. Was ihnen nicht paßt, weisen sie vertraulich mit Worten zurück, die der Kaiser gesagt haben soll. Und wer sich ihren Forderungen widersetzt oder ihren Verboten nicht fügt, ist also kein Patriot. Es ist bei uns eine Art Beruf geworden, zu jenen zu gehören, von denen man unter vier Augen, Diskretion Ehrensache, hören kann, was der Kaiser »eigentlich« will. Man kann davon leben. Und es ist nicht anstrengend, weil noch keiner dementiert worden ist. Allmählich hat es sich zu einem völligen System entwickelt, manche haben es darin zu wahren Virtuosen gebracht. Da gab es zum Beispiel einen Intendanten der beiden Hoftheater, der die Gewohnheit hatte, Schauspieler, die er nicht mochte, heftig zu loben, dann aber dem Direktor anzuvertrauen, wie leid ihm um diesen so hochbegabten Menschen wäre, der nun aber einmal das Unglück hätte, dem Kaiser zu mißfallen. Der Kaiser geht nicht ins Theater, wenn er nur seinen Namen auf dem Zettel sieht! Was nicht einmal gelogen war, weil der Kaiser wirklich schon seit Jahren nicht mehr ins Theater geht. Und die Macht dieser Leute bestand darin, daß es ja schließlich auch einmal wahr sein konnte. Es dauerte nicht lange, so wurde das System, zuerst von Protektoren erfunden, um ihren Lieblingen zu helfen, Nebenbuhlern zu schaden, dann auch in der großen Politik angewendet. Waren die Gründe des Ministers in offener Rede geschlagen, so nahm er sich Abgeordnete und Journalisten insgeheim vor, allen beteuernd, selbst durchaus ihrer Meinung, leider aber an den unbeugsamen Willen des Monarchen gebunden zu sein. Es kam ein eigener Typus von Ministern auf, der sich an jeden Busen warf, weinend, gezwungen zu sein, weil er nun einmal nicht könnte, wie er wollte! »Glauben Sie, ich weiß das nicht auch? Glauben Sie, ich will nicht dasselbe wie ihr? Glauben Sie, ich weiß nicht, was Österreich braucht? Aber sagens das dem Kaiser! Versuchen Sie einmal und sagens das dem Kaiser!« Wir hatten einen Minister, der schon ganz mechanisch jedes Gespräch mit dem Refrain schloß: »Aber sagens das dem Kaiser!«
Unter ihm bildete sich in der Politik gewissermaßen eine doppelte Buchführung heraus. Die Feinde, die er öffentlich mit flammenden Reden schlug, umarmte er zu Haus; was er öffentlich vertrat, verleugnete er daheim, und er lebte von dem Kredit, halt nur nie zu können, wie er wollte, und halt stets tun zu müssen, was er gar nicht wollte. Und so schützten ihn seine Feinde selbst vor jedem Nachfolger: denn sonst kommt am End einer, der auch noch will, was er muß; und das, dachten sie, wär noch ärger! Und die Journalisten schrieben, was niemand verstand, und wenn man sie fragte, sagten sie: »Das war doch gar nicht so gemeint, sondern Sie müssen wissen, was vorgeht, die Sache liegt nämlich ganz anders, der Minister möchte ja selbst, aber er kann nicht, weil der Kaiser nicht will!« So wurde die Politik jahrelang im geheimen betrieben. Und die Journalisten waren so stolz darauf, daß sie wußten, »was vorgeht«, wenn sie es auch leider nicht sagen dursten! Was aber »vorging«, war immer dasselbe, nämlich daß der Minister etwas wollte, aber um nicht dafür einstehen zu müssen, so tat, als wenn er wider seinen Willen nur gezwungen wäre, durch ein geheimes Gebot des Kaisers, das er übrigens in seinen Folgen abzuschwächen schon noch Mittel und Wege finden werde. Und es schmeichelte den guten Abgeordneten und den braven Journalisten sehr, eingeweiht zu sein, sie ehrten das Vertrauen des Ministers, und da sie nicht zweifelten, daß ja doch schließlich immer geschehen muß, was der Monarch will, halfen sie dem Minister noch bei seinen Mitteln und auf seinen Wegen. Das Verfahren war so probat, daß es bald allgemein angewandt wurde, und wo nur irgendwie eine unbequeme Forderung abzuwehren war widersprach man ihr nie, sondern man half sich stets mit der Berufung auf den vorgeblichen Unwillen des Kaisers aus. Immer nach diesem Klischee: »Aber natürlich habt ihr recht! Natürlich wär's das einzige! Glaubt's ihr, das weiß ich nicht auch? Glaubt's ihr, wenn's auf mich ankäm, hätten wir das nicht längst? Ja wenn's auf mich ankäm! Natürlich wär's das einzige! Aber sagens das dem Kaiser! Was soll ich denn tun, wenn der Kaiser nicht will? Und der Kaiser will nicht! Der Kaiser will –« Und nun eine lange Erklärung, mit allen Gebärden der Mißbilligung, was der Kaiser will. Natürlich immer nur das, was der Minister wollte, aber selbst zu verlangen zu feig war. Unsre Minister trieben es umgekehrt konstitutionell: sie deckten sich mit der Krone so, daß sie selbst gar niemals mehr in die Debatte gezogen werden konnten. Das ging nun so lange, bis einer eines Tages die überraschende Entdeckung machte, daß das Lügen ja nicht Privateigentum ist, sondern zur freien Verfügung steht. Log sich der Minister auf den Kaiser heraus, warum denn seine Gegner nicht auch? Und wenn der Kaiser zu seinen Lügen schwieg, wird er es wohl auch zu ihren! Man rechnete damit, daß der Kaiser schwieg. Und so vermehrten sich die »Wissenden«. Der eine hatte eine Tante, die mit dem Leibarzt bekannt war, der andre ritt mit dem Stallmeister in den Prater, der dritte war mit einem vertraut, der den kannte, der die Anekdoten erzählt, mit denen dann der Kaiser zum Frühstück versorgt wird. Wie jeder bessere Mensch sein Automobil hat, mußte jetzt, wer nur ein bißchen auf sich hielt, eine Hintertreppe haben. Das Komische war dabei nur, daß alle diese Lügner, die es doch hätten wissen können, untereinander den Verdacht hatten, an den Lügen der anderen könnte am End etwas Wahres sein. Als aber schon alle Hintertreppen besetzt waren und das Bedürfnis immer noch wuchs, hatte einer, wie schon die Not erfinderisch macht, den Einfall, daß wir ja auch einen Thronfolger haben. Plötzlich tauchten einige Leute mit der beunruhigenden Versicherung auf, daß ihre Zeit erst käme. Plötzlich war wieder ein neuer Kredit eröffnet: der der kommenden Männer. Und eine fieberhafte Bautätigkeit begann in neuen Hintertreppen. Und ein besonderer Reiz war es, daß der Thronfolger im Dunkel stand. Die Lügen über den Kaiser hatten nämlich doch ihre Grenzen an seinem Wesen, das, so selten es sich zeigt, mit den Jahren in Umrissen sichtbar geworden war. Aber der Thronfolger steht im Dunkel.
Der junge Erzherzog Franz Ferdinand wurde damals zuweilen mit dem Erzherzog Otto zusammen genannt, dem schönsten und liebenswürdigsten Prinzen, dessen strahlende Kraft an der Enge eines ziellosen Lebens zerbrochen ist; ein armer Wiener Mercutio war er. Dann hieß es, der junge Franz Ferdinand sei krank. Von Reisen heimgekehrt, hielt er sich abseits und vermied es populär zu werden. Er gehörte nicht zu den Prinzen, die Walzer komponieren, auf dem Graben Journalisten unter dem Arm nehmen, um mit ihnen über die Regierung zu schimpfen, und wenn die Naive vorübergeht, leutselig bemerken: »Schau, schau, die Kleine kriegt beinah einen Busen!« Niemals hat er sich, wenn er ausfährt, Ovationen bereiten lassen, sein stilles ernstes Gesicht winkt den Wienern nicht zu. Der Lärm unserer Gratispatrioten mit dem Federbusch scheint nicht nach seinem Geschmack, und er teilt offenbar die schlechte Meinung über Österreich nicht, in der sich unsere Prinzen gern gefallen. Ich habe einen gekannt, der, Kommandierender in einer kleinen Stadt, alle Herzen durch seinen Spott über unser Vaterland gewann. Nach der Session lud er einmal die Landtagsabgeordneten zu sich ein und bewirtete sie mit höfischem Tratsch. Wie machten da die braven Bürger und Bauern die Augen groß, als sie die Geschichten hörten! So arg hatte sich's keiner gedacht. Schließlich trank er ihnen zu, gab jedem die Hand und sagte noch zum Abschied: »Also auf Wiedersehn meine Herren, übers Jahr, falls nämlich im nächsten Jahr Österreich noch existieren sollte!« Durch die ganze Stadt lief es gleich herum, wie heroisch der Prinz gesprochen hatte. So furchtbar traurig kam mein alter Vater damals heim, ganz verlassen saßen wir in unserer untröstlichen Liebe zur Heimat. Diese Methode, sich beliebt zu machen, hat Franz Ferdinand nie versucht, er ist gar nicht fesch. Auch als er dann, unnachgiebig, mit seinem Herzenswunsch alle höfischen und politischen Bedenken überwand, ließ er sich die Gelegenheit entgehen, dem Volke romantisch zu kommen. Ein Kronprinz, der unbeirrt der Stimme seiner Neigung folgt und ein Mädchen unter seinem Stande nimmt! Aber es wurde zu der üblichen Reklame nicht benützt; er hat nirgends den volkstümlichen Erzherzog Johann Nummer zwei agiert. Was man ihm bei uns sehr verdenkt, wo es nicht genügt, was einer tut und wie er ist, sondern verlangt wird, daß er es dann erst auch noch spielen soll. Dies verschmäht er: das alte österreichische Spieltalent und unsere Lust, sich vorzuführen und wirksam darzustellen, sonst in der Dynastie sehr gepflegt, scheint ihm zu fehlen. Er ist den Leuten eigentlich unheimlich, denn sie sind es nicht gewohnt, daß einer seinen Weg geht. Der Wiener wünscht gefragt zu werden; er besteht nicht darauf, daß man seinem Rat dann auch immer gehorche, dies ist nicht nötig, aber gefragt will er sein. Und der Wiener liebt Leute, mit denen sich, wie er es nennt, immer »etwas tut«. Der Erzherzog fragt nicht, und »es tut sich« bisher gar nichts mit ihm. Und er hat gezeigt, daß er warten kann. Was nun auch wieder ganz unwienerisch ist, da hier meistens die Menschen niemals tätiger sind, als so lange es sie noch nichts angeht; sich aufzusparen ist nicht Landesbrauch.
Nun wird gegen ihn gesagt, er sei klerikal. Nach den Erfahrungen, die man mit den liberalen Kronprinzen gemacht hat, wäre das gar nicht so schlimm, vielleicht dreht auch er oben um. Und man mag fragen, welcher österreichische Monarch denn, seit dem zweiten Josef, nicht klerikal gewesen sei? Für das tätige Leben darf man Weltanschauungen auch nicht überschätzen. Wer sich nur nicht dem Notwendigen widersetzt, für den ist schließlich eine so gut wie die andre, da doch alle nur Hilfsmittel zur Einordnung der Gedanken sind, um es bequemer zu haben. Im höchsten Sinne ist keine wahr, aber von jeder aus kann man zu wahren Taten gelangen; warum nicht auch auf irgend einem Weg von der katholischen aus? Auch kann in dieser großen Krise des Klerikalismus jetzt, wo die Kapläne mit den Bischöfen ringen und die Kirche sich demokratisieren will, indem sich überall das unmittelbare Gefühl der religiösen Gemeinde gegen die vorgesetzten Lehrbehörden stellt, niemand wissen, was in fünf Jahren klerikal sein wird: der Name wird ja bleiben, aber wenn unter ihm eine starke, mißtrauische, demokratisch derbe Bauernpartei entsteht, die könnten wir brauchen. Und schließlich ist die Privatmeinung der Monarchen heute doch ziemlich unwichtig, solange sie sich dem öffentlichen Willen fügt.
Es heißt ferner, er sei stark, eigenwillig und unbeugsam. Das fürchtet man. Für die beste Eigenschaft des alten Kaisers gilt es unter uns, daß er stets den Entwicklungen im letzten Moment doch noch nachgegeben hat; er hört Forderungen an, wenn sie unaufhaltsam geworden sind, und läßt sie dann wider Willen geschehen. Dem verdanken wir viel, und so hat man sich bei uns angewöhnt, Entschlossenheit und Beständigkeit auf dem Thron eher für eine Gefahr zu halten. Nun scheint dem Thronfolger die Regententugend der gewissen heilsamen Schwäche zu fehlen, und man hat ihn im Verdacht, auf seinem Willen zu bestehen. Diese Furcht will mir doch ein wenig gar zu österreichisch scheinen. Sie nimmt ohne weiteres an, daß der Monarch und die Entwicklung einander feind sein müssen; dann ist allerdings eine Behutsamkeit erwünscht, die rechtzeitig die Gefahr von Explosionen spürt. Es ließe sich aber auch einmal einer denken, der sich zutraute, die Entwicklung nicht zu scheuen und, bevor er sich von ihr überwältigen läßt, lieber an ihr tätig teilzunehmen: der könnte es dann wagen furchtlos zu sein.