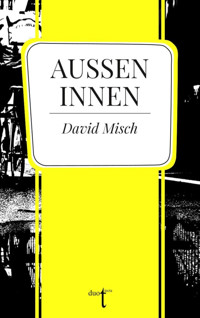
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: duotincta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kurzstrecke
- Sprache: Deutsch
"Keine Gedanken an vier Euro weniger für die nächste Monatsmiete – die halbstarke Spucke in ihrem Gesicht –, den dummgesoffenen Dispatcher oder die trotzdem stolzen Eltern. Die Zukunftsangst, die im Stillstand nach ihr heischt, kann Sabine auf ihrem Rad nicht einfangen." Vier Brüder in der noblen Wiener Naglergasse, eine Fluchtfahrt durch Graz, ein Verlorener zwischen Tarifa und Aachen, ein endendes Leben auf vergilbtem Fotopapier. – Unterliegt das Innen dem Außen, sind Dysbalance und Kontrollverlust die Folge. "Außen Innen" spiegelt eine Gesellschaft, in der Divergenz und Veränderung die einzigen Konstanten sind. Grundverschiedene Perspektiven, die sich zu einem Blickwinkel vereinen: jenem der Menschlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
verlag duotincta
Über den Autor
David Misch, 1985 in Wien geboren, lebt mit seiner Familie in der Steiermark. Neben Prosatexten, u. a. für die Literaturzeitschriften »manuskripte«, »Lichtungen« und »mosaik«, veröffentlichte er im egoth Verlag »Randonnée. Ein Ultracycling Tagebuch« (2016) und »Intensität. Auf der Jagd nach dem Flow« (2018) sowie im Covadonga Verlag »1000/24 – Christoph Strasser und die Jagd nach dem perfekten Tag« (2021). Sein Debütroman »Schatten über den Brettern« erschien 2020 bei duotincta und stand auf der Shortlist von »Das Debüt - Bloggerpreis für Literatur«.
David Misch
Außen Innen
Erzählungen
Kurzstrecke
#2
Impressum
Erste Auflage 2025
Copyright © 2025 Verlag duotincta GbR, Wackenbergstr. 65-75, 13156 Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Lektorat: Verlag duotincta/Ansgar Köb, Lohmar
Korrektorat: Carolin Radscheit, Berlin
Satz und Typographie: Verlag duotincta/Nikko Ray Cotelo, Balanga City
Einband: Jürgen Volk, Berlin
Coverabbildung: David Misch, Leoben
Vignette: unter Verwendung von pixabay.com
Printed in Germany
ISBN 978-3-946086-74-1
ISBN 978-3-946086-75-8
An anderer Stelle bereits erschienen:
»Vollzug« unter dem Titel »Büroalltag«, in: manuskripte 227, 2020
»Ivy League«, in: Lichtungen 164, 2020
»Waldläufer«, in: Mosaik 30, 2019/20
Bücher haben einen Preis! In Deutschland und Österreich gilt die Buchpreisbindung, was für Dich als LeserIn viele Vorteile hat. Mehr Informationen am Ende des Buches und unter www.duotincta.de/kulturgut-buch
Außen Innen
Für Jana, Simon und Nina
Inhalt
12 84 Tage
32 Elternhaus
48 Die Rezension
64 Vollzug
78 Wirtschaftsmigrant
88 Kulturkampf Polypropylen
98 Ivy League
110 Hansonkeltant’ und Ilona
126 Fluchtfahrt
144 Quadratisch, grün
164 Erbschaftssteuer
176 Machtkomplex
186 Körperkunst
192 Selbstoptimierung light
206 Waldläufer
210 Kayenta
224 Fahrt ans Meer
240 Son of Ambazonia
254 Zensus
84 Tage
Montag, 31.1.
Mit Mühe aufgestanden, nach dem ersten Kaffee ist es aber schnell bergauf gegangen. Auf dem Weg ins Büro wenig Verkehr, das war angenehm. Gleich notiert, dass mir das gefallen hat. Dabei ist mir eine gute Geschichte gekommen. Auch das notiert. Es wird immer besser mit der Konzentrationsfähigkeit. Nach dem zweiten Kaffee an die Arbeit gemacht, aber leider viele Ablenkungen. Zuerst der Anruf von Günter, wegen der vermissten Rezensionsexemplare. Dem nachgegangen, aber nichts in Erfahrung gebracht. Vielleicht hat sie der Praktikant am letzten Arbeitstag eingesteckt. Man weiß es nicht. Dann Susanne, Nachbesprechung vom Wochenendprogramm. Natürlich wieder bei der Politik hängengeblieben, und schon wieder Schweißausbruch. Den Schweißausbruch notiert. Die zehn Sätze in Gedanken durchgegangen. Den fünften ausgesucht. Das Sehen, das Hören und das Fühlen haben gut funktioniert. Beim Riechen waren mein penetranter Schweißgeruch und das Parfum von Susanne im Weg. Aufgeschrieben, wie das Versagen gerochen hat. Danach Ressortsitzung. Ruhig verhalten. Leider nichts sagen können, aber dafür auch nicht angesprochen worden. Während der ganzen Sitzung ruhig gesessen, ohne nervöse Ticks. Aufgeschrieben. Dann Mittagessen. In der Kantine, weil Freitag frei war. Jeden zweiten Tag in die Kantine gehen, für den Anfang, hat er aufgetragen. Nervös gewesen, weil es wieder so lange gedauert hat. Montags dauert es immer lange, aber zum Glück jetzt zwei Wochen Ruhe. Froh gewesen, dass jetzt zwei Wochen Ruhe ist. Aufgeschrieben. Jeden zweiten Tag, das ist machbar. Es muss machbar sein, damit es nachhaltig ist. Er muss es wissen. Nach dem Mittagessen eine Geschichte recherchiert. Beim Recherchieren müde geworden. Frustriert über die schnelle Müdigkeit den Bildschirm geschlagen. Aufgeschrieben. Zum Glück niemand im Büro, weil alle auf der Pressekonferenz waren. Notiert, dass ich auch auf die Pressekonferenz hätte gehen sollen. Vermeidung ist schlecht. Mit dem Gedanken an schlecht den Computer herunter- und nach Hause gefahren. Ein Paar Frankfurter, Senf, Kren, Semmel, ein kleines Bier und dreißig Tropfen Baldrian zum Abendessen. Die neue Staffel House of Cards angefangen. Der Gedanke an schlecht ließ sich nicht vertreiben. Früh im Bett, mit Big Sur von Kerouac. Notiert, dass Lesen über Kalifornien den Gedanken an schlecht verwischt. Mit dem Kugelschreiber in der Hand knapp vor Mitternacht aufgewacht, aber schnell wieder weggedöst.
Dienstag 1.2.
Blaue Flecken auf der Tuchent vom Kugelschreiber. Ab jetzt keine Notizen mehr im Bett. Die Morgenerektion bleibt weiter aus. Darüber nachgedacht, wieso das wichtig ist, wenn man sowieso keine Verwendung hat. Beim Gedanken an die verwendete Erektion hängengeblieben. Das notiert, und die Kugelschreiber-Sauerei. Der 82. Strich im improvisierten Kalender, eine ansehnliche Reihe. Heute kein Kaffee, stattdessen weißer Tee zum Warmlaufen. Es ist nicht dasselbe. Dementsprechend mies gelaunt in den Wagen gestiegen, der beim Starten wieder gezickt hat. Vermutlich das Abgasventil wie immer. Die Werkstattöffnungszeiten auf dem Smartphone gegoogelt. Danach mit Verspätung losgefahren und in den Stau gekommen. Das nennt man Kausalkette. Über das Wort Kausalkette nachgedacht. Eigentlich bestehen bei einer Kette alle Verbindungen schon von Anfang an. Über diese Unstimmigkeit weiter nachgedacht, dabei unruhig geworden. Mit dem Notizbuch zwischen den Beinen versucht, alles aufzuschreiben. Dabei fast ein Taxi gerammt. Über den Mittelfinger geärgert, kurz überlegt ihn zurückzuzeigen. Zum Glück nicht im Auto die Beherrschung verloren. Die Sätze haben geholfen, auch wenn das Riechen noch immer nicht klappt. Darüber nachgedacht, welche archaische Genwindung daran schuld ist. Seitdem kreisen schuld und schlecht um die Wette. Negationen vermeiden. Zu spät in der Redaktion. Notiert, dass sie blöd dreingeschaut haben, und Susanne auch ein bisschen besorgt. Günter ist im Krankenstand, Magen-Darm-Beschwerden. Darüber nachgedacht, wann ich ihm das letzte Mal die Hand gegeben habe, und ob ich morgen auch in den Krankenstand gehen kann. Vermeidung ist schlecht. Das notiert, zusammen mit den zehn Sätzen. Dabei ein paar Flüchtigkeitsfehler eingebaut, wegen der Verspätung. Zuerst Spam-Mails gelöscht, dabei auf die Anzeige für Erektionsbeschwerden gestoßen. Ertappt gefühlt und Browserdaten gelöscht. Dann die Redaktionsmails durchgegangen, langsam, um nichts zu übersehen. Keine Antwort auf die Interviewanfrage. Gott sei Dank. Vermeidung ist schlecht; notiert, dass das Interview etwas Gutes ist, etwas, auf das man sich freuen sollte. Das Hirn glaubt der Hand nicht, lässt sie aber trotzdem schreiben. Das ist ein Fortschritt in der Neuprogrammierung. Schlecht und schuld sind keine Fortschritte, aber man muss gnädig mit sich sein. Es sind schon, oder erst, 82 Tage. 82 Tage nach Reha. Die neue Zeitrechnung. Von der Einladung zum Jour fixe am Freitag überrascht gewesen. Die letzte Redaktionssitzung war vor genau 186 Tagen. Der Chefredakteur vergisst anscheinend schnell. Mit dem Bild des Chefredakteurs im Kopf nervös auf die Toilette gelaufen und den Darm entleert. Den kalten Schweiß auf der Stirn mit kaltem Leitungswasser gemischt, danach wieder ein paar Zeilen geschrieben. Die Geschichte wird wohl nicht in Druck gehen. Mittagessen diesmal von zu Hause mitgebracht, beim Gedanken an die Kantine morgen aber den Appetit verloren. Notiert, dass es unmöglich ist, seinem Gehirn das Denken zu verbieten. Das ist ja die Misere. Bei dem Gedanken an das Denkverbot fürs Gehirn an die verpasste Pressekonferenz denken müssen. Wieder so ein Kurzschlussgedanke. Am Nachmittag eigentlich nicht mehr viel weitergebracht. Die tiefstehende Sonne hat die Staubpartikel über der Tischplatte tanzen lassen wie kleine Hampelmänner. Mit dem Gedanken an die Interviewanfrage im Kopf den Computer hart heruntergefahren. Den Fluchtreflex erst auf der Stadtautobahn wieder losgeworden. Mit Paranoia abgefahren, falls die Polizei hinter mir war und die Schlangenlinien bemerkt hat. Zu Hause gleich fünfzig Tropfen Baldrian und eine halbe Xanor genommen. Die Xanor war vermutlich gar nicht nötig, weil eine halbe Stunde später bleierne Müdigkeit eingesetzt hat. Notiert, das nächste Mal auf die Tablette zu verzichten. Die übrig gebliebene halbe Xanor trotzdem wieder eingepackt und in den Badezimmerschrank gelegt. Alles aufgeschrieben, auch das Gefühl des Versagens und wieso ich mir Zeit geben muss.
Nachtrag: Aufs Kochen verzichtet, weil die Couch zu verführerisch dastand. Dafür zwei große Bier, die mit der Xanor gut reingehaut haben. Um drei ins Bett übergesiedelt, vorher die eingetrockneten Speichelfäden aus dem Couchbezug gerubbelt.
Mittwoch 2.2.
Gleich morgens den Therapeuten angerufen. Die Besorgnis in seiner Stimme ist mir nicht entgangen und hat mich besorgt. Es kann nicht sein, dass diese Sitten schon wieder einreißen, hätte er mir wohl am liebsten gesagt. Natürlich hat er das nicht, sondern die übliche Litanei aus Vor- und Ratschlägen, die eigentlich von mir selbst kommen sollten, damit sie auch schön wirksam sind. Vorher noch in der Redaktion angerufen, dass das Auto zickt und ich später komme. Es schleichen sich schon wieder Konzentrationsschwierigkeiten ein und ich habe Probleme, Abfolgen im Kopf in die richtige Ordnung zu bringen. Die zehn Sätze aufgeschrieben, bei Nummer sieben aber einen Fehler gemacht und ein Stück einfügen müssen. Die Reihenfolge von fünf und sechs vertauscht, darüber geärgert und den Kugelschreiber in die Ecke geschleudert. Die Flecken von der geplatzten Kugelschreibermine mit lauwarmem Seifenwasser und Radiergummi von der Wand entfernt, mit großer Verspätung losgefahren. Zum Glück ist der Wagen heute angesprungen. Es ist wichtig, auch das Positive gedanklich festzuhalten. Schriftlich nur mehr, wenn ich nicht gerade Auto fahre oder sonst irgendetwas mache, wobei andere zu Schaden kommen könnten, hat der Therapeut gesagt. Ich komme mir immer vor wie ein geistig Zurückgebliebener, so wie er mit mir spricht, als müsste man mir selbst die einfachsten Alltagsverrichtungen vorbeten, als wären sie intellektuelle Meilensteine. Ich bin Kulturredakteur bei Österreichs wichtigster Zeitung, verdammt. Jetzt bin ich gedanklich schon schlecht, schuld und verdammt, und der Psychohygieniker behält wieder recht. Meine Resilienz ist unter aller Sau. Daran will gearbeitet werden, zum Beispiel, wenn im Stau wieder kein Auskommen in Sicht ist. Kurz überlegt, doch zum Notizbuch zu greifen. Den Gedanken als verkappten Fluchtreflex enttarnt. Heute keine Schwächen mehr, auch nicht in der Kantine und beim Telefonat mit dem geschleckten Pomadenaffen, das endlich geführt werden will. Wieso passen Pomade und Koks gedanklich so gut zueinander? Darüber den Stau vergessen; im Schritttempo weiter, bis er sich kurz vor der Redaktion verflüssigt hat. Susanne war heute nicht am Platz, zum Glück. Diese Besorgnis, in die sich auch ein bisschen Ärger mischt, trifft mich. Er sagt, es ist ein gutes Zeichen, wenn mich etwas trifft – Gefühle sind schon in Ordnung, wenn man sie nur positiv konnotiert. Es ist erstaunlich, wie gut sich die Negationen in unserer Alltagssprache verstecken. Das wäre vielleicht eine Geschichte wert, aber welches Ressort? Notiert, dass ich mich wieder mehr in die Programmplanung einbringen muss, zumindest Bemühen zeigen. Er meint, nur dann werden sie mich wieder für voll nehmen, auch wenn er es eleganter formuliert. Er sollte ein Buch schreiben, oder eine Kolumne. Könnte für viele interessant sein. Bis der Computer endlich warmgelaufen ist, hat mir schon der Magen geknurrt, aber der Darm hat gestreikt beim Gedanken an die beengte Kantine. Auf dem Klo kurz überlegt, ob ich heute auslassen kann. Entschieden, dass das wohl nicht geht. Zum Glück war heute süßer Mittwoch und kaum Leute da. Der grüne Freitag wird eine Herausforderung, den lieben sie. Gesättigt den Pomadenanruf erledigt. Einfach so. War leichter als gedacht, mit den Kantinenendorphinen als Rückhalt. Vielleicht gibt es doch einen Fortschritt. Das Interview soll schon am Dienstag stattfinden, vor dem Konzert in der Stadthalle. Günter wird sich nicht freuen, am Dienstag pokert er immer mit den Sportredakteuren. Aber Susanne wird der Chefredakteur nicht einmal in Betracht ziehen, bei dem Interviewpartner. Selbst wenn Günter noch immer krank sein sollte, wird er sie nicht fragen, und sie wird sich grün und blau ärgern und dabei rot werden. Die Staubhampelmänner tanzen schon wieder, dabei ist kaum etwas passiert. Irgendwie demoralisierend, wie langsam jetzt alles geht. Schlecht, schuld, verdammt langsam. Schon wieder wird der Fortschrittsgedanke von Selbstnegation gekapert. Muss an der Hirnchemie liegen, oder irgendeinem unaufgearbeiteten Freud’schen Trauma. Wie kann er nur ewig Verständnis heucheln, bei all den Patienten, die ihm täglich die Ohren vollseiern? Notiert, ihn das zu fragen, wenn er wieder besonders ölig daherkommt. Notiert, dass das wohl nicht gut ankommt und ich es besser bleiben lasse. Ich muss lernen, den destruktiven Impuls wieder für mich zu nutzen. Das würde er nicht gerne hören wollen, aber ich bin davon überzeugt. Dieser Positivismus (kommt das nicht eigentlich aus der Philosophie? Googeln!) schlägt nicht an, nicht schnell genug jedenfalls. Vielleicht gibt es einen Kompromiss, ein Balancieren auf der Klinge. Über dem Nachdenken die Zeit vergessen, dafür ein paar gute Sätze geschrieben, was die Geschichte angeht. Vielleicht wird noch etwas aus ihr, für Online oder den Blog. Ablagen für Günter erledigt, damit er sich freut, wenn er zurückkommt. Tue Gutes und Gutes wird dir widerfahren. Wehe, wenn es einem schlecht genug geht und man sich an solche Leitsprüche klammern muss. Schwere Entscheidung, was da das geringere Übel ist, körperlicher Zusammenbruch oder geistige Umnachtung in babyrosa. Beim Gedanken an babyrosa Hemden aggressiv geworden. Interessante Assoziation. Vielleicht kann Ablage meine Meditation werden? Mit dem an die Wand starren habe ich es nicht so, der einsetzende Schwindel befeuert die Ticks. Notiert, auch Susannes Ablage zu übernehmen – sie wird es freuen und ich stehe gut da und habe eine Stunde Ruhe. Das angenehme am Nachdenken: die Zeit vergeht. Pünktlich ausgestempelt und vor dem Chaos durchgekommen. Zu Hause an der Geschichte weitergeschrieben, dabei den Anruf von Günter verpasst. Wahrscheinlich hat ihn der Ressortleiter schon wegen des Interviews aufgescheucht, vor der Redaktionssitzung. Soll er es sich auf die Fahnen heften. In Rage geschrieben beim Gedanken, dass vor sechs Monaten noch ich das Interview hätte machen können, müssen, dürfen. Und was wollte Günter wirklich? Auf dem Gang zum Badezimmerschrank schon gewusst, was passieren wird. Die halbe Xanor mit zwei Bier und einer Cash-Platte gemischt; dabei konfuses Zeug geschrieben, das vermutlich gelöscht gehört. Den eingepackten Rest vom Kantinen-Kaiserschmarrn mit Retortenapfelmus und einem dritten Bier (darin 50 Tropfen Baldrian und zwanzig Tropfen Rosenwurzextrakt) gejausnet, das hat gutgetan. Wichtig ist, wieder an solchen Kleinigkeiten Freude zu haben; vielleicht sind sie gar nicht so klein, vielleicht machen sie eigentlich alles aus. Ein schöner Gedanke zum Einschlafen, aber leider wachgelegen bis halb drei, dabei die zehn Sätze und noch vieles andere aufgeschrieben, und die Sinnesübung dreimal hintereinander gemacht, mit mäßigem Erfolg beim Riechen, wie immer.
Donnerstag 3.2.
Wie immer, wenn alles zusammenkommt, kommt alles zusammen. Keine Zeit eigentlich für diese Kindereien. Schlecht geschlafen. Nicht aus dem Bett gekommen. Abgestanden pelziger Geschmack, als wäre im Hals der Siphon ausgetrocknet und Fäulnisgas hätte sich auf den Weg in den Mund gemacht. Ohne Frühstück, ohne einen Schluck Wasser, Kaffee oder Tee ins Auto, die nächtliche SMS von Günter brennend im Hinterkopf. Konnte keiner wissen, dass die geschmierten Notizen so wichtig für die Gegendarstellung sind, dass er für sie direkt von der Klomuschel ins Chefbüro zitiert wird. Natürlich ohne Notizen – muss eine Überraschung gewesen sein, beim Durchsuchen des Arbeitsplatzes (zum Glück ist er so ein Chaot, dass er gar nicht auf die Idee kommt …); ein riesiges Donnerwetter, wie immer beim Obercholeriker. Wie kann man nur so babyrosa dumm werden in 187 Tagen? Günter wird schäumen, wenn er was davon erfährt – und er wird, wenn er erst genau sucht. Kündigung hat er nicht verdient, auch wenn er keine Ahnung hat, wie man Journalismus buchstabiert. Hat Susanne etwas bemerkt, gestern Nachmittag? Und dann springt genau jetzt der Wagen nicht an, und die Werkstatt ist natürlich noch nicht informiert; scheiß Vermeidung, die einem immer auf den Kopf fällt, auch wenn man es nie wahrhaben will, bis es wieder passiert. Bleibt nur das Taxi – Volk von Wahnsinnigen in zu teuren Leasingautos. Wären eine Geschichte wert. Reizdarm und Angstschweiß geben sich die Klinke in die Hand. Eingestiegen auf die Provokation und verloren im rhetorischen Schlagabtausch, ob Istanbul oder Wien die Drehscheibe in den Nahen Osten ist. Keinen Gedanken kann ich festhalten, wenn es mir so geht. Nicht einmal zehn einfache Sätze. Wie soll man ohne seinen kreativen Geist leben, betäubt und in babyrosa Watte gepackt – glücklich und im Reinen mit sich selbst und der Welt, aber belanglos? Betrüge ich mich um meine Genesung, um 187 Tage Verbesserung in kleinen Schritten? Kleinen Fort-Schritten. Fort vom weißen Gemäuer der Anstalt, auf mich gestellt und doch angewiesen auf die kleinen Stöckchen, die er mir zuwirft. Notiert, dass ich schon wieder mit mir selbst diskutiere, hinten, im Fond eines Taxis, Schweiß rinnt mir den Rücken hinunter, paust sich durch das billige Polyesterhemd und durchtränkt das Kunstleder. Und ich beginne wieder abzuschweifen, in Fantasterei und lose Assoziationen. Noch einmal werden sie es nicht erlauben, dass ich zurückkomme. Dann ist es aus. Womit eigentlich? In der Redaktion sitzt Susanne in unverhohlenem Zorn. Sie weiß also etwas. Aufgeschrieben was wäre, wenn ich Susanne ins Gesicht sagen könnte, was ich von ihr halte. Keinen originellen Satz geschrieben und schimpft sich Redakteurin. Aufgeschrieben, dass notieren ein schöneres Wort ist als aufschreiben. Manchmal zeugt einfache Ausdrucksweise von mehr Können als hochtrabendes Geschwurbel. Fragt die Pulitzerpreisträger. Wie kann man einen Notizblock von beachtlicher Dicke in 187 Tagen vollschreiben, ohne etwas Relevantes zu Papier zu bringen? Zum Glück ist es Umweltpapier. Wäre eine Geschichte wert, wie man so etwas produziert – Umweltpapier. Muss ein Riesenaufwand sein, die ganze Farbe aus alten Papierschnipseln herauszuwaschen und daraus neue, unbeschriebene Notizblockseiten zu machen. Zu denen man etwas bringen kann (die Formulierung ist schön – etwas zu Papier bringen). Da müsste man einen zweiten Blick darauf werfen, ob es sich wirklich lohnt, oder auch nur irgendein Beschiss dahintersteckt, an dem jemand fürstlich verdient und sich ins Fäustchen lacht, während wir unser Gewissen beruhigen. Wer könnte daran verdienen, an braungrauem, getrocknetem Zellulosebrei? Irgendjemand immer. Notiert, das zu googeln. Eine halbe Xanor eingenommen, um die Gedanken zu ordnen (kann das Präparat das überhaupt, die Gedanken ordnen? Googeln, wie es wirkt und warum!). Im Rollkasten den Wodka von der PR-Veranstaltung im MAK entdeckt; musste ja so kommen. Hat aber gutgetan, mit der halben Xanor als Rückendeckung. Endlich ruhiger; das Archiv durchsucht, Mittag ist dabei spurlos an mir vorübergegangen – ein schönes Gefühl, sich in ein Problem zu verbeißen, ganz wie früher, und darüber Zeit und Norm zu vergessen. Das kann ja auch nicht alles weg sein, wegen einem Mal die Regeln beugen. Wie oft werden Susanne und Günter schon geflunkert haben, wenn nichts Passendes dabei war, das Quote bringt? Sieht man ja an Günters Notizen, wie er arbeitet. Nichts gefunden, notiert, dass mir das auch egal ist. Schlecht, schuld und verdammt langsam – das vielleicht bald nicht mehr. Heute habe ich es gespürt, es ist noch da, zugedeckt von esoterischer Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist auch Selbstnegation, oder nicht? Wie soll man so einen Spagat seelisch überleben? Ich bin, wer ich bin. Notiert, dass in schlecht auch echt und damit wahr steckt. In schuld steckt nichts, und vielleicht bin ich es auch nicht, wenn Günter nicht besser aufpassen kann, wo er sein Zeug liegen lässt.
Nachtrag: Nach dem Archiv schliefen die Hampelmänner schon in der Dämmerung, und ich bin noch auf drei Bier in die Kneipe; ohne Angst, dafür hat die zweite halbe Xanor gesorgt, und ohne schlechtes Gewissen, weil Günter immer ein Arschloch war zu mir, und besonders während der Sitzung vor 188 Tagen, als alle auf mich eingehackt haben, bis ich nicht mehr konnte als zurückhacken, so, dass bis heute kein Gras mehr wächst, wo ich hingehackt habe. Und ohne Notizbuch. Das war ein Fehler, bei all den Geschichten, die man dort aufschnappt. Ich bin der Spiegel für die Fratze der Bigotterie, seelen- und gewissenlose Berichterstattungsmaschine. Und wie ich es liebe. Zu Hause angekommen noch ein Absacker aus Wodka, Rum und abgestandener Cola Light. Kein Baldrian oder Rosenwurz heute.
Freitag 4.2.
Aufgewacht mit einem Riesenkater – das müssen die Tabletten sein, mit Alkohol war ja nicht viel. Und einer Erektion! War aber nicht so einfach, sich darüber zu freuen, bei dem Brummschädel. Immer ist irgendetwas, das die Freude vermiest. Und Verwendungsmöglichkeit weiterhin keine in Sicht (vielleicht Susanne, wenn sie lockerer wird?). In der Redaktion angerufen, um mich krank zu melden. Erbärmlich genug dürfte ich geklungen haben, dass sie es mir abkaufen werden. Der Wagen streikt ja, und noch eine Taxikonfrontation in dieser Woche könnte blutig enden. Gleich in der Werkstatt angerufen, um für den frühen Nachmittag einen Termin zu vereinbaren, noch vor dem Wochenende (haben die morgen offen, wenn es etwas Gröberes ist?). Fragt sich nur, wie ich den Wagen jetzt dorthin bekomme. Vielleicht springt er ja doch noch einmal an, wenn es etwas wärmer wird. Zweiter oder dritter Frühling, soll es ja geben. Beim Warten auf die Wärme das Notizbuch durchgeblättert auf der Suche nach den schönen Sätzen für die Geschichte, die heute fertigwerden soll. Nur pseudoromantisches Gewäsch gefunden, dem die Ecken und Kanten fehlen. Das sich nichts traut. Und die zehn Sätze, immer und immer wieder. Und schwachsinniges Geschreibsel zum eigenen Befinden, das den Anschein von völligem Irrsinn erweckt. Trotzdem die zehn Sätze noch einmal hinten reingequetscht und damit das Buch endgültig vollgemacht. Ein neues Notizbuch ist ein neuer Anfang, eine Abzweigung ohne Wegweiser. Auch ein zweiter oder dritter Frühling. Die Wärme lässt sich bitten, also weitergeschrieben an der Geschichte. Sie wird dunkler, je heller mein Geist wird. Ich laufe wieder zur Hochform auf. Die halbe Xanor auf nüchternen Magen spüre ich kaum, außer, dass ich es mit mir selbst nicht so genau nehme. Schönes Leben, als kranker Schreiber. Ein bisschen nagt sie doch, seine Stimme im Hinterkopf, die langsam die Beherrschung verliert bei so viel Fatalismus. Also die Sinnesübung. Und siehe da, heute gelingt sogar das Riechen, als hätten sich Nasenschleimhäute und Verstand gegen die Therapie verschworen. Vielleicht schaffe ich doch den Spagat, muss das Düstere, das mich ausmacht, auch wenn er das nicht hören will, nicht ganz aufgeben, aber auch nicht den Gesellschaftskonformismus, der vieles leichter macht. Soll er doch recht behalten. Die Sätze, die Übung, das bisschen vorgetäuschter Selbstbetrug – wenn es hilft, nicht aufzufallen, ein kleiner Preis für Abende wie gestern, Zeilen wie heute. Will ich mich für mich anpassen oder für ihn? Für sie alle. Damit ich in Ruhe gelassen werde, es einfach weiterläuft wie bisher, nur ohne den obligatorischen Zusammenbruch alle paar Jahre – oder Monate, so hat er es mit niedergeschlagenen Augen (hat er vergessen, dass ich darin geschult bin, entgleiste Gesichtszüge zu entlarven?) prognostiziert und damit die Unabdingbarkeit seiner Expertise in meinem lithiumgetränkten Gehirn einzementiert, dieser geschickte Souffleur. In den Post-Atomkrieg-Dystopien sind die Kakerlaken am anpassungsfähigsten. Kakerlaken und Quacksalber schenken sich vermutlich nichts in diesem Belang, beide wird es immer geben, solange es Dreck gibt – den Dreck anderer –, in dem man rühren und den man aufwirbeln kann, um sich genüsslich darin zu suhlen und zu verkriechen, bevor man als Schädling entlarvt wird. Anpassen oder mit wehenden Fahnen untergehen; es muss doch einen Kompromiss für mich geben – mich, mich, MICH. Notiert, die Kakerlake zu googeln (mit Fokus auf ihren Lebensraum und wie man sie doch loswerden kann). Wieso eigentlich noch immer diese aufoktroyierte, stupide Tagesablaufbeschreibung im Telegrammstil? Weil er danach fragen wird? Vermutlich, und ich ganz die wehende Fahne im Wind, um jeden Preis Auffälligkeiten vermeiden, dabei so viele schwelende Glutnester im Kopf, die nach Löschung durch Exzess schreien. Was wird er machen, wenn es wieder auffällt? Wenn die Ticks zurückkommen, oder die Verhaltensauffälligkeiten in der Redaktion? Heute wäre so ein Tag; die Redaktionssitzung, da könnte es passieren. Ihn würde es bestimmt freuen, meinen persönlichen, scharfgemachten Pleitegeier, der über meinem Kopf kreist wie ein Damoklesschwert, und gute Ratschläge, die nur Stillstand und Ruhigstellung bedeuten, herunterkrächzt. Ich könnte mir einen Spaß machen und in der dritten Person schreiben, vielleicht reibt er sich dann die Hände, weil er eine noch nachhaltigere Persönlichkeitsstörung wittert. Vielleicht lässt er mich aber auch wieder einweisen, also lieber gute Miene zum bösen Spiel (und die provokanten Seiten schwärzen nicht vergessen, vor Mittwoch!). Wenn selbst Big Sur bedrohlich wirkt im richtigen, nebelgetrübten Licht, wie kann dann überhaupt irgendetwas von absoluter Richtigkeit sein? Wie kann er sich anmaßen, mich als abnormal und die Gehirnzombies, die Weltschmerz und Absurdität des Lebens mit Ignoranz und Selbstbetrug begegnen, als normal, als gesund zu klassifizieren? Sind nicht sie schlecht, schuld und verdammt langsam beim Kapieren der augenscheinlichsten Tatsachen!? (Big Sur googeln und versuchen, das Bedrohliche zu verstehen, von dem Kerouac schreibt.)
Nachtrag: Jetzt sitze ich wieder hier, ohne Verpflichtungen, ohne festen Tagesablauf, ohne Verantwortung für Geld und Verpflegung, und am schlimmsten: ohne Erektion! Eigentlich soll ich nicht schreiben – er meint, die Idee mit dem Notizbuch war in meinem ganz besonders gelagerten Fall eine schlechte (er konnte es aber nicht wissen, sagt er); als Journalist löst das Schreiben bei mir offensichtlich einen geistigen Fluchtreflex aus, irgendeine subversive Gehirnzelle versucht immer, Stunk zu machen und sich gegen die Neuprogrammierung aufzulehnen. Und eigentlich ist schreiben – in meinem speziellen Fall – nichts anderes als Selbstgespräche führen, und die soll man meiden wie der Teufel das Weihwasser, wenn es schlecht um die psychische Konstitution bestellt ist, zumindest sehen das alle Experten so, die er großteils persönlich kennt und auch dazu befragt hat. Ich warte noch auf die medikamentöse Einstellung, dann wird alles klarer werden. Auch, wann und wie ich mich auf den Weg in die Redaktion gemacht habe. Gefunden haben sie meinen Wagen, kaltverschweißt mit dem Cabrio des Chefredakteurs (scheint also doch angesprungen zu sein!). Die Sitzung schon voll im Gange, ich hinein und großes Tohuwabohu wegen des Interviews. Dabei hat der Chefredakteur mich sowieso dafür haben wollen, hätte es mir montags persönlich mitgeteilt – sagt er –, wegen meines Faibles für Austropop. Scheints kann Günter damit aber auch gar nichts anfangen, richtig rebellisch geworden ist er mit dem Chef an der Strippe, und hat mich vorgeschlagen. Das wollte er mir auch erzählen am Telefon, dass er mich forciert hat, schon in der ersten Woche, und dafür vermutlich ein Lob kassieren, Vorzeigekollege usw. usf. Jedenfalls soll der Anschiss wegen der fehlenden Notizen – die SMS scheint er im Suff geschrieben zu haben – nicht annähernd so schlimm gewesen sein. Eher laues Lüftchen, denn brüllender Orkan, wie sonst üblich – muss frisch verliebt sein der Chef, oder angehend altersmilde, wenn ihn nicht einmal das kaltverformte Cabrio mehr in Rage bringt (er hat auch schon angerufen und sich erkundigt, wie es denn gehe – und froh war er, als ich ihn aus dem Gespräch entließ, kleinlaut wie der Praktikant). 84 Tage also ist jetzt mein Rhythmus. Damit kann man arbeiten. Genug Zeit, eine gute Geschichte zu schreiben. Die letzte noch einmal durchgelesen, auch auf Droge liest sie sich wirklich, wirklich gut. Vielleicht sollte ich ihr und denen, die noch zu schreiben sind, einen der zehn Sätze widmen. Vielleicht sogar alle. Auch das Riechen kann ich mir vorstellen – eigentlich sogar als erstes, den Geruch nach Umweltpapier, oder Glanzpapier und Toner, ganz deutlich nehme ich ihn wahr, jetzt schon, mit verklebten Schleimhäuten und zugedröhnt, ohne mich allzu sehr darauf zu fixieren. Man kann sich selbst eben doch nichts vormachen. Ich freue mich, wenn ich richtig eingestellt bin und mich wieder konzentrieren kann. Dann werde ich sofort mit Schreiben beginnen. Hoffentlich lässt er mir das Notizbuch nicht wegnehmen; wäre schade, es sind kaum zehn Seiten voll. Susanne und der Schlagerstar; also hätte mich der Chef wirklich hingeschickt, so einen guten Eindruck hat alles auf ihn gemacht. Aber sie wird es auch gut machen, und freuen wird sie sich, dass sie einmal im Mittelpunkt steht, Günter auf dem Scheißhaus (ich vermute es), ich im Irrenhaus. Darüber kann man lachen, und das will er doch von mir (wollen sie alle) – positive Neuvernetzung der teerverkrusteten Synapsen, Schluss mit der latenten Schwarzmalerei. Nichts mehr im Verborgenen, alles an die Sonne. Und flugs ist der Mensch wieder funktional. Sagt er, und ich beginne ihm zu glauben.
Elternhaus
In der Naglergasse wohnen vier Brüder.Alles Männer von Welt: einer Steuerrechtsexperte im Finanzministerium, einer Chemieprofessor, einer Zirkusdirektor und der Jüngste … – da weiß keiner genau, was er macht, doch er schwimmt im Geld und fährt Porsche Cabrio. Norbert das Nesthäkchen; vielleicht kommt daher sein Selbstverständnis, das Universum krümme sich nur, um allen Normalsterblichen einen guten Blick auf sein Tun zu gewähren.
Der Älteste, Josef, ist ein ernster Mensch, gehobenes Bildungsbürgertum mit zementiertem Weltbild und klaren Wertvorstellungen. Die zwei mittleren, Peter und Franz, sind in ihren Eigenschaften Zwitterformen der Endglieder Josef und Norbert. Zu viert bilden die Brüder also eine Art Josef-Norbert-Mischreihe, nach der Sprache von Peter.
Der Vater konnte den Josef nie leiden, doch als seinen Stammhalter akzeptieren musste er ihn, so kannte er es von seinem Vater, zu dem er noch Sie sagte. Der Josef bekam immer die volle Härte zu spüren, das sehen auch die drei anderen so, und selbst am Schluss konnte ihm der Vater nicht gerade ins Gesicht schauen, vielleicht auch aus Scham, denn die Altersmilde blieb nicht gänzlich aus. Die Nachricht traf den Josef genauso tief wie die unverhohlene Verachtung des Vaters, als er sich für das Jurastudium und gegen einen handfesten Beruf – etwa Maschinenbauer oder Bergingenieur, schwebte dem Patriarchen vor – entschied. Für den Vater zählte Bildung etwas, sogar so viel, dass er unter seinen Stammtischkumpanen als der Revoluzzer galt. Aber einen Luftikus wollte er nicht durchfüttern müssen, und selbst nachdem Josef per Handschlag vom Staatssekretär – in Vertretung des Ministers – auf seinem neuen Posten vereidigt wurde, zeigte er dafür kein ernsthaftes Interesse, eher im Gegenteil, kaum verborgene Enttäuschung, dass nun der falsche Weg auch noch geebnet und sauber gepflastert war.
Mit der Chemie konnte der Alte mehr anfangen, wenn auch lieber zugunsten eines profitablen Unternehmens, denn als Hallodri für arbeitsscheues Studentenpack, wie es, glaubte der Vater und weiß der Sohn, heute die Universitäten überschwemmt. Peter konnte sich gut hinter Josef verstecken, wiewohl er, bevor die Professur unter Dach und Fach war und er in die Akademie berufen wurde, was dann auch dem Vater etwas galt, selbst genug einzustecken hatte. Beide, Josef und Peter, können sie Franz bis heute nicht verzeihen, dass an ihm immer die brühendheiße Suppe abperlte, die dann einer von ihnen – mit einem lauten »Danke schön, Franz!«, aber nur im Geiste – auszulöffeln hatte. Gegen Norbert hat eigentlich keiner der Brüder etwas – eigentlich –, zumindest nicht so richtig, denn er war mit zwölf Jahren Abstand eine schwere Geburt, fast wäre die Mutter am Kindbettfieber draufgegangen, hätte sich so zumindest den Krebs erspart. Norbert schien nicht nur Luft wie Franz, sondern gar süße Luft zu sein für den Vater; völlig nebensächlich was er trieb, es legte sich immer eine einfältige Heiterkeit über die Eltern, wenn er kam, wie es bei Eltern eigentlich sein sollte, zumindest sieht man das heute so.
Aber auch Norbert musste so einiges durchstehen, keiner weiß von der Fehlgeburt seiner Ex, den Ängsten, der ständigen Traurigkeit, gegen die nicht einmal der Porsche hilft. Gerade weil er nie etwas musste, so wie seine Brüder, ist er der Getriebene, der Zampano im Geldverdienen, Abschleppen und Rauslavieren. Das Wasser steht ihm bis zum Hals, doch er schwimmt gut – besser, als es ob der viel zu weichen Erziehung und der kosmischen Nachlässigkeit, die ihn immer auf die ebenso weiche Butterseite fallen ließ, zu vermuten wäre.
Zwischen Norbert und Josef steht – eigentlich – doch etwas im Raum, und Peter, im Unterschied zu Franz, weiß etwas darüber, doch keiner der Brüder spricht davon, und vermutlich wäre nur Franz in der Lage, Worte zu finden, die den Graben zu überspannen vermögen, doch der weiß eben nichts, und weiß überhaupt am wenigsten, denn er ging früher fort als die anderen, und kam seltener zurück. Vermutlich eine Grausamkeit, wie sie zwischen älteren und jüngeren Brüdern seit jeher und überall auf der Welt vorkommt, dem biologischen Wechselspiel von Dominanz und Unterordnung geschuldet, das sich nicht nur im Sexuellen manifestiert. Aber wer ist schon ohne Narben? Jetzt, da der Vater tot ist, spielt das ohnehin keine Rolle mehr, denn das Elternhaus ist nur mehr eine leere Hülle, und damit – so steht es zu befürchten – auch die Zeit, als die vier im Leben noch von Belang waren füreinander, abseits des unvermeidlich Unterbewussten, das jeder von ihnen mit sich herumträgt, und das zu entwirren mehr als einen Freud, einen Adler und einen Jung zugleich bedürfte.
Der Franz weiß noch nichts davon. Wie schon beim letzten Mal, als die Mutter im Sterben lag, in Windeln und mit Schläuchen aus ihrem Mund, die das absaugten, was ihr Körper nicht mehr selbst loszuwerden vermochte, und was sie langsam und doch kontinuierlich vergiftete, ist er selig in seiner Unwissenheit, wie immer der Paradiesvogel, der sich nur niederlässt, wo es ihm gerade passt – und das nie für lange. Eine Tournee durch Russland, und Franz wie immer ohne Kontaktmöglichkeit. Die Nachricht wird ihn bald erreichen, irgendwie, doch dann wird schon alles erledigt sein, was nun wieder an Josef – vor allem – und Peter hängenbleibt. Norbert ist wie schon beim Tod der Mutter in Schockstarre, ab in den Porsche und dem Sonnenuntergang entgegen, vermutlich klischeehaft mit einer flüchtigen Bekanntschaft an seiner Seite und jedenfalls nicht willens, Verantwortung zu übernehmen. Josef telefoniert und wundert sich über das Geschäft Tod, obwohl er es schon von damals kennt. Eine Mitarbeiterin des Bestattungsinstituts belehrt ihn freundlich und gewissenhaft über Urnen und Särge, adäquate Blumenauswahl und stimmungsvolle Trauermusik, die Länge der individuellen Eintragung auf der Gedenktafel, und wie diese sich preislich niederschlüge im Vergleich zu einer kostengünstigen Standardvariante. Josef, der Ministerialbeamte von Einfluss, entscheidet sich immer für das Teuerste.





























