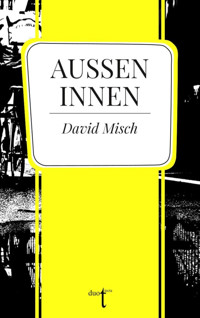Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: duotincta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Theaterspieler in Zeiten zunehmender Repression. Er ist hin- und hergerissen zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und dem Streben nach Selbstverwirklichung. Seine Figuren und Rollen, die er nicht spielen muss, weil sie in ihm zur Realität geworden sind, bedeuten ihm alles. Eine Kulturverordnung droht sie ihm zu nehmen und der Kampf gegen die neue Autorität im Lande stellt Beziehungen und eigenes Ich mehr denn je in Frage. In seinem ersten Roman beschwört David Misch eine abgrundtief böse Macht herauf, die aus der Mitte einer Gesellschaft entsteht, in der Reflexionsvermögen und mahnende Erinnerungen schwinden. Eine konkrete Dystopie: Prinzip Warnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
verlag duotincta
David Misch
Schatten über den Brettern
Roman
Über den Autor
David Misch, 1985 in Wien geboren, lebt mit seiner Familie in der Steiermark und ist dort in der geowissenschaftlichen Forschung tätig. Ob Reportage, politische Kurzgeschichte oder Roman, er schreibt, weil er muss. Seine belletristischen Texte handeln von gesellschaftlicher Ausgrenzung, Hetze und einfachen Wahrheiten. Literatur als Spiegelbild der Gesellschaft hält er für wichtiger denn je. Neben Prosatexten, u.a. für die Literaturzeitschriften »Manuskripte« und »mosaik«, veröffentlichte er »Randonnée. Ein Ultracycling Tagebuch« (2016) und »Intensität. Auf der Jagd nach dem Flow« (2018), eine Reportage über Österreichs Extremsportler (beide im egoth Verlag, Wien).
www.davidmisch.at
Für Jana und Simon
Es gibt auf Erden zwei Menschenrassen, aber auch nur diese beiden: die »Rasse« der anständigen Menschen und die der unanständigen Menschen … Was also ist der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist.
Viktor E. Frankl
… trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager
1
ER kann sich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal nicht ängstlich war. Die Angst begleitet ihn wie ein Schatten, immer da, mal größer, mal kleiner, dunkel und undurchschaubar. Sie ist nicht nur Feind, nein, das zu behaupten träfe nicht den Kern der Sache. Sie ist ihm vielmehr in den ersten Jahren seiner institutionellen Bildung ans Herz gewachsen als Freund in der Not; namentlich Schularbeiten, in denen er sein Wissen besser als andere abrufen kann, irgendwo aus den hintersten Gehirnwindungen, eben weil er Angst vor dem Versagen hat. Oder vor der Geringschätzung seiner Lehrer, denen er mit fast aufdringlicher Unterwürfigkeit ein Lob ums andere abzutrotzen sich zur Hauptaufgabe seiner jungen Existenz gemacht hat. Er ist nicht, was man landläufig als Streber bezeichnen würde. Nein, sein Drang nach Lob und äußerer Bestätigung sitzt tiefer, obwohl er ihn selbst nicht erklären kann.
Die Beziehung zu den Eltern? Die sind immer mit sich selbst und mit Streit beschäftigt, aber was ihn angeht, so läuft er eben nebenher, gute Leistungen werden mit Zuwendungen honoriert, schlechte aus Zeitmangel ignoriert. Ein Mangel an Freunden? Er ist nicht der beliebteste Junge auf dem Fußballplatz, aber auch nicht der unbeliebteste. Er ist talentiert genug, um nicht negativ aufzufallen. Das gilt nicht nur für den Fußball, der ultimativen Maßeinheit auf der Anerkennungsskala, die in seiner noch jungen Welt die Hackordnung bestimmt, sondern für alles, was mit Ausdauer, Kraft oder Ballgefühl, aber auch mit Köpfchen und Kombinationsgabe zu tun hat. Er ist vielen seiner Altersgenossen körperlich überlegen, zum Glück, und schöpft daher aus dem Vollen, wenn es an physische Auseinandersetzungen geht. Was ihn außerdem noch zum talentierten Sportler macht, ist sein unbedingter Wille, sich durchzusetzen, genährt von der Angst, verspottet zu werden. Natürlich will er zwar auch gegen seine Gegner gewinnen, aber in erster Linie die Schmach der Niederlage vermeiden. Er unterscheidet nicht zwischen Niederlagen im Sport und jenen im Klassenzimmer; für ihn endet die Prüfung, die sein Leben ausmacht, nicht Freitag nachmittags an der Schulpforte. Er muss immer dem eigenen Anspruch Genüge tun. Gelingt das, so stellt sich aber nicht etwa ein Gefühl von Zufriedenheit oder gar Stolz ein, nein, er sieht es als nichts anderes als seine Pflicht an, als die Minimalanforderung an eine nicht gänzlich überflüssige Existenz. Sich selbst betrachtet er mit einer Ernsthaftigkeit, die für sein Alter untypisch ist. Er sollte leben, spielerisch und unbedarft, doch stattdessen denkt er zu viel und im Kreis. Er sieht Nachrichten und macht sich Gedanken, über den Trinkwassermangel in Bangladesch, die Schlafkrankheit, die von der Tsetsefliege übertragen in Afrika Kinder dahinrafft. Er ist nicht wirklich emphatisch, sein Interesse an der Not anderer ist eher narzisstischer Natur. Und er vermag nicht zu begreifen, wieso als normal durchgeht, was er als so augenscheinlich widersinnig und ungerecht empfindet. Diese Disbalance übt eine Faszination auf seinen jungen Geist aus, ohne dass er sich dessen allzu bewusst wäre. Er neigt dazu, sich in den Mittelpunkt zu stellen und dabei unendlich egoistisch zu sein, bemerkt das aber, gefangen in seinem Gedankenkreisel, kaum. Selbst wenn er vordergründig an anderer Menschen Schicksal interessiert ist, so ist er es nur, weil er als der Helfer, der Retter wahrgenommen werden möchte. Paradox, denn nicht, weil er der Meinung ist, er würde es verdienen, sondern unbewusst im Versuch, ständig seine Unzulänglichkeiten auszugleichen, möchte er etwas gelten bei den Menschen, die ihn umgeben.
Auf dem Fußballplatz ist er der Verteidiger der Schwachen. Er kann es nicht leiden, wenn sich die älteren oder von der Natur mit mehr Kraft oder Talent gesegneten Jungen den Schwachen gegenüber süffisant geben, denn sie sind ein Spiegel seiner selbst; er schart dann mit Vorliebe die schlechteren Spieler um sich und versucht mit doppelt so hohem Einsatz die Gemeinheiten und großtuerischen Anwandlungen der Alphatiere abzustrafen. Manchmal gelingt das, dann überkommt ihn ein warmes Gefühl der Genugtuung, wobei er insgeheim gerne so wäre wie sie – selbstsicher und arrogant von der eigenen Überlegenheit wie von einem Naturgesetz überzeugt. Manchmal gelingt es nicht, dann braucht es eine ganze Weile, bis sich der Knoten, den die blinde Wut über das Versagen in seinem Bauch zurückgelassen hat, wieder löst.
Was ihm Ruhe bringt, ist die Ablenkung durch geistige Anstrengung – er liebt es, die Textaufgaben zu lösen, die sein Mathematiklehrer der Klasse aufgibt, auch wenn er wie alle anderen aus Konformismus in das Gestöhne ob der Unerträglichkeit der Hausaufgaben einstimmt. Seine Liebe zu Rätselaufgaben ist ambivalent, der Ansporn, sie zu lösen, entspringt nicht einem kindlichen Spieltrieb, sondern vielmehr dem ständig alles übertünchenden Drang der Selbstbestätigung. Damit nicht genug, die Schwierigkeit muss stetig gesteigert, die Schlagzahl erhöht werden. Einmal gelingt es ihm nicht, alle Aufgaben der Mathematikschularbeit in der zur Verfügung gestellten Zeit fehlerfrei zu lösen. Wochenlang hadert er; mit sich, seiner mangelnden Intelligenz oder jedenfalls langsamen Auffassungsgabe, insgeheim auch mit seinem so hochgeschätzten Mathematiklehrer. Am meisten jedoch hadert er mit der Tatsache, dass ein anderer Schüler seine, ja seine, Aufgabe problemlos zu lösen vermochte. Zu Hause überkommt ihn ein Drang, eine sich bahnbrechende Idee, die er zurückhalten möchte, die ihn aber nicht loslassen will wie ein böser Traum, der einen Nacht für Nacht begleitet und einem auch am Tag eine Gänsehaut verursacht. Er lernt zum ersten Mal einen Teil seiner Seele kennen, einen dunklen Fleck, den er abstoßend findet, der zugleich aber auch unwiderstehlich nach Aufmerksamkeit schreit. Er geht in den alten Holzschuppen am Ende des kleinen Gartens hinter dem farblosen Reihenhaus, das er mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester bewohnt. Er holt einen übersponnenen Zuber hinter einem gerammelt vollen Regal hervor, das sein Vater Jahr um Jahr mit Memorabilien füttert, die im Haus keinen Platz mehr haben. Er füllt den Zuber mit dem alten, von der Sonne brüchig gewordenen Gartenschlauch etwa zur Hälfte mit kaltem Wasser. Für den nächsten Schritt muss er auf die Suche gehen. Ein Bild konkretisiert sich und er muss leise lächeln bei der Vorstellung, was kommen wird, bis sich Scham einschleicht und sein Lächeln abrupt erstickt. Unmerklich wird seine Haltung etwas gebückter, ein schaler Geschmack breitet sich in seinem Mund aus und er fühlt, wie sich sein Herzschlag beschleunigt. Durch eine morsche Holztür ist der Garten von einer weitläufigen Wiese abgetrennt. Die Wiese ist ein großes Rechteck, auf der einen Stirnseite von einer Tanne und einer Birke, auf der anderen durch einen großen Geräteschuppen und ein paar Weiden vor Blicken geschützt. Zwischen Schuppen und Weiden befindet sich ein Geheimversteck, in dem er und seine Freunde allerhand lagern, das von den Erwachsenen nicht gefunden werden soll. Heute geht es ihm aber nicht darum, sondern um die namenlosen Katzen der Siedlung, die sich mehr noch als auf der offenen Wiese in dem Wirrwarr von Stämmen und Zweigen herumdrücken. Katzen. Er kann sie nicht leiden, weil sie so arrogant, so natürlich selbstsicher sind. Ähnlich wie die Alphatiere auf dem Fußballplatz. Sie zeigen keine Unterwerfung, keine Loyalität, selbst wenn sie ein Leben lang gut behandelt und durchgefüttert werden. Einen Hund dagegen hätte er immer gerne gehabt. Anschmiegsam, dankbar, die Hackordnung nicht in Frage stellend.
Er ist überzeugt, dass er hier finden wird, was er sucht, und er behält recht. Eine der namenlosen Streunerkatzen treibt sich im Gebüsch herum und mustert ihn misstrauisch. Lange kann sie ihre Neugier, die Hoffnung auf einen kleinen Leckerbissen oder eine Streicheleinheit nicht hintanhalten, da hat er sie in der Tasche. Zurück im Schuppen verrammelt er die Tür, erregt, schuldbewusst. Er weiß, dass es falsch ist, diesem dunklen Trieb nachzugehen, diesem Drang nach Destruktion, nach Regelbruch. Er weiß es, aber das ändert nichts an der magnetischen Anziehung, die der Zuber mit dem kalten Wasser jetzt auf ihn ausübt. Er erschrickt, als er einen Moment lang nicht aufpasst und die Katze ihre Krallen in Angst tief in seinen Unterarm arbeitet – schmerzhaft, aber auch der letzte Anstoß. Mit kräftigem Griff stößt er die Katze ins Wasser, die Reaktion erahnend, die sich augenblicklich einstellt. Das Tier windet sich, kämpft, chancenlos, seinem eisernen Griff zu entkommen. Er lässt das Tier kurz wieder hoch, nicht lange genug für einen vollen Atemzug, aber doch so lange, dass er Schrecken und Unverständnis in den Augen des Tiers erblicken und in sein kindliches Sammelalbum der Eindrücke und Erinnerungen aufnehmen kann. Oft wird er an diesen Moment zurückdenken, den Moment, als er sich das erste Mal nicht beherrschen konnte. Während das Tier ums Überleben kämpft, ringt er um die Kontrolle über seine Hand, denn der Kopf sagt, dass es nicht mehr viel länger andauern darf, wenn das Ultimative nicht eintreten soll. Die Hand wehrt sich noch ein paar schleppende Sekunden, Sekunden, die ihn viel über sich, aber auch über das zappelnde Leben in seiner Hand, lehren. So banal, so schwach auf eine fast schon widerwärtige Art und Weise. Verächtlich zieht er das kraftlose Tier aus dem Wasser, lässt es in die Ecke mit dem Laubrechen fallen. Er verlässt den Schuppen, um das Wasser auszuleeren, sein Herzschlag normalisiert sich und der Tunnelblick verflüchtigt sich langsam. Er fühlt sich nicht mehr wie Gott am sechsten Tag, sondern nur noch wie der kleine erbärmliche Schwächling, für den er sich schon immer gehalten hat. Als er sich mit dem leeren Zuber wieder dem Schuppen zuwendet, blickt er in die Augen der Katze, die, er kann es spüren, allen Hass dieser Welt in ihrem starr fixierenden Blick einen. Mit einem Satz ist sie hinter der Gartenmauer verschwunden und er wird sie nie mehr in der Nähe seines Elternhauses sehen.
Das ist die erste Erinnerung an den dunklen Schatten, der in ihm wohnt. Aber die Erzählung wird ihm nicht ansatzweise gerecht, denn er ist nicht nur das brutale Monster, der Soziopath, als den sie ihn erscheinen lässt – er wird Großes leisten und man wird ihn lieben. Nur wenn der Schatten kommt, dann gerät alles außer Kontrolle. Als ich von dieser, seiner prägendsten Kindheitserinnerung erfuhr, konnte ich mich nicht abwenden, denn seine Ehrlichkeit stand in so krassem Gegensatz zu meiner eigenen Selbstverleugnung und Heuchelei, dass ich so empfänglich für sie war, wie ich nur sein konnte. Er sprach zu mir und verriet mir alles; und ich schaute in den Abgrund und sah mich selbst dort stehen und hochblicken. So konnte ich ihn nicht verstoßen, mich seinem Bann nicht entziehen, obwohl das wohl jeder mit ein bisschen Anstand als gerechtfertigt oder gar geboten empfunden hätte. Meine eigene Kindheit jedenfalls lief ganz anders ab, das kann ich dir sagen. Von dunklen Trieben, von Nonkonformismus und übertriebenem Ehrgeiz hätte ich wohl nicht weiter entfernt sein können. Ich war die Personifizierung des Adjektivs angepasst, oder farblos, negativer formuliert wohl bedeutungslos bis hin zur völligen Unsichtbarkeit. Ich war nie der Erste und nie der Letzte, nie der Leiseste und nie der Lauteste, nie existent für die meisten meiner Lehrer und Mitschüler. Jedenfalls kam ich nicht über die Rolle eines Statisten hinaus. Genau wie in einem Hollywoodfilm, wenn sich der Star seinen Weg durch die Massen bahnt, die es nicht einmal wert sind, für den Bruchteil einer Sekunde im Fokus der Kamera zu stehen. Ich war kein Problemfall, das nicht, sondern nur ein statistischer Mittelwert, also Teil jener diffusen Masse, die man leicht vergaß, während man sich mit den positiven und negativen Ausreißern auseinandersetzte. Du weißt, ich bin als Einzelkind aufgewachsen wie du, ich denke sogar als Wunschkind, oder besser, als Sollkind, also die Pflicht meiner Eltern, während sie auf die Kür verzichteten.
Was ist meine prägendste frühkindliche Erinnerung, fragst du? Was soll ich von mir denken, weil ich gar nicht sagen kann, was mich vor der Spätpubertät, die bei mir, und das ist vermutlich schon das Außergewöhnlichste an mir, mit dem Erreichen des Erwachsenenalters zusammenfällt, als Mensch geprägt hat? Eine Sache wüsste ich vielleicht doch zu erzählen, und zwar folgende, als ich einmal tatsächlich den Unmut einer Lehrerin auf mich zog, ohne viel dazugetan zu haben. Das war wohl in der ersten Klasse im Gymnasium, ja genau, als ich ungefähr zehn oder elf Jahre alt gewesen sein muss. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, an die Überraschung, die Scham, aber auch das Prickeln, plötzlich aus der Masse herausdestilliert zu werden von den Worten einer desillusionierten Zeichenlehrerin, die mir in bildnerischer Erziehung, damals noch ein Pflichtfach, von Amts wegen künstlerische Kreativität in mein Gehirn zu prügeln hatte. Der Stein des Anstoßes? Türkis. Eine Farbe, die ich mich weigerte, der Skizze einer Blumenwiese hinzuzufügen, denn bei mir war Gras noch immer grün und ein Löwenzahn gelb und ein Gänseblümchen weiß, aber türkis? Das grenzte ans Absurde, das konnte ich schlicht nicht mit meinem Verständnis von richtig und falsch, mit meinen Beobachtungen, meiner jungen Wahrnehmung der Welt in Einklang bringen. Beobachtungen. Eigentlich kann ich vielmehr die Erinnerungen anderer wiedergeben, als meine eigenen. Manchmal habe ich das Gefühl, als ginge das eine in das andere und das andere in das eine über, die Grenzen verschwimmen, wenn ich darüber nachdenke.
Eine weitere Erinnerung weiß ich dir aber doch noch zu erzählen: mein erster Besuch im Theater. Das Jahresabo der Eltern, hin und wieder durfte ich meine Mutter oder meinen Vater begleiten, wenn der jeweils andere Elternteil krank oder verhindert war oder wenn ich, was erst später kam, einfach so lange bettelte, bis sich einer der beiden meiner armen Seele erbarmte. Der magische Moment, in dem alle Lichter erloschen und der Vorhang sich hob, das Publikum plötzlich verstummte, dieser unendlich lange Augenblick der Erwartung, der Vorfreude, der Unsicherheit, die Besitz von einem ergriffen, sobald man im Dunkeln saß und sich die Lichtkegel auf die Bretterbühne richteten, die so schön den Schall der dynamischen Bewegungen der Schauspieler transportieren konnte, die für zwei Stunden den Mittelpunkt der Welt ausmachte, die einen für Wochen beflügeln, oder aber, wie ich später auch lernen musste, mit dem flauen Gefühl der vergeudeten Zeit, des Überrolltwordenseins von dem Ego eines Regisseurs, ausspucken konnte zurück in die Tristesse des realen Pflichtlebens. Vielleicht wunderst du dich, dass ich damals schon so empfunden habe, denkst dir, dass ein Kind von zehn, zwölf Jahren zu solchen Empfindungen noch nicht im Stande ist. Aber bei mir war es so, und darin begründet sich vielleicht auch meine einzige vordergründige Ähnlichkeit zu IHM. Im Inneren war ich immer zu ernst, zu schwermütig für mein Alter, hinkte nach in vielerlei Hinsicht, vor allem in sexueller, war aber auch voraus, wenn es um das – früher wie später ertraglose – Grübeln und Sinnieren ging. Nicht über Schulisches oder die Anforderungen, die ein Jungenleben so mit sich brachte, die Akzeptanz und Beachtung stifteten, mochte ich nachdenken. Vermutlich lag in meinem Desinteresse an den Belangen meiner Altersgenossen auch meine soziale Unsichtbarkeit begründet, die mich aber nicht sonderlich störte, denn sie schaffte mir die Notwendigkeit vom Hals, mich für Belangloses wie Äußerlichkeiten, das neueste technische Gimmick oder was auch immer sonst gerade das Blut meiner Mitschüler in Wallung brachte, zu interessieren oder gar Anteil an ihren niederen sozialen Gebaren zu nehmen. Theater und Bücher dagegen, die waren anders. Darin wurden die großen Themen der Welt abgehandelt, ja auch damals schon war ich mir derer gewahr, wenn auch in einer noch kindlich geprägten, in vielerlei Hinsicht einfältigen, aber auch ehrlichen Form. Theater war für mich nicht Unterhaltung, nicht Geschichten erzählen oder gar ein Mittel zur Bildung, so wie wohl für meine Eltern, die in ihrer eigenen Jugend nicht in den Genuss eines aufgeklärten und weltoffenen Haushalts gekommen waren. Es war vielmehr ein ganz spezielles Gefühl, ohne dass ich es gänzlich einzuordnen oder gar zu begreifen vermochte, ein so intensives Gefühl, wie ich es sonst nicht kannte, nicht hervorrufen konnte durch die Kinkerlitzchen, mit denen sich meine Altersgenossen die Zeit vertrieben, wie Fußball, Revierkämpfe, das Buhlen um die Gunst der frühreifen Mädchen. Nur dort, wo Wahrheit und Fiktion – damals schon maß ich dieser Unterscheidung weniger Wert bei als die meisten – so reizvoll verschwommen, dort, wo alles inszeniert war, fühlte ich mich sichtbar in der Unsichtbarkeit, verstanden, obwohl ich nichts sagte, sondern nur lauschte. Dort war für mich nichts abstrakt, empfand ich das Gefühl des Überdrusses nicht so stark wie in der echten, banalen Welt des Klassenzimmers und des Schulhofs. Ich war natürlich noch zu jung, um mir darüber im Klaren zu sein, wie sich das Theater auf mich auswirkte, wie es meinen Charakter formte und sich eine Leidenschaft, eine Obsession manifestierte, die mich Jahre, nein Jahrzehnte später mit IHM zusammenführen sollte. Ich war einfach glücklich. Ohne Wenn und Aber, so wie in den Kindertagen alle Wahrheiten einfach, alles Empfinden kondensiert und polarisiert ist auf die Frage: gut für mich oder schlecht für mich? So war ich mir sicher, dass Theater für mich reines Glück bedeute, Flucht aus der Misere einer überaus durchschnittlichen, farblosen, langweiligen Existenz, die ich natürlich damals noch nicht so benennen konnte, die einfach Ich war, Ich wie ich nun einmal war und immer sein würde. Dass es mich auch einen Preis kosten würde, später, als die Wahrheiten komplizierter und das Ich nebulöser wurde, als das Steppenwölfische sich Bahn brach, um es mit einem meiner Lieblingsstücke zu halten, das konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen.
ER konnte mit Attributen wie glücklich nichts anfangen. Es läge nicht in seiner DNA, habe ich später erfahren, es sei ihm nicht in die Wiege gelegt, so zu empfinden. Nicht ein einziges Mal sei er wirklich zufrieden gewesen mit seiner Situation, mit sich, mit der Welt, die ihn umgab, besser den Menschen, die ihn umgaben, obwohl er sie mehrheitlich nicht um sich haben wollte, und die, die er um sich haben wollte, die wollten ihn nicht um sich haben. Wie beispielsweise seine Eltern, die sich trennten, als er zwölf war. Daher kam es auch, dass er mit Zuhause oder Heimat, ebenso wie mit Geborgenheit oder Sicherheit, ähnlich wenig am Hut hatte wie mit Glück und Zufriedenheit. Ironisch, dass gerade diese Begriffe so viel Bedeutung gewinnen sollten in seinem Leben, einem Leben, das sich in Bahnen entwickeln würde, wie sie für kaum jemanden vorgezeichnet sind, aber dazu später. Die Trennung seiner Eltern katalysierte alles, den unbändigen Ehrgeiz zu genügen, die Angst zu versagen, die unterschwellige Wut. Die Gedanken an das Dasein des Schattens, dessen er sich seit dem Erlebnis mit der Katze bewusst war, katalysierte es auch, wenngleich er sich geschworen hatte, sich im Zaum zu halten, normal zu sein, weil nicht der Norm zu entsprechen gleichzusetzen war mit Schwäche, inakzeptabel. Aber ganz ließ es ihn doch nicht los, hier und da bekam der Schatten seine Gelegenheit, wie etwa, wenn er einem Schulkameraden im Turnunterricht ein Bein stellen konnte, worauf dieser schmerzhafte Bekanntschaft mit dem staubigen und hartgetretenen Bolzplatzboden machte, auf dem es üblicherweise heiß herging wie im Stadion bei der Fußball-WM. Selten wurde er bei solchen Aktionen erwischt, er entwickelte ein Talent dafür, ungesehen zu bleiben. Ein Talent, das ihm Jahre später noch von großem Nutzen sein sollte, in vielerlei Hinsicht.
Was die Trennung seiner Eltern auch katalysierte, war sein ohnehin schon obsessives Bestreben, sich mit Menschen zu umgeben, die seine Hilfe brauchten, schwach und schutzbedürftig oder, wie er insgeheim dachte, ein bisschen zu dumm dazu waren, sich um sich selbst zu kümmern. Zwischen ihnen verstummten die Selbstzweifel kurz, zumindest an guten Tagen, zwischen ihnen war er sich seiner Überlegenheit gewiss, und zu seiner eigenen Überraschung sogar dazu in der Lage, so etwas wie Zuneigung und Verständnis zu heucheln, was von den Bemitleidenswerten auf für ihn widerwärtige Weise dankbar und gierig aufgesogen wurde wie von einem Schwamm, der schon zu lange vertrocknet in der Sonne liegt.
Der einzige Mensch, zu dem er aufsah, war seine Schwester. Gefühlte zehn, und tatsächliche fünf Jahre älter, verkörperte sie, was im Leben erstrebenswert war. Gutes Aussehen und Intellekt besaß sie, und Erfolg und Beliebtheit wurden ihr wie selbstverständlich zuteil, ohne dass sie jemals etwas dafür getan zu haben schien. Weder strebsam noch übermäßig bemüht, schlicht als Alpha geboren, entsprach sie dem Archetypus desjenigen Menschenschlags, den er aus Neid verachtet hätte, eigentlich, doch für seine Schwester empfand er echte Zuneigung. Ihren Namen habe ich nie erfahren, wohl nicht ganz ohne Vorsatz, denn in seinen Augen und in seinen Schilderungen war sie zu erhaben, als dass ihr einer jener banalen Namen hätte gerecht werden können, die man zu dieser Zeit oft auf der Straße hörte. Sein Verhältnis zu ihr war jedenfalls ein ambivalentes, oder besser gesagt die Auswirkungen ihrer Existenz auf ihn waren ambivalent, denn einerseits war sie die Einzige, die ihm so etwas Ähnliches wie Zuneigung, gar Liebe, abrang, andererseits fachte sie, ohne es zu beabsichtigen, seine destruktive Ader, den Hang zur Selbstzerstörung an, der ihn permanent auf ungesunde Art und Weise antrieb. Die Gefühle für seine Schwester gingen über Bruderliebe hinaus; es war etwa zur selben Zeit, als dieser eine Schüler seinen inneren Schutzkreis durchbrach, sein Intimstes störte, zur selben Zeit, als der Schatten das Leben der streunenden Katze streifte, dass er begann, diese Gefühle auf andere Mädchen zu projizieren. Zunächst noch passiv, eben wie bei einem Zwölfjährigen, in dem sich eine Ahnung Bahn bricht, in einem Gehirn, das zwischen Ohren steckt, hinter denen es noch grün hervorschimmert. Aber nicht allzu lange, und er jagte hinter jeder knackigen Jeans, jedem zu kurzen Rock, jedem prallen Dekolleté her, das seine Bahnen kreuzte – wenn auch nur imaginär, denn er war nicht der Gigolo, in den er sich hineinträumte, während er mit Standbild im Kopf abends im Bett masturbierte. Aber ich schweife ab, mein Kind – du siehst, ich fühle mich in den Lebensgeschichten anderer heimischer als in meiner eigenen!
Wir waren noch weit davon entfernt, uns nahezukommen, er und ich, doch lassen wir in unserer Vorstellung ein, zwei Jahre ins Land ziehen (ein Luxus der Erzählung!), dann kannst du sehen, wie sich auch in deinem Vater langsam ein Fünkchen regte. Nicht etwa in Bezug auf die Mädchen, nein, denn selbst zu diesem Zeitpunkt, zu dem auch den schlimmsten Spätzünder längst der Hafer gestochen hätte, ließen mich jene noch kalt, was insofern praktisch war, als dass ich sie augenscheinlich ähnlich gering tangierte und somit das Angebot in seiner Bescheidenheit der Nachfrage um nichts nachstand. Aber ich war gereift, was meinen Anspruch an die Füllung des mir beschiedenen Zeitkontingents mit sinnstiftender Tätigkeit anging. Ich forderte ein, was mich mit Leidenschaft erfüllte, namentlich Literatur und Theater, in stetig steigenden Dosen. Mittlerweile Herr eines ansehnlichen Bücherregals – damals las man noch gedruckt auf Papier – sowie meines eigenen Platzabos, der Bildungszugewandtheit meiner Eltern sei Dank, konnte ich die Leere zwischen den in Frequenz und Dauer zunehmenden Glücksimpulsen besser verdrängen und war ein lebendiger Jugendlicher geworden. Ein eigener Bibliotheksausweis war als Ersatzdroge bei vorherrschender Sommerpause oder Geldmangel, notorischer Grund für mangelnden Nachschub an Gedrucktem, mehr als nur zweckdienlich. Ich verschlang nicht nach Genres oder Autorenliste, vielmehr alles, was irgendeinen Nerv in mir traf. Hesse, Dostojewski, Bukowski, Joyce, Orwell, Huxley, Proust, Zweig, Beckett gaben sich die Klinke in die Hand, und noch viele mehr. Nicht alles verstand ich und ich war alles andere als leicht bei der Stange zu halten, denn ich saugte nicht Autorennamen und Hintergrundfakten, sondern vielmehr Stimmungslagen und emotionale Färbungen der Charaktere auf. So konnte ich bald den Titel eines Werks nicht mehr dem Autor zuordnen oder gar einzelne Passagen rezitieren wie der Deutschprofessor, bei dem meine wachsende Zuneigung zur erzählenden Kunst nicht unbemerkt geblieben war, jedoch reichte es, die Augen zu schließen, und ich konnte mich nach Belieben in die Imagination, die ein guter Autor für seine Leserschaft auf oft so geniale Weise konstruiert und mit Leben füllt, hineinversetzen. Dabei entging mir keine Nuance der komplex verwobenen, oft ambivalenten Empfindungen; die fiktionalen Charaktere wurden mir eher als jene realen, deren Leben ich streifte, zu Seelenverwandten.
An dem Punkt, an dem der Gedanke an deinen Vater als Sonderling in deinem Kopf gepflanzt ist, so wie ein gutes Kapitel in meinen Kopf die wunderbarsten Ideen säen konnte, damals, muss ich noch einen Sprung nach vorne in der Zeit machen, denn es ist wichtig, dass die Geschichte voranschreitet, bis an ebenjenen Punkt, den sich ein guter Autor für die treuen Leser aufspart, um mit ihnen das zu teilen, was ihm ein Loch in die Seele brennt und ihm keine Ruhe lässt, bis auch der letzte Satz aufs Papier gespien ist.
2
Der Schüler, ebenjener, den ich schon erwähnt habe, begleitete IHN noch eine ganze Weile. Sechs Jahre sind vergangen; er ist mittlerweile achtzehn, das Äußere hat sich zum Besseren gewandelt, das Innere ist verhärtet durch tausendfache Bestätigung dessen, was für ihn seit jeher feststeht: dass er sich schützen muss vor den Gedanken anderer über ihn, dass er eine Mauer hochziehen muss, um seinen Verstand, sein Wesen vor ihnen zu schützen und der zu bleiben, der er sein muss, um den eigenen Vorstellungen auch nur im Ansatz zu genügen. In Manipulation und Täuschung hat er es zur Meisterschaft gebracht und dadurch an Beliebtheit gewonnen. Er ist nahe dran an der sozialen Stellung, die er sich in seiner Traumvorstellung ausgemalt hat: Klassensprecher im Abschlussjahrgang, sportlich erfolgreich, gutaussehend und sexuell aktiv, Klassenbester. Nicht ganz, denn dieser eine Schüler, seinen Namen mag er nicht einmal denken, weigert sich, die Niederlage einzugestehen. Regelmäßig läuft es auf einen Wettstreit um die höchste Punktzahl bei der Schularbeit, das eindrucksvollste Referat, die schnellste Abgabe der Projektarbeit oder was auch immer sonst von den Lehrern an messbarer Leistung abverlangt wird, hinaus. Einige Lehrer haben es sich zum Sport gemacht, beide Westentaschengenies gegeneinander aufzuhetzen, zum Zwecke des Amüsements oder um den Rest der Klasse anzustacheln, zu besseren Leistungen und mehr Fleiß zu animieren. Die Motive werden wohl unterschiedlich sein, doch sie verfehlen ihr Ziel nicht; die Rivalität zwischen den beiden Gehirnzombies, wie sie hinter vorgehaltener Hand von weniger ambitionierten Mitschülern genannt werden, ist voll entbrannt. Der andere ist in allen Belangen des sozialen Zusammenlebens unterlegen – nur seine Synapsen, ja, die arbeiten mindestens ebenso effizient. Er hat keine Schwächen, schreibt gerne, rechnet gerne, lernt gerne geschichtliche Fakten und kennt die Hauptstadt jedes zivilisierten Landes, die meisten nicht nur aus Büchern. Ansonsten ist er zurückgezogen, gibt nicht viel preis von sich. Man munkelt, dass seine Eltern Diplomaten seien, er mindestens ein Dutzend Mal umgezogen ist in seinem noch jungen Leben, was ihm zu Weltgewandtheit und umfassender Bildung, nicht aber zu einem besonders üppigen Freundeskreis verholfen hat. Das scheint ihn aber nicht groß zu stören; mit einer Nonchalance, die schon fast ans Beleidigende grenzt – jedenfalls für IHN –, gibt er sich seiner Einzelgängerrolle hin. Nicht, dass der Rivale nicht eloquent wäre und schlagfertig sich zu präsentieren wüsste im richtigen Licht. Nein, er scheint dies im schulischen Umfeld, die benotenden Lehrer einmal ausgenommen – als wären die anderen ihm zu minder –, lediglich nicht als notwendig zu erachten; eine Eigenschaft, die, mehr noch als des Konkurrenten Talent für Worte und Zahlen, die Aufmerksamkeit des Schattens weckt.
Du kannst dir vorstellen, mein Kind, dass der Sache kein gutes Ende beschieden war, denn wen der Schatten einmal bemerkt hatte, den vergaß er auch nicht mehr. Mit den Jahren hatte ER auch gelernt, subtiler vorzugehen, nicht mehr mit jener Rohheit, die von kindlicher Unbedarftheit genährt wird, sondern mit der Berechnung eines werdenden Erwachsenen. Er bemühte sich, Zwietracht zu säen, aber nicht so offensichtlich, als dass es ihm selbst Argwohn und Missgunst von Seiten der Mitschüler eingebracht hätte. Es erstaunte ihn selbst, wie effektiv ein paar arglos fallengelassene Bemerkungen hier und da ihre Wirkung entfalteten, Nadelstichen gleich, die kaum zu sehen sind und doch schmerzhafter als der brutalste Hieb. Wie leicht sich sein perfider Plan umsetzen ließ! Natürlich, man muss bedenken, der Vater des anderen war Pole und auch dessen Großvater mütterlicherseits, und schon damals begann zu keimen, was heute in voller Blüte steht. Die Grenzen zu, flott abgeschottet, energisch beschützt, was andere uns zu nehmen trachten. Die Nation wurde zum zentralen Identifikationsobjekt vieler, auch der sich selbst als gehoben ansehenden Teilmenge der Bürger, die aber doch nicht so gehoben war, als dass sie schon allzu oft den eigenen Dunstkreis verlassen oder gar fremdländische Luft geatmet hätte, um festzustellen, dass sie sich ähnlich atmete wie die vertraute. Plötzlich wurden positive Begriffe negativ konnotiert, die realitätsferne Bildungselite wurde zum diffusen Feindbild erkoren ebenso wie die Gutmenschen, denen keine Schlechtmenschen gegenüberstanden, sondern Wutbürger, die chronisch um ihr Seelenheil und die Früchte der täglichen Arbeit fürchteten. Vielleicht unterschied sich der gesellschaftliche Impetus doch ein wenig vom letzten Mal, als die einfachen Wahrheiten die Bedachtsamkeit in die Schranken wiesen, war nicht ganz so rassisch motiviert wie damals, sondern auf geografisch-wohlstandsängstliche Art und Weise, zumindest bei denen, die nicht zu den ideologischen Hardlinern, sondern zur unscharfen Masse der Mitläufer zu rechnen waren. Jedenfalls war die halbpolnische Flagge als Zielscheibe auf dem Rücken des anderen Gold wert für den Schatten, der zu schüren wusste, was ohnehin in den Köpfen der vielen schon als kleines, aber beständiges Flämmchen loderte. Sozialschmarotzer stand einmal mit schwarzem Edding auf dem Pult des Halbpolen geschrieben, ein anderes Mal noch viel unschönere Formulierungen, etwa Scheißpollack und Dreckstschusch, was universell auf alle Nicht-Inländer anwendbar war, obwohl er mit der historischen Definition des Tschuschs denkbar wenig gemein hatte – schon aus geografischen Gründen, wie der Diskreditierte mit Zornesröte im Gesicht und gepressten Lippen dachte, während der Unterricht wie jeden Tag seinen zähen Gang ging, mit der Ausnahme, dass der Halbpole oder Scheißpollack oder Tschusch oder wie auch immer man ihn nennen soll, sich nicht beteiligte und sehnlichst der Entlassung durch den arglosen Lehrer entgegenfieberte. Als es endlich Zeit war, bahnte sich das Opfer der üblen Diffamierung einen Weg durch die Meute der Schaulustigen mit klarem Ziel, denn obwohl der Bloßgestellte mit ziemlicher Sicherheit wusste, dass der Stift, der die unaussprechliche Ehrenbeleidigung – Polen sind bekannt für ihren Stolz und so nahm er die Schmähwörter als solche wahr – ausspie, nie die Hand des Drahtziehers berührt hatte, war er klug genug, um sich ebenso gewiss zu sein, wo das Übel an der Wurzel zu packen war. Die Zaungäste grinsten und es kribbelte und Energie knisterte in der Luft des Klassenzimmers und jeder erwartete sich das, was in Klassenzimmern nun einmal Usus ist und eigentlich auch weiter nicht erwähnenswert – wenn nicht eben dieser eine Halbpole beteiligt gewesen wäre. Ein Zerrissener mit angeborenem Hang zur Depression und dem diffusen Gespür, dass er eigentlich nirgends richtig hingehört. Der sich aufgrund unzähliger Umzüge als Kind und seiner Diplomateneltern, die ihn sein halbes Leben lang mitschleiften wie ein Stück sperriges Gepäck, seines Platzes in der Welt schon unsicher genug ist, und genau heute, in diesem Moment, in diesem Klassenzimmer mit der stickigen, schweißgeschwängerten Luft und dem postpubertären Schwanzvergleichsgehabe und unter den vielen stummen Münder und großen Augen, die dem beiwohnen, was in zwei oder mehr Leben später einen großen Unterschied machen wird, die Bestätigung bekommt, dass dem wirklich so ist, dass er tatsächlich auch hier nicht dazugehört, obwohl er an diesem Ort mitten in einem kleinen Land in Westeuropa die längste Zeit am Stück verbracht hat. Während er die Bankreihen durchquert, sieht er seine Großmutter vor sich, die ihm immer Piroggen gekocht hat, als er in Przebieczany, dem kleinen und unscheinbaren Dorf in der Nähe von Krakau, zu Besuch war. Diese Piroggen aus Kartoffelteig waren gefüllt mit Speck oder mit Frischkäse, und er konnte sie tellerweise verschlingen, wenn er ausgehungert zurück vom Spielen mit seinen Altersgenossen kam, mit denen er zwar nicht richtig befreundet war – immerhin war er nur auf der Durchreise –, doch in deren Gegenwart er zumindest so etwas wie Vertrautheit empfand, was mehr war, als er von den Kindern behaupten konnte, die dort zu Hause waren, wohin er mit seinen Eltern nach dem meist viel zu kurzen Besuch zurückkehren würde. An ganz seltenen Anlässen gab es diese Piroggen auch mit Waldbeeren und haufenweise in geklärter Butter angeschwitzten Semmelbrösel; alle saßen am Tisch in der viel zu kleinen, überheizten Küche in dem baufälligen alten Bauernhaus, alle lachten und redeten durcheinander, der Vater mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, die Mutter sanft angelehnt an den Vater, mit halb geschlossenen Augen und verträumtem Blick. Diese Abende konnten lang werden und ausgelassen. Später wurden die Erwachsenen rührselig vom Vodka, der, ähnlich dem Vogelbeerschnaps hierzulande oder dem Grappa in Italien, unter dem Deckmäntelchen der Magenberuhigung von jedem anständigen Gastgeber auf dem Land stets in Griffweite gehalten wurde und zu ebensolchen Anlässen als Gesprächskatalysator gute Dienste erwies. Manchmal wurden die Gespräche der Erwachsenen auch düster zu später Stunde, wenn die Kinder schon längst auf dem Teppichboden oder dem kleinen Sofa der Großmutter oder zwischen den Beinen der Eltern dösten und scheinbar davon nichts mehr mitbekamen. Er lauschte dann oft mit geschlossenen Augen, Schlaf vortäuschend, den Tiraden der Alten; es war von den Russen und den Deutschen die Rede und von Dingen, die er nicht verstand, von denen er aber fühlte, dass sie als Teil dessen, was seine Eltern zu dem gemacht hatte, was sie waren, niemals vergessen werden durften. Er begriff, dass, ohne ein besonders schöner Ort zu sein, dieser Fleck auf der Landkarte etwas südöstlich von Krakau in der województwo małopolskie eine Bedeutung auch für sein Leben hatte, eine Bedeutung, der er jedoch nie würde nachgehen können, was er damals in seiner kindlichen Naivität natürlich noch nicht ahnte. Oft mussten sie am nächsten Morgen schon wieder los, er und seine Eltern, dann färbte sich wieder alles grau, der Glanz in den Augen seiner Mutter war verschwunden und das Spielerische in den Bewegungen und Gesten seines Vaters, alles ging wieder seinen gewohnten Gang. Zu Hause – wo auch immer das gerade war – gab es die Piroggen seiner Großmutter nie, und fast schien es, als brächte seine Mutter es nicht übers Herz, in dieser kulinarischen Wunde ihres Mannes zu rühren, wissend, dass diese einfachen und doch so köstlichen Teigtaschen – mehr noch als der Vodka – ihn an die langen Abende in der Heimat erinnerten.
Mein Kind, du wirst so gespannt auf die Rückkehr ins Klassenzimmer warten wie ich, als ich die Geschichte das erste Mal hörte. Also, folgendermaßen: Während sie alle glauben, dass es die Aggression ist, die nur darauf wartet, sich Bahn zu brechen, ist in ihm tatsächlich ein Damm gebrochen, aber ein anderer, einer, der tiefe Traurigkeit zurückhielt bis jetzt, der verantwortlich war für seine stille Art, seine Strebsamkeit, um nicht aufzufallen, keine Angriffsfläche zu bieten. Der Halbpole baut sich auf mit hochrotem Kopf und geballten Fäusten, er nimmt nicht Rücksicht auf die, die ihn anstarren, nicht auf den Drahtzieher, der ein Grinsen verbergend gelassen vor ihm steht. Er blickt ihm fest in die Augen, fixiert aber nicht ihn, sondern den Punkt in seiner Vergangenheit, an dem er vergessen hat, was sich heimisch fühlen bedeutet, und leise Tränen laufen über seine Wangen. Er versucht nicht, wie es in seinem Alter wohl üblich wäre, sie zu verbergen, den Starken zu spielen, nein, er lässt ihnen freien Lauf, und selbst denen, die keinen Blick auf sein tränenüberströmtes Gesicht erhaschen, verrät sein bebender Rücken alles, was sie wissen müssen. Nun passiert etwas Interessantes – bei einigen der Schüler, es mögen ungefähr ein Drittel sein, zeigt sich so etwas wie stille Betroffenheit, sie wenden sich schweigend ihren Siebensachen zu und verlassen mit gesenktem Blick das Klassenzimmer. Vom Rest der Meute, der die Szene bis dahin gebannt verfolgte, ergreift eine seltsam aufgeladene Stimmung Besitz; die destruktive Energie, die auch den Schatten speist, ist deutlich spürbar. Die einen lachen hysterisch, die anderen flüstern hämisch und zeigen auf das tränennasse Elend, wieder andere boxen ihre Nachbarn provokant in die Rippen, denn der Schatten greift auch auf sie über. Nur der Halbpole und sein Gegenüber bleiben reglos wie zum Stillleben erstarrt, fast als würden sie zur Kulisse gehören für eine Szene, die sich, und das spürt der Halbpole plötzlich mit einer niederschmetternden Gewissheit, täglich tausendfach überall auf der Welt wiederholen und doch nie ein besseres Ende nehmen würde, solange es die Menschen gäbe. Der Gedanke reißt ihn aus der Schockstarre und in die Traurigkeit mischt sich Resignation; sie hilft Tränen trocknen, hilft den Automatismus in Gang zu setzen, der ihn aus dem Klassenzimmer und in den Bus führt, der ihn vor der modernen Villa im grünen Vorstadtspeckgürtel ausspuckt, die sich nie wie ein Zuhause angefühlt hat, und in der er sich zwei Tage später mit den Schlaftabletten seiner ruhelosen Mutter das Leben nehmen wird.
Männer von der Polizei, schmerbäuchig mit grauen Augenrändern und klischeehaft kalten Nikotinrauch ausdünstend, kamen, um die unerklärliche, unaussprechliche Sache aufzuklären. Wie war der Mitschüler, wie waren seine Noten, wer waren seine Freunde und war jemandem etwas Merkwürdiges an ihm aufgefallen? War es ein Problem jugendlich-ungestümer Liebelei oder war er gar mit Drogen in Berührung gekommen? Der Schatten hatte sich zurückgezogen und mittlerweile waren alle Schüler der Klasse betroffen, wenn auch ein Drittel etwas mehr als der Rest. Die Kritzeleien und damit der Stein des Anstoßes waren verschwunden, die depressive Ader der Mutter pflanzte den Beamten, wider aller Objektivitätsbekundungen, die die Polizei in solchen Fällen den drängenden Anfragen der Angehörigen entgegenhält, schon ein gewisses Bild in den Kopf. Ein Bild, das sich mehr und mehr festigte und Nuancen entwickelte, als die Gespräche mit den Mitschülern ihren Lauf nahmen. Einzelgänger, ruhig, zwanghaft in der Erledigung der schulischen Aufgaben, jedoch ohne jegliches aufrichtige Interesse, anzuknüpfen an die Belange der Mitschüler, das soziale Gefüge, das, fragt man den Psychologen, mindestens genauso wichtig für die gesunde Entwicklung eines jungen Erwachsenen ist wie ein stabiles Elternhaus, welches offenkundig nicht gegeben war usw. usf. Zum Zeitpunkt, als ER befragt wurde, waren die Fragen den Polizisten schon zur lästigen Pflicht geworden und sie hörten nur noch mit einem halben Ohr hin, als der Klassensprecher und Vorzeigeschüler von Rivalität sprach, die der Bemitleidenswerte offenkundig empfunden habe, und die unlängst in eine aggressive Auseinandersetzung im Klassenzimmer gemündet hätte, selbstverständlich unter Zeugen, denn die versammelte Klasse mit Ausnahme eines Lehrers – die Begebenheit habe sich kurz nach dem Ertönen der Pausenglocke zugetragen – habe dem Vorfall beigewohnt. Auf erneute Nachfrage wurde dies tatsächlich von etwa zwei Drittel der Klasse bestätigt, während ein Drittel sich unter dem Vorwand, nichts mitbekommen zu haben, einer Aussage enthielt. Wieder ein Fall zu den Akten, dachte sich der Oberschmerbauch zum Wochenende, als er in seinen Dienstwagen stieg und sich insgeheim schon auf die Grammelknödel freute, aus Kartoffelteig und traditionsgemäß mit Sauerkraut, die seine schon betagte Mutter es sich nicht nehmen ließ, ihrem hart arbeitenden Sohn jede zweite Woche freitags zu kredenzen, wenn auch gegen den Willen der vom Schmerbauch des Besagten zunehmend angewiderten Ehefrau.