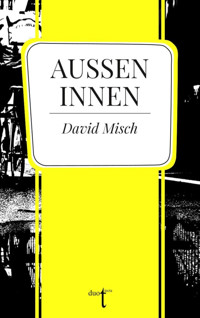Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Egoth Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie extrem ist Extremsport wirklich und wieso nehmen die Aktiven Qualen und Risiko auf dem Weg zur sportlichen Selbstverwirklichung in Kauf? Dieser Frage geht David Misch in seinem neuen Werk "Intensität – Auf der Jagd nach dem Flow" auf den Grund. Selbst "Rookie of the Year" beim legendären Race Across America, trifft Misch im Zuge seiner Spurensuche auf Szenegrößen wie Ultra-Radfahrer Christoph Strasser, Apnoe-Taucher Herbert Nitsch und Extrem-Kletterer Hansjörg Auer. Er zeichnet ein kontroversielles und zutiefst persönliches Bild der Ausnahmeathleten, ihres Strebens nach einem intensiven Leben und der Entscheidungen, die ihren sportlichen Werdegang prägen. Misch sucht nach Parallelen zwischen den unterschiedlichen Disziplinen und hinterfragt den Suchtfaktor, der exzessiven sportlichen Abenteuern im Allgemeinen attestiert wird. In achtzehn Gesprächen auf Augenhöhe räumt Misch mit Heldenmythen und Vorurteilen gleichermaßen auf, um schließlich zu resümieren: Ist es das wert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
David Misch – INTENSITÄT. Auf der Jagd nach dem Flow
1. Auflage
© Copyright 2018
egoth Verlag GmbH
Untere Weißgerberstr. 63/12
1030 Wien
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.
ISBN: 978-3-903183-07-0eISBN: 978-3-903183-60-5
Alle Bilder, soweit nicht anders vermerkt, stammen aus den Privatarchiven der jeweiligen Athleten beziehungsweise aus dem Archiv David Misch.
Lektorat: Lisa Krenmayr
Covercollage: Alexander „Lex“ Karelly
Grafische Gestaltung und Satz: Clemens Toscani/Clemens.Toscani.at
Printed in the EU
Gesamtherstellung: egoth Verlag GmbH
David Misch
INTENSITÄT
AUF DER JAGD NACH DEM FLOW
INHALT
Vorwort
Die Beweggründe für dieses Buch und der unzulängliche Versuch einer Begriffsdefinition
Eine Spurensuche
No big deal – oder die Sache mit der Selbsteinschätzung
Xandi Meixner
Pragmatischer Wahnsinn
Rainer Predl
Totale Akzeptanz
Severin Zotter
Der akribische Champion
Christoph Strasser
#Trailbeard – Spielwiese Natur
Florian Grasel
Egotrip?
Michael Strasser
Die Freiheit zu träumen
Paul Guschlbauer
Den Elementen ausgeliefert
Christian Kargl
Come down
Eugen Göttling
Extrem, und was dann?
Christian Schiester
Sich selbst vertrauen
Wolfgang Fasching
Gegen den Strom
Josef Köberl & Michael Nussbaumer
Intensität
Hansjörg Auer
Goldene Zeiten für Abenteurer
Peter Habeler
Reality Check
Holger Ferstl
Abrechnung
Thomas Frühwirth
No Limits
Herbert Nitsch
Ein persönliches Resümee
Schlussbemerkung
Weiterführende Literatur
Biographie
Für Simon und Jana. Und eure Träume.
VORWORT
Es ist der 1. Dezember 2016. Ich habe eine Lesung gehalten und war anschließend mit guten Freunden feiern. Der Abend war ein Erfolg und meine ganze Familie war da. Leider blieben sie nicht lange, denn meinem Vater ging es nicht gut. Dennoch, es war heute mein Tag, noch immer kann ich nicht glauben, dass das Buchprojekt abgeschlossen ist. Ich liebe Bücher und es war immer ein Jugendtraum, selbst eines zu schreiben. Dass ich die richtigen Geschichten erleben würde, um sogar eines über mich zu schreiben, konnte ich damals noch nicht ahnen. Der Ausdauersport öffnete mir diese Türe und noch viele mehr. Er ist meine Kraftquelle, meine Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Wenn ich gestresst bin, meditiere ich nicht, ich setze mich auf mein Rad oder schnüre die Laufschuhe. Die Monotonie der Bewegung hilft mir, in eine Art „Flow“ zu kommen. Ich habe dieses Modewort eigentlich immer gehasst, aber es trifft den Kern der Sache. Es zählt dann nur noch die saubere Ausführung des nächsten Tritts oder Schritts, der nächste Anstieg oder die nächste Kurve – ich glaube, dieser Zustand ist der kleinste gemeinsame Nenner vieler Extremsportarten – und hat definitiv Suchtpotential. Aber der Sport lässt auch Raum für Gedanken, klarer als ich sie je im Büro oder zuhause im Wohnzimmer denken könnte. Nicht selten finde ich die Lösung für ein Problem auf der Straße. Der Sport hat für mich eine so große Bedeutung, dass es mir ein Anliegen ist, ihn anderen Menschen näherzubringen. Mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten und vor allem in seinen „extremsten“ Ausprägungen. Mein Erstlingswerk „Randonnée“ schreibe ich zur Hälfte für meine Kinder, um ihnen meine Persönlichkeit, meine Leidenschaft näherzubringen. Zur anderen Hälfte für jeden, der sich dafür interessiert, wieso jemand sich vermeintlich quält, um glücklich zu sein. Ich versuche ohne Wertung zu beschreiben, was ich erlebt habe, möchte niemanden vom Sinn oder Unsinn überzeugen, sich tage- oder wochenlang im Sattel eines Fahrrads abzumühen, scheinbar ohne Lohn.
Aber schon während des Schreibens denke ich darüber nach, dass trotz aller Bemühungen meine Beschreibung eindimensional, weil allein von meinen eigenen Empfindungen und Einstellungen gefärbt, bleiben wird. Es entwickelt sich die Idee, ein ähnliches Buch zu verfassen, diesmal allerdings über andere Protagonisten des Extremsports, Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen, unterschiedlichen Zielen und Beweggründen. Ich kenne viele Leute im Langstreckenradsport, möchte mich aber in meinem neuen Buch nicht nur damit beschäftigen, was ich schon gut kenne, das wäre zu nahe an meinem letzten Versuch als Autor. Ich lege mir ein Konzept zurecht, führe Telefonate … und lasse das Thema wieder verebben, denn Weihnachten steht vor der Türe. Das übliche Festtagschaos – an Schreiben nicht zu denken. Ein Ultraschallfoto wird am Christbaum hängen, denn wir erwarten wieder Nachwuchs. Familie hat in diesen Tagen Priorität. Am 30. Dezember ändert sich schlagartig alles. Ein Anruf von meiner Mutter, bei meinem Vater wurde vermutlich Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Unsere Welt stellt sich auf den Kopf, jedem ist klar, was diese Diagnose bedeutet. Ich bin wie betäubt, kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Der nächste Besuch bei meinen Eltern gleicht einem Abschiedsbesuch. Jeder weitere Besuch in den nächsten Monaten wird wie ein Abschiedsbesuch sein und mir all meine Energie rauben. Die Situation verschlechtert sich dramatisch, aber ein Zwischenziel gibt einen letzten Rest Zuversicht – die Geburt des Enkels im Sommer. Leider erreicht mein Vater dieses Ziel nicht, er stirbt am 23. April 2017 im Alter von 65 Jahren. Ich habe im Sport schon viel gelitten, aber noch nie jemanden so leiden sehen.
Warum erzähle ich Ihnen das? Nachdem mein Vater einen Großteil seiner letzten Monate im Krankenhaus verbringen musste, völlig abhängig von den Entscheidungen und der Motivation Fremder, denke ich oft über die Wichtigkeit von Selbstbestimmung für ein glückliches Leben nach. In unserer Gesellschaft leben wir kaum noch selbstbestimmt, alles läuft in irgendeiner Form standardisiert ab. Das wird mir im Krankenhaus vor Augen gehalten, als meinem sterbenden Vater gegenüber tage- und wochenlang keine klaren Aussagen gemacht werden, ihm (zugunsten einer in Wahrheit aussichtslosen Besserung) kleine Dinge verwehrt werden, die seine letzten Tage vielleicht etwas lebenswerter gemacht hätten. Niemand hat sich formell falsch verhalten, aber eben auch so gut wie niemand menschlich richtig. Oft bin ich völlig kraftlos, wenn ich aus dem Krankenhaus komme, zwinge mich aber trotzdem auf mein Rad, um mir eine Portion Endorphine zu holen. Es ist sicher eine Sucht, ja, aber vielleicht nicht die schlechteste. Ich denke öfter als in den letzten Jahren über meine Erlebnisse beim Langstreckenfahren nach und diese Erinnerungen geben mir Kraft. Ich habe diese Sportart (so wie einige andere, die hier vorkommen) immer als die ultimative Selbstbestimmung gesehen. Sich keine Grenzen auferlegen lassen, losfahren, bei Tag und Nacht die Freiheit spüren, etwas zu tun, das einen wirklich mit Leidenschaft erfüllt, auch wenn es so gut wie kein Geld bringt. In Krisen selbst zu entscheiden, wie zu reagieren ist, gemeinsam mit einem Team, das einem den Rücken stärkt. Ich hatte die Faszination etwas aus den Augen verloren, aber in diesen schwierigen Tagen geben mir die intensiven Erinnerungen Kraft. Was ich damals gemacht hatte, ergibt in der Retrospektive plötzlich wieder mehr Sinn: Ich war frei und glücklich bei dem, was ich tat.
Mein neues Buch. Ich will es schreiben, möchte die Geschichten meiner Freunde erzählen, verstehen was sie, aber auch andere Extremsportler, antreibt. Welche Beweggründe, Ziele und Ängste sie haben. Ich möchte aber auch ein Portrait zeichnen von der Diversität der Menschen, die sich so absurde Dinge wie ein 5000 Kilometer langes Radrennen quer durch Wüsten, Hochgebirge und endlose Steppen antun. Ich habe in keinem Bereich meines Lebens so viele interessante und vielschichtige Charaktere kennengelernt wie im Sport. Diesen soll dieses Buch gewidmet sein und ich hoffe inständig, dass meine Darstellung jenen Menschen, die im Folgenden vorkommen werden, auch nur ansatzweise gerecht wird.
DIE BEWEGGRÜNDE FÜR DIESES BUCH
UND DER UNZULÄNGLICHE VERSUCH EINER BEGRIFFSDEFINITION
Extremsport. Ein Wort das polarisiert. Es soll einen Superlativ ausdrücken, bei näherer Betrachtung ist es jedoch nur eine mehr als unzureichende Verallgemeinerung. Was ist extrem? Schlägt man im Duden nach, so ist Extremsport ein „mit höchster körperlicher Beanspruchung oder besonderen Gefahren verbundener Sport (z. B. Triathlon, Freeclimbing)“. Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass solch subjektive Kriterien nicht quantifizierbar und daher unbrauchbar sind. Ich käme wohl kaum auf die Idee, eine Blinddarmoperation bei einem meiner Kinder selbst durchzuführen, nichtsdestotrotz wäre das eine Routineaufgabe für jeden Turnusarzt. Für mich wurde es irgendwann ebenso zur Routineaufgabe, 500 Kilometer und mehr nonstop auf dem Rad zu sitzen. Es wäre jedoch naiv zu sagen, während eines Tauchgangs ohne Sauerstoff über neun Minuten die Luft anzuhalten sei nicht extrem. Genauso wie ohne nennenswerte Pausen 5000 Kilometer quer durch einen Kontinent zu radeln oder mehrere 100 Kilometer laufend zurückzulegen. Aber natürlich auch, den Olympiasieg im Mehrkampfturnen anzustreben, wie in jeder anderen Weltsportart mit großer Konkurrenz. Tatsächlich bin ich überzeugt, dass die Leistungsdichte eine sportliche Herausforderung genauso ins Extrem treiben kann wie die Beschaffenheit der Aufgabe an sich, beispielsweise die schier unvorstellbare Länge einer Strecke oder die Exponiertheit eines Gipfels. In diesem Sinne ist es also eine Themenverfehlung, Extremsportarten überhaupt von „normalen“ Sportarten abzugrenzen. Dennoch nimmt der Volksmund diese Trennung vor, und daher interessiert mich: Wie definiert man nun diese Grenze, und noch wichtiger, werden „extreme“ Sportarten zwangsläufig von extremen Menschen ausgeübt? Mich beschäftigt diese Frage nicht zuletzt, weil ich selbst nicht weiß, ob etwas mit mir nicht stimmt, weil ich Spaß daran hatte, tagelang pausenlos auf dem Rad zu sitzen. Natürlich verfolgte ich auch die Berichterstattung, als ich im Ultracycling aktiv war. War Teil davon und konnte mich doch nie damit identifizieren. Ebenso konnte ich keinen meiner Freunde aus dem Sport wiedererkennen. Man bekam einen Eindruck von Übermenschen vermittelt, schmerzfrei, stets leistungswillig, immer Herr der Lage. Dabei sah es hinter den Kulissen oft ganz anders aus. Ich hatte nie den Eindruck, dass wir alle Menschen waren, die ein besonderes Risiko eingehen wollten oder sich gerne körperliche Schmerzen zufügten. Schmerztoleranz war nötig, verschaffte aber nie den Kick. Das perfekte Naturerlebnis, die Ästhetik der Bewegung und des sich Bewegens, das Gefühl durch akribische Vorbereitung etwas Unmögliches möglich gemacht zu haben, diese Dinge fand ich kaum in Berichten wieder. Wenn die breite Masse von „meiner“ Sportart nie mehr sehen würde als ein Zerrbild der Wirklichkeit, in der einzelne Aspekte überhöht werden und andere unter den Tisch fallen, was sagte das dann über andere in der breiten Öffentlichkeit als draufgängerisch oder gar selbstmörderisch gebrandmarkte Sportarten aus, die ich schon seit meiner Kindheit mit Begeisterung verfolge, jedoch nie aktiv betreiben würde? Viele Fragen kreisten in meinem Kopf: wie viel darf man für ein Hobby, eine Leidenschaft, bereit sein zu geben? Liegt die Grenze des gesellschaftlich Akzeptablen bei einem anständigen Muskelkater, einem Kreuzbandriss, einer abgefrorenen Zehe oder Schlimmerem? Hat der Mensch das Recht, Sicherheit zugunsten von Freiheit zu opfern? Wie egoistisch ist es, ein persönliches Risiko einzugehen, wenn man enge Bindungen zu anderen Menschen hat? Ich will diesen und ähnlichen Fragen mit Hilfe der in diesem Buch vorkommenden Persönlichkeiten nachgehen; schließlich bestehen berechtigte Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer 5000 Kilometer Radausfahrt, eines 250 Meter tiefen Tauchgangs oder einer Solo-Atlantiküberquerung. Reinhold Messner hat sinngemäß einmal über das Bergsteigen gesagt, es sei für die Allgemeinheit unnütz, nur der Alpinist könne seinem Tun einen Nutzen für sich selbst abgewinnen. Ich glaube aber, dass scheinbar unnütze Abenteuer auch inspirieren und damit einen größeren Nutzen in einer zunehmend desillusionierten Gesellschaft stiften können. Ein Vorteil langer Trainingseinheiten, Nächte im Zelt und dergleichen ist jedenfalls die Möglichkeit, seinen Gedanken nachhängen und ungestört sinnieren zu können. Es besteht also die begründete Hoffnung, dass dieses Buch mehr sein kann als ein Bericht über die gesammelten Erlebnisse einiger talentierter Sportler. Ich bin mir sicher, dass Sport in seiner extremen Ausprägung nach Egoismus schreit, aber auch menschliche Größe hervorbringen kann. Jedenfalls aber lässt er nicht kalt.
Nachdem die Idee für dieses Buch geboren war, stellte sich natürlich unweigerlich die praktische Frage, welche Sportarten es beinhalten sollte. Wie zuvor schon erwähnt – und der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass mich einer der Protagonisten dieses Buchs, Thomas Frühwirth, erst für diesen Umstand sensibilisierte – ist die Abgrenzung von Extremsport problematisch. Man könnte auch sagen, das Extreme im Sport folge einer zweigipfeligen Verteilung; einen Gipfel stellt das extreme Ausreizen von an sich nicht extremen Disziplinen dar – beispielsweise Kurzstreckenlauf, wo Weltrekorde wie jener über 3000 m (etwa 7 min 20 sec) übermenschlich anmuten – den zweiten: das Steigern von Distanz, der Widrigkeit der äußeren Bedingungen oder Ähnlichem. Ich beschloss, mich auf zweiteren zu konzentrieren, also Sportarten, bei denen schon das Erreichen des Ziels (egal ob in Form einer Ziellinie, einer Küstenlinie, einer Tiefenangabe oder eines Berggipfels) mit grenzwertigem Aufwand verbunden ist. Dieser Aufwand lässt sich nach näherer Betrachtung in die folgenden Kategorien einteilen: (1) physische Belastung: darunter fallen Trainingsaufwand, der nötige Grad an physischer „Exzellenz“, um das jeweilige Ziel überhaupt erreichen zu können, sowie die physischen Belastungen während der Herausforderung selbst; (2) psychische Belastung: dieser Punkt beinhaltet die sozialen Einschränkungen, die mit der Vorbereitung und der Durchführung des Vorhabens verbunden sind, psychische Strapazen wie Schlafmangel und Isolation, aber auch das Überwinden des subjektiven Eindrucks der Unmöglichkeit, welches mitunter eine größere Barriere darstellen kann als das jeweilige Vorhaben an sich; (3) objektive Gefahren: darunter fallen Risiken, die selbst bei bester Vorbereitung nicht ausgeschlossen werden können, wie beispielsweise die Möglichkeit, bei einer Atlantiküberquerung in einen Sturm oder beim Höhenbergsteigen in eine Lawine zu geraten. Oder in der Nacht auf einem nordamerikanischen Highway von einem Pickup angefahren zu werden. Nicht unter diesen Punkt fallen jedoch Probleme, die sich aus einer unzureichenden Vorbereitung ergeben; enttäuscht werden an dieser Stelle jene Leser sein, die an einer völlig objektiven Kategorisierung der im Folgenden behandelten Sportarten nach den oben genannten Kriterien interessiert sind. Ich kann ihnen nicht den härtesten Hund unter den Extremsportlern präsentieren. Wieso? Ein Beispiel zur Veranschaulichung: als Hobbybergsteiger ohne Höhenerfahrung den Mt. Everest zu besteigen – eine schlechte Idee. Nichtsdestotrotz, es ist nicht auszuschließen, dass ein solcher Bergsteiger eines Tages den Everest bezwingen wird (auf der Normalroute dürfte dies sogar beängstigend oft vorkommen). Was bedeutet das für die oben genannten Anforderungskategorien? Eine relativ geringe physische Belastung im Training – schließlich hat unser Hobbybergsteiger ja Besseres zu tun – bezahlt er mit einer ungleich höheren Anstrengung während der eigentlichen Besteigung. Der Hobbybergsteiger befindet sich schon längst in einer körperlichen Extremsituation, während der Elitebergsteiger Fotos knipst und sich an der Schönheit der Natur erfreut. Natürlich sendet dem Hobbybergsteiger auch die Psyche früher einen Gruß, aufgrund seines mangelhaften technischen Könnens gerät er mit Sicherheit in die eine oder andere Bredouille. Die objektiven Gefahren mögen für Elite- und Hobbybergsteiger dieselben sein, aber deren frühere Antizipation und kompetentere Deutung erlauben dem Eliteathleten, souveräner damit umzugehen. Man könnte unzählige ähnliche Beispiele anführen, die Kernaussage bliebe dieselbe. Eine allgemeingültige Reihung von Extremsportarten nach quantifizierbaren Kriterien führt sich ad absurdum, denn wie viel Risiko jemand einzugehen bereit ist, wo die individuelle Schmerzgrenze liegt, all diese subjektiven Faktoren lassen sich nicht leicht in eine Gesamtbewertung einrechnen. Theoretisch könnte man auch als Anfänger versuchen, wie bei der Mini Transat, mit einem knapp über sechs Meter langen Boot einhand über den Atlantik zu segeln, jedoch wird das Vorhaben nur durch entsprechendes Knowhow auch vertretbar. Oder anders gesagt, es liegt mir als Autor nicht daran, mich mit den Heldentaten jener auseinanderzusetzen, die nicht vorhaben unversehrt ans Ziel zu kommen, oder denen jedenfalls nicht genug am eigenen Leben liegt, um das Risiko derart zu beschränken, dass es nach vernünftigen Maßstäben (wieder so eine unzulässige Generalisierung, um die ich leider nicht herumkomme) noch nicht als selbstmörderisch einzuordnen ist. Draufgängertum mag hin und wieder der Schlüssel zu ganz und gar unbeschreiblichen Erlebnissen sein, aber die Grenze ist (zumindest für mich) dort erreicht, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit ein schlechter Ausgang zu erwarten ist. Umgekehrt schaffen es Sportler mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten in als riskant oder extrem einzustufenden Situationen, durch große Expertise und eingeübte Routinen noch innerhalb ihrer „Komfortzone“ unterwegs zu sein, ja sogar ausgesprochene Freude am Tun zu empfinden, was für Außenstehende in vielen Fällen paradox wirken mag.
Wieso nerve ich Sie mit Vorgeplänkel, wenn Sie doch schon voller Ungeduld den Anekdoten der Grenzgänger entgegenfiebern? Aus zwei Gründen. Erstens möchte ich Sie als Leser dazu ermutigen, sich während der Lektüre möglichst von Vorurteilen zu befreien. Verurteilen Sie nicht den Lebensstil des einen oder anderen Protagonisten, auch wenn Sie sich nicht ansatzweise vorstellen können, wieso man diesen wählen sollte. Sie müssen dieses Buch nicht als Bewunderer zuschlagen (sofern Sie das nicht schon sind), aber nehmen Sie den einen oder anderen Gedanken mit. Und zweitens: Ich fühle mich genötigt, die Auswahl an Sportarten zu rechtfertigen, die im Folgenden vorkommen wird, denn ich bin der Letzte, der diese exotischen Ausprägungen des Sports heroisieren oder über anerkannte Weltsportarten stellen möchte, in denen Erfolgsdruck und Konkurrenz ungleich höher einzuschätzen sind. Bin ich Ihnen in dieser Hinsicht Rechenschaft schuldig? Vermutlich nicht. Und dennoch zerbrach ich mir zu Anfang lange den Kopf darüber, wie die Sportarten für dieses Buch auf eine sinnvolle Anzahl einzugrenzen wären, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen. Wie sollte die Abgrenzung zwischen Adrenalinjunkies, wie sie beispielsweise im Base-Jumping zu finden sind, Ausdauerspezialisten im Ultracycling oder Ultrarunning sowie Abenteurern, die beträchtliche (aber dennoch einigermaßen kalkulierbare) Risiken auf ihrem Weg zu den entlegensten Orten dieser Welt in Kauf nehmen, gelingen? Ich kam zu dem Schluss, dass ich nur Disziplinen miteinbeziehen wollte, die sowohl Psyche als auch Physis über lange Zeiträume, also viele Stunden, Tage oder sogar Wochen, extremen Anforderungen aussetzen. Also kein klassischer Motorsport, kein Base-Jumping und auch kein Kunstflug, auch wenn diese Sportarten durchwegs riskant, physisch anspruchsvoll und mit Sicherheit auf ihre Art extrem sind. Ich kam auch zu dem Schluss, mich kühn dem Duden zu widersetzen und Triathlon bis zur Ironman-Distanz außen vor zu lassen. Dieser Sport mutierte zwar im letzten Jahrzehnt sozusagen zum Volks-Extremsport und ist daher durchaus ein interessantes Phänomen, aber letztlich ist es doch so, dass für einen Triathlon-Profi oder einen ambitionierten Amateur in diesem Sport nicht das Finish, also das reine Erreichen der Ziellinie, sondern die erzielte Zeit oder Platzierung zählt. Zweifellos wird auch der Profi durch psychische Tiefs gehen, er wird leiden. Ein Langdistanztriathlon ist hart, aber er ist sozusagen im gesellschaftlichen Mainstream angekommen. Manager, Sportlehrer, Fernsehmoderatoren, viele von ihnen tummeln sich auf den Ironman-Strecken dieser Welt, um Teil der braungebrannten Triathlon Incrowd zu sein. Die Quote der erfolgreichen Finisher liegt weit jenseits der 90 Prozent, die Teilnehmerzahlen gehen in die Tausende. Zur Veranschaulichung: würde man die psychischen und physischen Leiden, die finanzielle Belastung, die Monate und Jahre der Vorbereitung und den Grad an sozialer Einschränkung als harte Währung ansehen, die man für die Eintrittskarte in den illustren Kreis der Etablierten in einer Sportart zu bezahlen hätte, und hätte die Eintrittskarte in den Ironman-Finisher Club den Gegenwert eines luxuriösen Abendessens, so gäbe es auch Menschen, die ein Jahresgehalt für die Eintrittskarte in ihren Club hinzublättern hätten. Während also der Eintrittspreis für den Ironman-Club im gesellschaftlich vertretbaren Bereich liegt (wie oben schon erwähnt, gilt diese Betrachtung für Hobbyathleten), löst jener für viele der hier vorkommenden Sportarten wohl eher ein Kopfschütteln in der breiten Masse der Bevölkerung aus.
Warum Apnoetauchen? Aus ebendiesem Grund, denn Apnoetauchen spielt sich an der Grenze des menschlich Denkbaren ab und erfordert körperliche Anpassungsprozesse, die physiologisch eigentlich unerklärbar sind. Neben angeborenem Talent benötigen Apnoetaucher vom Schlage eines Herbert Nitsch, der mit über 250 m Tiefe den aktuellen Weltrekord im Freitauchen hält, unglaubliche Konsequenz im Training, um Körper und Geist auf Tauchgänge von bis zu 10 Minuten ohne künstliche Sauerstoffzufuhr einzustellen. Die subjektive „Unmöglichkeit“ dieser Aufgabe, die Entbehrungen während der Vorbereitung und die Unwägbarkeit der Durchführung, all diese Faktoren brachten mich am Ende zu dem Schluss, dass Apnoetauchen trotz mangelnder Langzeitkomponente die Anforderungen von anderen ausdauerlastigen Extremsportarten sozusagen in kondensierter Form bündelt. Und ja, es fasziniert mich. Warum aber Segeln, eine Tätigkeit mit der man weder besondere physische Anforderungen, noch extreme psychische Beanspruchung assoziiert? Nun: würden Sie sich alleine auf einem sechs Meter langen Boot ohne Motor über den Atlantik wagen? Diese Sportart mag eine vergleichsweise geringe physische Komponente aufweisen (wobei das Ausharren in einem Gewittersturm auf offener See mit Sicherheit an körperliche Grenzen bringen kann), aber der Grad an Exponiertheit, Unwirtlichkeit und lange andauernder Gefahr wiegt den „Mangel“ an physischer Beschwerlichkeit auf.
Ein nicht ganz naheliegender Aspekt bestärkte mich letztendlich in der oben beschriebenen Abgrenzung: die gesellschaftliche Wahrnehmung. Sie ist trügerisch, weil nicht immer faktenbasiert, aber doch ein Gradmesser für die Richtigkeit meiner Einschätzung. Während Sportarten wie Mountainbike-Downhill, BMX, Formel 1, Kunstflug oder Base-Jumping eher mit Adrenalin, Spaß an der Geschwindigkeit oder Ähnlichem assoziiert werden, verbindet die Medienöffentlichkeit die hier vorkommenden Sportarten in erster Linie mit Qualen, sei es psychischer oder physischer Natur. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob diese Überzeichnung ein Weg zu gesteigertem Publikumsinteresse oder das Produkt einer wirksamen Selbstvermarktung der Aktiven ist, im Kern trifft sie aber den Nagel auf den Kopf. Vielleicht werden die hier vertretenen Sportler sogar versuchen diesen Aspekt herunterzuspielen, ihre Leidenschaften als „normaler“ verkaufen, als sie nach allen üblichen Maßstäben zu bewerten sind; jedoch lässt sich nicht leugnen, dass alle im Folgenden beschriebenen Unternehmungen die Entschlossenheit erfordern, sich zu quälen, und zwar lange. Obwohl es durchaus schmerzhaft sein kann, beim Moto-Cross zu stürzen, obwohl ein Base-Jump ungleich gefährlicher sein kann als eine gut geplante Achttausender-Besteigung, der Grad körperlicher und geistiger Zermürbung (und sei es nur im unverzichtbaren Training) wird hier nur untergeordnet wahrgenommen. Am Ende steht es jedem frei, die oben genannten Argumente zu entkräften – ich erhebe keinen Anspruch auf ihre Richtigkeit. Vielleicht habe ich Sportarten ausgelassen, die hier ebenfalls Beachtung verdient hätten, ganz sicher ist die Liste der Protagonisten nicht annähernd erschöpfend, in Anbetracht der Unmenge interessanter Persönlichkeiten in diesem Metier. Es mag auch sein, dass jemand den Ansatz kritisiert, sich in der Betrachtung auf meine österreichischen Landsleute einzugrenzen. Dies bietet jedoch den praktischen Vorteil, das Feld der Sportler auf ein einigermaßen überschaubares Maß beschränken zu können. Und selbst hier bin ich überfordert von der Vielzahl außergewöhnlicher Leistungen. Ein paar Beispiele gefällig? Der erste Mensch ohne künstlichen Sauerstoff auf dem Mount Everest? Peter Habeler (mit Reinhold Messner). Die erste Frau auf allen 14 Achttausendern? Gerlinde Kaltenbrunner. Der Weltrekordhalter im Apnoetauchen? Herbert Nitsch. Der mehrfache Weltrekordhalter im 24h-Zeitfahren und Race Across America Rekordsieger? Christoph Strasser. Der Erste, der sowohl das Race Across America mehrfach gewann als auch die Seven Summits bestieg? Wolfgang Fasching. Ultratriathlon-Weltrekord? Alexandra Meixner. Diese Liste lässt sich noch lange fortsetzen und ist umso erstaunlicher, als dass eine entsprechende Aufzählung beispielsweise für unser nördliches Nachbarland Deutschland – durchaus eine Sportnation und beträchtlich größer mit der zehnfachen Einwohnerzahl – bedeutend kürzer ausfallen dürfte. Ich bin stolz, dass sich die meisten, wenn auch nicht alle, Lichtgestalten der heimischen Szene bereiterklärt haben, an diesem Buch mitzuwirken.
Seien Sie zum Abschluss ein letztes Mal versichert, dass es nicht meine Absicht ist, die in anderen Disziplinen erbrachten Leistungen zu schmälern, sondern vielmehr, Sie durch fesselnde Geschichten zu inspirieren und mitzunehmen in die Gedankenwelt jener, die sich nicht vom augenscheinlich Unmöglichen abbringen lassen.
EINE SPURENSUCHE
Ich beginne meine Spurensuche im Extremsport in der Aachener Heinrichsallee. An diesem Ort finde ich keine Sportler. Hier kreuze ich täglich den Drogenstrich auf dem Weg zur Technischen Hochschule, meinem neuen Arbeitsplatz. Zu Beginn meiner Recherche zu diesem Buch drehen sich meine Gedanken oft um ein Kernthema, das der Betrachtung aller extremen sportlichen Herausforderung zugrunde liegt. Warum tun sich Menschen so etwas freiwillig an? In der Heinrichsallee streife ich vorbei an Menschen, die sich durch Drogenkonsum zugrunde richten. Ich schwanke zwischen Mitleid und Ärger, wenn ich mit meinen kleinen Kindern wieder einem Müllhaufen ausweichen muss, den eine Gruppe Drogenabhängiger an einem Versammlungsort hinterlassen hat. Sie sind offensichtlich nicht frei in ihren Entscheidungen, tragen Traumata in sich, die sie verfolgen, nicht mehr loslassen und augenscheinlich dazu zwingen, sich selbst tagtäglich mit Substanzen ruhigzustellen, die langfristig – so steht es zu befürchten – ihren Untergang bedeuten werden. Es existiert nur der nächste Schuss. Schon am Morgen sehe ich Drogenabhängige unruhig auf und ab gehen, mit unstetem Blick scheinbar auf die nächste Gelegenheit wartend. Auch spät abends sind dieselben traurigen Gestalten noch auf der Straße unterwegs oder rotten sich an einem nahe gelegenen Busbahnhof zusammen, vermutlich um die Drogen zu konsumieren, die sie sich tagsüber Gott weiß wie erarbeitet haben. Die Sucht wirkt hier wie ein schauriger Fulltime-Job, mit schlechter Bezahlung. Diese Menschen leben ein Extrem, ähnlich wie Topmanager, erfolgreiche Unternehmer oder Hochleistungssportler. Aber kann man Parallelen zwischen diesen unterschiedlichen Lebensstilen ziehen? Die „Opfer“ der Heinrichsallee werden von irgendeinem inneren Dämon zu ihren Handlungen gezwungen, davon bin ich überzeugt. Aber wie steht es mit dem Sportler – oder dem Unternehmer? Wieso gibt es Menschen, die (wie soll man es besser ausdrücken) mit einem „durchschnittlichen“ Leben vollauf glücklich sind, während andere immer weiter ihre Grenzen austesten und verschieben wollen? Ich sehe den Begriff Durchschnitt, obwohl er in unserer Gesellschaft negativ behaftet ist, nicht als Abwertung, denn was bedeutet er? Nichts anderes, als dass man sich in der Mitte einer Gruppe von Individuen befindet, also aus demokratischer Sicht genau das macht, was die meisten als richtig oder jedenfalls normal einordnen würden. Aber wie in jeder Gemeinschaft gibt es Minderheiten, die sich aus irgendeinem Grund nicht an dieses Schema anpassen wollen oder können. Extremsportler und Drogenabhängige. Natürlich haben beide Gruppen völlig unterschiedliche Stellungen in unserer Gesellschaft: die einen werden bejubelt (meistens jedenfalls) während die anderen im Allgemeinen als Versager oder gescheiterte Existenzen wahrgenommen werden. Aber teilen sie gar ähnliche psychische „Defekte“, die sie zu ihren Handlungen zwingen? Christoph Strasser, RAAM Rekordsieger und 24h-Ultracycling-Weltrekordler, wischt diesen Vergleich in einem Interview mit dem Österreichischen Rundfunk weg. „Meiner Meinung nach ist, was ich mache, kein Extremsport im herkömmlichen Sinn, weil es weder mit Adrenalin noch mit Risiko oder Kontrollverlust zu tun hat, also mit Suchtrisikofaktoren. Es ist normaler Sport, der den physikalischen Gesetzen unterliegt, wobei man seine Leistung durch Ausdauertraining Schritt für Schritt verbessern kann. Ich bin aber nicht süchtig danach, meine körperlichen Grenzen auszuloten.“ Eine gewagte These natürlich, etwas so Banales wie Sport in Relation zu echter Sucht zu bringen. Ich will mir nicht vorstellen, wie schlimm die persönliche Entwicklung sein muss, die einen Menschen zum Konsum harter Drogen treibt. Aber macht es sich Strasser nicht zu einfach? Kann es sein, dass der Funke, der einem Extremsportler bewusst oder unbewusst die Programmierung mit auf den Weg gibt sich immer wieder selbst herauszufordern und mitunter damit zu schädigen, ein ähnlicher ist? Es ist schon interessant, dass man relativ häufig hört, jemand hätte eine Sucht mithilfe des Sports überwunden. Aber ist es wirklich ein Überwinden oder doch eher der Tausch einer Sucht gegen eine andere, wenngleich auch weniger schädliche? Eines der krassesten Beispiele lieferte der Deutsche Andreas Niedrig, der vom Heroinjunkie zum Ironman-Profi wurde, später sogar einmal das Race Around Slovenia, einen 1200 Kilometer langen Ultracycling-Bewerb, bestritt. Aber auch einer der Protagonisten dieses Buchs, der Ultraläufer Christian Schiester, begann nach eigener Aussage nur aufgrund seines ungesunden, ausufernden Lebensstils mit dem Laufen. Seither hat er einige der härtesten Langstreckenläufe der Welt bestritten und wirkt auf seinen durchgestylten Pressefotos wie ein gestählter Asket. Sucht gegen Sucht getauscht? Ein gewisser Hang zum Exzess liegt nahe, außerdem wirken Extremsportler in ihrer Persönlichkeit oft ambivalent; einerseits scheu und zurückhaltend, was die Bewertung der eigenen Leistung angeht, harmoniebedürftig in der eigenen Community, andererseits stets auf Öffentlichkeit bedacht, heischend nach der nächsten großen Mediensensation. Natürlich darf man nicht aus den Augen verlieren, dass für sie der Sport nicht nur Leidenschaft, sondern auch Lebensgrundlage darstellt. Wenn der Ausnahmekletterer David Lama als Erster den Cerro Torre in Patagonien frei klettert, kann er nicht einfach im Geheimen mit seinem Seilpartner losziehen; die Kameracrew seines Hauptsponsors ist auf seinen Fersen. Lama hat 2009 bei einem ersten erfolglosen Versuch den Cerro Torre zu „befreien“ damit unwissentlich eine Kontroverse ausgelöst, die ihn noch Jahre später verfolgt. Ihm wird Show-Alpinismus vorgeworfen. Reinhold Messner fragt ihn: „Denkst du nicht, dass das Filmteam dich in diesem Punkt am Cerro Torre missbraucht?“. Schlussendlich schafft Lama 2012 mit seinem Kletterpartner das für unmöglich Gehaltene und der daraus entstandene Spielfilm wird ein großer Erfolg. Lama bleibt augenscheinlich derselbe umgängliche und schüchterne junge Kletterer, der er zu Beginn seiner Karriere war. Lässt er sich nur filmen, um seine Träume verwirklichen zu können oder ist er süchtig nach der öffentlichen Anerkennung seiner unvorstellbaren Leistungen? Oder aber ist es eine Mischung aus beidem? Im Falle von David Lamas Versuch am Cerro Torre ging die Sache auf, anderen Extrembergsteigern wurde der Erfolgsdruck, das überhandnehmende Medieninteresse zum Verhängnis. Ein prominentes Beispiel ist Christian Stangl, der durch seine vorgetäuschte Solobesteigung des K2 zweifelhaften Ruhm erlangte. Keiner wird unterstellen, dass Stangl ein schlechter Bergsteiger wäre, er trieb es schlicht zu weit und konnte den selbst definierten Erwartungen schlussendlich nicht mehr gerecht werden. Vorkommnisse wie dieses sind Zunder auf dem Feuer jener, die der Höher-Schneller-Weiter-Mentalität des modernen Spitzensports nichts abgewinnen können.
Aussagen wie die folgende des legendären Extrembergsteigers Peter Habeler, getätigt während eines Interviews mit der „Wiener Zeitung“, legitimieren diese Skepsis noch weiter. Während des Abstiegs vom 8586 Meter hohen Kangchendzönga, den er wie zuvor schon den Everest ohne künstlichen Sauerstoff bestieg, geriet Habeler an seine Grenzen: „Ich hatte bereits Halluzinationen, glaubte den ‚Guardian Angel‘ wahrzunehmen. Das ist in solchen Phasen aber nichts Schreckliches, sondern ein Trost. Der dreitägige Abstieg war verheerend, wir husteten Blut. Zum Glück war ich damals in der besten körperlichen Verfassung meines Lebens. Sonst hätten wir nicht überlebt.“ Halluzinationen scheinen eine Art Ventil für den Geist zu sein, um besser mit extremer Belastung umgehen zu können. Sie sind ein weit verbreitetes Phänomen vor allem in Extremsportarten, die große physische Belastung mit Schlafmangel verbinden. Wieder so eine Parallele mit der Drogensucht. Ich habe bei meiner Teilnahme am Race Across America selbst erlebt, wie auf den Straßen Teerstreifen zu Schlangen wurden; Severin Zotter, Gewinner des RAAM 2015, bremste einmal nachts auf einer völlig menschenleeren Straße scharf ab, weil er der Meinung war, ein Mann mit einer großen Matratze stünde im Weg. Auch von morbideren Wahnvorstellungen, wie etwa aufgehängten Personen im Wald am Wegesrand, hört man beim RAAM immer wieder. Christoph Strasser erkannte gar einmal sein Fahrrad nicht mehr als solches und dachte, dass er schon längst an der Atlantikküste angekommen sei und ihn seine Crew aus Bosheit wieder ins Landesinnere zurückschicken würde. Er erzählte mir außerdem, dass er einmal sogar fest davon überzeugt war, in Norwegen unterwegs zu sein, dabei befand er sich in den Appalachen nahe der US-Ostküste. Auch Einhandsegler wie Christian Kargl fürchten Halluzinationen während langer Nonstop-Regatten. Und das sind beileibe nicht die einzigen Ausfallerscheinungen; Langstreckenläufer berichteten beispielsweise von eingeschränktem Sehvermögen während Wettkämpfen jenseits der hundert Kilometer. Angsteinflößend. Würde man ein abschreckendes Buch über Extremsport schreiben wollen, man bräuchte nur an der Oberfläche der schon zahlreich beschriebenen körperlichen und psychischen Strapazen zu kratzen und hätte ausreichend Material für eine anständige Ohrfeige an alle Anhänger.
Es gibt hier nur einen Widerspruch. Während meiner Recherche zu diesem Buch habe ich nicht das Gefühl, es vorwiegend mit draufgängerischen Exzentrikern zu tun zu haben. Weder Habeler, noch der Ausnahmekletterer Hansjörg Auer oder der Gleitschirmpilot Paul Guschlbauer versprühen in ihren Aussagen eine besondere Todessehnsucht. In Interviews spielen sie die Reizwirkung der Gefahr herunter, sehen sie als notwendiges Übel, aber nicht als Teil der Faszination am Berg oder in der Luft. Man gewinnt viel eher den Eindruck, dass man es mit ausgesprochenen Feingeistern zu tun hat, die sich an der Natur und der Ästhetik der Bewegung mehr erfreuen als dem eigentlichen Erreichen eines Ziels. Vermarktung ist ungeliebtes Mittel zum Zweck. Habeler betont in Interviews häufig, dass er es verabscheut, wenn davon gesprochen wird, Berge zu bezwingen. Er sieht sich als geduldet, als Gast des Berges, der ihm im Idealfall freundlich gesinnt ist. Das Gros der Spitzenalpinisten sieht das ähnlich. Andererseits: schöne Naturerlebnisse wären auch abseits der Achttausender, abseits der ausgesetztesten Nordwände möglich und Peter Habeler gibt auch offen zu: „Wenn man erfolgreich war, freut man sich natürlich über die Anerkennung, insbesondere bei einer großen Expedition, bei der die ganze Welt auf einen blickt.“ Habelers Aussagen vermitteln Demut und Bescheidenheit, fast als wäre es ihm peinlich, über seine Erfolge zu sprechen. Allerdings hat er sich den höchsten Berg der Welt ja nicht aus Zufall für einen Besteigungsversuch ausgesucht. Ich halte Habelers Aussagen trotzdem für authentisch; jedenfalls glaube ich ihm, dass er sich selbst glaubt. Die Frage ist, macht er sich bewusst oder unbewusst etwas vor?
Während eines Gesprächs mit meinem Freund Christoph Strasser vor dem Race Across Italy 2013 musste ich schmunzeln, als er die Meinung vertrat der bevorstehende Junggesellenurlaub seines Bruders Philipp sei eine größere Belastung für das Nervenkostüm seiner Eltern als seine eigene RAAM-Teilnahme. Das grenzt an Realitätsverweigerung. Oder ist das Herabwürdigen von Risken, bei Extremisten aller Couleur, eine Bewältigungsstrategie? Man könnte in Anbetracht der haarsträubenden und knochenzermürbenden Abenteuer im Folgenden jedenfalls diesen Eindruck gewinnen. Aber warum wirken diese Leute dann so verdammt glücklich dabei? Wie so oft im Leben dürfte eine differenzierte Betrachtung nötig sein. Und vor allem der Input von vielen verschiedenen Individuen mit unterschiedlichen Charakterzügen, um persönliche Färbungen weitestgehend zu minimieren. Vielleicht gibt es ja den Archetypus des Extremsportlers, der Angst und Herausforderung anders wahrnimmt als der Normalsterbliche und damit besser umgehen kann. Ein gutes Beispiel ist Alex „No Big Deal“ Honnold, ein bekannter amerikanischer Free Solo-Kletterer, der selbst mit dreihundert Metern Luft unterm Hintern alles nur für ein Spiel hält. Wieso sollte er auch stürzen? Natürlich, die Fehlerwahrscheinlichkeit auf einer vermeintlich leichten Route ist bei so einem Topkletterer gering; die möglichen Konsequenzen werden dadurch allerdings nicht minder fatal. Wie kann man das ausblenden, damit am Ende „bei aller Gefahr letztlich immer die Freude am Berg überwiegt“, wie Peter Habeler es ausdrückt? Es wird meine Aufgabe sein, die Sportler aus der Deckung zu locken, mich nicht mit Plattitüden abspeisen zu lassen. Das wird schwierig genug. Dazu kommt, dass ich die meisten Extremsportler, die ich treffen werde, nicht persönlich kenne. Werden sie mir vertrauen, sich auf dieses Projekt einlassen? Ein Erfolg wird dieses Buch nur dann, wenn ich am Ende sowohl dem Extremsportbewunderer als auch dem Skeptiker seine Antworten liefern kann, wertfrei, unvoreingenommen. Ich muss darauf hoffen, dass meine Gesprächspartner bereit sind, sich im Angesicht der Kontroverse zu exponieren. Ich darf mich von den beeindruckenden Erfolgen und meiner Bewunderung nicht blenden lassen. Ich will den Spiegel liefern, in dem sich die vermeintlichen Übermenschen selbst reflektieren können. Ich möchte Gespräche auf Augenhöhe führen und die Leser in die Wohnzimmer der Extremsportstars mitnehmen. Diese Gedanken kreisen in meinem Kopf, als ich ins Auto steige, um die 1000 Kilometer lange Strecke zurückzulegen, die mich an den Ort meines ersten Gesprächs führen wird.
NO BIG DEAL –
ODER DIE SACHE MIT DER SELBSTEINSCHÄTZUNG
XANDI MEIXNER
Ein wolkenverhangener Himmel begrüßt mich, als ich mich am 28. Oktober 2017 im oberösterreichischen Freistadt, wo ich in einem abgewohnten Hotel die letzte Nacht verbracht habe, dick eingemummt und nur mäßig enthusiastisch auf mein Rennrad schwinge, um die 50 Kilometer lange Strecke zu meiner ersten Interviewpartnerin zurückzulegen. Schnell wird mir warm, denn hier im Mühlviertel geht es ständig bergauf und bergab. Ich fahre durch die goldgelbe Herbstlandschaft, der Nebel hängt tief über den Bäumen und eine angenehme Ruhe geht von der mich umgebenden Landschaft aus. Ich begegne nur wenigen Menschen, die Ortschaften sind hier klein und verschlafen. Ich fahre entlang der tschechischen Grenze, auf der Strecke des Race Around Austria. Irgendwie passend, um mich auf das bevorstehende Gespräch vorzubereiten. Dr. Alexandra Meixner, mit ihr werde ich mich heute unterhalten. Wir tauschten schon Emails aus und telefonierten ein paar Mal, ich kenne sie jedoch bislang nicht persönlich. Für einen Außenstehenden ist ihr Lebenslauf beeindruckend: im Bundesheereinsatz auf den Golanhöhen in Syrien, dann Flugrettung in Tirol, eigene Praxis für Gynäkologie, Sextherapeutin, Buchautorin, Kabarettistin, Ultratriathlon-Weltrekordlerin, erste österreichische RAAM-Finisherin. Das deutet schon ein gewisses Ego an. Ich bin ein bisschen nervös und hoffe, dass die Chemie stimmt, denn nichts ist peinlicher als ein stockendes Gespräch. Schließlich bin ja ich an Alexandra oder „Xandi“, wie sie sich auf gut Waldviertlerisch nennt, herangetreten, nicht umgekehrt.
In St. Martin, ihrem Heimatort, angekommen, biege ich auf eine kleine Seitenstraße ein, die leicht bergan Richtung Norden in den Wald führt. Nur wenige Kilometer, dann wäre ich in Tschechien – polemisch könnte man denken, dass man hier entweder sportverrückt oder zum Alkoholiker wird, denn in der wenige hundert Einwohner zählenden Gemeinde dürfte das Unterhaltungsangebot überschaubar sein. Dafür ist das Zuhause von Alexandra Meixner und ihrem Ehemann, dem Krankenpfleger Walter Wegschaider, umso einladender: zwei komplett sanierte und gegen die Straße hin durch eine opulente Glasfront verbundene Bauernhäuser, ein üppiger Garten, das alles strahlt Wohlstand aus und passt zur erfolgreichen Ärztin. Ich werde von Walter freundlich begrüßt und durch den netten, mit Herbstlaub bedeckten Garten in das modern eingerichtete Wohnzimmer geführt, wo mich Xandi schon erwartet. Nach zehn Minuten mache ich mir keine Sorgen mehr um den Verlauf des Gesprächs. Xandi und Walter gehören zu jenem Menschenschlag, mit dem man sich sofort freundschaftlich verbunden fühlt, obwohl man sich praktisch nicht kennt. Jedenfalls geht es mir so. Schon an ihrem Äußeren sieht man: in Xandis Leben spielt Sport im Moment eine zentrale Rolle. Dicke Pulsuhr am Arm, Trainingsanzug mit Sponsorenlogos. Sofort beginnt sie wie ein Wasserfall über das vergangene RAAM zu sprechen, an dem sie als erste Österreicherin erfolgreich teilgenommen hat. Aber der Reihe nach. „Ich habe mit dem Sport begonnen, weil ich mir zu dick war. Und das auch von meinen damaligen Partnern ständig zu hören bekommen habe“, irgendwie nach dem Motto, „wenn schon nicht schön, dann wenigstens kräftig“. Diese Offenheit irritiert, stößt fast ein wenig vor den Kopf. „Ich habe mir früher ausgerechnet, wie viel Kalorien eine Topfentorte hat – dann wusste ich, wenn ich jeden Tag ein Stück davon esse muss ich soundso viel trainieren, um die Kalorien auszugleichen. In dieser Zeit war ich generell ein Kontrolltyp, ich habe zweimal im Jahr die Steckdosen abmontiert und im Geschirrspüler gewaschen“, erzählt sie lachend. „Ich konnte auch nicht verstehen, dass ein Mann mich attraktiv fand, das war undenkbar, wenn ich mich selbst im Spiegel sah.“ Das hört sich für mich im ersten Moment nicht unbedingt nach einer gefestigten Persönlichkeit an. Ich war immer skeptisch, wenn Leute in meinem Bekanntenkreis Sport rein als Diätmittel angesehen haben. Erstens brachte es in neunundneunzig Prozent aller Fälle nicht den gewünschten Effekt (zumindest nicht dauerhaft) und zweitens fanden diese Menschen nie denselben Zugang, dieselbe Freude an der Bewegung oder dem Naturerlebnis, welche ich immer mit dem Sport verband. Es blieb eine Pflichtübung, ein weiterer Zwang in einem Tagesablauf voller Verpflichtungen. Aber aus den darauffolgenden Erzählungen Xandis höre ich heraus, dass sie sich im Laufe der Zeit von ihrer unsicheren Persönlichkeit und damit auch von ihrer Grundmotivation, Sport zu betreiben, emanzipierte. „Das hat mich viel Zeit und Geld für Therapien gekostet“, gibt Xandi zu, weiterhin in einer unerwarteten Offenheit. Die Unsicherheit lag wie ein Schleier über vielen Bereichen ihres Lebens. Es war ein langer Weg dorthin, aber nun genießt sie es, gewissermaßen als bunter Hund angesehen zu werden, sich vieles erlauben zu können. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, schließlich sind wir hier nicht in der Großstadt, sondern in einer der eher abgeschiedenen Ecken des Landes. Hier stehen Frauen sonntags noch immer am Herd, um für die Großfamilie aufzukochen, oder sitzen im Trachtengewand in der Kirche, jedenfalls nicht auf dem Ergometer oder dem Rennrad, um sich auf den nächsten Double-Deca (20fach Ironman) vorzubereiten. Ihr mache es Spaß, für ebenjene ein Vorbild zu sein, sie zu ermuntern, sich mehr zuzutrauen und über den Tellerrand der Konventionen zu blicken. Gleichzeitig hegt Xandi jedoch großen Respekt für Traditionen, erzählt mir davon, dass sie während ihres UltratriathlonWeltrekords mit Gebeten ihre Dankbarkeit und Demut auszudrücken versuchte, etwas so Außergewöhnliches erleben zu dürfen. Sie ist eine Persönlichkeit voller Widersprüche und mir wird in unserem Gespräch sehr schnell klar, dass das auch auf ihre Motivation im Extremsport zutrifft. Es mag sein, dass sie aus fragwürdigen Gründen und ohne Selbstbewusstsein mit dem Sport begonnen hat, mittlerweile hat sich ihre Einstellung zu sich selbst aber grundsätzlich geändert. Sie will sich spüren, sagt sie auf die Frage nach ihrem heutigen Antrieb, immer neue, noch unvorstellbarere Herausforderungen anzugehen. Sie habe jetzt auch den Mut, für sich selbst einzustehen und sich treu zu bleiben, auch wenn sie häufiger mit Gegenwind, zum Beispiel in den sozialen Medien, zu kämpfen habe. Umgekehrt wolle sie aber nicht provozieren, nicht anecken nur um des Aneckens Willen. Trotzdem: Xandi bedauert die gesellschaftliche Entwicklung hin zur Intoleranz allem Andersartigen gegenüber. Auch hier hält sie Sport für ein probates Mittel, Grenzen abzubauen und sich auf Augenhöhe zu begegnen, und möchte dieses in ihrem Umfeld und darüber hinaus propagieren. Sport macht Menschen glücklich, demütig und dankbar für die Leistungsfähigkeit des eigenen Körpers – und nur wer dankbar für sein eigenes Leben ist und auf sich selbst schaut, der kann auch tolerant und emphatisch anderen gegenüber sein, ist sie überzeugt. Hier spricht die Therapeutin. Das klingt für mich logisch, und den verbindenden Effekt quer durch die Gesellschaftsschichten konnte ich auch selbst schon feststellen. Ob Universitätsprofessor, Vorstandsmitglied oder Müllmann – im Radtrikot begegnet man sich auf Augenhöhe (diese Beispiele sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern befinden sich tatsächlich im Kreis meiner Radfreunde). Auch abseits des Sports thematisiert Xandi gerne Tabus, kokettiert scheinbar mit dem schonungslosen Ansprechen von unangenehmen Themen. Ihr Buch über Sexmythen und das dazugehörige Kabarettprogramm schrammen hart an der Grenze der gesellschaftlichen Konventionen entlang und man kann sich die Frage stellen: Ist das nicht auch Überkompensation eines geringen Selbstbewusstseins? Ich denke am Tag nach unserem Treffen darüber nach und komme zu dem Schluss, dass der Denkfehler darin liegt, die bestehenden Konventionen als Norm zu akzeptieren. Wieso sollte man als Sextherapeutin nicht über Probleme beim Orgasmus, Erektionsstörungen und Vergewaltigungsphantasien schreiben dürfen, wenn dies das täglich Brot in der Arbeit mit Patienten ist? Genauso offen spricht Xandi über ihre persönliche Vergangenheit in sexueller Hinsicht, die mit Missbrauch schon im Jugendalter nicht gerade vielversprechend anfing. Mir imponiert dies ungemein und ich habe den Eindruck, dass die heutige, selbstbewusste Frau Dr. Alexandra Meixner nicht aufgesetzt, nicht gekünstelt ist. Es klingt für mich auch logisch, dass für Xandi der Sport ein Katalysator zu einem besseren Körpergefühl, einem größeren Zutrauen zu sich selbst und damit schlussendlich auch einer gereiften und reflektierten Persönlichkeit war. Aber kann man das generalisieren? Ich bin mir nicht sicher. Mir kommt wieder der Gedanke an die Drogensüchtigen in der Aachener Heinrichsallee und ich konfrontiere Xandi damit. Glaubt sie als Ärztin, dass Sport sozusagen als Substitutionsmittel für Menschen mit Suchtproblemen oder gravierenden psychologischen Defiziten von Nutzen sein könnte? Nach dem Vorbild von Andreas Niedrig, vom Junkie zum Ironman? „Auch wenn mir an dieser Stelle viele Menschen, vielleicht auch Fachleute, widersprechen werden, halte ich Sport für eine gute Möglichkeit hier als Substitution zu dienen, zumindest so lange, bis eine akute Krise ausgestanden ist. Selbstverständlich eine gewisse Konstitution vorausgesetzt.“ Sport ist sicher kein Allheilmittel und es geht ihr nicht darum jeden zum Extremsportler zu bekehren. Doch es bedarf Wertschätzung dem eigenen Körper, so wie andererseits auch Toleranz vorhandenen Schwächen gegenüber. Das sind wichtige Persönlichkeitsmerkmale, die bei Menschen mit derartigen Problemen gestärkt werden müssen. Aber lassen sich ein achtsamer Umgang mit den eigenen körperlichen Ressourcen und die extremen Belastungen während Ultratriathlon und -cycling Wettbewerben vereinbaren? Gerade Xandi wird – nicht nur als Ärztin – oft mit dieser Frage konfrontiert. „Meine Mutter war nie ein großer Fan meiner sportlichen Eskapaden; Während des Double-Deca-Weltrekords bekam ich jeden Morgen eine SMS von ihr, ich solle doch bitte aufhören, denn ich würde mich über kurz oder lang damit umbringen. Es war zermürbend, aber ich ließ es einige Tage über mich ergehen, denn meine Mutter ist 83 und ich konnte nicht erwarten, dass sie mein Treiben gutheißt. Als ich schon mehr als zehn Ironmans hinter mich gebracht hatte, konnte ich aber nicht mehr anders, ich antwortete meiner Mutter wie folgt: Als ich in den letzten Jahren 70–80 Stunden gearbeitet habe, um die Praxis aufzubauen, teilweise völlig am Ende war, hast du mir nie gesagt, ich solle kürzertreten, obwohl ich kurz vor dem Zusammenbruch stand. Aber jetzt, wo ich etwas für mein Herz tue, da lässt du es nicht gelten. Meine Mutter war dann so ergriffen, dass sie sich eine Zugfahrt in die Schweiz organisierte und mich zum ersten Mal in der Ausübung meiner Leidenschaft sah. Seitdem habe ich ihre Akzeptanz. Sie sitzt teilweise mit ihren Stricksachen in der Betreuerzone und sieht mir dabei zu, wie ich meine Runden drehe.“ Auch hier kann man eine Parallele zu gesellschaftlichen Verhaltensschemen ziehen. Die Angst vor dem Unbekannten, dem Andersartigen. Natürlich, ein Triathlon mit 76 km Schwimmen, 3600 km Radfahren und 840 km Laufen ist extrem und kritische Kommentare haben ihre Berechtigung, aber muss die Kritik so weit gehen, jemandem seine Leidenschaft abzusprechen oder sie als abartig zu verorten, wie es in vielen Social Media Kommentaren der Fall war? Xandi meint, dass ihre Mutter es als erstaunlich unspektakulär empfand, die geliebte Tochter schlussendlich in Aktion zu sehen. „Es hat ihr viele Befürchtungen und insgesamt den Schrecken vor der Veranstaltung genommen.“