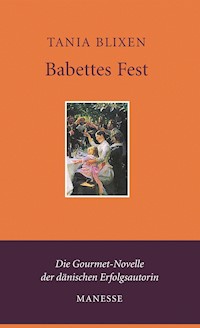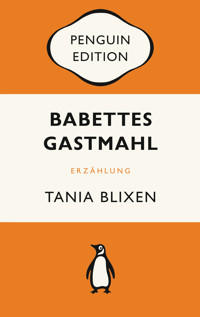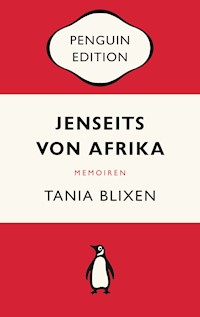5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tania Blixens Geschichten sind Perlen moderner Erzählkunst
Jahrelang hat Babette in der Lotterie gespielt, bis ihr eines Tages das Glück hold ist. Mit dem Gewinn richtet die Meisterköchin in dem abgelegenen norwegischen Dorf ein Festmahl aus, dessen lukullische Verführungskunst die Gäste für ein paar Stunden in den Himmel erhebt. Mit der anrührenden Erzählung »Babettes Fest« ist Tania Blixen ein literarisches Glanzstück gelungen, das ihren Ruf als große Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts mitbegründet. In diesem Band sind alle fünf »Schicksalsanekdoten«, wie die Autorin den Band betitelte, versammelt. Sie bezeugen, dass Blixens Texte, ihre Lebensthemen und Stoffe, das Exotische, das Märchen- und Legendenhafte dank der bildkräftigen Beschreibungskunst heute noch so lebendig sind wie eh und je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tania Blixen
Babettes Fest
und andere Erzählungen
Aus dem Englischen übertragen von W. E. Süskind
Das Buch
Jahrelang hat Babette in der Lotterie gespielt, bis ihr eines Tages das Glück hold ist. Mit dem Gewinn richtet die Meisterköchin in dem abgelegenen norwegischen Dorf ein Festmahl aus, dessen lukullische Verführungskunst die Gäste für ein paar Stunden in den Himmel erhebt. Mit der anrührenden Erzählung Babettes Fest ist Tania Blixen ein literarisches Glanzstück gelungen, das ihren Ruf als große Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts mitbegründet. In diesem Band sind alle fünf Schicksalsanekdoten, wie die Autorin den Band betitelte, versammelt. Sie bezeugen, dass Blixens Texte, ihre Lebensthemen und Stoffe, das Exotische, das Märchen- und Legendenhafte dank der bildkräftigen Beschreibungskunst heute noch so lebendig sind wie eh und je.
Die Autorin
Inhaltsverzeichnis
Der Taucher
Mira Jama hat diese Geschichte erzählt.
In Schiras lebte ein junger Theologiestudent namens Saufe, hochbegabt und reinen Herzens. Indem er unablässig und stets von neuem den Koran las, versenkte er sich dermaßen in Gestalt und Wesen der Engel, daß seine Seele mehr mit ihnen Umgang hatte als mit seiner Mutter und seinen Brüdern, mehr auch als mit seinen Lehrern und Studiengenossen oder irgend jemandem sonst in Schiras.
Er wiederholte bei sich die Worte des heiligen Buches: »… von den Engeln, so die Menschenseele mit Gewalt hervorreißen, und von jenen, so es mit Sanftmut tun; von den Engeln, so mit Gottes Befehlen durch die Luft gleiten, als schwämmen sie; von jenen, so dem Rechtschaffenen vorangehen, wenn sie ihn ins Paradies geleiten, und von jenen, so an untergeordneter Stelle stehen und die Geschäfte dieser Welt regieren …«
Gottes Thron, dachte er, muß notwendigerweise so himmelhoch gelegen sein, daß das Menschenauge ihn nicht erreichen kann und daß der Menschengeist taumelt. Die strahlenden Engel indessen schweben hin und her zwischen Gottes azurenen Hallen und unseren lichtlosen Häusern und Schulstuben. Es müßte möglich sein, daß wir sie sehen und mit ihnen Umgang haben.
Die Vögel, überlegte er weiter, sind wohl von allen Geschöpfen am meisten wie die Engel. Sagt nicht die Schrift: »Was da immer sowohl im Himmel wie auf Erden wandelt, das lobpreist Gott; so auch die Engel« – und unbestreitbar tun die Vögel das: am Himmel und auf Erden wandeln. Und sagt sie nicht weiter, von den Engeln: »Sie sind nicht erhaben wie vor Stolz, also daß sie mit Hoffart ihren Dienst tun, sondern sie singen und verrichten, was ihnen geheißen« – und unbestreitbar tun dies auch die Vögel. Streben wir also in alledem mit Fleiß den Vögeln nach, so werden wir den Engeln ähnlicher sein, als wir es jetzt sind.
Überdies kommt hinzu, daß die Vögel Flügel haben, ganz wie die Engel. Es wäre gut, wenn sich die Menschen auch Flügel schaffen könnten, um in hohe Regionen aufzusteigen, wo ein helles und ewiges Licht herrscht. Ein Vogel, der die Kräfte seiner Schwingen aufs äußerste anstrengt, mag wohl bei der einen oder anderen seiner wilden Ätherfahrten einen Engel treffen, ihm über den Weg fliegen. Vielleicht hat der Flügel der Schwalbe einen Engel am Fuß gestreift, oder der Adler hat einem Gottesboten in die stillen Augen geblickt, gerade als seine Kraft erlahmen wollte.
Ich will, beschloß er, meine Zeit und meine Gelehrsamkeit dazu verwenden, daß ich solche Flügel baue für meine Mitmenschen.
So ging er denn mit sich zu Rate und fand, daß er Schiras verlassen sollte, um die Lebensweise der geflügelten Geschöpfe zu studieren.
Bisher hatte er, indem er Söhne aus reichen Häusern unterrichtete und alte Handschriften kopierte, seine Mutter und seine kleinen Brüder ernährt, und sie klagten, ohne seine Unterstützung würden sie Not leiden. Er wandte ein, früher oder später werde sein Werk sie vielfältig für die gegenwärtigen Entbehrungen entschädigen. Seine Lehrer, die sich eine schöne Laufbahn für ihn versprochen hatten, stellten sich bei ihm ein und redeten ihm ins Gewissen, die Welt sei so lang ohne einen näheren Umgang mit den Engeln ausgekommen, daß es wohl so vorbestimmt sei und auch in Zukunft so bleiben könne.
Aber der junge Gottesgelehrte widersprach ihnen in aller Ehrerbietung. »Bis zu diesem Tage«, sagte er, »hat noch niemand gesehen, daß die Zugvögel ihren Weg nehmen nach wärmeren Gegenden, die es gar nicht gibt, oder daß sich die Flüsse ihren Lauf durch Felsen und Ebenen brechen und einem Meer entgegenströmen, welches nirgends vorhanden ist. Gott hat gewiß keine Sehnsucht oder Hoffnung erschaffen, ohne auch die Wirklichkeit zur Hand zu haben, die als Erfüllung dazugehört. Aber unsere Sehnsucht ist unser Pfand, und selig sind, die da Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Wieviel besser doch«, rief er aus, denn sein eigener Gedankengang riß ihn hin, »stünde es um unsere Erdenwelt, wenn der Mensch bei den Engeln Rat einholen und sich von ihnen sagen lassen könnte, wie das Muster der Schöpfung zu verstehen ist – sie können es ja mit Leichtigkeit lesen, denn sie schauen’s von oben.«
So stark war sein Glauben an seinen Vorsatz, daß die Lehrer ihm schließlich nicht länger widersprachen; sie überlegten, daß der Ruhm ihres Schülers sie dereinst, in künftiger Zeit, mit ihm zugleich berühmt machen könnte.
Der junge Softa nahm nun, ein ganzes Jahr hindurch, seinen Aufenthalt bei den Vögeln. Er machte sich sein Lager im hohen Gras der Felder, wo die Wachtel ruft; er kletterte auf die alten Bäume, wo die Ringeltaube und die Drossel nisten, suchte sich einen Sitz im Laub und verharrte dort so still, daß sie nicht von ihm gestört wurden. Er stieg in die hohen Berge und hielt sich, dicht unterhalb der Schneegrenze, in der Nähe eines Adlerpärchens auf, beobachtete, wie sie ausflogen und wiederkehrten.
Reich an Erkenntnis und Wissen kehrte er alsdann nach Schiras zurück und nahm die Arbeit an den Flügeln auf.
Im Koran las er: »Lob sei Gott, der die Engel erschafft, ausgerüstet mit zwei, mit drei, mit vier Schwingenpaaren«, und er beschloß, daß er für sich drei Paar Flügel anfertigen wollte, eins für die Schultern, eins für den Gürtel und eins für die Füße. Während seiner Wanderungen hatte er viele hundert Schwungfedern von Adlern, Schwänen und Bussarden gesammelt; mit denen schloß er sich nun ein und arbeitete mit solchem Eifer, daß er lange Zeit keinen Menschen sah oder sprach. Doch sang er bei der Arbeit, und die Vorübergehenden blieben stehen, lauschten und sprachen: »Dieser junge Softa preist Gott und führt aus, was befohlen ist.«
Als er aber sein erstes Paar Flügel fertig hatte, sie ausprobiert und ihre Tragkraft verspürt hatte, konnte er seine Freude nicht für sich behalten, sondern vertraute sie den Freunden an.
Anfangs lächelten die Großen in Schiras, die Gottesgelehrten und hohen Beamten, bei dem Gerücht von seiner Tat. Als sich das Gerücht aber ausbreitete und von vielen jungen Leuten bestätigt wurde, fühlten sie sich beunruhigt.
»Wenn dieser fliegende Junge da«, sagten sie untereinander, »tatsächlich Engeln begegnet und mit ihnen Verbindung aufnimmt, dann wird es den Leuten von Schiras wieder so ergehen wie immer, wenn etwas Ungewöhnliches sich ereignet: Sie werden vor lauter Staunen und Freude den Verstand verlieren. Und wer weiß, was ihm die Engel nicht für neues und umstürzlerisches Zeug erzählen mögen. Denn schließlich«, fügten sie hinzu, »ist die Möglichkeit ja nicht in Abrede zu stellen, daß es Engel im Himmel gibt.«
Sie beratschlagten die Sache, und der älteste unter ihnen, ein königlicher Minister namens Mirzah Aghai, sagte: »Dieser junge Mann ist gefährlich, weil er große Dinge träumt. Gleichzeitig aber ist er harmlos, und es wird leicht mit ihm fertigzuwerden sein, weil er das Studium unserer wirklichen Welt verabsäumt hat, in welcher Träume auf den Prüfstand müssen. Wir werden ihm, und dazu braucht’s nur einer einzigen Lektion, die Existenz der Engel zugleich beweisen und widerlegen. Es gibt doch wohl noch junge Frauen in Schiras?«
Den folgenden Tag schickte er nach einer von des Königs Tänzerinnen; ihr Name war Thusmu. Er setzte ihr den Fall so weit auseinander, wie er dachte, sie müsse darüber Bescheid wissen, und versprach ihr eine Belohnung, wenn sie ihm gehorchte. Ließe sie ihn aber im Stich, so würde ein anderes junges Tanzmädchen, eine Freundin von ihr, in der königlichen Tanzgruppe an ihre Stelle vorrücken, wenn das Fest der Rosenernte und des Rosenöls gefeiert würde.
So kam es, daß der junge Softa, als er eines Nachts auf das Dach seines Hauses gestiegen war, um nach den Sternen zu schauen und sich auszurechnen, wie schnell er vom einen zum andern würde reisen können, hinter sich leise seinen Namen rufen hörte und, als er sich umwandte, eine schmale, strahlende Gestalt gewahrte, in einem Gewand aus Gold und Silber, die hochaufgerichtet, die Füße eng beisammen, am äußersten Rand des Daches stand.
Der junge Mann war ganz erfüllt von der Vorstellung der Engel, er zweifelte keinen Augenblick an der Wesensechtheit seines Besuches und empfand nicht einmal besonderes Erstaunen, nur eine überwältigende Freude. Er sah einen Moment zum Himmel empor, ob der Engelsflug dort nicht eine schimmernde Spur hinterlassen habe, und unterdessen zogen die Leute unten die Leiter weg, auf der die Tänzerin das Dach erstiegen hatte. Im nächsten Augenblick fiel er vor ihr auf die Knie.
Sie neigte ihm freundlich den Kopf zu und blickte ihn an mit dunklen, dichtbewimperten Augen. »Du hast mich lange in deinem Herzen getragen, Saufe, mein Knecht«, flüsterte sie, »nun bin ich gekommen und will mir diese meine kleine Heimstatt beschauen. Wie lange ich bei dir in deinem Hause bleibe, das hängt von deiner Demut ab und davon, ob du bereit bist, meinen Willen zu tun.«
Sie ließ sich mit gekreuzten Beinen auf dem Dach nieder, während er weiter vor ihr kniete, und sie sprachen miteinander.
»Wir Engel«, sagte sie, »brauchen in Wahrheit gar keine Flügel, um uns zwischen Himmel und Erde zu bewegen; unsere Glieder genügen dazu. Wenn du und ich wirklich Freunde werden, wird es sich mit dir ebenso begeben, und du kannst die Flügel vernichten, an denen du arbeitest.«
Zitternd vor Inbrunst fragte er sie, wie denn ein solches Fliegen wider alle Gesetze der Naturwissenschaft möglich sei. Da lachte sie ihn aus; ihr Lachen klang wie eine helle kleine Glocke.
»Ihr Männer«, sagte sie, »seid immer so versessen auf Gesetze und Meinungsstreit und habt einen ungeheuren Glauben an die Worte, die ihr aus euren Bärten herauslaßt. Ich aber will dich davon überzeugen, daß wir einen Mund für süßeres Gespräch haben, und einen süßeren Mund für das Gespräch. Ich will dich lehren, wie Engel und Menschen ohne Meinungsstreit zu voller Verständigung gelangen, auf die himmlische Art.« Dies also tat sie.
Einen Monat lang war des Softas Glück so groß, daß sein Herz es nicht zu fassen vermochte. Er hatte keinen Gedanken mehr für seine Arbeit, indes er sich ein übers andere Mal der himmlischen Verständigung überließ. Er sagte zu Thusmu: »Ich sehe jetzt, wie recht der Engel Eblis hatte, als er zu Gott sprach: ›Ich bin besser geschaffen als Adam. Ihn hast du nur aus Erde gemacht, mich aber aus Feuer.‹« Und auch dies zitierte er ihr aus der Heiligen Schrift, und seufzte dazu: »›Wer aber den Engeln feind ist, der ist Gott selber feind.‹«
Er behielt den Engel bei sich im Hause, denn sie hatte ihm gesagt, der Anblick ihrer Lieblichkeit würde die Uneingeweihten, die Leute von Schiras, erblinden machen. Nur bei Nacht stieg sie mit ihm aufs Hausdach, und sie schauten zusammen in den jungen Mond.
Nun begab es sich aber, daß die Tänzerin den Theologen sehr lieb gewann; denn er war hübsch anzusehen, und seine unverbrauchte Kraft machte ihn zu einem großen Liebhaber. Ihm ist alles zuzutrauen, sagte sie sich allmählich. Aus ihrer Unterhaltung mit dem alten Minister hatte sie schon den Eindruck gewonnen, daß er den jungen Mann und seine Flügel als eine Gefahr empfand, als verderblich für sich selbst, seine Standesgenossen und den Staat, und nun festigte sich in ihr der Gedanke, daß sie recht gern den alten Minister, seine Amtsgenossen und den Staat wollte zugrundegehen sehen. Ihre Liebe zu ihrem jungen Freund ließ ihr Herz beinahe ebenso weich werden, wie das seine war.
Als der Mond voll wurde und die ganze Stadt in sein Licht tauchte, saßen die beiden zusammen auf dem Dach. Der junge Mann ließ seine Hände über sie hinwandern und sprach: »Seit ich dich getroffen habe, sind meine Hände auf eine eigene Weise lebendig geworden. Ich merke jetzt, als Gott den Menschen Hände gab, da hat er ihnen ein ebenso großes Liebeszeichen erwiesen, als hätte er ihnen Flügel geschenkt.« Bei diesen Worten hob er seine Hände in die Höhe und schaute sie an.
»Lästere du nicht«, sagte sie und seufzte leise. »Nicht ich, sondern du bist ein Engel, und du hast in der Tat in deinen Händen wunderbare Kraft und Lebendigkeit. Laß es mich noch einmal spüren, und dann, morgen, zeig mir die großen Dinge, die du mit deinen Händen angefertigt hast.«
Um ihr eine Freude zu machen, brachte er sie am nächsten Tag, tief verschleiert, in seine Werkstatt. Da sah er, daß die Ratten seine Adlerschwungfedern zernagt hatten und daß das Fluggestell zerbrochen und durcheinandergeworfen auf der Erde lag. Er schaute die Trümmer an und gedachte der Zeit, da er daran gearbeitet hatte. Die Tänzerin aber weinte.
»Daß er das tun wollte, hab ich nicht gewußt«, rief sie. »Ist er nicht ein böser Mann, dieser Mirzah Aghai!«
Erstaunt fragte sie der Softa, was das heißen sollte, und in ihrer Not und Empörung sagte sie ihm alles.
»Und außerdem, Liebster«, sagte sie, »ich kann gar nicht fliegen, wenn man auch behauptet, ich hätte beim Tanzen eine besondere Leichtigkeit. Sei mir nicht bös – du mußt dir überlegen, der Mirzah Aghai und seine Freunde sind große Leute, gegen die ein armes Mädchen nichts ausrichten kann. Sie sind reich und haben herrlichen Besitz. Von einer kleinen Tänzerin kannst du nicht erwarten, daß sie ein Engel ist.«
Bei diesen Worten fiel er auf sein Angesicht und blieb stumm. Thusmu setzte sich neben ihn, ihre Tränen tropften auf sein Haar, das sie sich um die Finger wand.
»Du bist so wunderbar, du«, sagte sie. »Bei dir ist alles groß und süß und wirklich himmlisch, und ich hab dich lieb. Also sei nicht traurig, Liebster.«
Er hob den Kopf, blickte sie an und sprach: »Gott hat nur Engel, niemand sonst, dazu bestimmt, daß sie über dem Höllenfeuer wachen.«
»Niemand«, sagte sie, »niemand kann so schön aus der Heiligen Schrift vortragen wie du.«
Wieder schaute er sie an. »Und so hast du vielleicht doch gesehen«, sagte er, »wie die Engel es machen, wenn sie den Ungläubigen den Tod geben. Sie schlagen sie ins Gesicht und sprechen zu ihnen: ›Da schmeck, wie Feuer brennt; dieses sollst du erdulden zur Strafe für das, was deine Hand getan hat.‹«
Nach einer Weile sagte sie: »Vielleicht kannst du die Flügel wieder ausbessern, vielleicht werden sie wieder wie neu.«
»Ich kann sie nicht ausbessern«, sagte er, »und wo du jetzt dein Werk vollbracht hast, mußt du gehen; es ist gefährlich für dich, wenn du bei mir bleibst. Denn Mirzah Aghai und seine Freunde sind große Leute. Und du sollst ja tanzen auf dem Fest der Rosenernte und des Rosenöls.«
»Vergißt du Thusmu?« fragte sie.
»Nein«, sagte er.
»Kommst du, wenn ich tanze?«
»Ja, wenn ich kann«, erwiderte er.
Sie erhob sich und sagte ernst: »Ich werde immer hoffen, daß du kommst. Denn ohne Hoffnung kann man nicht tanzen.«
Damit ging sie traurig fort.
Saufe hielt es nicht länger in seinem Haus; er ließ die Tür seiner Werkstatt offenstehen und wanderte durch die Stadt. Aber auch da hielt es ihn nicht; er lief weiter, hinaus in Wald und Feld. Doch er konnte es nicht ertragen, Vögel zu sehen, sie singen zu hören, und er kehrte bald um, zurück ins Straßengewühl. Ab und zu hielt er inne, blieb vor dem Laden eines Vogelhändlers stehen und schaute lange den Vögeln in ihren Käfigen zu.
Freunde, die ihn ansprachen, erkannte er nicht. Aber wenn Straßenbuben ihn auslachten und schrien: »Da seht den Softa, der geglaubt hat, die Thusmu ist ein Engel!« blieb er stehen, blickte sie an und sagte: »Das glaube ich noch. Nicht meinen Glauben an die Tänzerin habe ich verloren, sondern meinen Glauben an die Engel. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich mir, als ich jung war, die Engel vorgestellt habe. Ich glaube, sie sind entsetzlich anzuschauen. Wer den Engeln feind ist, der ist auch Gott feind, und wer Gott feind ist, der hat keine Hoffnung mehr. Ich habe keine Hoffnung, und ohne Hoffnung kann man nicht fliegen. Das ist’s, was mich ruhelos macht.«
Auf solche Weise wanderte der unglückliche Softa ein Jahr lang umher. Ich selber bin ihm als kleiner Junge in den Straßen begegnet, er war eingehüllt in seinen schäbigen schwarzen Umhang und einen noch schwärzeren aus unendlicher Einsamkeit.
Als das Jahr vorüber war, verschwand er und ward in Schiras nicht mehr gesehen.
»Und dies«, sprach Mira Jama, »ist der erste Teil meiner Geschichte.«
Nun traf es sich aber viele Jahre später – als ich mich als junger Mensch darauf verlegt hatte, Geschichten zu erzählen zum Vergnügen der Welt und um sie ein wenig weiser zu machen –, daß ich an die sandige Meeresküste reiste, zu den Dörfern der Perlenfischer, um mir von diesen Leuten ihre Abenteuer erzählen zu lassen und in mich aufzunehmen.
Denn es ist ja vielerlei, was so einem Menschen zustößt, der auf den Meeresgrund taucht. Perlen, von allem andern abgesehen, sind geheimnisvolle, abenteuerliche Gebilde – du brauchst nur den Werdegang einer einzigen von ihnen zu verfolgen, und du hast Stoff für hundert Geschichten. Perlen sind wie Dichtermärchen: Krankheit wird zur Köstlichkeit, durchscheinend und doch undurchsichtig; Geheimnisse der Tiefe kommen ans Licht zum Schmuck für junge Frauen, und sie erkennen darin die tieferen Geheimnisse ihrer eigenen Brust.
Im späteren Leben habe ich vor Königen nacherzählt, und viel Erfolg damit gehabt, was diese sanften, einfältigen Fischersleute mir zuerst berichtet hatten.
Nun kehrte in ihren Erzählungen immer ein bestimmter Name wieder, so daß ich neugierig wurde und sie bat, mir mehr von der betreffenden Person zu erzählen. Da erfuhr ich denn, es handle sich um einen Mann, der unter ihnen berühmt geworden war wegen seiner Kühnheit und seines ganz außergewöhnlichen und unerklärlichen Glücks. In der Tat bedeutete auch der Name, den sie ihm gegeben hatten, Elnazred, in ihrer Mundart soviel wie »der Erfolgreiche« oder »der Glückliche und Zufriedene«. Er pflege tiefer hinabzutauchen und länger zu verweilen als irgendein anderer Fischer, und unfehlbar bringe er Muscheln nach oben, die die schönsten Perlen enthielten. In den Dörfern der Perlenfischer heiße es, er müsse in der Tiefe der See einen Freund besitzen – eine schöne Meerjungfer vielleicht oder auch einen Dämonen –, der ihm den rechten Weg weise. Während die anderen Fischer von den Handelskompanien ausgebeutet wurden und ihr Leben lang arme Leute blieben, hatte sich dieser Glückliche ein nettes Vermögen beiseitegelegt, im Binnenland Haus und Garten gekauft, seiner Mutter dort Obdach geboten und seine Brüder gut verheiratet. Doch wohnte er selbst noch in einer kleinen Hütte am Strand. Trotz seines Rufs als Dämonenbeschwörer, schien er auf trockenem Boden und im täglichen Leben ein ganz friedfertiger Mensch zu sein.
Ich bin Dichter, und etwas in diesen Berichten rief mir langvergessene Geschichten ins Gedächtnis zurück. Ich beschloß, den Erfolgreichen aufzusuchen und mir seine Geschichte erzählen zu lassen. Zuerst versuchte ich es vergebens in seinem schönen, gartenumgebenen Haus. Dann, eines Abends, ging ich hinaus zum Strand, nach seiner Hütte.
Der Mond stand voll am Himmel, die langen grauen Wellen fluteten unablässig heran, alles ringsum schien ein Geheimnis zu bewahren. Ich schaute alles an und fühlte, daß ich eine schöne Geschichte hören und nacherzählen sollte.
Der Mann, nach dem ich suchte, war nicht in seiner Hütte; er saß im Sand, starrte aufs Meer hinaus und warf ab und zu einen Kieselstein hinein. Der Mond beschien ihn, und ich sah, er war ein hübscher, wohlgenährter Mann, dessen ruhiges Antlitz tatsächlich Glück und Harmonie ausdrückte.
Ich grüßte ihn mit Ehrerbietung, nannte ihm meinen Namen und erklärte ihm, ich hätte mich in der hellen, warmen Nacht auf einen Spaziergang begeben. Er erwiderte höflich meinen Gruß, zeigte sich überhaupt sehr aufgeschlossen und bemerkte, ich sei ihm dem Vernehmen nach bereits bekannt als ein Jüngling, der sich in der Kunst des Geschichtenerzählens zu vervollkommnen strebe. Er lud mich ein, mich im Sand neben ihm niederzulassen, und plauderte eine Zeitlang über den Mond und das Meer. Nach einer Gesprächspause sagte er, es sei lange her, seit er eine Geschichte habe erzählen hören – ob ich ihm nicht, da wir so nett in der hellen, warmen Nacht beisammensäßen, eine erzählen wollte.
Ich war begierig darauf, meine Kunst zu zeigen; außerdem überlegte ich mir, daß ich mir bei ihm für später einen Stein im Brett verschaffen würde, und so suchte ich in meinem Gedächtnis nach einer guten Geschichte. Irgendwie, ich weiß nicht warum, war mir die Geschichte vom Softa Saufe in den Sinn gekommen. So fing ich also, recht leise und mit einer sanften Stimme, wie es zum Mond und zu den Wellen paßte, zu erzählen an: »In Schiras lebte ein junger Theologiestudent …«
Der glückliche Mann lauschte still und aufmerksam. Als ich aber zu der Stelle kam, wo die Liebenden auf dem Hausdach sitzen, und den Namen der Tänzerin Thusmu nannte, hob der Mann seine Hand und schaute sie an. Ich hatte mir viel Mühe mit der Erfindung dieser hübschen Mondschein-Szene gegeben, und sie war meinem Dichterherzen teuer; so erkannte ich denn sofort die Gebärde und rief voller Überraschung und Bestürzung: »Du bist der Softa Saufe aus Schiras!«
»Ja«, sagte der glückliche Mann.
Für einen Dichter ist es eine unheimliche Sache, wenn er entdeckt, daß seine Geschichte wahr ist. Ich war noch sehr jung und ein Anfänger in meiner Kunst – die Haare sträubten sich mir, und ich wäre am liebsten aufgesprungen und davongelaufen. Aber etwas in der Stimme des Glücklichen hielt mich fest.
»Früher einmal«, sagte er, »hat mir das Wohlergehen des Softa Saufe, von dem du mir eben erzählt hast, sehr am Herzen gelegen. Inzwischen aber hatte ich ihn schon beinahe vergessen. Es freut mich aber zu erfahren, daß er in eine Geschichte eingegangen ist, denn das war wahrscheinlich seine Bestimmung, und ich will ihn in Zukunft von Herzen gern drinlassen. Fahr fort mit deiner Erzählung, Mira Jama, Geschichtenerzähler, und laß mich das Ende hören.«
Ich zitterte bei diesem Ansinnen, aber wieder faszinierte mich seine Art, und erlaubte mir, den Faden meiner Geschichte wieder aufzunehmen. Als erstes empfand ich, daß er mir Ehre antat, und bald, indem ich fortfuhr, daß ich ihm Ehre erwies. Das Siegesgefühl des Geschichtenerzählers erfüllte mein Herz. Ich erzählte sehr bewegend, und als ich am Ende war, auf dem dürren Meeressand, nur er und ich unterm Vollmond, da war mein Gesicht in Tränen gebadet.
Der Glückliche sprach mir Trost zu und ermahnte mich, ich sollte mir so eine Geschichte nicht allzusehr zu Herzen nehmen. Als ich wieder Herr meiner Stimme war, ersuchte ich ihn nun meinerseits, er möge mir berichten, was ihm alles zugestoßen sei, seitdem er Schiras verlassen hatte. Seine Erlebnisse in der Meerestiefe, sagte ich, und das Glück, das ihm Reichtum und Ruhm unter den Menschen eingebracht, würden sicher eine ebenso köstliche Geschichte ergeben wie die von mir erzählte, und eine vergnüglichere. Fürsten, große Damen und Tänzerinnen, erklärte ich ihm, mögen traurige Geschichten, ebenso auch die Bettler an der Stadtmauer. Ich aber hätte vor, ein Geschichtenerzähler für die ganze Welt zu werden, und die Geschäftsleute, sagte ich, und ihre Gattinnen verlangten Geschichten, die gut ausgehen.
Der Glückliche schwieg eine Weile.
»Was mir begegnet ist, nachdem ich Schiras verließ«, sagte er, »gibt überhaupt keine Geschichte ab.«
»Ich bin berühmt unter den Menschen«, fuhr er fort, »weil ich die Fähigkeit habe, länger auf dem Meeresboden zu bleiben als sie. Diese Fähigkeit, wenn du so willst, ist ein kleines Erbteil von dem Softa, von dem du mir erzählt hast. Aber das ergibt keine Geschichte. Die Fische sind immer gut zu mir gewesen; die verraten niemand. Das gibt auch keine Geschichte.«
»Dennoch«, sagte er schließlich nach einer längeren Pause, »zum Entgelt für deine Geschichte und weil ich einen jungen Dichter nicht entmutigen möchte, will ich dir, obwohl es keine Geschichte abgibt, erzählen, was mir begegnet ist, nachdem ich Schiras verließ.« Darauf begann er seinen Bericht, und ich hörte ihm zu.
»Ich werde nicht erst näher erklären, wie ich aus Schiras fortging und hierher kam, sondern meinen Bericht gleich da beginnen lassen, wo er bei den Geschäftsleuten und ihren Gattinnen Gefallen findet.
Als ich nämlich das erste Mal auf den Meeresgrund niederstieg, um eine bestimmte seltene Perle zu suchen, die mir damals viel im Kopf herumging, nahm sich ein alter Korallenfisch mit einer Hornbrille meiner an. Als er noch sehr klein war, hatten ihn zwei alte Fischer in ihrem Netz eingefangen, und er hatte da eine ganze Nacht zugebracht, im Bilgewasser ihres Bootes, und den Reden der beiden Alten zugehört, die offenbar fromme und nachdenkliche Leute waren. Am Morgen aber, als das Netz an Land gezogen wurde, ging er ihnen durch die Maschen und schwamm davon. Seitdem lacht er nur noch darüber, daß die anderen Fische so mißtrauisch gegen die Menschen sind. Wahr ist, pflegt er zu sagen, wenn ein Fisch weiß, wie er sich zu benehmen hat, kommt er mit den Menschen bequem zurecht. Er hat sogar angefangen, sich ernsthaft mit der Natur und den Gewohnheiten des Menschen zu beschäftigen, und hält öfters vor einem Fisch-Auditorium Vorträge zu diesem Thema. Auch mit mir unterhält er sich gern darüber.
Ich habe diesem Korallenfisch viel zu verdanken, denn er erfreut sich eines bedeutenden Ansehens im Meere, und ich bin als sein Schützling überall gut aufgenommen worden. Ich verdanke ihm auch viel von dem Wohlstand und Ruhm, der mich, wie man dir gesagt hat, zu einem glücklichen Menschen hat werden lassen. Aber noch viel mehr verdanke ich ihm, denn bei den langen Unterhaltungen, die wir gehabt haben, vermittelte er mir die Lebensweisheit, die mir Ruhe geschenkt hat.
Folgendes ist seine Auffassung. Der Fisch, sagt er, ist von allen Geschöpfen am sorgfältigsten und genauesten nach Gottes Ebenbild geschaffen. Alles wirkt zu seinem Besten zusammen, und daraus können wir den Schluß ziehen, daß der Fisch völlig nach Gottes Absicht ins Leben gerufen ist.
Der Mensch vermag sich nur in einer Ebene zu bewegen und ist an die Erde gefesselt. Und die Erde stützt ihn nur durch den schmalen Raum unter seinen beiden Fußsohlen, und er muß sein Gewicht mit sich herumschleppen unter bitterem Seufzen. Er muß, wie ich den Reden meiner alten Fischersleute entnommen habe, mühselig die Berge erklimmen; dabei kann es ihm passieren, daß er herunterfällt, und dann empfängt ihn die Erde äußerst unsanft. Sogar den Vögeln geht es so, sie haben zwar Schwingen, aber wenn sie ihre Flügel nicht anstrengen, verrät sie die Luft, in die sie doch hineingeboren sind, und läßt sie fallen.
Wir Fische hingegen werden von allen Seiten gestützt und getragen. Wir lehnen uns vertrauensvoll und in Eintracht gegen unser Element. Wir bewegen uns in jeder Richtung, und welchen Kurs wir auch nehmen, das gewaltige Wasser hat so viel Ehrfurcht vor unserer Wohlbeschaffenheit, daß es gehorsam seine Gestalt verändert.
Wir haben keine Hände, können also niemals etwas bauen und basteln und lassen uns nicht von eitlem Ehrgeiz verleiten, daß wir auch nur im geringsten etwas verändern wollten an der Schöpfung des Herrn. Wir säen nicht und werkeln nicht, daher schlägt auch keine unserer Erwartungen fehl, und nichts schätzen wir verkehrt ein. Die größten unter uns haben unten in der Tiefe die völlige Dunkelheit erreicht. Und das Muster der Schöpfung können wir mit Leichtigkeit lesen, wir schauen’s ja von unten.
Indem wir so durchs Gewässer kreuzen, tragen wir einen Schöpfungsbericht mit uns, der uns unsere bevorzugte Stellung aufs nachdrücklichste beweist und unser Kameradschaftsgefühl festigt. Dem Menschen ist dieser Bericht ebenfalls bekannt, er nimmt sogar in seiner Geschichte einen bedeutenden Platz ein, aber entsprechend seiner allgemeinen unterentwickelten Vorstellung von den Dingen bleibt sein Verständnis in diesem Punkt verworren. Ich will dir alles auseinandersetzen.
Als Gott Himmel und Erde geschaffen hatte, verursachte ihm die Erde bittere Enttäuschung. Der Mensch, zum Fallen geneigt, fiel denn auch beinahe auf der Stelle, und mit ihm fiel, was auf dem Trockenen war. Da gereute es den Herrn, daß er den Menschen geschaffen hatte und die Tiere auf der Erde und die Vögel in der Luft.
Nur die Fische sind nicht gefallen und werden nie fallen, denn wieso und wohin sollten wir fallen? Darum blickte der Herr gütig auf uns, seine Fische, und war getröstet bei ihrem Anblick, da unter aller Schöpfung sie allein ihn nicht enttäuscht hatten.
Er beschloß daher, die Fische nach Verdienst zu belohnen. Da wurden alle Quellen der Tiefe aufgebrochen und die Fenster des Himmels aufgetan, und die Wasser der großen Flut kamen über die Erde. Und die Wasser schwollen über und nahmen zu, und alle hohen Berge, so wie sie unterm Himmel waren, wurden bedeckt. Und die Wasser schwollen über alle Grenzen, und alles Fleisch, das auf Erden wandelte, mußte sterben, die Vögel und das Vieh, die wilden Tiere und der Mensch. Alles, was auf dem Trockenen wohnte, mußte sterben.
Ich will in meinem Bericht nicht lange bei der Annehmlichkeit dieser Zeit und dieses Zustandes verweilen. Ich habe Mitgefühl mit dem Menschen, ich besitze Takt. Auch du, bevor du den Weg zu uns fandest, hattest vielleicht Rinder in dein Herz geschlossen oder Kamele und Pferde, oder du hast Tauben gehalten oder Pfauen. Du bist noch jung und hast dich vielleicht unlängst erst hingezogen gefühlt zu so einem Geschöpf, einem von deiner eigenen Art und doch ein wenig einem Vogel ähnlich, junge Frau sagt ihr wohl zu ihnen. Obgleich, nebenbei gesagt, günstiger wäre für dich, es wäre nicht an dem, denn ich erinnere mich an die Worte meiner Fischer, daß eine junge Frau ihren Liebsten die Qual des Verbrennens erleben läßt, und da könnte dir wohl in den Sinn kommen, dich nach einer meiner eigenen Nichten umzusehen, das sind ganz ungeheuer salzige junge Dinger, bei denen ein Liebhaber nie fürchten muß, daß er brennen könnte. Was ich sagen will, ist nur dies: daß wir hundertundfünfzig Tage des Überflusses hatten und daß das Glück sich aus dem Füllhorn über uns ergoß.
Ferner werde ich, und diesmal meinetwegen, nach der klugen, erprobten Weise der Fische flüchtig über die Tatsache hinweggehen, daß der Mensch, obwohl gefallen und verderbt, durch List und Tücke noch einmal vermocht hat, nach oben zu kommen. Doch bleibt es zweifelhaft, ob er bei all seinem scheinbaren Triumph wirkliches Wohlergehen erlangt hat. Wie soll ein Geschöpf wahre Sicherheit erlangen, das von Zweifeln zerfressen wird, ob es in diese oder in jene Richtung gehen soll, und das der Frage des Steigens oder Fallens eine ungeheure Bedeutung beimißt? Wie soll es Gleichgewicht erlangen, wenn es sich nicht entschließen kann, den Gedanken der Hoffnung und des Wagnisses aufzugeben?
Wir Fische ruhen gelassen, von allen Seiten gestützt, in einem Element, das sich unablässig aufs genaueste und unfehlbarste ausgleicht, einem Element, von dem man sagen kann, daß es unsere persönliche Existenz in sich aufgenommen hat, indem nämlich, unabhängig von unserer individuellen Gestalt und gleichgültig, ob wir Flachfische oder symmetrische Fische sind, unser Gewicht und unsere Körperform danach berechnet sind, wieviel wir von unserer Umgebung verdrängen.
Unsere Erfahrung hat uns bewiesen, was auch die deine dir eines Tages beweisen wird, daß man nämlich sehr wohl ohne Hoffnung dahinschwimmen kann, ja, daß dies ohne Hoffnung sogar besser gelingt. Darum steht auch in unserem Glaubensbekenntnis geschrieben, daß wir alle Hoffnung hinter uns gelassen haben.
Wir riskieren nichts. Denn unser Ortswechsel, solange wir leben, schafft oder hinterläßt nie, was die Menschen eine Spur, einen Weg nennen, auf welche Erscheinung – es ist in Wirklichkeit keine Erscheinung, sondern eine Einbildung – sie unbegreiflicherweise leidenschaftliche Überlegung verschwenden.
Der Mensch, dies als letztes, wird beunruhigt vom Gedanken der Zeit und aus dem Gleichgewicht gebracht von einem unablässigen Schweifen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Bewohner der flüssigen Welt haben Vergangenheit und Zukunft zusammengebracht in einem einzigen Sinnspruch: »Après nous le déluge.«
Babettes Fest
1. Zwei Damen in Berlevaag
In Norwegen gibt es einen Fjord – einen langen, schmalen Meeresarm zwischen hohen Bergen – mit Namen Berlevaag-Fjord. Am Fuß der Berge liegt die kleine Stadt Berlevaag, die wie ein Puppenstädtchen aus dem Kinderbaukasten aussieht: lauter hölzerne Häuserchen in Grau, Gelb, Rosa und vielen anderen Farben.
Fünfundsechzig Jahre ist es her, da lebten in einem der gelben Häuser zwei ältere Damen. Die Damenwelt trug zu jener Zeit die Tournüre, und die beiden Schwestern hätten sich mit allem Anstand so kleiden können, denn sie waren rank und schlank gewachsen. Doch sie hatten nie auch nur den geringsten Modeartikel besessen, sich vielmehr zeitlebens in züchtiges Grau und Schwarz gehüllt. Ihre Taufnamen waren Martine und Philippa, nach Martin Luther und seinem Freund Philipp Melanchthon. Ihr Vater war Propst gewesen und ein Prophet, Gründer einer pietistischen Partei oder Sekte, die in ganz Norwegen bekannt und hoch angesehen war. Die Mitglieder versagten sich die Freuden dieser Welt; denn die Erde mit ihren sämtlichen Gaben galt ihnen als eine Art Sinnentrug, und die einzige Wirklichkeit war das Neue Jerusalem, nach dem sie strebten. Sie enthielten sich jeglichen üblen Worts, ihre Rede war ja ja und nein nein, und sie nannten einander Brüder und Schwestern.
Der Propst hatte spät geheiratet und war nun schon lange tot. Seine Jünger wurden Jahr für Jahr geringer an der Zahl, weißhaariger, kahlköpfiger und schwerhöriger, und allmählich bildete sich unter ihnen auch ein gewisses streitsüchtiges Querulantentum heraus, so daß in der Gemeinde betrüblicherweise zuweilen Spaltungen entstanden. Doch kamen sie immer noch zusammen und lasen und deuteten das Wort des Herrn. Sie hatten alle die Propsttöchter noch als kleine Mädchen gekannt, und in ihren Augen waren die beiden immer noch zwei recht junge Dinger, an denen man um ihres seligen Vaters willen mit besonderer Liebe hing. In dem gelben Haus hatten die Gemeindemitglieder das Gefühl, daß der Geist ihres Meisters bei ihnen war; hier fühlten sie sich zu Hause und geborgen.
Die beiden Damen hatten ein französisches Dienstmädchen mit Namen Babette.
Das war eine ungewöhnliche Sache für zwei pietistische Weibsleute in einem norwegischen Städtchen; so ungewöhnlich, daß es nach einer Erklärung verlangte. Die Leute von Berlevaag fanden diese Erklärung in der Frömmigkeit und Herzensgüte der beiden Schwestern. Die Propsttöchter gaben ihre Zeit und ihr bißchen Geld für Werke der Nächstenliebe hin; kein Mühseliger und Beladener klopfte umsonst an ihre Tür. Und auch Babette war vor zwölf Jahren als ein Flüchtling an diese Tür gekommen, halb irre vor Kummer und Sorge.
Die wahre Ursache freilich für Babettes Anwesenheit im Hause der Schwestern lag weit zurück in vergangener Zeit und ruhte tief verborgen in den Kammern des Menschenherzens.
2. Martines Liebhaber
Als junge Mädchen waren Martine und Philippa außerordentlich hübsch gewesen, von der beinahe übernatürlichen Schönheit eines blühenden Obstbaums oder des ewigen Schnees. Auf Bällen und Gesellschaften waren sie nie zu sehen, aber die Leute drehten sich um, wenn sie ihnen auf der Straße begegneten, und die jungen Männer von Berlevaag gingen in die Kirche, um sie hereinkommen zu sehen. Die jüngere von den Schwestern hatte zudem eine reizende Stimme, die am Sonntag die Kirche mit Wohllaut erfüllte. Für die Brüderschaft des Propstes bedeutete die irdische Liebe, und so auch die Ehe, nichts Besonderes, im Grunde eigentlich nicht mehr als Sinnentrug; dennoch ist es möglich, daß mehr als einem unter den älteren Gemeindebrüdern die beiden Mädchen köstlicher schienen als Edelsteine und daß sie dieses dem Gemeindevorstand auch nicht vorenthielten. Der Propst aber hatte erklärt, für ihn in seinem Amt seien die beiden Töchter gleichsam die rechte und die linke Hand – wer könne da wünschen, ihn ihrer zu berauben? Die beiden schönen Mädchen wären zu einer Idealvorstellung von himmlischer Liebe erzogen, sie wußten von nichts anderem und ließen sich nicht berühren von weltlichen Flammen.
Und doch hatten sie den Herzensfrieden von zwei Herren aus der großen Welt außerhalb Berlevaags gestört.
Es gab da einen jungen Offizier namens Lorens Löwenhjelm, der in seiner Garnisonstadt ein flottes Leben geführt und sich verschuldet hatte. Im Jahre 1854, als Martine achtzehn und Philippa siebzehn waren, schickte ihn sein empörter Vater für einen Monat auf Besuch zu seiner Tante auf das alte Landhaus Fossum nicht weit von Berlevaag, wo er Zeit haben würde, nachzudenken und sich zu bessern. Eines Tages ritt er ins Städtchen und traf Martine auf dem Marktplatz. Er schaute hinunter auf das hübsche Mädchen; sie schaute auf zu dem schönen Reitersmann. Als sie vorüber war und seinen Augen entschwand, wußte er nicht, ob er seinen eigenen Augen trauen konnte.
In der Familie Löwenhjelm gab es eine Überlieferung, wonach vor langen Jahren ein Angehöriger des Hauses eine Huldre gefreit habe, einen weiblichen Berggeist aus Norwegen, der von solcher Schönheit war, daß die Luft um ihn herum glänzte und zitterte. Seit damals hatten immer wieder Mitglieder der Familie das zweite Gesicht besessen. Der junge Lorens war sich bisher nie einer besonderen spiritistischen Veranlagung bewußt gewesen. In diesem Augenblick aber stieg vor ihm plötzlich und machtvoll die Vision eines höheren und reineren Lebens auf, ohne Gläubiger, Zwangsvollstreckungen und elterliche Moralpauken, ohne unsympathische heimliche Gewissensnöte, und statt dessen mit einem sanften, goldhaarigen Schutzengel, der einen leiten und belohnen würde.
Durch seine fromme Tante erhielt er Zutritt zum Hause des Propstes und sah, daß Martine ohne Hütchen noch viel hübscher war. Er folgte ihrer schlanken Gestalt mit anbetenden Blicken; um so nichtswürdiger und verächtlicher schien ihm die Figur, die er selber in ihrer Nähe machte. Mit Verwunderung und Schrecken stellte er fest, daß er nichts zu sagen wußte und daß ihm auch aus dem vor ihm stehenden Glas Wasser keine Eingebung zustieg. »Gnade und Wahrheit, liebe Brüder, sind einander begegnet«, sprach der Propst, »Rechttun und Seligwerden verschmelzen wie in einem Kuß.« Ach, den jungen Mann beschäftigte in seinen Gedanken einzig der Augenblick, da Lorens und Martine in einem Kuß verschmelzen würden. Er wiederholte seinen Besuch ein übers andere Mal, und jedesmal kam er sich dabei kleiner, unbedeutender und verächtlicher vor.
Abends, wenn er ins Haus der Tante zurückgekehrt war, schleuderte er die blankgewichsten Reitstiefel in die Zimmerecke; ja, es kam vor, daß er den Kopf auf den Tisch legte und zu weinen begann.
Am letzten Tag seines Aufenthalts machte er einen letzten Versuch, Martine seine Empfindungen mitzuteilen. Bisher war es ihm immer leichtgefallen, einem hübschen Mädchen zu sagen: Ich liebe dich – aber die zärtlichen Worte stockten ihm im Halse, als er dem Mädchen ins Gesicht sah. Als er sich bei der Gesellschaft verabschiedet hatte, begleitete ihn Martine mit einem Kerzenleuchter an die Haustür. Das Licht fiel voll auf ihren Mund und warf den Schatten ihrer längen Wimpern der Stirn entgegen. Schon im Begriff, in stummer Verzweiflung von dannen zu gehen, faßte er auf der Schwelle jählings ihre Hand und preßte sie an seine Lippen.
»Ich gehe für immer fort!« rief er. »Ich werde Sie nie, niemals wiedersehen! Das hab ich gelernt hier: daß das Schicksal hart ist; daß es Dinge gibt auf dieser Welt, die unmöglich sind!«
Als er wieder zu Hause in seiner Garnisonstadt war und sich sein Abenteuer überlegte, mußte er entdecken, daß ihm der Gedanke daran nicht angenehm war. Während die anderen jungen Offiziere von ihren Liebesgeschichten redeten, begrub er die seine in sich. Denn von der Offiziersmesse aus gesehen und sozusagen mit deren Augen war es ein ziemlich klägliches Abenteuer. Wie hatte es nur geschehen können, daß sich ein Husarenleutnant von einem Haufen dürrwangiger Sektierer, in den teppichlosen Zimmern eines Pfaffenhauses, aus dem Feld und in die Flucht hatte schlagen lassen?
Bei diesem Gedanken erschrak er tief und Panik überkam ihn. War es das alte Familienübel, das ihn wie einen Wahnsinnigen immer noch das traumhafte Bild eines Mädchens mit sich herumtragen ließ, das so schön war, daß es die Luft ringsum vor Reinheit und Heiligkeit glänzen machte? Er wollte kein Träumer sein; er wollte sein wie seine Offizierskameraden.
So riß er sich denn zusammen und beschloß mit einer Gewaltanstrengung, wie er sie in seinem jungen Leben noch nie aufgebracht hatte, daß er alles vergessen wollte, was ihm in Berlevaag geschehen war. Von nun an, beschloß er, würde er vorwärts blicken, nicht rückwärts. Er würde sich auf seine Karriere konzentrieren, und der Tag würde kommen, da er in einer glänzenden Umgebung eine glänzende Figur machen würde.
Seine Mutter war zufrieden mit dem Ergebnis seines Besuchs in Fossum und drückte in ihren Briefen der Tante ihre Dankbarkeit aus. Sie wußte nicht, auf welchen seltsamen, gewundenen Wegen ihr Sohn seinen erfreulichen moralischen Standpunkt erreicht hatte.
Der ehrgeizige junge Offizier lenkte bald die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich und wurde ungewöhnlich rasch befördert. Man schickte ihn nach Frankreich und Rußland, und bei seiner Rückkehr verheiratete er sich mit einer Hofdame der Königin Sophia. In diesen hohen Gesellschaftskreisen bewegte er sich mit Anmut und Selbstverständlichkeit, zufrieden mit seiner Umwelt und mit sich selber. Im Laufe der Zeit zog er sogar Nutzen aus gewissen Redewendungen und Gedankenverbindungen, die sich ihm damals im Hause des Propstes eingeprägt hatten, denn Frömmigkeit war zur Zeit bei Hofe in Mode.
Im gelben Haus in Berlevaag lenkte Philippa zuweilen das Gespräch auf den hübschen, schweigsamen jungen Mann, der so plötzlich aufgetaucht und so plötzlich wieder verschwunden war. Ihre ältere Schwester wußte darauf immer freundlich zu antworten – mit einem ruhigen und hellen Gesicht – und ließ die Unterhaltung auf andere Gegenstände übergehen.
3. Philippas Liebhaber
Ein Jahr darauf kam eine noch bedeutendere Persönlichkeit als Leutnant Löwenhjelm nach Berlevaag.
Der große Sänger Achille Papin aus Paris hatte eine Woche lang an der Königlichen Oper in Stockholm gastiert und dort wie überall das Publikum hingerissen. Eines Abends hatte ihm eine Dame des Hofes, die von einem Roman mit dem Künstler träumte, die wilde, großartige Landschaft Norwegens geschildert. Seine eigene romantische Natur wurde durch die Erzählung angesprochen, und er nahm seinen Weg zurück nach Frankreich entlang der norwegischen Küste. Doch in der majestätischen Umgebung fühlte er sich klein; er hatte niemanden, mit dem er sprechen konnte, und versank in Melancholie, in der er sich als alten Mann empfand, am Ende seiner Karriere – bis er an einem Sonntag, da ihm nichts Besseres einfiel, in die Kirche ging und Philippa singen hörte. Da wußte und verstand er alles in einem einzigen Augenblick. Denn hier waren die schneeigen Gipfel, die wilden Blumen und die weißen nordischen Nächte in die ihm geläufige Sprache der Musik transponiert und dargebracht in der Stimme einer jungen Frau. Wie Lorens Löwenhjelm hatte er eine Vision.
Allmächtiger Gott, dachte er, deine Macht ist ohne Ende und deine Barmherzigkeit reicht bis in Wolkenhöhen. Das ist ja eine Opernprimadonna, die Paris zu ihren Füßen sehen wird.
Achille Papin war zu jener Zeit ein schöner Mann von vierzig Jahren mit schwarzem Lockenhaar und einem roten Mund. Die Vergötterung landaus landein hatte ihn nicht verdorben; er war ein gutherziger Mensch und ehrlich gegen sich selbst.
Er ging geradewegs zu dem gelben Haus, nannte seinen Namen – der dem Propst nichts sagte – und erklärte, er halte sich aus Gesundheitsgründen in Berlevaag auf und werde sich in dieser Zeit glücklich schätzen, die junge Dame als Schülerin zu unterrichten.
Die Pariser Oper erwähnte er nicht, sondern verbreitete sich darüber, wie herrlich Fräulein Philippa in der Kirche werde singen können, zur Ehre Gottes.
Einen Augenblick vergaß er sich. Als der Propst nämlich fragte, ob er römisch-katholisch sei, antwortete er wahrheitsgemäß, und der alte Pfarrherr, der nie einen leibhaftigen Katholiken gesehen hatte, verfärbte sich ein bißchen. Indessen vergnügte es den Propst, daß er französisch sprechen konnte; es erinnerte ihn an seine Jugendzeit, als er die Schriften des großen französischen Lutheraners Lefèvre d’Étaples studiert hatte. Und da niemand Achille Papin lang widerstehen konnte, wenn er sein Herz wirklich an eine Sache gehängt hatte, gab der Alte schließlich seine Zustimmung und bemerkte seiner Tochter gegenüber: »Gottes Wege laufen übers Meer und durchs Schneegebirg, wo ein Menschenauge keine Spur gewahrt.«
So fanden sich also der große französische Sänger und die junge Anfängerin aus Norwegen zur Arbeit zusammen. Achilles Erwartung steigerte sich zur Gewißheit, die Gewißheit zur Begeisterung. Er dachte: Das war ein Irrtum, als ich glaubte, ich würde alt. Meine größten Triumphe liegen noch vor mir. Die Welt wird noch einmal an Wunder glauben, wenn wir zwei zusammen singen.
Nach einiger Zeit konnte er sein Wunschbild nicht länger für sich behalten. Er erzählte Philippa davon.
Wie ein Stern würde sie aufgehen, sagte er ihr, und höher steigen als je eine Diva der Vergangenheit und Gegenwart. Kaiser und Kaiserin, die kaiserliche Prinzessin, die großen Damen und Schöngeister von Paris würden sie hören und Tränen dabei vergießen. Auch das einfache Volk würde sie anbeten, und den Entrechteten und Unterdrückten würde sie Trost und Kraft bringen. Wenn sie am Arm ihres Lehrers die Große Oper verließe, würde ihr die Menge die Pferde ausspannen und sie ins Cafe Anglais ziehen, wo ein prächtiges Souper ihrer harrte.
Philippa erzählte dem Vater und der Schwester nichts von diesen Zukunftsaussichten. Es war das erste Mal in ihrem Leben, daß sie etwas vor den beiden geheimhielt.
Nun kam es zu dem, daß der Lehrer seiner Schülerin die Rolle der Zerline in Mozarts Don Giovanni zu studieren aufgab. Er selber, wie oft genug vorher, sang den Don Giovanni.
Nie im Leben hatte er so gesungen. In dem Duett im zweiten Akt – dem sogenannten Verführungsduett – brachte ihn die Himmelsmusik und der Zusammenklang der beiden Himmelsstimmen völlig aus der Fassung. Als die letzte Note dahinschmolz, faßte er Philippas Hand, zog die junge Frau an sich und küßte sie feierlich, wie ein Verlobter seine Braut am Altar küssen mochte. Dann ließ er sie gehen. Der Augenblick war zu erhaben für jedes weitere Wort, jede weitere Bewegung; Mozart selbst blickte auf sie beide herab.
Philippa ging nach Hause, sagte ihrem Vater, sie wünsche keine Gesangsstunden mehr zu nehmen, und bat ihn, er möchte das Monsieur Papin brieflich mitteilen.
»Und auch über Wasserflüsse läuft Gottes Weg, mein Kind«, bemerkte der Propst.
Als Achille den Brief des Alten erhielt, saß er eine Stunde wie gelähmt. Er dachte: Ich habe mich geirrt. Mein Tag ist zu Ende. Nie wieder werde ich der göttliche Papin. Und die Welt, die elende Unkrautsteppe, hat ihre Nachtigall verloren.
Später dachte er: Was hat sie denn nur, die kleine Range? Ich hab sie wohl gar geküßt?
Und zum Schluß: Da hab ich mein Leben für einen Kuß verloren und kann mich nicht einmal erinnern an den Kuß. Don Giovanni küßte Zerline, und Achille Papin muß dafür bezahlen. Das ist Künstlerlos!
Im Propsthaus bemerkte Martine, daß die Sache tiefer ging, und forschte im Gesicht der Schwester. Einen Augenblick, und der Gedanke machte sie zittern, hatte sie das Gefühl, der fremde Herr, der römisch-katholische, könnte versucht haben, Philippa zu küssen. Sie konnte sich nicht vorstellen, daß ihre Schwester über etwas in ihrer eigenen Natur überrascht und erschrocken sein könnte.
Achille Papin verließ Berlevaag mit dem nächsten Boot.
Von diesem Gast aus der großen Welt sprachen die Schwestern nur wenig. Es fehlte ihnen an den richtigen Worten dazu.
4. Ein Brief aus Paris
Fünfzehn Jahre später, in einer regnerischen Juninacht des Jahres 1871, wurde dreimal heftig am Klingelzug des gelben Hauses gerissen. Die beiden Hausherrinnen öffneten und fanden eine üppig gebaute, schwarzhaarige, totenblasse Frau mit einem Bündel am Arm vor der Tür stehen, die sie anstarrte, einen Schritt vortrat und plötzlich wie tot auf der Schwelle niedersank. Als die erschrockenen Damen sie ins Leben zurückgerufen hatten, setzte sie sich auf, schaute sie abermals lang aus ihren tiefliegenden Augen an, wühlte – ohne bei alledem ein Wort zu sprechen – in ihrer durchnäßten Kleidung und brachte einen Brief zum Vorschein, den sie den beiden überreichte.
Er war richtig an sie adressiert, jedoch in französischer Sprache. Die Schwestern steckten die Köpfe zusammen und lasen. Der Brief lautete:
Meine Damen!
Erinnern Sie sich noch an mich? Mir, wenn ich an Sie denke, wird immer das Herz weit, und alles duftet nach Maiglöckchen. Ob wohl die Erinnerung an einen Franzosen und seine Ergebenheit Sie dazu vermag, einer Französin das Leben zu retten?
Die Überbringerin dieses Briefes, Madame Babette Hersant, hat ebenso wie meine göttliche Kaiserin aus Paris fliehen müssen. Der Bürgerkrieg hat in unseren Straßen getobt. Franzosen haben französisches Blut vergossen. Die edelgesinnten Kommunarden, die die Menschenrechte verteidigen wollten, hat man zermalmt und vernichtet. Madame Hersants Gatte und Sohn, beide hervorragende Damenfriseure, wurden füsiliert. Sie selbst hat man als Petroleuse festgenommen (das Wort bezeichnet hierorts Frauen, die Häuser mit Petroleum in Brand stecken), und sie ist mit knapper Not den blutbefleckten Händen des Generals Galliffet entronnen. Sie hat all ihre Habe verloren und kann nicht länger in Frankreich bleiben.
Ein Neffe von ihr ist Koch auf der Anna Colbjörnsson, die nach Kristiania fährt (meines Wissens die Hauptstadt von Norwegen); er hat seiner Tante die Überfahrt verschafft. Ihr letzter trauriger Ausweg!
Da sie weiß, daß ich ehemals Ihr herrliches Land besucht habe, wendet sie sich an mich mit der Frage, ob in Norwegen gute Menschen wohnen, und mit der Bitte, ihr in diesem Fall einen Empfehlungsbrief mitzugeben. Die beiden Worte »gute Menschen« rufen mir alsbald Ihr Bild ins Gedächtnis, Ihr mir so teures Bild. Ich schicke sie zu Ihnen. Wie sie von Kristiania nach Berlevaag kommen soll, weiß ich nicht, da mir die Landkarte von Norwegen nicht gegenwärtig ist. Es handelt sich aber um eine Französin, und Sie werden finden, daß ihr auch jetzt noch im Unglück erfinderischer Sinn, Menschlichkeit und wahre Seelengröße eigen sind.
Bei allem ihrem Kummer beneide ich sie: sie wird Ihnen ins Antlitz blicken. Indem Sie sie gnädig aufnehmen, schicken Sie, bitte, auch eingnädiges Gedenken nach Frankreich.