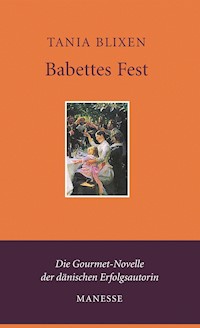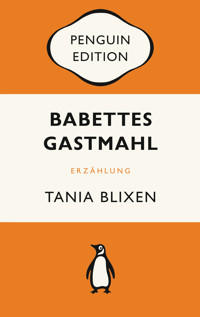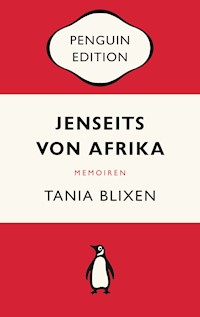4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tania Blixens Kurzgeschichten sind Perlen klassischer Erzählkunst. Zu Recht wurde die Autorin die Scheherazade des Nordens genannt, denn kaum jemand vermag es so wie sie, Leserinnen und Leser in Bann zu ziehen. Diese exklusive Textauswahl versammelt die schönsten Werke aus über fünfzig Schaffensjahren – allen voran das Glanzstück über die Meisterköchin Babette und deren exquisite kulinarische Verführungskünste. Tania Blixens Lebensthemen und bevorzugten Stoffe, das Exotische, Märchen und Legenden, aber auch herausragende Episoden der abendländischen Geschichte wirken dank ihrer sinnlichen Beschreibungskunst heute so lebendig wie eh und je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
TANIA BLIXEN (1885–1962), eigentlich Karen Blixen-Finecke, wurde nahe Kopenhagen geboren, studierte Kunst in Paris und Rom und ging 1914 mit ihrem Mann nach Kenia. Dort fand sie ihre zweite Heimat und blieb eineinhalb Jahrzehnte als Kaffeefarmerin. Ihr Memoirenband Jenseits von Afrika wurde zu einem Bestseller. Darüber hinaus bezauberte sie Leser in aller Welt mit einem reichen erzählerischen Werk.
»Blixens Erzählton ist vornehm, geistreich und voller Farben.«
Süddeutsche Zeitung
»Eine große Autorin … die Ikone einer weiblichen Sehnsucht nach Freiheit.«
Die Zeit
»In farbigen Bildern beschreibt sie die märchenhaft-mystische Atmosphäre der Natur, erzählt von der Jagd … und von so mancher bewegenden Begegnung.«
Der Westen
»›Ich bin eine Geschichtenerzählerin‹, beschrieb sich Blixen einmal selbst. ›Eine jener uralten Zunft, die sich schon bei den Ureinwohnern zu den hart arbeitenden Menschen und deren Realität gesellt hat, um ihnen eine Wirklichkeit zu zeigen, die sie verloren haben.‹«
3sat-Kulturzeit
»Eine herausragende Künstlerin und faszinierende Geschichtenerzählerin. In all ihren Texten wird der Leser sofort in die meist unheimliche und bizarre Welt ihrer Gestalten hineingezogen … Blixen schreibt über etwas Erlebtes, das sie mit der Kraft ihrer Fantasie verändert, verzaubert und so Grenzen aufsprengt.«
Titel Magazin
Außerdem von Tania Blixen lieferbar:
Jenseits von Afrika
Babettes Fest
Wintergeschichten
Besuchen Sie uns auch auf www.penguin-verlag.de und
www.facebook.com/penguinverlag
TANIA BLIXEN
Nordische Nächte
Die schönsten Erzählungen
Aus dem Dänischen und dem Englischen übersetzt von Ursula Gunsilius, Wolfheinrich von der Mülbe, Jürgen Schweier und W. E. Süskind
Herausgegeben von Horst Maria Lauinger
Inhalt
Saison in Kopenhagen (1957)
Die Familie de Cats (1905)
Babettes Fest (1950)
Onkel Théodore (1909/1913)
Karneval (1935)
Die Königssöhne (1946)
Eine tröstliche Geschichte (1942)
Editorische Notiz
Quellenverzeichnis
Saison in Kopenhagen
Zur Zeit, da diese Erzählung spielt, im Jahre 1870, wurde die Wintersaison in Kopenhagen am Neujahrsmorgen mit den großen Empfängen bei Hofe eröffnet und schloss mit den Feierlichkeiten zum Geburtstag König Christians des Neunten. Dieser ritterliche König und elegante Reiter hieß in der großen Welt »der Schwiegerpapa Europas«, denn er war der Vater der Prinzessin von Wales, der lieblichen Alexandra, und der anmutigen, geistreichen Dagmar, die Kaiserin von Russland werden sollte.
Klimatisch war die Saison dadurch charakterisiert, dass sie ins Winteräquinoktium fiel. Sie begann demnach mit einem Tag von sieben und einer Nacht von siebzehn Stunden, mit Raureif auf den roten Ziegeldächern der Stadt und dem Geräusch von Schneeschaufeln auf den Pflastersteinen, mit Schlittschuhlaufen auf den Wallgräben der Zitadelle und Schlittenpartien bei Fackelschein, mit Muffs und Baschliks und pelzgefütterten Stiefeln. Wenn dann die Karnevalstage im Februar vorüber waren, legitime Ehestiftungen und geheime Liebesaffären, elegante Rivalitäten und vornehme Intrigen in voller Blüte standen, konnten die Tage wieder länger werden, während Sonne und Frühlingswind das Pflaster rasch und verheißungsvoll trockneten. Und ehe noch die Saison ihr Ende fand, gab es Veilchen im trockenen Gras und samtne Kätzchen für die Spaziergänger auf den alten Wällen der Stadt, dazu einen glasklaren, grünen Abendhimmel.
Gesellschaftlich war die Saison dadurch gekennzeichnet, dass der Landadel die Stadt eroberte.
An Straßen und Plätzen erwachten stattliche graue und rote Häuser, die über Weihnachten blind und stumm dagestanden hatten, zum Leben und öffneten ihre Fenster. Vom Erdgeschoß bis unters Dach wurden sie gesäubert und geheizt und strahlten in Galanächten durch Reihen großer Fenster mit rosen- oder karmesinfarbenen Gardinen in die dunkle, eisige Welt hinaus. Schwere Tore, lange Zeit verriegelt, öffneten sich vor feurigen Gespannen, die zur See von Jütland und den dänischen Inseln herbeigeschafft worden waren und die gelenkt wurden von nahezu versteinerten Kutschern in pelzgefütterten Pelerinenmänteln auf dem Bock der Landauer, Phaetons und Coupés. An der Farbe der Livreen konnten die Kopenhagener auf der Straße die glänzenden Fuhrwerke trefflich voneinander unterscheiden. Da waren die Danneskjolds, die Ahlefeldts, die Frijses und die Reedtz-Thotts, die zu Hofe, zur Oper fuhren oder einander besuchten. Die Pferde schlugen lange Funken aus den Steinen, und alle trugen am Stirnriemen des Zaumzeugs das funkelnde Stückchen Metall, mit dem nur der Adel paradieren durfte. Auch ihre Stimmen fanden die großen Häuser wieder. Ganze Winternächte hindurch strömte Walzermusik aus ihnen, während draußen Nachtschwärmer herumstanden, den Takt schlugen und lauschten: Drinnen wurde getanzt.
In den Lärm der Straßen mischten sich jetzt neue Klänge, denn die Landedelleute legten trotz hohem Rang und Titel Wert auf einen Anflug ihres heimischen Dialekts, und so hörte man während der Saison auf den Promenaden, in den Theaterfoyers und bei Hofe den fröhlichen, sonoren Tonfall Jütlands, Fünens oder Langelands, von Männern in eleganter Kleidung oder Uniform, mit gestärkten Hemden und kräftigem Brustkasten gesprochen. Die jungen Damen vom Lande ließen sich auf der Stelle von den Töchtern der Bürger unterscheiden – offen, geschmeidig und hellhäutig, wie sie waren, frische, tief im Boden wurzelnde Blumen, unempfindlich gegen Regen und Wind, gut erzogen und immer zum Lachen bereit, tüchtige Reiterinnen und unermüdliche Tänzerinnen, junge Bärinnen, frisch vom Winterlager kommend und wild entschlossen, in drei von Kerzen strahlenden Monaten im Märchenland die langen Herbstmonate mit nassen Ausritten, abendlicher Handarbeit und frühem Zubettgehen wieder wettzumachen.
Mit dieser Eroberung der Stadt durch das Land erhob sich das Weiberwesen, die Welt der Frauen, wie eine Flutwelle und setzte Kopenhagen unter Wasser.
Normalerweise war die geistige Atmosphäre der Stadt männlich; so war es seit fünfzig Jahren gewesen. Die Hauptstadt von Dänemark besaß die einzige Universität des Landes; sie war Sitz des höchsten Kirchenfürsten, und um diese verehrungswürdigen Institutionen drängten sich hervorragende, gelehrte Männer – Philosophen, Geistliche und Ästheten –, die in glänzenden Diskussionen Probleme aufwarfen und lösten. Es war kaum zwanzig Jahre her, da hatte dieser illustre Kreis Gelegenheit gehabt, den Geist an dem scharfen Witz des Magisters Søren Kierkegaard zu wetzen, dessen Gegner immer noch heftig gegen ihn argumentierten. Seitdem das Land eine freie Verfassung hatte, tagte in Kopenhagen das Parlament. Die Aufrechterhaltung der geistigen Sphäre fiel Adams Söhnen zu. Eva saß am Klöppelkissen, führte das Haushaltsbuch oder begoss die Blumentöpfe am Fenster. Sie war der reine, sittige Schutzengel am häuslichen Herd; ihres Geistes Farbe war ein fleckenloses Weiß, ihre Tugenden mehr passiver als aktiver Art, sie hießen Unschuld und Geduld, und völlig fremd waren ihr die Dämonen des Zweifels und des Ehrgeizes, von denen anzunehmen stand, dass sie das Herz des Ehemannes plagten. Die Damen der wohlhabenden Bourgeoisie waren solide, vernünftige Frauen, die sich ihrer Dienstboten annahmen und für sich gewissenhaft, soweit es ihr beschränkter Ideenkreis erlaubte, die soziale Frage lösten. Eine Bohème gab es in Kopenhagen nicht; auch keinen Künstlerkreis höherer und leichterer Art. Eine blendende Schauspielerin war zwei Generationen hindurch das Idol aller gewesen, doch hatte auch sie ihre verzweifelte Wahl treffen müssen und war zu einer glorreichen Märtyrerin der Respektabilität geworden. Nur in der kleinen Gemeinde reicher orthodoxer Juden hatten sich begabte, willensstarke Frauen ein halbes Jahrhundert lang der Künste hilfreich angenommen.
Auf den großen Gütern hatte das Leben einen anderen Zuschnitt. Die Söhne der eingesessenen Magnaten liebten, wenn sie nicht in den diplomatischen Dienst gingen, das Dasein in Licht und Luft; ihr Interesse galt der Jagd, der Sorge für den Wildbestand ihrer Güter, den Pferden, einem guten Wein, der Forst- und der Landwirtschaft – und den schönen Frauen. Sie bereisten Europa, und obwohl sie sich in Paris und Baden-Baden wie zu Hause fühlten, kehrten sie doch gänzlich unverändert wieder nach Hause zurück. Sie ließen es sich gerne gefallen, dass man sie als gröbere Naturen betrachtete als ihre Frauen, denn diese Einschätzung befreite sie vom Bücherlesen, das ihnen zuwider war, und stellte es ihnen frei, sich zu vergnügen, wo und wie es ihnen zusagte. Ihre Schwestern wurden derweil daheim von französischen, englischen und deutschen Gouvernanten unterrichtet, nahmen Klavier-, Gesang- und Malstunden, wurden zum Abschluss ihrer Schulbildung nach Frankreich geschickt, und um das Gelernte nicht zu vergessen, lasen sie französische Romane und spielten die neuesten Kompositionen. Das religiöse Leben gehörte auf den Gütern ausschließlich dem Bereich der Frau an. Während die Männer nur an den hohen Festtagen zu Füßen ihrer Geistlichen saßen, fuhren ihre Damen sonntags regelmäßig zur Kirche, und wenn der Dorfpfarrer auf dem Schloss dinierte, war es die Frau des Hauses, die sich mit ihm über fromme und sogar theologische Gegenstände unterhielt. In einer Welt, wo die Frau als Hüterin von Zivilisation und Kunst gilt, werden die Anforderungen an ihre Tugend meist etwas weniger streng. Wohl wurden die jungen Mädchen noch sehr gehütet, aber sie heirateten – oft sehr jung – in die Freiheit. Eine geistreiche, charmante Hausfrau war für einen Landhaushalt ein großes Aktivum; ein gelegentlicher Verstoß gegen die Gesetze der Tugend wurde ihr verziehen, und ehrwürdige alte Damen mit tiefen Einblicken in die Genealogie ihrer Umgebung erzählten einem unbekümmert, dass das dritte oder vierte Kind eines großen Hauses in Wirklichkeit vom Nachbargut stammte.
In einer Welt, der die Legitimität als Prinzip und Grundgesetz gilt, erhält die Frau einen mystischen Wert. Sie ist mehr als nur sie selbst; sie versieht das Amt des ordinierten Priesters, der unter allen allein die Macht hat, die Trauben unserer gemeinen Erde in die erhabene Flüssigkeit zu verwandeln: in das wahre Blut. In der Zeit, von der wir sprechen, war die junge adlige Hausfrau Siegelbewahrerin des Namens und übertrug ihn feierlich auf die kommenden Geschlechter (und niemand sah ihrer Miene oder ihrem Benehmen an, ob sie wusste oder nicht, dass sie nach der Lehre Roms auch ohne ihren Herrn und Meister hätte vollbringen können, wozu er ohne sie nicht in der Lage war). Die jungen adligen Mädchen waren kleine, schnippische zukünftige Priesterinnen. Weise alte Herren machten ihnen bedächtig und artig den Hof; vielleicht trafen sie sie ja eines Tages als »Erzbischöfe« wieder.
So war es das weibliche Geschlecht, das die Saison in die Stadt brachte, und für drei Monate tat Kopenhagen die schwarzen Männerhosen beiseite und legte Ballstaat an. Die alten Damen aus den Landschlössern öffneten ihre Salons als Arenen modischen Wettstreits und setzten ihre Empfangstage wie Marksteine in die Woche. Auf der Straße bekamen die Wagen erst ihren Sinn, wenn sie ein gleichsam auf Wolken schwebendes weibliches Wesen aus den höchsten Kreisen mit sich führten, und im Theater wiesen die Leute nicht mehr auf die prominenten, düsteren Männer auf den bevorzugten Parkettplätzen, sondern richteten ihre Blicke auf das vor ihnen liegende buntfarbige, frisch duftende, lebhaft wogende Blumenbeet. Die fashionablen Blumenhändler erhielten Aufträge über Aufträge, Buketts nach hierhin und dorthin zu senden; es war, als werde die Stadt mit Rosen bombardiert.
Die Welt, in der sich die Eroberer des winterlichen Kopenhagen bewegten und dachten, war eine Welt der großen Namen. Für einen Aristokraten ist ja sein Name der Inbegriff seiner Existenz, sein Unsterbliches, das weiterleben musste, wenn die niederen Elemente dahin wären. Persönliche Talente und Charaktereigenschaften galten als Angelegenheiten menschlicher Wesen außerhalb seiner Sphäre. Dabei war das eher eine utopische Weisheit, denn im wirklichen Leben war der echte Individualist doch nur auf dem Lande zu finden. Der Stadtmensch musste in einer bestimmten Richtung dahinschreiten wie auch in einer bestimmten Richtung urteilen; die Leute auf den großen Gütern dagegen ritten noch immer querfeldein und bewegten sich ungehindert in zwei Dimensionen. Sie waren in einsamen Häusern aufgewachsen, wo der nächste Nachbar viele Stunden weit entfernt wohnte, nicht eben wie Waldbäume, sondern wie Bäume in Parks oder auf Ebenen, wo sie Platz und Freiheit hatten, ihre Eigenart zu entfalten. So hatten sich manche breite, kräftige Baumkronen entwickelt, andere sich zu knorrigen Unholdsgestalten ausgewachsen oder höchst überraschende Knoten und Auswüchse getrieben. Auf abgelegenen Gütern konnte man Exemplaren andernorts ausgestorbener Gattungen begegnen und mit alten Herren sprechen, die wie Mammuts oder Plesiosaurier, oder alten Damen, die wie Dodos waren. Der Landadel jedoch, zu nichts weniger geneigt als zur Reflektion, nahm Onkel Mammut und Tante Dodo als verehrungswürdige, archaische Blutsverwandte gern in Kauf.
Die meisten dänischen Adelsfamilien fanden ihren Namen mit einem für sie bezeichnenden Adjektiv verbunden: die frommen Reventlows, die nüchternen, treuen Frijses, die lustigen Scheels – und die Gesellschaft war sich mit der Jungmannschaft der alten Häuser darüber einig, dass es ein Beweis von Zuverlässigkeit sei, sich an die Merkmale der Familie zu halten, mochten es auch nur ererbte rote Haare sein, weil das von Loyalität zeuge. Ein junger Mensch mit altem Namen, der sich weder auf seine Erscheinung noch auf seine Begabung das Geringste einbilden durfte, bewarb sich doch in stolz-bescheidenem Vertrauen auf den Wert dieses seines wirklichen Ich um die Hand einer glänzenden Schönheit. Sowohl in der Stadt wie auch auf eigenem Grund und Boden ging, sprach, ritt, tanzte und liebte der Landedelmann als Personifikation seines Namens.
Das Land ging mit dem Namen; die großen Vermögen und alle guten Dinge der Erde gingen mit ihm. Alles war ererbt und dazu bestimmt, weitervererbt zu werden. Die alte Klasse dieser Grundbesitzer hatte wohl gehört, ja mit eigenen Augen gesehen, dass Leute imstande waren, selbst ein Vermögen zu erwerben; aber sie hatte eine Tatsache nie recht als wahr anerkennen können, die auf sie wie ein jäher, willkürlicher Schöpfungsakt wirkte, ein Verstoß gegen die Gesetze des Kosmos, wo doch das Leben sichtbar vererbt wurde. Von keinem Erbe begleitet zur Welt zu kommen, war ein unerquicklicher, fast unpassender Gedanke, und zu sterben, ohne ein Erbe zu hinterlassen, ein kaum auszudenkendes Leid. Alte, unverheiratete Töchter des begüterten Landadels legten von ihrem bescheidenen – ererbten – Einkommen Jahr für Jahr winzige Beträge zurück, die eines Tages wieder in den Familienfonds zurückfließen sollten, damit man sie später auch mit gebührenden Ehren in der Familiengruft beisetze.
In dieser Welt der Namen und Familien wurde persönliches Glück oder Missgeschick, solange es nicht Namen berührte, mit Gleichmut hingenommen, und der Tod des Einzelnen hatte seine eigenen feierlichen Riten als Wiederholung eines traurigen Passus in der Familiengeschichte. Das Erlöschen eines alten Namens hingegen war ein beklagenswertes, einigermaßen unerklärliches Ereignis, vor dem man das Haupt entblößte und die Augen einen Moment gen Himmel kehrte. Der gute dänische Name stand nun dort oben eingeschrieben: Außerhalb des Bereichs zweifelhafter, individueller Existenz hatte er den äußersten, kargen und unberührbaren Adel eines Korallenriffs angenommen. Namenlosigkeit dagegen wäre Vernichtung gewesen.
Eine spätere Generation wird nicht leicht begreifen, in welchem Ausmaß die Aristokratie der Vergangenheit sich selbst als die einzige Realität des Universums betrachtete. Ihren nächsten Vasallen und Hintersassen mochte als Gefolge noch eine Art Existenz zugesprochen werden, solcher hohen Stellung und Verbindung zuliebe mochte schließlich auch ein Spitzname noch eine Art Name sein, und während der Saison kamen vielleicht noch die Kopenhagener als Hintergrund und Publikum in Betracht. Indessen die großen, grauen Menschenmassen, die namenlosen Individuen, unter ihnen und um sie her spülend, entzogen sich ihrer Wahrnehmung. Der Gedanke, dass es eine irdische, von Not und Kampf durchsetzte Pseudoexistenz solcher Leute geben könnte, war für den Verstand noch annehmbar. Was wurde aber nach dem Tode aus ihnen, die ja nichts als Nichtigkeit hinterließen? Der Widerwille, mit dem die Welt der Namen von Zeit zu Zeit, wenn sie nicht anders konnte, ihren Blick auf die Welt der Namenlosigkeit richtete, war ein horror vacui1.
Dem König und seinem Hause hielt der Landadel unfehlbar die Treue. Es hatte eine Zeit gegeben, an die man sich noch erinnerte, von der man aber nicht gern sprach, als König Fredericks morganatische Ehe die Damen vom Hofe ferngehalten hatte – jetzt kamen sie wieder, schwärmend wie silbergeflügelte Bienen zum Bienenkorb, um einer Königsfamilie von solidem Glanz und vorbildlichem Familienleben zu huldigen. Der alte Adel stellte seine Loyalität wohl etwas mehr zur Schau, als er sie fühlte – nach der Art des ehelichen Rituals: Wer da immer sein Weib ehrt, der ehrt sich selbst. Ihr Blut sagte ihnen, dass ihr eigener Rechtsanspruch auf den Boden, das Klima und das Wetter Dänemarks, auf seine Wälder und Viehherden, seine Sprache und Sitten eigentlich triftiger und besser legitimiert sei als der eines Königshauses, dessen Mitglieder Dänisch immer noch mit deutschem Akzent sprachen. Wäre der Name der neuen Dynastie in einem Tal von Jütland oder Fünen gerufen worden, so hätte das dänische Echo, das wussten sie, darauf langsamer und dumpfer geantwortet als auf ihren eigenen.
Zur Zeit der folgenden Geschichte neigte sich diese Welt ihrem Ende zu, ja mit einem Fuß stand sie schon im Grab. Doch in dieser elften Stunde – wie das oft geschieht in der elften Stunde von Zuständen, Verhältnissen und Staaten – blühte sie so üppig auf wie zur Zeit ihrer Entstehung. Die dänischen Güter und Höfe waren vor Kurzem vom Getreidebau zur Viehzucht übergegangen; Reichtum strömte ins Land, und auf den Gütern gewöhnte man sich an einen Luxus, wie man ihn dreihundert Jahre lang nicht gekannt hatte.
In dieser Welt spielt unsere Geschichte und wendet sich nun zwei Familien zu, die, obwohl durch nahe Blutsverwandtschaft verbunden, sozial doch weit voneinander getrennt waren.
Die eine wurde damals fast allgemein als die Erste des Landes betrachtet. So weit breiteten sich ihre Ländereien nach allen Himmelsrichtungen, dass der Besitz zu einem eigenen Königreich geworden war: mächtige Wälder mit Hochwild und Damwild; Felder und Wiesen mit klaren, gewundenen Bächen; Seen und Teiche, die träumerisch in den Himmel blickten. Siebenhundert Pachthöfe lagen im Schutz der Gehölze und Hügelketten des Besitzes, zweiundvierzig gut lutherische Kirchen hielten auf den Kuppen fromme Wacht. Über den hohen Parkbäumen fingen die kupfergedeckten Türme des Schlosses die goldenen Strahlen der aufgehenden und der untergehenden Sonne auf. Die Jahrhunderte hatten Land und Namen so in eines verschmolzen, dass niemand mehr zu sagen vermochte, ob das Land zum Namen oder der Name zum Land gehöre. In den Flüssen drehten sich Mühlräder für den Namen, hinter geduldigen, zottigen Pferden brachen Pflüge für ihn den tiefen Boden auf. Der Grundherr trabte mit seinem Gefolge hinaus, um die Arbeit zu besichtigen oder einen Überblick über die Ernte zu gewinnen; den Pflüger und manchmal auch sein Gespann pflegte er beim anspruchslosen Namen zu kennen und fand auf wohlerprobte Weise wie sie, dass etwas einmal zu tun, Grund genug sei, es wieder zu tun. Die Kleider des Herrn wechselten mit der Zeit – früher hatte er unter einer Allongeperücke im Sattel gesessen, dann mit einem Zopf und dann im Zylinder und Umhang. Er war das zuverlässige, mehr oder weniger strahlende Zentrum eines Sonnensystems, das ohne ihn so wenig sein konnte, wie er allein ohne diesen Hintergrund zu sein vermocht hätte. In strohgedeckten Häuschen wirbelten hundert Spinnräder für den Namen. In einer vierspännigen Kutsche fuhr die Schlossherrin vor, um über die Spinnerei abzurechnen oder neue Anweisungen zu geben, steif und pompös in Puder und Fischbein, schlank in griechischen Draperien oder mit einem Schal und üppiger Krinoline – und auch sie erinnerte sich manchmal an die Namen der Kinder, die sie in den kleinen, düsteren Zimmern angafften.
Der Grundherr, der zur Zeit unserer Geschichte ein wachsames, väterliches Auge auf des Landes Bäume, Tiere und menschliche Bewohner hielt und an dem stattlichen Familientisch präsidierte, Graf Theodor Hannibal von Galen, war ein aufrechter, gelassener Mann, der Familientradition entsprechend körperlich und geistig ein wenig schwerfällig, ein echter Patriot und Patriarch. Seine Gräfin Louisa war eine begabte, ehrgeizige Dame, eine blendende Schönheit ehemals, die immer noch Komplimente zu hören bekam und gerne hörte, in der Gesellschaft eine Autorität in allen Dingen des Geschmacks und des Benehmens. Im Schloss wuchsen zwei Kinder heran, die dem Namen dienen und ihn verherrlichen sollten, ein Sohn von vierundzwanzig, der hübsche, herzgewinnende, liebenswürdige Leopold, der vergötterte und beneidete Führer der dänischen jeunesse dorée2, und eine neunzehnjährige Tochter Adelaide. »Die Rose von Jütland« wurde sie genannt, als habe sich alles Land der Halbinsel zwischen den Dünen am Skagerrak und den Weiden Frieslands vereinigt, um dieser einen duftenden, zarten Blume Boden zu sein. Biegsam schwankte die Rose im Winde, jung und naiv, verlockend in Farbe und Duft, doch stand sie auf gar hohem Hügel. Ihre Stimme klang klar und sanft wie Vogelruf und war fast immer leise, hatte sie es doch nie nötig gehabt, sie zu erheben, um ihren Willen durchzusetzen. Das Beste, was es auf der Welt an Kleidern, Essen und Wein, Betten, Pferden und Schoßhunden gab, hatte immer ihr gehört, von Geburts wegen und weil man fühlte, dass nichts anderes zu ihrer strahlenden, straffen Gestalt gepasst hätte.
Ein Wanderer in den Wäldern ihres Vaters, der auf dem Weg Hufschlag hörte und sie vorüberziehen sah, mit einem eleganten jungen Anbeter und einem Groom als Gefolge, mochte wohl stehenbleiben und ihr wie geblendet nachstarren, als hätte er stracks in die Sonne gesehen. Leicht wie eine Feder in ihrem Damensattel auf dem großen Pferd, trug sie die ganze Last der Felder und Wälder, der siebenhundert Pachthöfe und der zweiundvierzig Kirchen mit sich.
War der Wanderer ein junger Mann voller Weltschmerz oder ein Alter, der keine Illusionen mehr nährte, so ging er wohl mit einem plötzlich veränderten Schritt von dannen und auch ein wenig verändert in seinem Lebensgefühl; die Welt, sollte sie ein so ganz und gar hochbegünstigtes Wesen tragen können, musste ein glücklicherer, freundlicherer Aufenthalt sein, als er bisher hatte glauben mögen.
Sie war mit ihren Eltern durch Europa gereist, und auf den Promenaden der Badeorte wie in den Theatern der großen Städte hatten sich Leute umgedreht, um das leichtfüßige Mädchen mit dem langen Hals und den roten Lippen noch einmal zu sehen. Zweimal hatte sie in Kopenhagen die Saison mitgemacht und Schuhe mit so dünnen Sohlen getragen, dass sie am Morgen durchgetanzt waren. Die drei vornehmsten Epouseurs3 von Dänemark hatten um ihre Hand angehalten – und viele andere junge Adlige hatten es nur deshalb nicht gewagt, weil sie fühlten, dass sie für sie unerreichbar war. Der ihr dargebrachte Weihrauch hatte sie weder verhärtet noch eingeschüchtert; sie war so jung, dass ihr Mutwille davon nur ein wenig kecker wurde und ihre Koketterie lieblicher. Die erlesenen Schmeicheleien nahm sie hin wie ihre erlesenen Kleider und nickte den Anbetern Anerkennung zu, nicht anders als ihren Schneiderinnen, Modistinnen und Schustern. Sie hatte dunkelbraunes Haar und sehr dunkle Augen; durch ein kurzes, rundes Kinn wurde der klassisch geschnittene obere Teil ihres Gesichts pikant, mit seiner klaren Stirn und den gewölbten, ausdrucksvollen Brauen, die aussahen, als habe sie ein alter chinesischer Künstler mit dem Pinsel gezogen.
Die andere der beiden Familien hieß Angel, welcher Name im dänischen Adelskalender nicht vorkommt, und war auf Ballegaard in Nordjütland ansässig. Es war ein großer Besitz, in seiner Art ebenfalls ein Königreich. Doch war der Boden mager, große Strecken bestanden aus Moor und Marschland, und auf der hohen Hügelkette, die sich diagonal durch das Gebiet zog, krochen die windzerzausten Bäume mühsam über den Grund. Eine verborgene Eigentümlichkeit des Bodens, heimliche Lager von Kalk oder Kreide, gaben der Landschaft etwas außerordentlich Lichtes, Farbloses, Ausgeglichenes, sozusagen Schwereloses; Erde und Luft waren hier eins; in der Luft lebten die Menschen, spielten sich die Dinge ab; der Gesamteindruck war Kargheit und Größe. Das Vogelleben war auf Ballegaard ungewöhnlich reich; unendliche Schwärme wilder Gänse zogen am Himmel hin; näherten sich die Menschen, so erhoben sich Wolken von Enten aus den seichten, sumpfigen Seen, und die dichten Züge der Sumpfvögel auf ihrem Weg nach Norden oder Süden bezeichneten die Jahreszeiten. In den Mooren von Ballegaard gab es Schafe, auf den Wiesen Vieh, und über die Weiden galoppierten viele Pferde. Alles, was hier vor sich ging, passte in die Umgebung; es herrschte eine Mischung von Tüfteligkeit und Fantasterei, wie sie in der Psyche des Jütlandbauern nicht ungewöhnlich ist.
Das Herrenhaus war, wie das Gut, zu dem es gehörte, groß, vornehm und kahl. Ein niedriger, grauer Steinwall umhegte den Park mit den zugigen Lauben und dem vernachlässigten Rosengarten. Besucher aus zivilisierten Gegenden nannten ihn »romantisch«. Dazu stimmte gut, dass das junge Volk, das im Herrenhaus geboren war und in den großen Räumen und langen Korridoren ein wildes, glückliches Leben führte, sein Dasein einer Romanze verdankte.
Man vermöchte sich vorzustellen, dass eine Wassermühle, getrieben durch eine immer in derselben Richtung wirkende Kraft, von einer Windmühle, die ihre Antriebe aus allen vier Windrichtungen erhält, angezogen, ja betört werden könnte. Oder es wäre denkbar, dass aus einem winzigen, nicht wahrnehmbaren Korn von Extravaganz oder Narrheit in jeder Generation einer gesunden, soliden Familie, obwohl es im täglichen Leben streng unterdrückt wird, im Laufe der Jahrhunderte nach und nach eine unwiderstehliche Macht wird. Vor zweihundert Jahren hatte es einen großen Alchimisten aus dem Hause derer von Galen gegeben. Doch wie dem auch sei, fünfundzwanzig Jahre vor Beginn dieser Geschichte begab es sich, dass Graf Hannibals junge Stiefschwester aus der späten zweiten Ehe seines Vaters, ein hübsches Mädchen, der Liebling und die Hoffnung der Familie, ihr Heim verließ, weglief und einen Mann heiratete, der nicht zu ihrem Lebensbereich gehörte und diesem so unbekannt war, dass man sich wundern musste, wo das Mädchen ihn hatte kennenlernen können.
Für ihre Verwandten und die ganze Welt der großen Namen und Familien war es ein harter Schlag. Sie sagten, ohne Zauberei hätte sich die Natur nicht so widersinnig irren können; sie sahen die Figur des Verführers in kohlschwarzen Farben und entsetzten sich bei dem bloßen Gedanken an ihn. Viel gesprochen wurde von dem Ereignis unter diesen Umständen nicht. Der Bruder der verhexten jungen Dame hätte mit Berufung auf ihre Minderjährigkeit die Ehe für ungültig erklären lassen können und erwog diese Eventualität eine Zeitlang. Doch war er ein Mann der Tatsachen und sagte sich, dass er nicht viel mehr damit ausrichten würde, als seiner Schwester das Herz zu brechen. So machte er sich stattdessen daran, Erkundigungen über seinen zwielichtigen Schwager einzuziehen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen gewissen Vitus Angel handelte, den letzten einer langen Reihe jütländischer Pferdehändler, dessen Vater als gewiegter Pferdekenner ein Vermögen verdient und auf seine alten Tage für sein einziges Kind das Gut Ballegaard gekauft hatte.
Vitus war auf dem Galenschen Schloss gewesen, um dem Schlossherrn ein kostbares Pferd eigener Zucht zu verkaufen, und hatte beim Vorführen des Gauls im Schlosshof einem aus dem Fenster zuschauenden Mädchen seine Reitkunst gezeigt. Die Familie ergab sich in das, was nicht zu ändern war.
Die junge Frau führte ihren Mann und, als Kinder kamen, auch diese in ihren alten Freundeskreis ein, gleichsam in aller Unschuld darauf vertrauend, dass man lieben müsse, was sie lieb hatte, und zu ihrer eigenen Überraschung und gegen ihren Willen gewannen die Freunde den Fremden tatsächlich lieb. Er hatte einen angeborenen Sinn für Boden und Feldfrucht und einen fast unheimlich scharfen Blick für die Tauglichkeit der Zuchttiere. Wie die alten Kinderfrauen und Wildhüter, mit denen die jungen Aristokraten aufgewachsen waren, sprach er den breiten jütländischen Dialekt. Sie fühlten sich wie zurückversetzt hinter das heraldische Zeitalter, dem sie angehörten, und einem Ureinwohner Dänemarks gegenübergestellt, einem Steinzeitmenschen oder Wikinger, ihrer aller mächtigem, namenlosem Ahnherrn. Wahrhaftig besser – so sagte sogar Graf Galen –, als wenn seine Schwester einen geleckten Stadtherrn geheiratet hätte, der nach einem Schirm verlangte, wenn er bei Regen ausgehen sollte. Im Laufe der Zeit reinigte das glückliche Eheleben der hübschen, jungen Gesetzesübertreterin, schließlich auch ihr früher Tod im Kindbett bei Geburt ihres siebenten Kindes ihr Bild von allen Flecken der Vergangenheit. Nach und nach verdämmerte ihr Gedächtnis in silbrig-schwermütigen Farben wie jene Heldin einer alten dänischen Ballade, die sich vom Wassermann verlocken lässt.
Nach dem Tod seiner Frau sah man den Herrn von Ballegaard nur noch selten außerhalb seines Besitzes; es fiel der jüngeren Generation zu, die Versöhnung zwischen der Welt des Vaters und der der Mutter zu vollenden. Sie stiegen hervor aus ihrem Reich der Sümpfe, Kinder des Gottes der Herden und Triften, des Gottes mit der berühmten doppelten Rohrpfeife, darauf er von Tod und Leben singt.
In den Augen der Freunde und Verwandten ihrer Mutter waren das hübsche und artige Kinder, gleichzeitig aber unheimlich, ja furchterregend. Unbestreitbar waren sie legitim, im ehelichen Bett gezeugt, doch war die Zweideutigkeit ihrer Geburt vielleicht fataler als gewöhnliche Bankertschaft. Sie bewegten sich in der Gesellschaft wie frische, kerngesunde Träger eines gefährlichen sozialen Bazillus, der ihre zarteren, gefährdeteren reinbürtigen Spielgefährten bedrohte. Unter den alten Onkeln und Tanten war niemand, der ihnen nicht Gutes gewünscht hätte; aber gehörte es sich, war es moralisch, dies zu tun? Wenn’s diesen jungen Leuten wohl erginge auf Erden, so wäre das ein Verstoß wider das Gesetz von den Sünden der Väter, und wankte dann nicht auch die Regel vom Verdienst der Urväter? Noch auf der geradesten und festesten aller Lebensbahnen schien diesen leicht beschwingten Wesen ein Rest vom Marschland der Gesetzlosigkeit an den Sohlen zu haften.
Die besondere Blutmischung hatte sich als besonders erbbeständig erwiesen. Unter den Geschwistern von Ballegaard bestand eine fast ergreifende Ähnlichkeit, mehr des Wesens als der Formen – nicht eine homogene Anhäufung homogener Atome, die Ähnlichkeit der Eichel mit dem Eichenblatt und der eichenen Truhe. Zwei oder drei deutliche, ungewöhnliche Merkmale waren der ganzen Sippe eigen. Eins davon war die große, ungestüme Lebensfreude – das, was man in Frankreich la joie de vivre nennt. Alles, was zum täglichen menschlichen Leben gehört – Atemholen, Erwachen oder Einschlafen, Laufen, Tanzen, Pfeifen, Essen, Wein, Tiere und bis herab zu den vier Elementen –, erfüllte sie mit einem Entzücken, ähnlich dem einer jungen Kreatur, der Wonne eines Fohlens, das man auf der Koppel loslässt. Sie zählten einen Flug Gänse gegen die Sonne, die Stunden bis zu einem bevorstehenden Ball oder am Spieltisch die letzten Geldstücke mit derselben Inbrunst und vergaßen sich über der traurigen Liebesgeschichte eines Freundes oder beim Zusammensetzen einer Angelrute mit dem Kraftaufwand eines Menschen, der sich ins Meer wirft. Sie waren geborene Feinschmecker, kauten jedoch mit dem gleichen Genuss auch das trockene Schwarzbrot, das sie in der Tasche bei sich trugen, um die Pferde zu füttern. Sie waren ruhig und gesetzt und nichts weniger als ichbezogen, und doch strahlte eine nachgerade lärmende Zufriedenheit von ihnen aus, und ihr Stolz, dass sie auf der Welt waren, hatte fast schon etwas Prahlerisches. Von einer verborgenen Energiequelle des Lebens gespeist, inspirierten sie ihrerseits ihre Umgebung und waren deswegen bei der gleichaltrigen Jugend beliebt – die Kinder der Rechtmäßigkeit verliebten sich in die Kinder der Liebe. Die stumpferen ihrer adligen Freunde ließen sich mit Vergnügen bestätigen, dass es ein Vorrecht sei zu existieren, und sie hatten es nötig, sich diese Überzeugung von Zeit zu Zeit aufpolieren zu lassen; schon deswegen konnten sie ihre tollen jungen Verwandten aus dem Norden nicht lange entbehren. Als man kurz vor Beginn dieser Geschichte den Kopenhagener Jockey-Club als Refugium für die bevorzugteste Schicht gründete, wurde zunächst festgesetzt, es dürften nur junge Leute von reinstem Adel zugelassen werden. Sowie sich aber herausstellte, dass diese Bedingung die Brüder von Ballegaard ausschließen würde, änderte das Komitee den Paragrafen. Viele Jahre nach dem Ende unserer Erzählung bestätigte ein kahlköpfiger alter Herr, der wegen seiner Liebe zu der zweitältesten Tochter, Drude, fünfzig Jahre lang Junggeselle auf seinem schönen, großen Schloss geblieben war, einem jungen Mädchen aus der Familie, Drudes Patenkind: »Als es keine Angels von Ballegaard mehr unter uns gab, lohnte es nicht mehr, an den großen Treibjagden im Herbst, an den Jagden und Jagdbällen oder an den Weihnachtsgesellschaften auf den Schlössern teilzunehmen.« Möglich, dass die jungen Angels ihre Frohnatur ihrer nahezu vollkommenen körperlichen Beschaffenheit verdankten. Jedes Organ ihres Körpers war makellos, in ganz Dänemark gab es wohl wenig solcher Herzen und Lungen, solcher Lebern und gesunden Eingeweide. Ihre fünf Sinne waren scharf wie die von wilden Tieren. Sie waren glänzende Tänzer, Jäger und Fischer, und von ihren Vätern, den Pferdehändlern, hatten sie ein besonderes Verhältnis zu Pferden geerbt, sodass sie hoch zu Ross auch Leuten ohne klassische Bildung die Vorstellung von Zentauren vermittelten. Gegen Wind und Wetter waren sie unempfindlich, konnten eine Woche lang ohne Schlaf auskommen, tranken wie die Stiere und schliefen danach alles aus wie ein Bär im Winter, um am Morgen frisch, mit reinem Atem, aufzuwachen.
Sie sahen auch glänzend aus, der älteste Bruder war von geradezu exemplarischer Wohlgestalt und zwei Schwestern anerkannte Schönheiten. Die Mädchen waren alle etwas über Mittelgröße, die Jungen nicht groß, aber ungewöhnlich ebenmäßig gewachsen. Alle hatten sie lange Hände und Augenwimpern, kurze Füße und Zähne, weit auseinanderstehende Brauen und schmale Hüften, und alle bewegten sie sich leicht, gleichsam luftig. Ihre Augenlider lagen lose auf, sodass sich über den obersten Teil der Iris ein Schatten breitete, was ihrem Blick eine besondere Leuchtkraft und Tiefe gab, wie man sie bei jungen Löwen findet, im Gegensatz zum Blick der Ziegen, Schafe und Hasen, bei denen sich das Lid straff über den Augapfel spannt. Fünf Jahre vor dieser Geschichte, als die junge Prinzessin Dagmar nach Russland fuhr, um den Zarewitsch Alexander zu heiraten, wurde der älteste Angel, der bei der Garde stand, zu ihrer Begleitung kommandiert; eine so ungewöhnliche Ernennung – denn der Erwählte hatte weder Namen, Rang noch Vermögen – musste seinem guten Aussehen zugeschrieben werden, als ob die dänische Nation, nachdem sie ein Muster ihrer bezauberndsten Weiblichkeit geschickt hatte, nun wünschte, dem mächtigen Nachbarn und Alliierten auch noch zu zeigen, was sie an jungen Männern Prächtiges hervorgebracht hatte. Die russischen Gardeoffiziere hatten die Anweisung bekommen, ihren Gast gut zu unterhalten, und der junge Angel kehrte wie aus einem Traum nach Kopenhagen zurück. In Wirklichkeit hätte er sich auch aus eigener Fantasie ohne Mühe eine solche Traumwelt von Bärenjagden, Champagner, Zigeunermusik und Zigeunermädchen erschaffen können. Nun aber, da er sie herrlich und greifbar um sich gesehen hatte, war er nicht imstande, sich von ihr loszureißen. So bewegte er sich, immer noch schön wie ein Engel, in der Kopenhagener Gesellschaft, in den Augen der einen wie ein Tannhäuser aus dem Venusberg von Sankt Petersburg, für die anderen war er der Münchhausen aus den sibirischen Steppen. Zur Zeit dieser Geschichte befand er sich nicht in Dänemark, sondern auf der Reitschule von St. Cyr.
Der letzte Charakterzug der Geschwisterschar von Ballegaard bestand darin, dass das Los über sie geworfen, dass jeder von ihnen von vornherein dem Untergang geweiht war. Stirbt ein Mensch jung, dann geschieht es wohl, dass seine Freunde seltsam bewegt bei sich sagen: »Das haben wir gewusst.« Und in den meisten solchen Fällen wird das über das junge Haupt gefällte Todesurteil, weit davon entfernt, als Dornenkrone oder von der Welt trennende Schranke zu erscheinen, vielmehr wie ein matter Regenbogenschimmer leuchten, wie eine Gloriole oder als Kainszeichen eines besonders engen Pakts mit allem Lebendigen und dem Leben selbst. Auf solche Weise umgab das kommende Unheil die jungen Angels wie ein sanftes, kühnes Strahlen. Wohlwollend und freundschaftlich kamen ihnen die Menschen entgegen. Nur niedrige, rohe Naturen missgönnten ihnen ihre jugendlichen Erfolge; es war, als hätte ihre Umgebung sich gesagt: »Es dauert ja nicht lang.« Später, als die Ahnung bei allen Brüdern und Schwestern in Erfüllung gegangen war, erinnerten sich die Freunde mit Staunen und Trauer an ihr Vorgefühl. Die ältere Generation, der gleich Böses geschwant und die das Unheilschwangere in der Atmosphäre um die jungen Leute gespürt hatte, sah sich in ihrem Argwohn bestätigt: Die Göttin Nemesis war sichtbar hervorgetreten – ein verstörender Anblick.
Ein alter Maler und Bildhauer, der in allen Ländern Europas Welt und Menschen beobachtet hatte, kam eines Tages nach Ballegaard, um Vögel zu studieren, und wurde bei dieser Gelegenheit mit den Geschwistern, die damals noch nicht erwachsen waren, bekannt gemacht. Er sah sie an, verfiel in tiefe Nachdenklichkeit und bemerkte wie zu sich selbst: »Dieses hübsche Jungvolk von Ballegaard wird im Laufe seines Lebens unsere meisten Gesetze und Gebote übertreten. Nur einem Gesetz werden sie unweigerlich treu sein – dem Gesetz der Tragödie. Das ist ihnen allen ins Herz geschrieben.«
Eine letzte kleine Familieneigentümlichkeit soll hier erwähnt werden: Sie träumten alle lebhaft und schön. Kaum waren sie in ihren Betten eingeschlafen, so tauchten aus ihrem Innern gewaltige Landschaften, weite, tiefe Meere, seltsame Tiere und Menschen auf. Sie waren zu gut erzogen, Fremden von ihren Träumen zu erzählen, aber unter sich beschrieben und besprachen sie sie. Die älteste Schwester, die größte unter ihnen und die beste Reiterin, sagte gegen Ende ihres Lebens zu ihren Kindern: »Wenn ich tot bin, könnt ihr auf meinen Grabstein schreiben: ›Sie hatte viele harte Tage, aber ihre Nächte waren herrlich.‹«
Doch der Geschichtenerzähler will nicht vorgreifen. Zur Zeit dieser besonderen Kopenhagener Saison war noch auf keines der jungen Geschwister der Schicksalsschatten gefallen. Nur die älteste Schwester saß weit weg auf einem großen Gut im Westen, in einer seltsamen Ehe mit einem reichen Mann, der mehr als doppelt so alt war wie sie. Die jüngsten Kinder spielten noch Verstecken auf den Treppen und Hausböden von Ballegaard. Der zweite Bruder, Ib, der damals dreiundzwanzig war, und Drude, die zweitälteste Tochter, deren zwanzigster Geburtstag auf den Tag des Äquinoktiums fiel, schwärmten auf den Tanzböden von Kopenhagen.
Graf Hannibal, der gern eine große eigene Familie um sich gesehen hätte, war freundlich zu den Kindern seiner Schwester gewesen; sie durften sich in seinem Schloss ebenso daheim fühlen wie in ihrem eigenen Hause. Ib, der, als seine Mutter starb, zwölf Jahre gewesen war und den Verlust sehr schwer genommen hatte, wurde mit seinem Vetter Leopold zusammen erzogen. Gräfin Louise hatte zuerst Bedenken gegen diese Intimität gehabt, denn sie hielt sehr auf Ebenbürtigkeit des Umgangs. Gleichzeitig war sie jedoch eine leidenschaftliche Mutter, und da Leopold sich über alles wünschte, Ib zu seinem ständigen Gefährten seiner Studien und Vergnügungen zu haben, Adelaide nicht ohne Drude leben konnte und sie außerdem sah, wie vorteilhaft Drudes lichte Anmut mit Adelaides dunkler Schönheit kontrastierte, gab sie nach.
Und langsam nahm sie ihre Nichte und ihren Neffen gütig in ihr eigenes Familienleben auf. Fremden erzählte sie lächelnd, die jungen Leute seien wie Geschwister; ihren Kindern gegenüber nahm ihre Güte gegen die orphelins de mère4oft einen ernsteren Ton an, und vor allem zu Leopold, der seiner Mutter ergeben war und ihr sehr ähnelte, sprach sie mit Bedauern von der zweifelhaften Stellung der jungen Angels in der Gesellschaft und den betrüblichen Folgen der Mesalliancen im Allgemeinen.
Die Saison über wohnte Drude, sozusagen offiziell, im Rosenvaenget-Viertel bei ihrer alten Tante Nathalie, einer früheren Hofdame der Prinzessin Mariane. Doch beschwor Adelaide ihre Freundin immer wieder, bei ihr im Galenschen Palais zu übernachten, damit sie sie vor einem Ball wegen ihres Kleides und ihres Haarschmucks beraten könne. Da musste dann die Kammerzofe auch Drudes goldblonde Locken auf neue, überraschende Art frisieren, oder die Kusinen tauschten nach dem Ball, während sie ihr Haar bürsteten, ihre Geheimnisse aus und machten sich über ihre Anbeter und Rivalinnen gemeinsam lustig. Die beiden Mädchen galten allgemein als die Schönheiten der Saison; und die beiden Vettern waren so eng befreundet, dass die Witzbolde des Kreises ihnen einen Namen gegeben und so eine mythische Gestalt geschaffen hatten, die Eleganz und Weitläufigkeit mit einer freien, wildwachsenden Genialität in eins verflocht. Auf den Wogen des Kopenhagener Gesellschaftslebens glitten die vier jungen Menschen so von einem Wellenkamm zum andern, von allen beobachtet, im glücklichsten Einverständnis miteinander.
Doch Ib war nicht glücklich; die unselige Liebe zu seiner Kusine Adelaide fraß ihm am Herzen. Er wunderte sich oft darüber, wie es zugehen mochte, dass ein Mensch mit dem Dolch im Herzen dennoch täglich zwanzig Mal neu erdolcht werden konnte. Wie war es möglich, fragte er sich, dass ein stets gegenwärtiges Bild es dennoch vermochte, immer wieder neu und überwältigend in Erscheinung zu treten, dunkeläugig, mit weißen Zähnen, schrecklich siegesgewiss wie ein fahnenschwingendes Kriegsheer?
Adelaide war völlig unerreichbar, hoffnungslos unerreichbar für ihn. Die Gesellschaft brauchte ihm das nicht erst zu bestätigen; er hatte es sich selbst längst klargemacht. Vom Bilderstürmer war nichts in seiner Natur. Sich Adelaide in einer geringeren Umgebung zu denken als in der, in die sie hineingeboren war, empörte ihn, stieß ihn ab. Welch Entsetzen nun gar, sich vorzustellen, dass solche Sünde wider die Natur von ihm selbst verursacht werden sollte. Er hatte Adelaide mit ihren Freundinnen über ihren Stickrahmen davon reden hören, wie es wohl wäre, wenn man einen Bürgerlichen heiratete, und dass das Allerbetrüblichste dabei sein müsse, über dem Monogramm im Taschentuch keine Krone mehr zu haben. Er hatte nicht widersprochen; in der Tiefe seines Herzens hatte er ihr recht gegeben. Zu Adelaides Bildnis, vom dunklen, blumengeschmückten Haar bis zum zierlichen Fuß im Seidenschuh, gehörte auch das kronenbestickte Taschentuch zwischen ihren schlanken Fingern.
Da für alle aus diesem Stamm Seele und Leib in eins flossen, verzehrte die Sehnsucht nach ihr seinen jungen Leib. Mit seinem Blut war er Adelaide verfallen; seine Glieder und Eingeweide gehörten ihr; seine Augen, seine Lippen, sein Gaumen, seine Zunge brannten von ihr wie von einem Fieber. Und doch enthielt sein Dasein dann wieder unsagbar selige Stunden: Sie wandte ihm den halb geschlossenen, lächelnden Blick zu; sie ließ sich von ihm den Handschuh zuknöpfen; und eines Nachmittags, nachdem sie erklärt hatte, die ganze Welt sei sterbenslangweilig, legte sie einen Augenblick ihr Gesicht gähnend an seine Schulter.
Schließlich, vergangenen Herbst, hatte er eine Woche Urlaub genommen und war heim nach Ballegaard gefahren. Er hatte bei seinem Vater gesessen, wirkliche, handgreifliche Angelegenheiten mit ihm besprochen und Bekannte aus seiner Kindheit besucht, die sich an seine Mutter erinnern konnten und ihm erzählten, wie schwer es einen ankam, sie betrübt oder enttäuscht zu sehen. Er war zu ihrem Grab hinausgegangen. Und hier in Ballegaard war es auch, dass er spät an einem regnerischen, windigen Abend, als er mit seinem alten Hund, der wild vor Freude war, ihn wiederzuhaben, über die Felder ging, einen Einfall hatte. Er wollte das Land verlassen und in die französische Armee eintreten, die wohl bald gegen Deutschland ins Feld ziehen würde. Der Plan erwies sich als brauchbarer, als er erwartet hatte, und das empfand er als den ersten Glücksfall seit Langem. Als er jedoch beim Kriegsministerium um Urlaub einkam, wurde sein Ansuchen abgelehnt. In der gegenwärtigen Lage musste die dänische Regierung strengste Neutralität beobachten, auch wenn diese Haltung dem Wunsch des dänischen Volkes widersprach. Der Eintritt eines dänischen Offiziers in die französische Armee im Augenblick, wo ein französisch-preußischer Krieg vor der Tür stand, würde von den Preußen als Neutralitätsbruch aufgefasst werden und könnte schlimme Folgen haben.
Ein süßes Gift der Versuchung beherrschte einen Tag lang Ibs Sinnen und Trachten. Er hatte sein Möglichstes getan, er konnte daheim bleiben und Adelaide sehen wie bisher. Doch am Abend schon schrie es in ihm: »Weiche von mir!« Ib Angel sollte nicht zur Molluske werden. Und noch weniger sollte sie, seine unschuldige Adelaide, ins Licht einer Kalypso geraten. Nicht umsonst hatte er in Ballegaard seinen Entschluss gefasst. Er würde seinen Abschied als Offizier der dänischen Armee einreichen, dann war er frei und konnte gehen, wohin es ihm beliebte.
Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass er nicht wieder nach Dänemark zurückkehren könnte. Das spielte keine Rolle für ihn; es war nicht seine Absicht zurückzukehren. So traf er seine Vorbereitungen, wobei er auf wunderliche Weise Vergangenes und Zukünftiges zugleich im Auge behielt.
Um die Wartezeit auszufüllen, nahm er eine ihm bisher unbekannte Gewohnheit an. Er machte Besuche und erschien regelmäßig am jour fixe5der tonangebenden Damen Kopenhagens. Er allein wusste, dass es sich um Visiten pour prendre congé6handelte, die er aus einer gewissen Dankbarkeit abstattete oder auch aus einer Art schlechtem Gewissen, weil er im Begriff war, an seinem Kopenhagener Leben Verrat zu üben. Alte Gastgeberinnen, die Augen für das Strahlende seiner Erscheinung hatten und denen er bisher als wilder junger Mensch beschrieben worden war, lächelten freundlich zu seiner gesellschaftlichen Bekehrung und verheirateten ihn in Gedanken schon mit dieser und jener Großnichte aus einem großen Schwesternkreis. Die lustigen jungen Freunde verfolgten sein Benehmen mit gutmütigem Spott und glaubten, er sei auf der Jagd nach einer reichen Erbin.
Auf dieser seiner mondänen Pilgerfahrt erlernte Ib die Kunst, seinen Säbel und seine Mütze mit den weißen Handschuhen darin zugleich mit einer Tasse Tee zu balancieren, und er wirkte ganz wie ein gutmütiges Geschöpf der Wildnis mit großen, weichen Tatzen, das geduldig und gewissenhaft seine Zirkuskunststücke absolviert. In den Salons begegnete er gelegentlich Adelaide, von ihrer schönen, Respekt einflößenden Mutter chaperoniert7, und hörte durch das allgemeine Gespräch hindurch ihr Lachen und ihre süße, gedämpfte, klare Stimme. Das war gleichzeitig Glück und Qual, doch war es mehr Glück als Qual, sonst hätte er seine Visiten aufgeben müssen. Auf eine unbestimmte Weise tat es ihm wohl zu sehen, dass andere Menschen ihr Gesicht und ihre Gestalt genauso leibhaftig in sich aufnehmen konnten wie er; so konnte er doch für kurze Zeit sicher sein, dass er nicht närrisch war. Auf dem Weg zu oder von seinen gesellschaftlichen Verrichtungen begegnete sie ihm manchmal in ihres Vaters Kutsche, mit Drude an ihrer Seite, wenn sie unterwegs war, um den mystischen Ritus des Kartenabgebens zu vollziehen, eine Ehrenerweisung, die ein vornehmes Haus dem andern darbrachte, ausschließlich vermittels zweispänniger Wagen, mit Kutscher und Diener, während sich die jungen Töchter des Hauses sozusagen unsichtbar beteiligten, ohne je den Fuß aus dem Wagen zu setzen. Manchmal lächelte Adelaide ihm dann geheimnisvoll zu oder schenkte ihm sogar eine verstohlene kleine Kusshand, wahrhaft verstohlen, denn sie blieb unsichtbar.
Bei den Empfängen beobachtete er sie im Gedränge ihrer Anbeter, doch die störten ihn nicht. In seiner Liebe zu ihr war eine Art Würde, die alle Eifersucht ausschloss. Er wusste, seine Leidenschaft war von anderer Art als die jedes anderen Mannes.
Gegen Ende der Saison sah sich Ib unerwartet als Helden des Tages. Nach einer lustigen Nacht hatte er am Morgen mit dem schwedisch-norwegischen Militärattaché ein Säbelduell ausgefochten, und auf beiden Seiten war Blut geflossen, wenn auch nur in bescheidener Menge. Das Duellieren war verboten, und er erhielt eine Woche Kasernenarrest. Sich eine Weile von der Welt zurückzuziehen, behagte ihm; er war nicht stolz auf seine Tat, denn weder er selbst noch Leopold, der ihm sekundiert hatte, noch auch sein Gegner erinnerten sich deutlich an den Anlass des Streites. Als er wieder in der Kopenhagener Gesellschaft auftauchte, bemerkte er, dass man dort von den Hauptpersonen keine Aufklärung hatte erhalten können und allerhand aufregende Geschichten in Umlauf gesetzt worden waren; das pfiffige Lächeln, mit dem er antwortete, machte die Lage nur noch spannender.
Eine der großen alten Damen hatte ihren Empfangstag am Freitag. Auf dem rechteckigen Platz vor ihrem Palais hielt eine lange Reihe glänzender Equipagen. Eine nach der andern fuhr bis zum Portal, wendete dann in dem Hof und fuhr wieder hinaus, um der nächsten in der Reihe Platz zu machen. Trotz des scharfen Lüftchens, das Papierfetzen und Strohhalme vor sich her durch die Straßen blies, lag Frühling in der Luft. Der Himmel war blassblau mit leichten, weißen Wolken, und wenn die Damen die Wagen verlassen hatten, blinzelten die sonst so unbeweglichen Kutscher nachdenklich zu ihm auf. Das große, luftige Vestibül des Palais war warm, an den breiten Treppen zu den Empfangsräumen standen Oleanderbäume in Kübeln, und es war Räucherwerk verbrannt worden – eine Spezialität des Hauses, welche die noch nach vielen Jahren die Treppe auf- und abschreitenden Gäste an ein verschollenes Arkadien gemahnte. Heute war die Treppe selbst zum Empfangsraum geworden; sie hallte wider von Begrüßungen, vom Rascheln seid’ner Kleider und von gelegentlichem Sporenklirren.
Das damalige Gesellschaftsleben unterschied sich von dem späterer Zeiten dadurch, dass sich alle Generationen trafen. Blühende Mädchen mit lebhaften Augen steuerten wie junge Schwäne im Kielwasser ihrer gewichtigeren Schwanenmütter; weißhaarige oder kahlköpfige Herren küssten jungen Frauen die Hand und umgurrten die Debütantinnen. Sehr alte Damen, mit den Jahren klein und leicht wie Puppen geworden, entfalteten ihren Charme und Witz vor schüchternen Jünglingen oder ehrgeizigen jungen Männern, die das Märchen noch nicht vergessen hatten, wo der Held, dem ein einziger Wunsch freigegeben ist, sich die Freundschaft aller alten Frauen wünscht. Die großen Altersunterschiede in der Versammlung machten die Einförmigkeit von Stand und Ideen wett.
Ib kam mit seinem Vetter Leopold die Treppe herauf. Ehe sie das Haus betraten, hatten sie über eine Abendgesellschaft gesprochen, die Ibs Regiment zu Ehren einer schönen französischen Sängerin geben wollte, wenn sie auf ihrer Tournee nach Kopenhagen käme. Das Frühlingswetter hatte Ibs Herz plötzlich mit leisem Schmerz ergriffen. Er sah, die blauen Baumschatten auf dem Pflaster waren anders geworden; die Knospen schwollen und ließen das feine Netzwerk der Schatten voller erscheinen. Draußen auf dem Lande, dachte er, wurde der Huflattich an den Straßenrändern jetzt gelb; die Felder, hellbraun in der lichten Luft, wurden geeggt, und wenn man vorbeiritt, flog einem die lange Staubwolke hinter der Egge, scharf und kalt, mit Stäubchen trockenen Düngers vermengt, gegen Augen und Mund. Auch die Lerche war zu hören. Sein Interesse an dem Souper für die Sängerin erlosch, und er verstummte.
Auf dem Treppenabsatz wurden die jungen Leute einen Augenblick durch eine reife Schönheit aufgehalten, die sich vor dem Spiegel drehte und, während sie ihre Spitzen in Ordnung brachte, zu sich selbst sagte: »Diese Spiegel sind auch nicht mehr so gut wie früher«, woraufhin sie durch die Flügeltür segelte.
Im ersten Salon hatte sich eine kleine Gruppe um die Frau des für die Ferien heimgekehrten dänischen Gesandten in Paris geschart und erörterte die Möglichkeit eines französisch-deutschen Krieges.
»Aber kann man denn sicher wissen, was Italien vorhat?«, fragte ein alter Kammerherr die Gesandtin.
Die lachte, sozusagen auf Französisch. »Lieber Freund!«, rief sie aus, »welche Frage? Graf Nigra gehört zu den glühendsten Anbetern der Kaiserin.«
Im letzten, dem roten Salon wurde die Gastgeberin, während sie sich am Kamin neben dem Samowar mit einem älteren Prinzen des Königshauses unterhielt, auf Ib aufmerksam und beorderte ihn überraschenderweise mit einem kurzen, scharfen Blick an ihre Seite. Dort brachte sie ihn zu späterer Verwendung hinter einer Teetasse unter.
In der Fensternische hatten sich etliche Damen um einen schmächtigen Herrn geschart, einen Maler von europäischem Ruf. Er hatte dereinst erklärt, alle künstlerische Größe sei nur ein höherer Grad der Liebenswürdigkeit, eine Theorie, die auf seine eigene Kunst wohl zutreffen mochte, denn die war ausschließlich von dem Entzücken inspiriert, das Schöne der sichtbaren Welt einzusaugen und wieder von sich zu geben. Da es unangemessen schien, dass eine so hervorragende Persönlichkeit ein kleines, rosiges, völlig haarloses Vollmondgesicht besitzen sollte ohne einen markanten oder besonderen Ausdruck, am ehesten einem Kinderpopo zu vergleichen, hatten seine ihn hoch verehrenden Schüler an der Kunstakademie die Theorie aufgestellt, dass in seiner Anatomie etwas vertauscht worden sei und er an einer anderen Stelle ein besonders lebhaftes und ausdrucksvolles Gesicht habe. In der Gesellschaft war er hoch gefeiert, jedoch auch gefürchtet, weil er manchmal wortlos dasitzen und Gesicht und Gestalt einer Frau in sich aufnehmen konnte, bis sie schließlich das Gefühl hatte, nackt ausgezogen zu sein. Bei anderen Gelegenheiten wieder, wenn ihn ein Thema interessierte, war er nicht mehr zum Schweigen zu bringen.
Im Augenblick diskutierte man in der Gruppe den Begriff des Fortschritts. Die Entwicklungslehre lag in der Luft, Professor Darwin hatte ganz England zum Vibrieren gebracht, und diese Erregung der Atmosphäre hatte sich über die Nordsee fortgesetzt. Den dänischen Adel beunruhigte und schockierte Darwins Lehre, jene Behauptung, dass die Vorfahren nicht besser gewesen seien als man selbst, wenn auch andererseits die Feststellung etwas Gewinnendes hatte, wonach hoher Rang in der Schöpfung an sich schon ein Beweis für die wahre Zugehörigkeit zu diesem Rang sei.
»Ich bin ganz Ihrer Meinung, liebste Eulalia«, sagte der Professor. Er sprach, wie immer, sehr langsam, leicht krächzend und mit vielen kleinen Grimassen, die den fehlenden Gesichtsausdruck ersetzen sollten. »Es geht vorwärts in der Welt, mit uns allen geht es vorwärts, und in hundert Jahren werden wir dem Zustand der Vollkommenheit näher sein als heute. Und doch, sage ich Ihnen, werden mitten in unserem siegreichen Vormarsch gewisse kleine Züge in unserer Natur, sozusagen von selbst, den Höhepunkt ihrer Vollendung erreichen, um alsbald abgeworfen zu werden, zu verfallen und dann für immer zu verschwinden. Ich will Ihnen den Teil von uns nennen, der jetzt, in diesem Augenblick, seinen Zenit erreicht hat und im Begriff steht, rudimentär zu werden. Wir werden in Zukunft Zeugen wunderbarer wissenschaftlicher und sozialer Fortschritte werden, aber nie wieder werden unsere Augen Nasen sehen wie die, die wir heute um uns erblicken. Nicht eine ist darunter, die nicht fünfhundert Jahre zu ihrer Entwicklung gebraucht hätte. Hier, in diesem Salon, können Sie sich davon überzeugen, dass die Nase wahrhaftig die Pointe der gesamten menschlichen Persönlichkeit ist und dass die eigentliche Aufgabe unserer Beine, Lungen und Herzen darin besteht, unsere Nasen durch die Welt zu tragen.«
Hier lachte eine hübsche Dame des Kreises kurz auf mit einem Blick auf das winzige Näschen des Redners, hielt dann verlegen inne und führte ihr Taschentuch vor den Mund.
»Wir haben hier«, fuhr der Professor unbekümmert fort, »Antilopen- und Gazellenmäuler, Panther- und Fuchsschnauzen. Und was erst die Schnäbel angeht, meine Liebe, die Schnäbel! Adlerschnäbel und Papageienschnäbel, kräftige, kleine Eulenschnäbel, kaum zu sehen unter den weichen Hängebacken, Pelikanschnäbel mit fürsorglichen Kröpfen darunter und lange Schnäbel freundlicher, schwatzhafter Bekassinen. Betrachten Sie doch einmal die Nase unserer hochverehrten Gastgeberin. In ganz Kopenhagen gibt es keine feinere, raffiniertere. Mit der Genauigkeit eines Seismografen nimmt sie alles auf, was in ihre Riechweite kommt. Gleichzeitig ist sie so stark wie der Rüssel eines Elefanten, der im Dschungel die schwersten Baumstämme trägt. Sie hat Myladys purpurfarbenen Samtbusen bis unters Kinn emporgehievt und hält ihn dort fest. Nach Gefallen kann sie den Obskursten unter uns in das strahlende Rampenlicht des gesellschaftlichen Lebens heben oder auch, Gott behüte, falls ihr unser persönlicher Geruch missfällt, jeden unter uns von diesem blanken Parkett auflesen und mit einem Schwung in den tiefsten Abgrund sozialer Finsternis befördern. Und bleibt bei alledem«, schloss er, »vornehm – unbewegt.«
»Aber sollen wir denn wirklich«, fragte da eine füllige Dame in prachtvollem Taftkleid, »unsere guten Nasen verlieren wie Blätter im Herbst? Ich habe das Gefühl, meine sitzt noch recht fest.« Nachdenklich berührte sie ihre Nase mit einem kurzen, dicken Finger.
»So mag es scheinen«, antwortete der Alte. »Aber eine Nase verliert sich leicht, und ich habe die Policinelli aller Zeiten auf meiner Seite. Von welch anderem Teil der menschlichen Anatomie gilt in diesem Grade, dass man sich von ihm unabhängig machen kann?«
»Bester Meister«, sagte eine magere Dame in Grau, »Sie haben mir da ein unbehagliches Gefühl eingejagt, als ob wir in der Morgendämmerung der Zivilisation gleichsam als eine Art Werwölfe herumliefen mit fleischfressenden Nasen aus dunkler Vorzeit. Ihre Charakteristik unserer Nasen war nicht eben schmeichelhaft.«
»Sie war aber so gemeint«, antwortete der alte Künstler niedergeschlagen. »Es fällt mir nur schwer, mich auszudrücken, wie Sie alle wissen. Hätte ich meinen Pinsel hier, würde ich Ihre geschätzten Nasenspitzen der Reihe nach umreißen und mich im Nu verständlich machen. Doch lassen Sie mich, so gut ich eben kann, erklären, dass die fünf Sinne, unter denen der Geruchssinn doch gewiss einen hohen Rang einnimmt, das savoir vivre8der wilden Tiere und der primitiven Völker vorstellen. Indem nun, im Laufe des Fortschritts, diese unschuldigen Geschöpfe mit ein wenig Sicherheit und Bequemlichkeit gesegnet werden sowie mit etwas Erziehung, wird sich durchs Leben zu riechen unwichtiger, die Nasen verkommen, werden stumpf, und damit verschwinden die guten Manieren. Unsere Haustiere, die im Dienste des kulturellen Fortschritts verbraucht werden, und für die wir sorgen und sogar eine Art Erziehung aufbringen, unsere Haustiere haben ihre scharfen Sinne verloren, und unsere Schweineställe und Entenverschläge sind keine Stätten guter Manieren. Der Mittelstand in unserer Zivilisation hat Sicherheit und eine gewisse Erziehung erlangt, und wo, meine Lieben, sind dabei die Nasen geblieben? Schon das Wort ›Geruch‹ klingt für diese Leute ungehörig. Erst auf Ihrem hohen sozialen Niveau, meine Herrschaften, findet man wieder die scharfen Sinne und das alte savoir vivre. Denn was ist das Ziel aller höheren Erziehung? Rückkehr zur Naivität. Daher steht auch keines unserer Haustiere den Tieren der Wildnis so nahe wie das höchstgezüchtete und am besten dressierte, der Vollblüter, unsere Luxusausgabe des Pferdes. Sehen Sie da drüben«, fuhr er fort, »die Blondine im olivgrünen Samtkleid mit dem fast leuchtenden Haar, die mit Graf Leopold spricht. Ihre Knie und Schenkel, der kühne Schwung ihres Rückens, all das ist freier, ehrlicher Ausdruck ihres Wesens. Aber ist nicht die Nase die eigentliche Pointe? Lebendig, pikant, mit einem hübschen kleinen Stups und fast kreisrunden Nasenlöchern – so kann man sie direkt auf das kühne und rasseechte Profil der Araberstute zurückführen. Sie wird ihren Reiter nie im Stich lassen. Doch wird man lang suchen müssen, bis man einen Reiter findet, der ihrer würdig ist.«
»Es ist Drude Angel«, sagte eine Dame mit einem Toupet. »Eine Kusine von Leopold und Adelaide. Man hat in dieser Saison viel darüber gestritten, wer besser aussieht, sie oder Adelaide. Sie ist eins von den Angel-Kindern, denen Sie einmal in Ballegaard eine tragische Zukunft prophezeit haben.«
Der Professor blickte bei diesen Worten das junge Mädchen lange und tief an und sagte kein Wort weiter.
»Graf Leopold«, bemerkte die füllige Dame, ihre Lorgnette aufnehmend, »scheint bei dem Wettstreit auf seine Kusine zu setzen.«
»Apropos tragisch«, sagte eine Dame, der vom Diener gerade eine frische Tasse Tee serviert wurde. Sie war etwas schwerhörig und klammerte sich wie viele Schwerhörige an ein im Gespräch gefallenes Wort, an das die andern schon nicht mehr dachten. »Wer von uns entgeht schon dem Tragischen? Eben vorhin, als ich in den Wagen stieg, um hierherzufahren, brachte man mir ein Telegramm, dass meine arme Nichte auf Lolland ihre neunte Tochter bekommen hat. Im Theater sind die Tragödien lange nicht so aufreibend wie im wirklichen Leben. Für meine arme Anna – Sie kennen ja alle ihren Mann – bedeutet das, dass für sie nun der zehnte Akt beginnt.«
»Aber Charlotte«, sagte die magere Dame verweisend, »du kannst doch nicht übersehen, dass die Tragödie die Folge des ersten Sündenfalls ist und deshalb nicht wohl vermieden werden kann. Unsere Enkelkinder werden wohl mancherlei erreichen, aber der Tragödie des menschlichen Lebens auszuweichen, werden sie so wenig Hoffnung haben wie wir.«
»Leider nein«, sagte die Schwerhörige.
»Leider doch!«, sagte der Professor. »Das Tragische kann man leicht aus dem Leben verbannen, fast so leicht wie die Nase. Wenn ich die Augen zumache«, fuhr er fort, und er schloss tatsächlich seine kleinen, wimperlosen Augen, »sehe ich in hundert Jahren eine Gesellschaft wie unsere vor mir, bestehend aus Ihren Urenkeln. Es werden sehr nette Leute sein, mit Recht stolz darauf, es in der Wissenschaft und im sozialen Leben sehr weit gebracht zu haben, und ihre Nasen ausgenommen, werden sie sehr hübsch anzusehen sein. Sie werden zum Mond fliegen können, doch keiner von ihnen wird imstande sein, eine Tragödie zu schreiben, und ginge es um sein Leben. Denn die Tragödie«, fuhr er fort, »ist weit davon entfernt, die Folge des Sündenfalls zu sein, im Gegenteil, sie ist die Abwehr, zu der sich der Mensch gegen die niederträchtigen, hässlichen Folgen des Sündenfalls entschlossen hat. Plötzlich aus seiner Himmelsfreude in Notdurft und Routine gestürzt, hat er in einer erhabenen Anstrengung seines Menschentums die Tragödie geschaffen. Das war eine freudige Überraschung für den Herrgott. ›Diese Kreatur‹, rief er aus, ›war es wirklich wert, erschaffen zu werden. Ich habe gut daran getan, den Menschen zu erschaffen, denn er macht mir Dinge, die ich ohne ihn nicht fertiggebracht hätte.‹«
»Ja, du liebes bisschen, Herr Professor«, rief die füllige Dame, »Sie sind sehr mysteriös, oder heißt es ›mystisch‹? Die beiden Wörter habe ich nie richtig auseinanderhalten können. Bitte, seien Sie nett, drücken Sie sich ein wenig verständlicher aus. In meinen jungen Jahren habe ich, wenn ich einen Ballsaal betrat, eine Sensation erregt, und in dieser Saison hab’ ich, Gott steh mir bei, mithilfe verschiedener selt’ner Gewürze ein neues Rezept für Cumberlandsauce kreiert. Aber wie, bitte schön, schafft man eine Tragödie?«