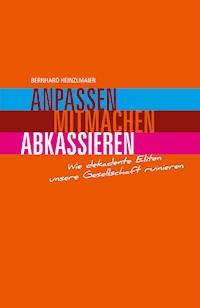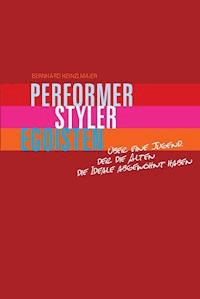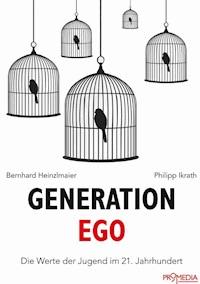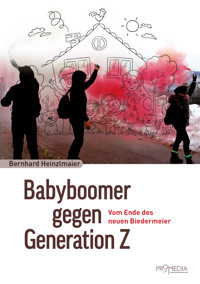
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch ist alles ruhig und harmonisch in den Familien heutzutage. Nichts erinnert an die Generationenkonflikte der 1960er-Jahre. Eltern und Kinder sind keine Gegner, es herrscht ein partnerschaftliches Einvernehmen. Man geht kooperativ miteinander um. Die Vorbilder der Jugendlichen sind nicht mehr Sportler oder Stars der Popmusik, sondern die eigenen Eltern. Der Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier erkennt in dieser Eintracht ein neues Biedermeier-Zeitalter, das kaum infrage gestellt wird. Im Gegenteil: In den Medien wird von der Harmonie zwischen den Generationen geschwärmt. Aber wer genauer hinsieht, der bemerkt, wie es unter der friedlichen Oberfläche gehörig brodelt. Denn der Familienfriede wird primär vom Nützlichkeitsdenken aufrechterhalten. Jugendliche geben unumwunden zu, dass sie mit ihren Eltern nur deswegen gut auskommen, weil sie ihnen des eigenen Vorteils wegen nach dem Mund reden. Streit würde nur – vor allem finanzielle – Nachteile bringen. Deshalb hält man die Klappe, auch wenn die Alten den größten Unsinn verzapfen. Wehe aber, wenn die Eltern ihren Kindern nicht mehr das Erwartete bieten können. Inflation und horrende Aufwendungen des Staates für Energiewende, Hochrüstung der Ukraine und Flüchtlinge engen die Spielräume der Haushalte immer mehr ein. In Zukunft wird deutlich weniger Geld dafür vorhanden sein, womit sich die Familien das angepasste Wohlverhalten der Nachkommenschaft erkaufen können. Auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene wird es schwieriger, die Mittelschichten bei der Stange zu halten. Der Autor sieht einen Generationenkampf heraufdämmern, einen Kampf der "Realisten" aus der Generation der Babyboomer gegen die "links-grünen Pubertäts-Idealisten" aus der Generation Z.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bernhard HeinzlmaierBabyboomer gegen Generation Z
Vom Ende des neuen Biedermeier
© 2025 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
Coverfoto : Shutterstock
Covergrafik: Gisela Scheubmayr
ISBN: 978-3-85371-920-6(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-534-5)
Der Promedia Verlag im Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über den Autor
Bernhard Heinzlmaier, geboren 1960 in Wien. Studium der Geschichte, Psychologie und Philosophie. Er ist Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung in Wien und Geschäftsführer des Marktforschungsunternehmens »tfactory« in Hamburg. Von ihm ist zuletzt bei Promedia erschienen (gemeinsam mit Philipp Ikrath): »Generation Ego. Die Werte der Jugend im 21. Jahrhundert«.
Editorische Notiz:
Wenn nicht anders angegeben, stammen die mündlichen Zitate in den Kästen im Text aus Befragungen der Jugendkulturforschung in den letzten Jahren.
Einleitung: Vulnerabilität als Freiheitsverzicht
Die Geschichte vom harmonischen Zusammenleben der Generationen ist eine Mär, die immer wieder gerne erzählt wird. Tatsächlich liegen Generationen im Widerstreit miteinander. Das bedeutet, dass viele ihrer Gegensätzlichkeiten nicht vermittelbar sind und bestehen bleiben, egal was man tut. Unvereinbarkeiten müssen ausgehalten werden. Kant hätte von der Notwendigkeit der Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz gesprochen, was bedeutet, dass die Menschen Vieldeutigkeit und Unsicherheit ertragen lernen müssen, wollen sie ein annehmbares Miteinander gestalten. Es liegt ein Selbstbetrug darin, zu glauben, alle Konflikte in harmonischer Gemeinschaftlichkeit auflösen zu können. Im Gegenteil, wir müssen Gegensätze akzeptieren und lernen, mit ihnen zivilisiert umzugehen.
Werfen wir einen Blick auf das Medienverhalten der Menschen unserer Zeit, so eröffnet sich ein gravierender Generationengegensatz, auf den wir im Verlaufe des Buches noch öfter zu sprechen kommen werden. Während die Alten, wir nennen sie heute Babyboomer, noch immer traditionelle Medien wie die klassischen Printprodukte und das Programmangebot der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten nutzen, verbringen die Jungen, die unter der Bezeichnung »Generation Z« firmieren, ihre Zeit auf diversen Onlineplattformen. Auch eine unterschiedliche Aufmerksamkeitskultur spaltet die Generationen. Während die Babyboomer lange Filme ansehen und manche von ihnen dicke Bücher lesen, ohne sich dabei zu langweilen, fehlt den Jungen dafür die Geduld. Sie bevorzugen Serien und kurze Handlungssequenzen, die im Kontext eines größeren narrativen Zusammenhangs stehen und deren Konsum man jederzeit unterbrechen kann, ohne den Überblick zu verlieren. Abgeschlossene Teilkapitel machen einen problemlosen Aus- und Einstieg möglich. Ideal sind daher lange Geschichten, die in kleine Narrative gegliedert sind. So trifft man auf dieselben Personen in unterschiedlichen abgeschlossenen Episoden. Dies passt gut zur Praxis der oberflächlichen Wahrnehmung, zur extremen Sprunghaftigkeit und der geringen Aufmerksamkeitsspanne der Generation Z.
Zusammengefasst: Die Generation Z verlangt nach einer Abfolge von Kurzepisoden, denen ein kontinuierliches Setting von Charakteren gemein ist, also eine Verbindung von spannenden Kurzgeschichten unter gleichbleibenden inhaltlichen und personalen Rahmenbedingungen. Besetzung und Rahmenhandlung bleiben konstant, während die einzelnen Episoden spannende Wendungen und damit Abwechslung bieten. So ist es möglich, konservatives Festhalten am Immergleichen mit der Lust an Veränderungen und überraschenden neuen Begebenheiten zu verbinden. Dies widerspiegelt den Grundcharakter der Generation Z, die sich nicht zwischen Gegensätzen entscheiden will, sondern die, konfliktvermeidend wie sie ist, Kompromisse anstrebt, auch wenn sich unvermittelbare Widersprüche zeigen. Anstatt Spannungen auszuhalten und Streitigkeiten auszutragen. Der Grund für diesen Konflikteskapismus besteht aber nicht nur in der Angst vor der Auseinandersetzung oder im Unwillen zum Streit, sondern zeigt in der Regel ein knallhartes Kalkül. Wer nicht widerspricht und keine Kontroversen vom Zaun bricht, hat eher Erfolg in einem Karrieresystem, das nach dem Grundprinzip Aufstieg durch Anpassung funktioniert.
Ein anschauliches Beispiel für den Serienkult unserer Tage ist die Sendung »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«. Sie wird seit 1992 von Montag bis Freitag auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt und ist wohl nach wie vor als das Flaggschiff der fragmentierten und rhapsodischen Wahrnehmungskultur der Postmoderne zu bezeichnen, die uns die nervöse, medienüberladene und oberflächliche digitale Kommunikationskultur beschert hat. Viele Medienkritiker halten diese Serie für den Ausgangspunkt der Serienmanie im deutschsprachigen Raum.
Eine verweichlichte Generation im Opferwahn
Insbesondere die Jüngeren scheinen in einer Art kollektiven ADHS-Symptomatik gefangen. Sie sind auf ständige Reizstimulation angewiesen, um nicht in Langeweile oder gar in Depressionen zu versinken. Die Angst vor der lähmenden Tristesse ist der Grund für ihre Nervosität, die sie niemals still sitzen lässt. Wenn sie sich nicht durch nervöses Herumflippen ablenken können, muss sich etwas emotional Bewegendes auf einem der vielen Bildschirme ereignen, von denen sie immerfort umgeben sind. Überhaupt scheint es der »Horror vacui«, die panische Angst vor der Leere zu sein, der die Menschen dazu treibt, nahezu ohne Unterbrechung aktiv zu sein. Erich Fromm meint in seinem Buch »Die Furcht vor der Freiheit«, Arbeit und Erfolg als Hauptziele des Lebens übten eine so große Anziehungskraft auf die Menschen aus, weil sie Angst vor der Einsamkeit und der kritischen Selbstreflexion in Zeiten der Ruhe und der Ereignislosigkeit hätten. Lieber hält man sich in Betriebsamkeit, als in einer Entspannungsphase in quälende Sinnfragen zu stürzen.
Noch nie existierte eine Generation, die sich so schnell, weil ständig überstimuliert, gelangweilt hat und noch nie war die Konzentrationsfähigkeit einer Altersgruppe so unterentwickelt, wie die der heute die Schulen und Universitäten bevölkernden Generationen Z und Alpha. Als Alphamenschen werden die nach 2010 Geborenen bezeichnet, die neu aufkommende Alterskohorte, die die Generation Z als die emblematische kulturelle Repräsentation der Jugend demnächst ablösen wird. Ein hervorstechendes Merkmal der Generation Z und ein weiteres Beispiel für den gravierenden Gegensatz zwischen den Alten und den Jungen ist deren ausgeprägte Fragilität und deren theatralische Opfermentalität. Noch keine Generation hat sich dermaßen verfolgt und ungerecht behandelt gefühlt. Ein scharfes Wort genügt, und schon erfolgt ein oft inszeniert erscheinender Zusammenbruch und die Vorhaltung mangelnder Achtsamkeit an den Kommunikationspartner. Die gesamte Gesellschaft wird als Hort des Bösen und der Destruktion empfunden. Überall lauern Verwerfungen und Defekte. Und diese identifizieren die Jüngeren als genuinen Bestandteil der gesellschaftlichen Strukturen. Rassismus gilt nicht mehr als negative Eigenschaft konkreter Individuen, sondern er ist strukturell, d. h. Behörden, dem Schulsystem, den Universitäten und dem ganzen politischen System eingeschrieben. Das Böse lauert also nicht mehr im Individuum, es hat sich quasi von diesem gelöst und ist nun in jedes Gesetz, jede mediale Berichterstattung und jede Institution, so als wäre es gasförmig, auf geheimnisvolle Weise eingedrungen. Würde ein rechter Politiker so einen Humbug von sich geben, er würde als Verschwörungstheoretiker etikettiert und aus der Gemeinschaft der Rechtschaffenen ausgeschlossen. Wenn jedoch die woke Community empirisch absolut nicht begründbare Behauptungen aufstellt, werden sie zur unumstößlichen Wahrheit stilisiert, an die keiner zu rühren wagt. Die Mikroaggressionen, von denen die woke Community immer wieder spricht, sind ebenso wie die bis an die Grenzen des Nichts verdünnten Wirkstoffe der Homöopathie noch nie nachgewiesen worden. Dennoch seien sie wirksam. Wäre die woke Bewegung nicht an den Universitäten hoch angesehen und anerkannt, würde man sie eine obskurante Verschwörungsbewegung nennen. Doch wer wagt es schon, gegen die Wissenschaft, die sich heute als unhintergehbare Wahrheitsinstanz inszeniert, aufzubegehren?
Jonathan Haidt über die Gefahren der sozialen Medien
Wenn junge Menschen ihre sozialen Beziehungen in die virtuelle Welt verlagern, werden diese Beziehungen entkörperlicht, asynchron und manchmal austauschbar. In der virtuellen Welt, wo Content ewig weiterlebt und für alle sichtbar ist, können selbst kleine Fehler große Kosten verursachen. Unter Umständen werden Fehler von zahlreichen Personen scharf kritisiert, zu denen man gar keine grundlegende Beziehung aufweist. Auf Entschuldigungen reagiert man oft mit Spott, und jedes Signal von Akzeptanz oder Versöhnung ist möglicherweise gemischt oder vage. Statt Erfahrungen bei der Bewältigung sozialer Probleme zu sammeln, bleibt ein Kind oft mit dem Gefühl zurück, sozial inkompetent zu sein, an Status verloren zu haben und weitere soziale Kontakte fürchten zu müssen. Daher ist es kein Widerspruch, wenn ich sage, Eltern sollten ihre Kinder in der realen Welt weniger überwachen, in der virtuellen Welt jedoch mehr – indem sie das Eintauchen in diese verzögern. Die Kindheit entwickelt sich auf der Erde, und die kindliche Antifragilität ist abgestimmt auf irdische Verhältnisse.
Die woke Ideologie, mit der wir alle seit 20 Jahren geradezu drangsaliert werden, ist die Weltanschauung der Generation Z und sie spiegelt die Infantilität von verweichlichten Kindern wider, die von ihren Helikopter-Eltern verhätschelt und von der Realität des Lebens abgeschottet wurden, sodass sie nicht die nötige »Antifragilität« entwickelten, um in der Welt der Erwachsenen zu bestehen. Woher kommt nun diese Fragilität und die fehlende Resilienz der Generation Z? Eine ernst zu nehmende Antwort auf diese Frage gibt der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt in seinem Buch »Generation Angst. Wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen«. Nach Haidt besteht das Grundübel der Kindererziehung unserer Zeit darin, dass Kinder von ihren Helikoptereltern manisch vor den Gefahren der gesellschaftlichen Realität geschützt werden, sich hingegen in der toxischen Welt der digitalen Plattformen völlig unkontrolliert bewegen dürfen. Dort lauern Bedrohungen auf sie, die ihre Gehirne irreversibel schädigen können. Haidt spricht sogar von einer »Neuverdrahtung« der Gehirne, die durch übermäßigen Konsum von sozialen Medien entsteht. Diese Neuverdrahtung bewirkt, dass eine ganze Generation durch ein smartphonebasiertes Freizeitverhalten zu Risikovermeidern umerzogen und in eine damit im Zusammenhang stehende ständige Verteidigungshaltung gedrängt wird. Im Gegensatz dazu wäre, so Jonathan Haidt, die spielebasierte Freizeit der natürliche Weg, um bei Jugendlichen die Lust auf die Entdeckung von Unbekannten und auf neue Erfahrungen zu wecken. Doch die spielebasierte Freizeit wird von den digitalen Medien gnadenlos verdrängt. Kinder und Jugendliche verbringen heute täglich mehrere Stunden vor Bildschirmen, lassen sich passiv unterhalten, anstatt aktiv zu handeln und so wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Am Ende entsteht ein Menschentypus, der sich hinter Bildschirmen versteckt, weil er Angst vor den medial unvermittelten Begegnungen des wirklichen Lebens hat, das Bestehende jeder Veränderung vorzieht und in eine ständige Abwehrhaltung gegenüber ungeschützten und damit riskanten Handlungsweisen verfällt.
Die durch übermäßigen Konsum digitaler Medien ausgelöste Umbildung der Gehirne bewirkt, dass junge Menschen zu wahren »Angstwesen« werden. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen sie das sonst für Jugendliche typische explorative Verhalten ein und schließen sich ängstlich von der gesellschaftlichen Realität ab. Bevor man sich die Abfuhr von einem wirklichen Menschen abholt, flüchtet man lieber in virtuelle Liebesgeschichten, die auf Netflix und anderen Streaming-Diensten rund um die Uhr laufen. Zu diesem psychopathologischen Kontext gehört auch der überbordende Wunsch der Generation Z nach sogenannten »Safe Spaces«. Ein Safe Space ist nichts anderes als ein Ort, von dem Personengruppen ausgeschlossen sind, die sich nicht konform den Gesetzen der Wokeness verhalten oder interne Diskurse durch kritische Gegenpositionen stören könnten. Während frühere Generationen, beispielsweise die 1968er-Bewegung, die Anti-Atombewegung, die Friedensbewegung oder gar die Protestbewegung gegen den Opernball, die Konfrontation mit der erstarrten Erwachsenenwelt suchten, flieht man vor Gegensätzen, Widersprüchen und Konfrontationen. So wie sich das Kleinkind hinter Mutter oder Vater vor den Bedrohlichkeiten der Welt versteckt, verbergen sich die Woken hinter einem Dickicht von Konventionen und restriktiven gesetzlichen Regelungen, die der Politik abgerungen wurden.
Von der Vulnerabilität zum Freiheitsverzicht
Frauke Rostalski hat ein interessantes Buch mit dem Titel »Die vulnerable Gesellschaft« geschrieben. Schon in der Einleitung stellt sie fest: »Infolge gewachsener Vulnerabilitätsannahmen werden Einzelne und Gruppen stärker durch Gesetze geschützt – mit dem Erfolg einer Ausdehnung staatlicher Hoheitsbefugnisse. Insofern folgt aus meiner Analyse die Diagnose, dass sich die Gesellschaft immer mehr in eine vulnerable entwickelt. Dieser Prozess findet Ausdruck in einer Vielzahl von Gesetzesänderungen.« Während sich die Gesellschaft in Opfergruppen zerlegt, die den Staat um stärkere Gesetze zu ihrem Schutz anwinseln, verlagert sich die Macht zunehmend von den Bürgern hin zum Staat. Der Staat avanciert so zu einem Gouvernantenstaat, der alle Gruppen patroniert. Der Preis für den Schutz von Opfergruppen durch den Staat ist der Verlust von bürgerlichen Freiheiten und die Ermächtigung des Staates zur Übermacht. Was das in der Praxis bedeutet, wurde uns in jüngster Vergangenheit in Deutschland vorgeführt. Dort erhob der Gesetzgeber im Jahr 2021 die Politiker zur besonders vulnerablen Gruppe. Das heißt nichts anderes, als dass sich die Mächtigen auf perfide Weise vor der Kritik derjenigen schützen, die ihrer Macht unterworfen sind. Der zur absoluten Ordnungsmacht erhobene Staat kooperiert nun mit privaten Spitzelorganisationen wie »Correctiv«, »Respekt« oder »So done«, um Verbalinjurien gegenüber Politikern zu erfassen, zur Anzeige zu bringen und Strafbefehle zu erwirken. Mittlerweile hat sich diese Praxis zu einer Kultur der Verfolgung, des Zwangs und der Einschüchterung entwickelt. Viele Bürger wagen daher nicht mehr, ihre Meinung pointiert, zum Beispiel in den sozialen Medien, zu äußern, aus Angst, die Polizei könnte am frühen Morgen mit einem Hausdurchsuchungsbefehl vor der Türe stehen. Politiker nützen die neuen Möglichkeiten zur Unterdrückung des Souveräns gerne; so brachte Robert Habeck, deutscher Vizekanzler, bereits mehr als 800 Strafanzeigen gegen Bürger auf den Weg, von denen er sich beleidigt fühlte. Wie ernst die Behörden diese Anzeigen nehmen, zeigte sich im November 2024, als die Polizei im Morgengrauen vor der Tür eines Rentners stand und seine Wohnung umdrehte, weil er Habeck in einem sozialen Netzwerk als »Schwachkopf« bezeichnet hatte.
Ähnlich verhält es sich mit dem sogenannten »Selbstbestimmungsgesetz«, im Zuge dessen jeder Bürger einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln darf. Es kommt nicht mehr darauf an, was bislang als biologisches Faktum galt, sondern was man sein möchte. Die Gruppe oder besser gesagt der »Stamm«, der das durchgesetzt hat, besteht aus Menschen, die sich im falschen Körper fühlen. Aufgrund des Gesetzes besitzen sie nun die Möglichkeit, den Staat per Gericht anzurufen und aufzufordern, dass jene bestraft werden, die sie mit den falschen Pronomen anreden. Tatsächlich haben sie mit diesem Schachzug aber nicht ihre eigene Position gestärkt, denn die Akzeptanz für Randgruppen in der Gesellschaft wurde noch nie verbessert, wenn man sie per Gesetz erzwingen wollte. Im Gegenteil, gestärkt wurde der Staat, der nun über erweiterte Rechte verfügt, gegen Bürger mit Hilfe von Gerichten und Polizeigewalt vorzugehen.
Hier sehen wir einen fundamentalen Widerstreit, der die Generationen unwiderruflich auseinanderdividiert. Die Babyboomer und auch noch die Generation X haben in sozialen Bewegungen für mehr Freiheit gegen den Staat gekämpft, während die Generation Y und Generation Z hingegen für mehr Staat, weniger Freiheit und mehr Sicherheit eintreten. Das, was die Alten dem Staat in sozialen Kämpfen abgerungen haben, geben die Jungen heute diesem Stück für Stück wieder zurück, um neben den Eltern eine weitere Schutzmacht über sich zu wissen, die sie verteidigt und abschirmt. Dies hängt offensichtlich mit der überfürsorglichen Erziehung zusammen, die sie genießen mussten. Die Eltern räumten ihnen alle Steine aus dem Weg, beschützten sie im Übermaß und verteidigten sie gegen Gleichaltrige, Lehrer, Arbeitgeber, indem sie sich in jeden Machtkampf einmischten, um ihn im Sinne ihrer Sprösslinge zu entscheiden. Dadurch machten sie sich für ihre Kinder unverzichtbar, so wie es der Staat heute für alle jene ist, die aus Gründen der Annehmlichkeit und der ihnen anerzogenen Angst vor Risiken und Verantwortung lieber ihre Freiheiten an den Staat abtreten, als täglich selbst um die Durchsetzung ihrer Wünsche und Zielvorstellungen zu kämpfen. Wie schon oben erwähnt, sprach Erich Fromm in diesem Zusammenhang von der »Furcht vor der Freiheit«. Diese Furcht befällt alle, denen die Eltern, assistiert von paternalistischen Medien und autoritären Ideologien, den Weg in die Selbstbestimmung durch Überbehütung, Verweichlichung und Verzärtelung verbaut haben. Weil sie niemals gelernt haben, frei zu sein, müssen sie sich dem Staat und anderen Autoritäten unterwerfen, da sie sich nur unter der Obhut eines Stärkeren sicher und geborgen fühlen können.
Gefühle statt Vernunft
Wir stoßen auf ein weiteres ernstes Problem. Als Wahlspruch der europäischen Aufklärung fungierte das »Sapere aude« von Immanuel Kant. Ins Deutsche übersetzt bedeutet es so viel wie »Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen«. Obwohl man den Jugendlichen in diversen Studien immer wieder attestierte, pragmatisch und kalkulierend zu sein, ist das nur die halbe Wahrheit. Die Jugend ist zwar stark vom eigenen Vorteil getrieben, aber ihr Kalkül ist nicht rational motiviert; es sind Empfindungen, die an die Stelle der Vernunftsentscheidung treten. Sie können nicht vernünftig begründen, warum sie so oder anders entscheiden, lediglich ihre Intuition teilt ihnen mit, was richtig und falsch ist. Im Gegensatz zu den Babyboomern und der Generation X, die tatsächlich beinhart rechnen und gelernt haben, ihren Vorteil mit dem kalten Kalkül der Vernunft zu erreichen, sind die Jungen von heute in ihrer Mehrheit Menschen, die sich von Gefühlen leiten lassen. Für das, was sie wollen und was sie tun, brauchen sie keine rationale Begründung und verhalten sich aggressiv abweisend gegenüber anderen, die sie von ihnen einfordern.
Auch das hängt mit der postmodernen Medienkultur zusammen. Während die Älteren mit Medien aufwuchsen, die vom logischen Instrument der Sprache beherrscht wurden und in denen das Argument die Kommunikation bestimmte, wurden Generation Y und Generation Z durch Bildmedien sozialisiert. Überall dort, wo das Bild herrscht, regieren Affekte, Emotionen und die Intuition. Noch dramatischer beschreibt der deutsch-südkoreanische Philosoph Byung-Chul Han die Wirkungsweise der digitalen Bilder.
Byung-Chul Han über die Wirkung der digitalen Bilder
Die Wahrnehmung digitaler Bilder vollzieht sich als Affektion, als unmittelbarer Kontakt zwischen Bild und Auge. Das digitale Medium ist ein Affektmedium. Affekte sind schneller als Gefühle und Diskurse. Sie beschleunigen die Kommunikation.
Das affectum kennt keine Geduld zum studium und keine Empfänglichkeit fürs punctum. (…) Das affectum schreit und erregt. Es bringt nur sprachlose Erregung und Reize hervor, die ein unmittelbares Gefallen auslösen.
Stärker als das gedruckte oder affichierte Bild schlagen die digitalen Bildmedien die Vernunft aus dem Feld. Die unmittelbare Intuition entscheidet darüber, was gut und was schlecht ist, nicht mehr die bedächtige Abwägung und das ruhige und wohlüberlegte Urteil.
Bilder sind in hohem Maße manipulativ. Viele Menschen glauben, dass Bilder die Wirklichkeit repräsentieren, doch sind sie lediglich eine Interpretation derselben. Die Perspektive und der gewählte Ausschnitt bestimmen die Aussage des Bildes. Der amerikanische Kunsthistoriker William John Thomas Mitchell behauptet sogar, dass der Mensch bei der Betrachtung von Bildern in eine magische, vormoderne Haltung zurückfällt. Er lässt sich durch das Bild anziehen, von ihm fesseln und gefangen nehmen. Genau das ist auch die Aufgabe des Bildes in der Kommunikation: Den Menschen in seinen Bann zu ziehen, ihn im wahrsten Sinn des Wortes zu fesseln, bewegungsunfähig zu machen, die Vernunft auszuschalten und ihn förmlich zu ergreifen und zu überwältigen. Dies wird auch als Medusa-Effekt des Bildes bezeichnet. Der Anblick der Medusa der griechischen Mythologie ließ alle erstarren. Auch das persuasive Bild soll den Menschen derart in seinen Bann ziehen, dass er seinen Körper vergisst, erstarrt und die Kontrolle über sich an äußere Instanzen abgibt.
In der Werbeforschung spricht man vom »Picture Superiority Effect«. Dieser besagt, das Bild würde unsere Aufmerksamkeit mehr erregen als das geschriebene Wort. Zudem motivieren Bilder stärker zum Handeln und können zudem ohne große mentale Anstrengung rezipiert werden. Bilder sind jedoch nicht eindeutig, sie sind weit weniger klar als die mit dem logischen Instrument der Sprache geformten Nachrichten. Jeder interpretiert ein Bild auf seine Weise, die Interpretationen variieren von Mensch zu Mensch. Aus dem Blickwinkel derer, die Menschen manipulieren wollen, bietet das Bild den Vorteil, dass es die Rationalität zu narkotisieren in der Lage ist. Eine kritische Distanz zu einem Bild ist schwer herzustellen, da es unmittelbar wirkt und intuitiv verstanden wird. Das trifft übrigens auch auf die Musik zu.
Durch die Wende von der sprachgeleiteten diskursiven Gutenberg-Galaxis, in der das geschriebene Wort dominierte, zur präsentativen, intuitiven Bildkultur, ist die Bedeutung des Körpers größer geworden. Die Selbstinszenierung des Menschen mithilfe seines abbildbaren Körpers stellt heute die zentrale kommunikative Praxis dar. Der Filmkritiker Béla Balázs sah dies schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts voraus, als er bemerkte, dass in der Kultur der Worte unser Körper als Ausdrucksmittel nicht gebraucht wurde und deshalb seine Ausdrucksfähigkeit verkümmert sei. In dieser Zeit wäre er primitiv, dumm und barbarisch geworden. In unserer Zeit des Bildes hingegen hat sich ein breites Repertoire an Stilmitteln und Techniken entwickelt, mit denen vorwiegend die jungen Menschen ihre Körper dekorieren und optisch aufwerten. Die Körperbilder sind in der Folge differenzierter, stilistisch raffinierter und kultivierter geworden.
Heute geht es nicht, wie in früheren Epochen, darum, die Defizite des Körpers zu verhüllen, vielmehr wird der Körper selbst in das Visier von ästhetischen Techniken genommen und systematisch »getunt«. Das beginnt bei der Ernährung mit »functional food« und endet bei Maßnahmen der Body Modification und der Schönheitschirurgie. Für 70 % der österreichischen Lehrlinge spielen gutes Aussehen und ein muskulöser Körper eine wichtige Rolle. So versteht es sich von selbst, dass die Angehörigen der Generationen Y und Z die Fitness-Studios stürmen, um ihren Körper, der in einer Transparenz- und Inszenierungsgesellschaft förmlich zur Instrumentalisierung gedrängt wird, den Idealen der muskulösen Sportlichkeit unserer Zeit entsprechend zu formatieren. Beliebt sind heute Piercings und Tattoos, wobei besonders junge Frauen zu diesen Praktiken der Selbststilisierung eine große Affinität zeigen. So tragen fast 50 % der weiblichen Lehrlinge sichtbare Piercings, und weitere 27 % Tattoos.