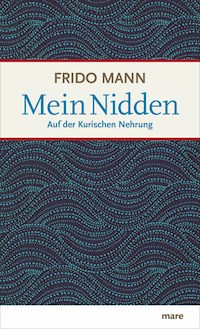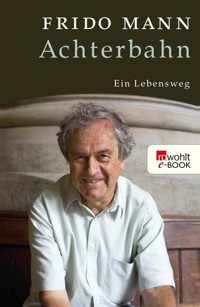9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Romancier namens Mann In einer Kleinstadt nahe der deutsch-polnischen Grenze führt der jüdische Stardirigent Aurelio de Monti das von ihm wiederentdeckte Oratorium «Babylon» aus der Vivaldi-Zeit auf. Wegen einer unglücklichen Liebschaft mit der verheirateten evangelischen Pastorin Hendrike Hönig und der sich anbahnenden Freundschaft mit dem liberalen Islamforscher Ahmed Karimi bleibt er länger als geplant. Gemeinsam wollen die drei einen Dialog der Religionen ins Leben rufen und ein Zeichen gegen die rechte Szene setzen. Doch ihre Zukunftsvisionen von einer grundlegenden Erneuerung der weltweit zerstrittenen Religionen stoßen auf Widerstände. Als die von einer immer breiteren Bürgerschaft unterstützten Neonazis einen Brandanschlag auf das Asylantenheim verüben, gerät de Monti in Lebensgefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Frido Mann
Babylon
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein Romancier namens Mann
In einer Kleinstadt nahe der deutsch-polnischen Grenze führt der jüdische Stardirigent Aurelio de Monti das von ihm wiederentdeckte Oratorium «Babylon» aus der Vivaldi-Zeit auf. Wegen einer unglücklichen Liebschaft mit der verheirateten evangelischen Pastorin Hendrike Hönig und der sich anbahnenden Freundschaft mit dem liberalen Islamforscher Ahmed Karimi bleibt er länger als geplant. Gemeinsam wollen die drei einen Dialog der Religionen ins Leben rufen und ein Zeichen gegen die rechte Szene setzen. Doch ihre Zukunftsvisionen von einer grundlegenden Erneuerung der weltweit zerstrittenen Religionen stoßen auf Widerstände. Als die von einer immer breiteren Bürgerschaft unterstützten Neonazis einen Brandanschlag auf das Asylantenheim verüben, gerät de Monti in Lebensgefahr.
Über Frido Mann
Frido Mann, geboren 1940 in Monterey/Kalifornien, ist der Sohn von Michael und Gret Mann. Der Lieblingsenkel von Thomas Mann wuchs in der Schweiz überwiegend im Haus seiner Großmutter Katia auf und studierte Musik, katholische Theologie, Medizin und Psychologie. 1986 wurde er Professor für klinische Psychologie in Münster. Erst gegen Ende seiner akademischen Laufbahn wandte er sich der Schriftstellerei und interkulturellen Tätigkeiten zu. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Pfäffikon/Schweiz und in Göttingen.
Inhaltsübersicht
Der Stiftung Weltethos gewidmet.
Mein besonderer Dank gilt Karl-Josef Kuschel, Professor für Theologie der Kultur und des Interreligiösen Dialogs an der Eberhard-Karls- Universität Tübingen, für seine kompetente und freundliche Beratung und Unterstützung sowie Dirk Heißerer in München für seine tatkräftige Hilfe bei der Publikation des Buches.
Eins
Es schien glücklicherweise auch heute kein schwarzer Tag zu werden.
Hubertus Hech betrat pünktlich um achtzehn Uhr mit dem Schlüssel in der Hand die Kirche, um dort bei seinem allabendlichen Rundgang die Kerzen auszulöschen und dann abzuschließen. Da inzwischen die Tage wieder länger und wärmer wurden und die Dämmerung erst eingesetzt hatte, ließ er die Kirchentür offen, um wenigstens im Eingangsbereich des bereits halbdunklen Kircheninneren ein bisschen Tageslicht zu haben. Er ging am Tisch mit den zum Verkauf ausgelegten Broschüren, Faltblättern und Ansichtskarten und an der auf einem hohen Eisengestell brennenden, großen, weißen Kerze vorbei, die er immer erst am Ende seines Rundganges auszulöschen pflegte. Im flackernden Schein dieser Kerze bewegte er sich, unter den hohen, vergitterten Kirchenfenstern, die kalkfarbene Wand entlang, nach vorne in Richtung Altar, hinter dem die Windlichter und die größte Kerze auf ihn warteten. Sein Blick streifte die nur noch schemenhaft erkennbaren Kinderzeichnungen und die zu einem Kreuz zusammengesetzten, bunten Batiktücher.
Am Ende seiner Frühschicht versah Hubertus Hech an allen Wochentagen in der protestantischen Himmelfahrtskirche in Dregkwitz seinen ehrenamtlichen Küsterdienst. Für den morgigen Aschermittwoch hatte er extra Urlaub genommen, um zusammen mit seiner Frau noch vor Tagesanbruch mit dem drei mal drei Meter großen Fastentuch den Altar zu verdecken. Dies war eine seiner schönsten Tätigkeiten während des ganzen Kirchenjahrs, wusste er doch, dass sich seine Frau Hendrike, die Pastorin der Himmelfahrtskirche, ebenso darauf freute wie er. Diese kleine Gemeinsamkeit empfand er als Bestätigung für das Bild seiner harmonischen und einträchtigen Ehe, an dem ihm so viel lag und das einmal mehr der Grund für seinen freiwilligen Einsatz als Küster war. Außerdem hoffte er, durch die demonstrativ zur Schau gestellte, eheliche Einheit den treuen Mitgliedern der Kirchengemeinde gegenüber der zunehmenden Polarisierung zwischen Ausländergruppen und einer erschreckend großen Zahl gewaltbereiter Einwohner im Städtchen einen starken Rückhalt bieten zu können. Aber der wichtigste Grund für Hubertus Hechs Dienste war es, jede freie Minute in der Nähe seiner Frau zu sein, sie wie einen Schatz zu hüten und sie zu beschützen, zu bewachen und zu besitzen.
Gewärmt von seiner gefütterten Windjacke, bewegte er seine kleine Gestalt mit den auffallend groß und kräftig geratenen Armen auf das Altarbild mit dem vergoldeten, gekreuzigten Herrn und seinen ebenfalls vergoldeten Jüngern zu. Er blieb vor dem Bild kurz stehen und ließ seine himmelblauen Augen im runden Kindergesicht unter dem früh ergrauten, kurzgeschnittenen gewellten und brav in der Mitte gescheitelten Haar zur Seite wandern. Wie immer, wenn er kontrollierend nach seiner Frau Ausschau hielt, blähte er seine Nasenflügel auf und schnupperte in die Luft, so als könnte er durch die Kirchenmauern hindurch bis zum gegenüberliegenden Gemeindehaus ihrem Duft nachgehen, wobei er seine Anstrengungen mit angedeuteten Ruderbewegungen seiner großen Arme unterstrich. Er hatte sich schon beim Betreten der Kirche vergewissert, dass in den oberen Fenstern Licht brannte und Hendrike dort tatsächlich die Faschingsfeier mit ihren Konfirmanden abhielt, natürlich mit Berliner Pfannkuchen. Noch gestern Abend hatte sie sich, gleichsam als Beweis, ihrem Hübchen als Frau Holle präsentiert, mit zusätzlichen Stopfkissen für ihre lange, hagere Figur. Er hatte dies auch als Wiedergutmachung der Unkorrektheit empfunden, die sie sich am Nachmittag zuvor hatte zuschulden kommen lassen und die ihm um ein Haar einen schwarzen Tag beschert hätte. Hendrike hatte sich mit ihrem schwäbischen Amtsbruder Eberle aus dem nahegelegenen Dürrholz im hiesigen Gemeindehaus verabredet, aber dann hatte Hubertus Hech vom Fenster ihrer Wohnung aus beobachten können, wie sie sich, ganze zwei Stunden später, verdächtig fröhlich und aufgekratzt aus dem Gemeindehaus in das schräg gegenüberliegende Stadtcafé begeben hatten. Nach einer weiteren qualvollen halben Stunde war er schließlich in das Café hinuntergeeilt, wo er die beiden vornübergebeugt am Tisch sitzend und sich intime Blicke zuwerfend in ein angeregtes Gespräch vertieft vorfand. Er hatte sich mit starrem Gesicht neben ihrem Tisch aufgepflanzt und war so lange mit scharfen Bemerkungen zwischen ihr offensichtlich mit einem Geheimcode gespicktes Gefachsimpel gefahren, bis sich der andere endlich geschlagen gab und das Feld räumte. Damit war für Hubertus Hech der Tag gerettet gewesen.
Zufrieden und mit wieder ungetrübter Vorfreude auf morgen stieg Hubertus, neben Kanzel und Taufbecken, die mit einem grob gewirkten, grauen Teppich bedeckten, steinernen Stufen zum Altar hoch. Im Schein der heute überraschend wild flackernden Kerze hinter dem Altar tanzten besonders weitflächige Schatten über die musizierenden Engel des rötlich verblassenden Deckengemäldes. Hubertus steuerte, während er langsam seine Lungen mit Luft füllte, auf die hohe, weiße Kerze zu. Doch schon von weitem stach ihm im jungfräulichen Wachs unter dem brennenden Docht ein unheilverkündend großer, schwarzer Fleck in die Augen. Als er endlich dicht vor der Kerze stand und gerade zum Auspusten ansetzte, erkannte er zu seinem großen Entsetzen eine in der tiefen und breiten Lache des flüssigen Wachses schwimmende, riesengroße tote Schmeißfliege.
Er erstarrte und war einen Augenblick wie gelähmt. Dann blies er die brennende Scheußlichkeit von einer Sekunde zur anderen in die Dunkelheit, bückte sich zu den Steinen auf dem Boden, zwischen denen die kleinen Windlichter friedlich brannten, pustete auch diese aus und eilte dann, so schnell ihn seine kurzen Beine trugen, nach hinten zum Ausgang. Er rang kurz nach Luft, als das Herzstolpern, das ihn heute den ganzen Tag in Ruhe gelassen hatte, plötzlich wieder einsetzte. Auch überfielen ihn wieder die Schmerzen in dem durch einen Unfall lädierten linken Unterschenkel. Mit letzter Kraft blies er die Kerze am Eingang aus. Dann flüchtete er ins Freie. Dort stieß er die mit rostigen Eisenbeschlägen versehene, schwere Tür zu und drückte sie so weit nach innen, bis sich der Schlüssel geräuschvoll im Schloss umdrehen ließ.
In der oberen Etage des Gemeindehauses brannte immer noch Licht.
Zwei
Aurelio de Monti betrat den Untermarkt und schritt auf dem ringförmigen Straßenzug mit Laubengängen entlang der hochgiebeligen, prächtigen Renaissance-Kaufmannshäuser hinunter in Richtung auf den die alte Stadt Görlitz teilenden Grenzfluss Neiße. Er hatte seinen schwarzen Wintermantel aufgeknöpft und den langen schwarzen Schal offen um den Hals gelegt. Der breitkrempige Hut aus dunklem Leder spendete seinen Augen Schatten, und er ließ sich von der freigiebig kraftvollen und hellen Vorfrühlingssonne durchwärmen. Die vormittägliche Ruhe auf dem noch fast menschenleeren Platz mit dem großen Neptunsbrunnen war Balsam für seine Seele. Besonders freute er sich auf die Fortsetzung seiner Recherchen in der nur noch wenige Schritte entfernten Oberlausitz’schen Bibliothek der Wissenschaften, die eben in diesen Minuten öffnete.
De Monti war von seinem Arzt eine Auszeit verordnet worden, nachdem der den Beginn eines Burn-out-Syndroms diagnostiziert hatte. De Monti, selbst promovierter Mediziner, wusste, dass seine zunehmenden depressiven Phasen unmittelbar damit in Zusammenhang standen, und hatte sich von allen Konzertverpflichtungen der kommenden Frühjahrs- und Sommermonate freigemacht. Er fühlte sich zwischen seinen beruflichen Pflichten und seinen privaten Forschungsinteressen zerrissen. Umso mehr freute er sich darauf, in der Abgeschiedenheit dieses geschichts- und kulturträchtigen Landfleckens dem schon lange nicht mehr erlebten Gefühl von Freiheit und Drang in unbekannte Räume hinein nachgeben zu können. Endlich fand er Zeit, sich in aller Ruhe den Forschungen zu dem hiesigen Philosophen Jakob Böhme zu widmen.
Doch heute hatte er sich vorgenommen, zuerst im monumentalen, alten Büchersaal der Bibliothek nach jüdischen Kommentaren der Thora, der Mischna und des Talmud zu suchen, um sich dort eingehender mit der um Schöpfung, Sünde und Gottesstrafe und um gnadenhafte Neuschöpfung kreisenden Thematik der fünf Bücher Mosis zu befassen. Während der Karnevalstage hatte er ganz zufällig im Büchersaal einen höchst überraschenden Fund gemacht. Der Einband einer Böhme-Biografie hatte sich als Deckblatt der Partitur eines geistlichen Oratoriums mit dem Titel «Babylon» erwiesen, verfasst von Orlando Sestrelli, einem Zeitgenossen Antonio Vivaldis. De Monti hatte sofort in der Bibliothek nach dem Werk gesucht und dort auch bald ein ziemlich umfangreiches Fragment gefunden, und die Vertonung der zudem sehr eigenwilligen Textversion der biblischen Erzählung über den Turmbau von Babel hatte ihn sogleich gefesselt. Er hatte sofort beschlossen, das Fragment mit Ergänzungen zu versehen und aufzuführen. Ihm war bewusst, dass er sich damit zwar wieder viel zu viel aufbürdete. Aber nicht zuletzt die Tatsache, dass ihm dieses von Sünde und menschlicher Hybris handelnde Werk gerade zu Beginn der vorösterlichen Buß- und Fastenzeit in die Hände gefallen war, machte es ihm unmöglich, von seinem Vorhaben abzulassen.
Als de Monti am Ende des Platzes die Neißstraße überquerte, um zum Bibliothekseingang im Haus Nummer 30 zu gelangen, nahm er gedankenversunken bereits jetzt den Hut von seinen dichten schwarzen Locken. Das helle Sonnenlicht blendete ihn, und er kniff seine schrägen, etwas dunkel umschatteten Augen zusammen, die seinen weichen Gesichtszügen mit dem Vollbart etwas undurchdringlich Hartes gaben. Er durchmaß mit energischen Schritten den länglichen Loggiahof, der zum Bibliotheksgebäude führte, stieg die Steintreppe in der Eingangshalle hoch und gelangte zum großen Büchersaal mit seiner rund zweihundert Jahre alten, berühmten Kulissenbibliothek.
Das helle Holz der fünf hintereinander gereihten, mächtigen, doppelseitigen Bogenregale des Büchersaals glänzte heute in der Frühlingssonne so stark wie noch nie. Vor allem die braunen Lederrücken der Bücher und deren ornamentale Goldprägungen und goldene Titelaufdrucke strahlten im Widerschein des jungen Lichts besondere Anmut und Ehrwürdigkeit aus. Die arkadenartig bis zum Deckengesims gestaffelte Bücherpracht – von den eleganten Kleinoktavbändchen bis hin zu den gewaltigsten Folianten – kam so eindrucksvoll zur Geltung, dass Aurelio de Monti sich geradezu beflügelt fühlte, seine heutigen Studien in Angriff zu nehmen.
Etwa an derselben Stelle beim hintersten Regal, an der de Monti kürzlich sein Oratoriumsfragment entdeckt hatte, stand die breitstirnige, bebrillte Aufsichtsperson und griff mit ihren weißen Zwirnhandschuhen ins Regal, um für einen neben ihr wartenden Herrn einen Band herauszuziehen. Dieser wandte unmittelbar den Kopf und musterte ihn neugierig. De Monti sah diesen Mann in der Bibliothek zum ersten Mal. Er war, wie er selbst, ein Mann in den frühen Fünfzigern, hochgewachsen, schlank und mit spärlichem Haarwuchs, und sein markantes Gesicht mit der scharf gebogenen Nase hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug einen grünen, makellos gepflegten Anzug, im Vergleich zu dem sich de Montis dunkle und farblich ziemlich undefinierbare Freizeithose eher schäbig ausnahm. Wahrscheinlich war es diese Diskrepanz, in der de Monti den abschätzigen Blick des anderen auf sich ruhen fühlte und die ihn plötzlich bemerken ließ, dass er immer noch seinen breitkrempigen Hut in der Hand hielt. Er stutzte, hielt kurz inne und zog sich dann rasch aus dem Raum zurück.
Als er wieder in den Büchersaal zurückkehrte, standen die weißbehandschuhte Aufsichtsperson und der große, dunkelhäutige Herr immer noch an derselben Stelle und blickten in ein aufgeschlagenes Buch. Sie flüsterten miteinander, obwohl niemand sonst im Raum war. De Monti entnahm seinem Etui eine dünnrandige Lesebrille, setzte sie auf und machte sich auf den Weg zu seinem Platz. Als er an den beiden anderen vorbeiging, wurde sein Blick derart von dem aufgeschlagenen Buch angezogen, dass er ungeniert hineinblickte.
«Eine besondere Kostbarkeit?», erkundigte er sich.
«Ja, wirklich unverhofft», antwortete der andere mit einnehmend sanfter Stimme und flüssigem sowie – im Gegensatz zu seinem eigenen – akzentfreiem Deutsch. «Es ist ein Werk, nach dem ich schon lange suche … eine neue Darstellung der Rechristianisierung Spaniens im vierzehnten Jahrhundert, schonungslos, umfassend und doch mit vielen hochinteressanten Details, von einem katholischen Historiker verfasst … Ich wollte hier eigentlich nach Literatur über die entscheidende Rolle von Sachsen und Polen bei der Beendigung der Belagerung von Wien durch die Türken suchen. Aber eben jetzt fiel mir dieser Rodriguez Alvez in den Schoß», meinte der Gelehrte, mit einem triumphierenden Lächeln auf das Buch vor ihm deutend, um dann die Bibliothekarin neben sich in gedämpftem, höflichem Ton anzuweisen: «Ja, bitte, für morgen in den Lesesaal.»
«Dann ist es Ihnen ganz ähnlich ergangen wie mir», erwiderte de Monti, während sich die Bibliothekarin diskret mit dem Buch entfernte. «Sind Sie Historiker?»
«Ich bin Islamforscher. Auch, oder vielleicht erst recht, hier in meinem westeuropäischen Exil», erwiderte der andere bestimmt, fast trotzig. «Und Sie?»
De Monti begann den anderen sympathisch zu finden.
«Eigentlich bin ich Musiker und beschäftige mich nebenbei mit Religionsphilosophie und Religionsgeschichte», bekannte er, noch etwas unsicher, um sich dann, wie unter einer spontanen Eingebung, seinem Gesprächspartner namentlich vorzustellen.
«De Monti … Musiker … Warten Sie … Sie sind doch nicht etwa …?»
De Monti lächelte verhalten.
«Der berühmte Dirigent Aurelio de Monti?»
De Monti nickte etwas verlegen.
«Und ausgerechnet an diesem vornehmen Ort hier begegnet man sich … Heute ist anscheinend mein besonderer Glückstag … Ich heiße übrigens Ahmed Karimi», beeilte sich der andere nachzuholen. «Ich bewundere Ihre Operninterpretationen … Auch Ihre Aufführung des Verdi-Requiems in der Berliner Philharmonie im vergangenen November vergesse ich nie. So etwas Gewaltiges. Der ganze Saal hat gezittert.»
«Und Sie hat man aus Ihrer Heimat vertrieben, sagten Sie?», versuchte de Monti das Gespräch wieder auf Karimi zu bringen.
«Ich stand auf der schwarzen Liste der Oppositionellen an der Universität in Teheran und konnte gerade noch in letzter Minute das Land verlassen», antwortete Karimi stolz.
«Und Sie leben jetzt in Deutschland?»
«An sich in London. Ich bin aber oft in Berlin bei meiner Exilgruppe. Unsereins muss ja ständig um seine Aufenthaltsgenehmigung kämpfen, obwohl wir in Deutschland als politisch Verfolgte eigentlich anerkannt werden.»
«Diese Art von Heimatlosigkeit ist uns Juden keineswegs fremd», rutschte es de Monti heraus. «Auch wenn wir staatsbürgerlich abgesichert sind.»
Etwas erschrocken bemerkte er Karimis Verblüffung, die dieser jedoch sofort mit der Wiedergabe seiner historischen Fachkenntnisse überdecken zu wollen schien:
«Ich weiß, besonders am Beispiel der Rechristianisierung der spanischen Halbinsel, dass die Juden, noch viel drastischer als wir Muslime, die Opfer der gnadenlosen Verfolgung durch die katholische Kirche gewesen sind», erklärte Karimi, um dann hinzuzufügen: «Aber Ihr Vorname ist, wenn ich mich nicht irre, kein ausgesprochen jüdischer.»
«Nein, aber mein zweiter Vorname … Noah», erwiderte de Monti.
De Monti berichtete kurz, wie ihn der überraschende Partiturfund von seinen Recherchen für seine Böhme-Dissertation abgebracht und er sich wegen Vorstudien für seine geplante Vervollständigung des Oratoriums kurzfristig auf das jüdischchristliche Schöpfungs- und Sündenthema verlegt hatte.
«Oh, da fällt mir etwas ein. Kennen Sie das Große Zittauer Fastentuch aus dem fünfzehnten Jahrhundert?»
«Nein.»
«Es ist eines der heute nur noch ganz wenigen erhaltenen, christlichen Fastentücher hier ganz in der Nähe.»
«Sie meinen diese mittelalterlichen Verhüllungstücher während der vorösterlichen Fastenzeit?», fragte de Monti, während er seine Brille abnahm und diese in das Etui zurücklegte.
«Das war der ursprüngliche, einzige Zweck. Zuerst gab es nur diese einfarbigen, violetten oder schwarzen Tücher zur Verhüllung der Bilder, Kruzifixe und Kirchenfenster. Aber die wurden nach und nach abgelöst durch gemalte oder gestickte Bilderreihen, welche die ganze biblische Geschichte anschaulich erzählten. Und diese Bilderfolge sollte, vor allem über die Predigt, bei den meist leseunkundigen Gläubigen die Bibelerzählung in individuelle Vorstellungen und Bilder umsetzen. Durch diese Predigten wurden die Fastentücher gewissermaßen zum Sprechen gebracht.»
«Ist der Turmbau zu Babel auch auf diesem Fastentuch abgebildet?»
«Natürlich. Die Heilsgeschichte nimmt einen wesentlichen Platz ein: die Erschaffung des Menschen, dessen Sündhaftigkeit und Gottes Strafe und dann schließlich doch immer wieder seine Gnade.»
«Woher kennen Sie denn dieses Tuch?»
«Ich wurde im Zuge unserer interreligiösen Gespräche darauf gestoßen. Was mich, ganz abgesehen von dem Bilderverbot in meiner Religion, an diesem Bildwerk immer wieder von neuem in Rage bringt, ist die Tatsache, dass auch die Heilsgeschichte des Alten Testaments geradezu penetrant durch die christliche Brille des Neuen Testaments erzählt wird, schon vom ersten Schöpfungstag an. Das ist eine Beleidigung nicht nur von uns Muslimen, sondern auch des monotheistischen Judentums und seiner Thora, wenn ich gerade Ihnen das so sagen darf. Ich denke manchmal, dass die schwere Prüfung, die dieses Fastentuch durch die Jahrhunderte hindurch bis heute zu bestehen hatte, eine gerechte Strafe unseres einzigartigen, allgewaltigen Gottes ist.»
«Und was meinen Sie mit … ‹christlicher Brille›?»
«Das zeigt sich besonders bei der bildlichen Darstellung der zentralen Figuren in der alttestamentlichen Heilgeschichte. Ob Schöpfergott oder Abraham, Moses oder Jakob, immer schimmert ein frech vorweggenommenes Christusantlitz durch diese Abbildungen hindurch. Ich könnte Ihnen das am besten an Ort und Stelle zeigen.»
«Da machen Sie mich aber neugierig. Wie sieht denn dieses Tuch aus und wie ist es aufgebaut?»
«Es besteht aus neunzig Bildern auf einem etwa acht mal sechs Meter großen, quadratischen Feld. Die ersten fünf Zeilen mit je neun Bildern sind dem Alten und die zweiten fünf dem Neuen Testament gewidmet. Das Alte Testament konzentriert sich auf die fünf Bücher Mosis, von der Erschaffung der Welt bis zu Moses und den Israeliten in der Wüste, und im Neuen Testament liegt der Akzent auf den letzten Tagen des Lebens Jesu, auf dessen Leiden und Sterben und auf der Auferstehung Christi. Jedes Bild ist etwa einen halben Quadratmeter groß.»
«Und wo hängt dieses Tuch, sagten Sie?»
«Es hängt in der gotischen Kreuzkirche in Zittau, ganz nahe an der polnisch-tschechischen Grenze dreißig Kilometer südlich von hier. Ein Getreide- und Gewürzhändler soll es im fünfzehnten Jahrhundert zum Dank für eine überstandene Hungersnot der Stadt gestiftet haben, weshalb es im doppelten Sinn Hungertuch hieß. Nach dem großen Stadtbrand von 1757 lag es völlig verdreckt und beschädigt in der Ratsbibliothek zusammengerollt unter einem Bücherregal. Nach seiner Entdeckung fast hundert Jahre später brachte man es in die Museen von Dresden und Zittau, wo es bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein verschiedentlich ausgestellt wurde. Während der letzten Kriegsmonate 1945 war es wegen der Bombengefahr in der Burg- und Klosterruine über dem nahegelegenen Kurort Oybin ausgelagert. Dort fiel es im Mai plündernden sowjetischen Besatzern in die Hände. Sie zerschnitten und zerrissen das Tuch … das müssen Sie sich mal vorstellen … in mehrere Teile und benutzten es während etlicher Wochen als zeltartige Wand- und Deckenverkleidung einer improvisierten Badestube in den bei Oybin gelegenen ‹Dachslöchern›. Nach ihrem Abzug ließen sie die Fetzen des Tuches achtlos im Wald liegen, bis es ein alter Mann durchnässt und verdreckt entdeckte und auf seinem Handwagen ins Museum nach Zittau zurückbrachte. Dort blieben die Teile bis zur Wende 1990, eingewickelt in Zeitungspapier, unbeachtet auf dem Boden des Stadtmuseums liegen. Erst kürzlich wurde es, nachdem es geflickt und wieder zusammengenäht wurde, wieder nach Zittau zurückgebracht, wo es jetzt als Ausstellungsstück in der Kreuzkirche hängt. Aber die fast völlige Ausbleichung mehrerer Bilder, vor allem in den mittleren Zeilen des Tuches, ließ sich nicht mehr beheben.»
«Das muss ich mir unbedingt ansehen», rief de Monti so laut, dass die Bibliothekarin am entgegengesetzten Eingang indigniert zu den beiden einzigen Besuchern hinüberschaute.
Karimi beantwortete ihre Mahnung mit einem beschwichtigenden Kopfnicken.
«Wenn Sie wollen, kann ich Sie nächste Woche nach Dregkwitz mitnehmen, das ist nicht weit von hier in Richtung Berlin. Dort hängt seit Aschermittwoch in der Himmelfahrtskirche eine etwa um die Hälfte verkleinerte Leinenkopie des Fastentuchs. Ich kenne die Pastorin, mit der ich im Rahmen eines muslimisch-christlichen Dialogs in Verbindung stehe. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo Dregkwitz liegt.»
Karimi steuerte mit einer auffordernden Geste auf den Ausgang des Saales zu. De Monti folgte ihm.
Sie betraten den Lesesaal. Es war ein hoher, weißgetünchter und daher recht heller Raum mit Deckenstuckatur. Aus ihm waren offenbar einige historische Möbel herausgeschafft und durch nüchternes Gebrauchsmobiliar ersetzt worden, wie beispielsweise der lange Lesetisch in der Mitte und die um ihn herumstehenden, sehr einfach wirkenden Stühle. Da die Bücher den Besuchern immer aus dem Magazin in den Lesesaal gebracht wurden, war der Tisch leer. Ansonsten erinnerten einige gerahmte Stiche und Radierungen an der Wand, ein lackglänzender Mahagonisekretär, ein hoher, fest verschlossener, weißer Vitrinenschrank voller Bücher und ein mit Kerzen bestückter, großer Kristalllüster hoch über dem Lesetisch an die weit zurückreichende Tradition mittel- und ostdeutscher Wohnkultur dieses ehemaligen Großbürgerhauses.
Von der neben der Büchervitrine und in Fensternähe an der Wand angebrachten Landkarte, zu der Karimi ihn sogleich hinführte, hatte sich de Monti bisher ferngehalten. Die martialisch verschnörkelte Überschrift ‹Heimatkarte von Schlesien› und die über vierzig aufgemalten Städte- und Provinzwappen ‹Stand 1939› verwiesen auf heute zu Polen gehörige Orte, die bis hin zur ehemaligen Ostgrenze Schlesiens immer noch auf Deutsch aufgeführt waren.
«Wie genau die Karte wirklich ist oder wie weit die Grenzen doch tendenziös ein wenig verschoben wurden, sei dahingestellt», erklärte Karimi, nachdem de Monti sich seine Brille wieder aufgesetzt hatte. «Die ganze Stadt Görlitz befand sich jedenfalls bis Kriegsende noch auf schlesischem Boden. Aber die DDR verschleierte diese Tatsache, indem sie die Stadt mitsamt dem Landstrich westlich und nördlich davon mit sächsischem Gebiet zum Bezirk Dresden vereinte. Denn der Name Schlesien war nach dem Krieg mit Bann belegt. Hier jedenfalls liegt Dregkwitz.»
Schritte wurden im Flur hinter der offen gelassenen Tür vernehmbar. Die beiden vermuteten das Nahen der Aufsichtsperson und stellten sich darauf ein, ihre Unterhaltung beenden zu müssen. Doch es war nur ein anderer Bibliotheksbesucher, der am Lesesaal vorbeiging.
«Ich bin oft in Berlin. Von dort aus betreibe ich im hiesigen Grenzgebiet historische Forschung zum Verhältnis der drei von Abraham abstammenden Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam.»
«Aber Ihr Hauptwohnsitz ist in London, sagten Sie?», fragte de Monti, erfreut, mehr über Karimi zu erfahren.
«Ja. Ich bin Mitglied der vor einigen Jahren in London gegründeten Ibn-Khaldun-Gesellschaft. Wir sind eine Vereinigung liberaler Exil-Muslime, vom eigenen Regime verfolgte oder vertriebene Professoren für Islamwissenschaft, Literaten und andere islamische Gelehrte. Wir treten weltweit für einen aufgeklärten Islam und für eine demokratische und plurale, ja säkulare islamische Staatsordnung ein und kämpfen gegen den radikalen und gewaltbereiten Islamismus, gegen Missstände in islamischen Staaten wie den Bürgerkrieg in Algerien, den Sklavenhandel im Sudan, die Entrechtung der Frau und gegen die Unterdrückung von Minderheiten. Darüber hinaus befinden wir uns über Kongresse und Bildungsarbeit im Dialog mit der nichtislamischen Welt. Denn eines unserer Hauptziele ist die Versöhnung zwischen den Religionen und Kulturen und damit Völkerverständigung. Ich selbst bin in Berlin derzeit Stipendiat im neuen Berliner Dag-Hammerskjöld-Friedensforschungsinstitut, und eine meiner christlichen Gesprächspartnerinnen in der hiesigen Region ist ebendiese lutherischevangelische Pastorin in Dregkwitz, deren Gemeinde die Kopie des Fastentuchs besitzt.»
«Aber als Muslim lehnen Sie die einseitig christliche Darstellung der Heilgeschichte ab?», brachte de Monti das Gespräch wieder auf Karimis religiöse Kritik zurück.
«Ja, aber trotzdem finde ich einige Aspekte sehr interessant. Denn ungeachtet der Prägung der Bilderfolge durch den Geist oder vielmehr Ungeist der totalitären, mittelalterlichen Kirche bleibt für uns Muslime besonders die Schöpfungsgeschichte im Ersten Buch Mosis als solche immer eine zentrale, religiöse Wahrheit. Und auch alle wichtigen, biblischen Figuren von Adam über Noah, Abraham und dessen Nachkommen, vor allem sein Erstgeborener Ismael, unser Stammvater wohlgemerkt, bis hin zu Isa beziehungsweise Jesus, bleiben immer für uns große Propheten und Vorläufer des letzten und größten Propheten Mohammed. Dies ist, trotz aller ärgerlichen Wahrheitsverdrehungen und christlichen Vereinnahmungen in diesem Fastentuch, sicher Grund genug, sich auf das Gemeinsame zwischen den drei Bruderreligionen Abrahams zu besinnen.»
Karimi vollführte eine elegante Verbeugung, und in seine harten Züge glitt etwas Sanftes, fast ein wenig Glattes.
«Und wann glauben Sie, könnten Sie mir das Fastentuch in Dregkwitz zeigen?»
«Wenn Sie wünschen, bald.»
Im selben Augenblick sprang mit lautem Knall das Fenster neben der Wandkarte auf, und ein Windstoß fuhr so heftig durch den Raum, dass die Kristallkörper des Lüsters über dem Lesetisch klirrten. Der breite Holzrahmen des aufgestoßenen Fensters warf einen unheimlichen Schatten auf die von der Frühlingssonne beschienene Schlesienkarte, der de Monti zusammenfahren ließ. Er war froh, dass Karimi geistesgegenwärtig mit großen Schritten zum Fenster sprang und es mit einem energischen Griff wieder schloss.
Drei
Das Mittagslicht war unter der hartnäckig festsitzenden Hochnebeldecke so schwach, dass die evangelisch-lutherische Himmelfahrtskirche in der Dregkwitzer Altstadt mit dem sie umgebenden, mageren Rasenfleckchen und kleinwüchsigen Bäumen in ein trostloses Schwarzweiß getaucht war. Die erst kürzlich aus dem Winterschlaf erwachte Natur schien zu schwach, um gegen das sich überall ausbreitende, fahlgraue Licht anzukommen. Aurelio de Monti und Ahmed Karimi hatten ihr Auto bei der Brauerei an der Hauptstraße, die die Alt- und die Neustadt voneinander trennte, abgestellt, und sie waren durch die Grünanlagen und über den alten Marktplatz zur Kirche gelangt. Dort suchten sie den zur Sakristei führenden Seiteneingang des roten, gotischen Backsteingebäudes, in der die Pastorin Hendrike Hönig die beiden Besucher erwartete.
Als sie durch den Eingang in den kleinen Vorraum zur Sakristei traten, hörten sie durch die dünne Tür hindurch die bedrängt und unwillig klingende Stimme der Pastorin, die offenbar am Telefon irgendeinen unliebsamen Anrufer abwimmelte. Erst nach einer Weile öffnete sich die Tür und ein etwas dickerer, älterer Mann mit Hut und flüchtig übergeworfenem, schwarzem Mantel trat heraus. Auf seinem geröteten Gesicht drückte sich Verlegenheit aus, als er die beiden wartenden Besucher erblickte. Ihm auf den Fersen folgte die junge Pastorin, die ihre Verlegenheit mit einem süßlichen Lächeln zu überdecken verstand. Hastig verabschiedete sie den Herrn und begleitete ihn bis zur Außentür, um sich danach ihren neuen Besuchern zuzuwenden.
«Ich bitte zu entschuldigen, wenn wir vielleicht ein bisschen zu zeitig gekommen sind», begrüßte Karimi die Pastorin mit einer kurzen Verbeugung.
«Wirklich keine Ursache», antwortete diese, Karimi auch ihre Hand entgegenstreckend. «Ich muss mich entschuldigen, weil eine kurzfristig angesetzte Besprechung mit meinem Amtsbruder Eberle aus dem Nachbarort und ein dringendes Anliegen meines Mannes doch mehr Zeit in Anspruch genommen haben als erwartet. Und das ist also Herr Generalmusikdirektor de Monti … wie sehr ich mich freue.»
Sie blickte de Monti an, als würde sie ihn schon lange kennen, und reichte ihm die Hand. Daraufhin bat sie die beiden Herren in die sehr kleine und, wegen der winzigen Fenster, dunkle Sakristei.
Obwohl Aurelio de Monti so schnell wie möglich das Fastentuch sehen wollte, fühlte er sich auf Anhieb von der Erscheinung der etwa dreißigjährigen Frau angezogen. Trotz ihrer leicht nach vorn fallenden Schultern wirkte sie groß. Sie war sehr schlank, fast schon dürr, und ihr überaus schmales und blasses Gesicht auf dem langen und dünnen, schneeweißen Hals vermittelte einen fragilen und leidenden Eindruck. Dieser wurde durch einen melancholisch ergebenen Blick ihrer von den Lidern halb verdeckten, leuchtend graublauen Augen und den engelhaft sanften Klang ihrer etwas singenden Stimme noch verstärkt! Doch ihr werbendes Lächeln wirkte wie festgefroren. Der für eine geistliche Würdenträgerin schon fast frivol kurze, marineblaue Rock zeugte von damenhafter Eleganz und geschmackvoller Einfachheit zugleich. Die dürren und etwas krummen Beine und die auffallend ungepflegten, kurzen, dunklen Haare mit lieblosem Schnitt schienen die vornehme Erscheinung geradezu absichtlich wieder zunichtemachen zu wollen. De Monti folgte ihr mit einer ihn selbst überraschenden Faszination und Neugierde in die Sakristei. Irritiert bemerkte er, dass Hendrike Hönig sofort nach dem Betreten der Sakristei mit blitzschnellem und geschickt verstohlenem Griff zwei verdächtig nahe beieinanderstehende Stühle am Tisch auseinanderplatzierte, um sich dann augenblicklich wieder mit ihrem bezaubernden Lächeln ihren beiden Gästen zuzuwenden.
«Wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, interessiert sich Herr de Monti für das Fastentuch. Er ist gerade mit der Überarbeitung eines Oratoriumfragments beschäftigt, das den Turmbau zu Babel thematisiert», erläuterte Karimi. «Ich selber muss mich leider für ein halbes Stündchen entschuldigen, weil ich hier noch einen kurzen, anderen Termin habe. Wir treffen uns dann in der Kirche beim Tuch.»
Er verabschiedete sich.
«Wollen Sie mir nicht dieses interessante, biblische Oratorium erläutern? Bitte setzen Sie sich doch», bot Hendrike Hönig an und deutete auf einen der eben auseinandergerückten Stühle.
De Monti lächelte verlegen und setzte sich. Er öffnete nur den Reißverschluss seines Blazers und behielt auch den um seine Schultern hängenden, langen, schwarzen Schal an. Er ärgerte sich, dass er seinen Hut im Auto vergessen hatte, denn er kam sich ohne ihn etwas nackt und schutzlos vor.
Während Hendrike Hönig sich auf den anderen Stuhl setzte, fiel de Monti die ihm gegenüberstehende, niedrige und nur zur Hälfte mit Büchern gefüllte Vitrine auf, deren dunkle Farbe gut zur düsteren Atmosphäre der Sakristei passte. Auf der Vitrine stand eine leere Blumenvase.
De Monti erzählte als Erstes von seiner unverhofften Entdeckung des «Babylon»-Fragments in der Görlitzer Bibliothek und von seiner eindrucksvollen, ersten Begegnung mit Ahmed Karimi, der ihn dann auf das vielversprechende Zittauer Fastentuch und dessen Leinenkopie in Dregkwitz aufmerksam gemacht hatte. Dann erklärte er Aufbau und Struktur des Werks. Je länger er sprach, desto genussvoller schmückte er seine Erläuterungen aus und zögerte deren Abschluss hinaus, weil er von Hendrike Hönigs Augen das besondere Wohlgefallen und das wachsende Interesse ablas, mit dem sie seine Ausführungen aufnahm.
«Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich geehrt fühle, einer Persönlichkeit wie Ihnen zu begegnen», schwärmte sie, als er seine Erklärungen beendet hatte.
«Könnten wir uns jetzt das Fastentuch ansehen?», fragte de Monti. «Denn ich muss heute noch weiter nach Berlin.»
«Berlin … Ach, wie ich Sie beneide … Wann kommt unsereins schon mal raus?», jammerte die Pastorin.
«Ich besuche dort nur meinen Sohn, der in Berlin studiert, übers Wochenende», erklärte er. «Vor kurzem habe ich ihm geholfen, sein Studentenapartment einzurichten. Er fühlt sich sehr wohl in Berlin, und er fährt deshalb auch nur einmal im Monat zu seiner Mutter nach Frankreich.»
Aurelio bemerkte, wie Hendrike Hönig aufhorchte. «Sie können sich glücklich schätzen, Kinder zu haben», ließ sie ihren Charme spielen.