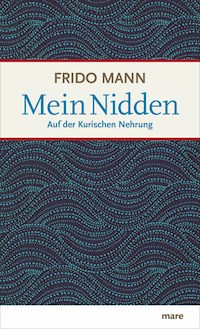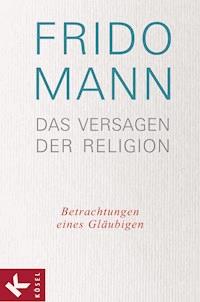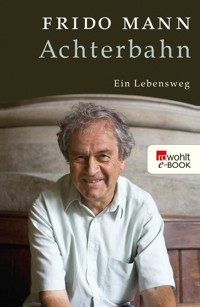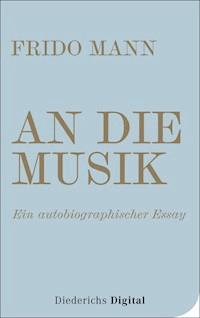12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Christine Mann, Tochter von Werner Heisenberg, und Frido Mann, Enkel von Thomas Mann, zeigen in ihrem gemeinsamen Buch ›Es werde Licht. Die Einheit von Geist und Materie in der Quantenphysik‹, wie der Umbruch in den Naturwissenschaften durch die Quantentheorie gravierende – und gute – Folgen für unser Denken und Handeln hat: Der Gegensatz von Idealismus und Materialismus wird überwunden, eine ganzheitliche Sicht der Welt und des Menschen wird möglich. Eine verständliche Erklärung der bahnbrechenden Einsichten der Quantentheorie und ein eindringlicher sowie persönlicher Aufruf zu einem neuen Menschenbild in der Naturwissenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Frido Mann | Christine Mann
Es werde Licht!
Die Einheit von Geist und Materie in der Quantenphysik
Über dieses Buch
Christine Mann, Tochter von Werner Heisenberg, und Frido Mann, Enkel von Thomas Mann, zeigen in ihrem gemeinsamen Buch, wie der Umbruch in den Naturwissenschaften durch die Quantentheorie gravierende – und gute – Folgen für unser Denken und Handeln hat: Der Gegensatz von Idealismus und Materialismus wird überwunden, eine ganzheitliche Sicht der Welt und des Menschen wird möglich. Eine verständliche Erklärung der bahnbrechenden Einsichten der Quantentheorie und ein eindringlicher und persönlicher Aufruf zu einem neuen Menschenbild in der Naturwissenschaft.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Frido Mann, geboren 1940 in Monterey/Kalifornien, arbeitete nach dem Studium der Musik, der Katholischen Theologie und der Psychologie viele Jahre als klinischer Psychologe in Münster, Leipzig und Prag. Er lebt heute als freier Schriftsteller in München. Zuletzt sind von ihm erschienen ›Mein Nidden. Auf der Kurischen Nehrung‹, ›Das Versagen der Religion. Betrachtungen eines Gläubigen‹ und ›An die Musik. Ein autobiographischer Essay‹.
Als zweitjüngste Tochter des Physikers Werner Heisenberg befasste sich Christine Mann schon früh mit dem Verhältnis von Physik und Theologie. Nach einigen Semestern Theologiestudium in Tübingen und Heidelberg wechselte sie zum Studium der Pädagogik und Psychologie und leitete schließlich eine Schulpsychologische Praxis.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490282-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Zitat
I. Zur heutigen Situation
Eingangsszenarium: Forschung im Zwielicht
Sackgasse oder neue Wege?
II. Die Entwicklung der Naturbetrachtung und Naturwissenschaft vergangener Epochen in Spiralbewegungen
Astronomie als Fähigkeit der Priester in der vorchristlichen Antike
Vernunftbetonte Naturforschung und Naturphilosophie im alten Griechenland
Die Finsternis frühchristlicher Naturwissenschaftsfeindlichkeit
Christlich-theologische Wegbereiter des naturwissenschaftlichen Denkens im ausgehenden Mittelalter im Visier kirchlicher Kontrolle
Das »Buch der Natur« bzw. das »Buch des Himmels« als Erweiterung göttlicher Offenbarung
Materialismus und Determinismus in der klassischen Physik. Die Cartesische Trennung von Materie und Geist
Die Relativitätstheorie als beginnende Öffnung zu einem neuen Weltbild
III. Die Revolution der Quantenphysik
Die neue Rolle des Beobachters bei der experimentellen Naturbeobachtung. Die Komplementarität von Impuls (Wellenaspekt) und Ort (Teilchenaspekt) (»Kopenhagener Deutung«)
Die Natur als ganzheitliches Beziehungsgefüge und als Vielfalt von Möglichkeiten
Die technisch ökonomische Nutzung der Quantenphysik
Unterschiedliche Perspektiven bei der Beschäftigung mit der Quantenphysik
IV. Quanteninformation als Urprinzip allen Seins (Protyposis)
Materie als kondensierte Information
Leben als bedeutungsvolle Information
Bewusstsein als sich selbst erkennende Information
Elektromagnetische Wellen bzw. Lichtquanten (Photonen) als »Träger« des Bewusstseins
V. Kosmische Dimensionen von Wahrnehmung, Erinnerung und Erleben als elektromagnetische Quanteninformationsverarbeitung
Das Ende des Dualismus
Intuition, Inspiration und Phantasie
Fernwahrnehmung und Fernwirkung
Kosmische Verbindungen
Existentielle Tiefenerfahrungen und religiöse Eingebung
VI. Konsequenzen aus der neuen Sichtweise
Der Tod – das Ende?
Willensfreiheit?
Kreativität, Kooperation und konstellatives Denken
Lernziel »Homo Empathicus«
Alle Religionen, Künste und Wissenschaften sind Zweige desselben Baumes
Albert Einstein
I.Zur heutigen Situation
Eingangsszenarium: Forschung im Zwielicht
Aus einem kürzlich gehaltenen Interview mit dem emeritierten Biologen Professor P. über dessen langes und bewegtes akademisches Leben. Wir erhoffen uns von ihm eine Stellungnahme zu der heute weitverbreiteten Sorge um die Situation naturwissenschaftlicher Forschung, welcher vielfach eine babylonische Fachsprachenverwirrung, Konkurrenzdenken und individualistische Vereinzelung nachgesagt wird.
Professor P. berichtet uns als Erstes vom prägenden Anfang seiner Laufbahn Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als der noch junge Doktorand als Mitglied eines aus anderen Doktoranden, Diplomanden, Praktikanten, Post-Docs und einigen Gastwissenschaftlern bestehenden molekularbiologischen Arbeitskreises im biochemischen Institut einer renommierten deutschen Universität forschte. Außer den Assistenzkräften und dem Projektleiter, der zugleich auch als Doktorvater fungierte, hatten alle befristete Arbeitsverträge. In diesem Arbeitskreis wurden, ähnlich wie in vielen anderen in- und ausländischen Forschungseinrichtungen, die Stoffwechselprozesse sowohl in Bakterienzellen als auch in den Viren untersucht, die in die Bakterien eingedrungen waren. Das Ziel war es, auf biochemischem Weg den zellulären Bedingungen für die Entstehung des Lebens nachzugehen. Man hoffte damit auch einen Beitrag zum damals ganz neuen Forschungsgebiet der Gentechnologie zu leisten. Deshalb herrschte in der damaligen Phase der biochemischen Forschung eine besondere Aufbruchstimmung, die von allen Beteiligten als überaus motivierend und spannend erlebt wurde. Entsprechend stark ausgeprägt war gerade unter den Mitgliedern dieses Arbeitskreises das Bedürfnis nach gegenseitigem Austausch über die von ihnen laufend neu erzielten Ergebnisse in ihren Untersuchungen des Bakterien-/Bakteriophagensystems.
Das Großlabor der etwa zwanzig Mann umfassenden Arbeitsgruppe war in dem in der Innenstadt gelegenen alten biochemischen Institut unter räumlich engen und technisch mangelhaften Bedingungen im Souterrain des Gebäudes untergebracht. Die Mitglieder des Arbeitskreises konnten sich während ihrer Arbeit unkompliziert und rasch über ihre Ergebnisse und über damit verbundene Probleme miteinander verständigen und sich gegebenenfalls auch gegenseitig helfen. Die vielen spontan zustande kommenden, anregenden Gespräche wurden so als angenehmer, in gewisser Weise auch entschädigender Ausgleich für die etwas unbequemen Verhältnisse empfunden, und sie gaben dem Einzelnen in der Gruppe ein gewisses Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, die dazu angetan war, die allgemeine Arbeitsmotivation zu stärken.
Ganz anders dann nach dem Umzug 1970 in das inzwischen fertiggestellte, neue Forschungsinstitut ziemlich weit außerhalb der Stadt. Es war ein imposanter, hochmoderner Beton- und Glasbau, labyrinthartig verschachtelt, von hohen Säulen getragen und mit mehreren seitlichen Treppenhäusern, Geheimgängen und überkuppelten Lichthöfen versehen. Das Institut war, inmitten einer idyllischen, kaum besiedelten Landschaft von einer künstlichen Parkanlage mit Springbrunnen umgeben. Der Forschungstrakt für die betreffende Arbeitsgruppe lag vom Haupteingang weit entfernt am anderen Ende des Gebäudes irgendwo in der zweitobersten Etage. Zur Überraschung der Arbeitsgruppe zeigte sich beim Einzug in das Institut, dass anstelle des bisherigen einen großen Gemeinschaftslabors jeder Forscher nun über ein eigenes geräumiges und wegen der großen Fenster sehr helles Labor verfügte, welches, hochmodern, mit einem Abzug eingerichtet war. Jedem Forscher wurde auch eine eigene Technische Assistentin zugewiesen, die sämtliche Routinearbeiten zu übernehmen hatte wie Puffer und Bakterienkulturen ansetzen und diese mit Viren animpfen usw. Die im Erdgeschoss unter einem der hohen, verglasten Lichthöfe elegant angelegte und vor Sauberkeit blitzende Kantine mit erstklassiger Verpflegung war so groß und verwinkelt angelegt, dass man sich allein dort schon fast verlaufen konnte.
Anfangs noch vom Glanz des neuen Instituts geblendet, freuten sich die Mitglieder des Arbeitskreises bei ihrem Einzug in die neuen Räume über die ihnen dort gebotenen, traumhaften Arbeitsbedingungen. Doch es dauerte nicht lange, da beschlich sie das ungute Gefühl, alle zusammen in einen Goldenen Käfig eingesperrt worden zu sein. Nach relativ kurzer Zeit begannen sie sich, besonders gegen Ende eines anstrengenden Arbeitstages, auf ihrer Forschungsinsel einsam und ziemlich isoliert zu fühlen. Um, wie im alten Institut, mit ihren Kollegen sprechen zu können, mussten sie diese oft am anderen Ende des langen Flurs auf deren Insel besuchen. Dieser Aufwand und diese Hürden führten allmählich dazu, dass das Kontaktbedürfnis der voneinander praktisch Abgeschnittenen nachließ, weil jeder sich an das Alleinsein und sein Dasein als Einzelkämpfer zu gewöhnen begann. Verstärkt wurde dies auch dadurch, dass, anders als früher, der das Projekt leitende Professor jetzt auffallend häufig bei seinen einzelnen Mitarbeitern aufkreuzte und sie mit gespitzten Ohren nach dem Stand ihrer Untersuchung ausfragte und deren Ergebnisse im Hinblick auf eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift penibel überprüfte. Der Professor gebrauchte dafür gern die unsympathische Formulierung »die Ergebnisse nachkochen«. Die frühere rege Interaktion unter den Mitgliedern der Arbeitsgruppe auf Augenhöhe wurde damit weitgehend von der Dyade zwischen Professor und dessen von ihm fachlich abhängigen Mitarbeitern abgelöst. Auf diese Weise verwandelte sich der ursprüngliche Forschungseifer der jungen Wissenschaftler, der in erster Linie der Sache galt, fast unmerklich in ein egoistisches Konkurrenzstreben, verbunden mit entsprechenden Abschottungstendenzen. Dies hatte zur Folge, dass auch die gegenseitigen Besuche von Insel zu Insel langsam immer seltener wurden und schließlich ganz einschliefen. Bei den in ihrer Arbeitsklause vor sich hin forschenden Mitarbeitern machte sich zunehmend ein von Leistungsdruck erfülltes Wettkampfdenken bemerkbar. Die Priorität in der Forschung lag immer weniger im neugierigen und ehrfurchtsvollen Erkunden naturwissenschaftlicher Wahrheit, sondern darin, möglichst rasch neue veröffentlichungswürdige Forschungsergebnisse zu liefern, die die größte Chance hatten, von irgendwelchen Stiftungen oder Sponsoren finanziell gefördert und womöglich mit einem Forschungspreis gekrönt zu werden.
Dies wiederum führte dazu, dass nicht nur die Motivation, sich mit den Arbeitskollegen über neueste Forschungsergebnisse auszutauschen, deutlich sank. Vielmehr machte sich eine zumindest stillschweigende Übereinkunft breit, Wissen sowohl intern als auch erst recht extern bewusst zurückzuhalten, um, mit allen daraus fließenden finanziellen und karrieristischen Vorteilen, möglichst der »Erste« zu sein.
»Der Arbeitsdruck war so groß«, so klagte Professor P. uns gegenüber, »dass ich und die, mit denen ich darüber sprach, oft so erschöpft waren, dass wir alles stehen und liegen ließen, nur um für einige Minuten tief Luft zu holen und sehnsüchtig durchs Fenster ins Grüne zu blicken, obwohl in der idyllischen Einöde um uns herum kaum etwas zu sehen war, außer gelegentlich vorbeifahrende Autos und noch seltener vorbeilaufende Menschen. Und da jeder fast nur für sich allein an seinem Arbeitsplatz klebte und wie besessen, oft bis tief in die Nacht hinein forschte, begegnete man auch in den Gängen oder im Treppenhaus kaum einer Seele. Sogar die Kantine war, außer in der Mittagszeit, meistens gespenstisch leer und wirkte, wenn nicht manchmal der eine oder andere Mitarbeiter kurz mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen Stärkung suchte, in ihrem sterilen Glanz wie tot.«
»Das war schon 1970 so«, meinte Professor P. nach einer kurzen Pause mit vielsagendem Kopfnicken.
»Sie meinen, dass damals im Vergleich zu heute noch eher milde Zustände herrschten?«, wollten wir wissen.
»Man wird da sicherlich differenzieren müssen. Aber nach meinen Erfahrungen kommt heute noch prinzipiell dazu, dass an den Universitäten in großen Mengen auch Drittmittel eingeworben werden müssen und die Forscher noch mehr als früher auf Fördergelder angewiesen sind. Das nachgerade alte amerikanische Prinzip Publish or Perish ist schon lange über den großen Teich zu uns hinübergeschwappt. In den USA ist die technische Ausstattung der Forschungsinstitute zwar noch luxuriöser und da fließen auch noch ganz andere Sponsorengelder als bei uns hier. Aber umso mehr zeigt sich dort, dass die Verbindung aus Komfort und Isolation der Kreativität in der Forschung schadet, sie vielleicht sogar lähmt.«
Abschließend berichtete Professor P. noch vom Ende seiner Doktorandenzeit in dem besagten Forschungsinstitut. Irgendwann stand eine Veröffentlichung seiner Untersuchung an. Das Problem war nur, dass seine Ergebnisse denen seines Projektleiters und Doktorvaters regelrecht widersprachen. Trotzdem schickte er seine fertiggestellte Arbeit an eine besonders renommierte Zeitschrift (er nannte sie »das Mekka unter unseren Fachzeitschriften«). Bald bekam er diese jedoch wieder zurückgeschickt mit der Bitte um eine Revision der Untersuchung mit einer neuen Versuchsreihe. Er tat dies, gelangte jedoch wieder genau zu demselben, die Untersuchung seines Doktorvaters widerlegenden Resultat. Seine Arbeit mit neuen Stichproben schickte er wieder an dieselbe Zeitschriftenredaktion und bekam sie wieder mit der Bitte um eine Wiederholung des Experiments mit noch weiteren Messreihen zurück. Dieses Hin und Her setzte sich so oft fort, bis eines Tages sein Projektleiter und Doktorvater aufgeregt bei ihm auftauchte und ihm mitteilte, er habe soeben über geheime Kanäle erfahren, dass in einem führenden molekularbiologischen Forschungsinstitut in den USA Ergebnisse erzielt worden wären, die genau mit den seinigen, also mit denen des Doktoranden (unseres späteren Professors P.) übereinstimmten. Und er forderte seinen Doktoranden auf, jetzt so bald wie möglich mit einer Veröffentlichung seiner Ergebnisse den Amerikanern zuvorzukommen. Prompt erschien seine Arbeit anstandslos in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift – mit dem Projektleiter als Mitautor.
Jetzt, aus der Distanz von vierzig Jahren, gab Professor P. diese Episode mit einer gewissen Belustigung, aber auch einem abschätzigen Kopfschütteln über die Rücksichtslosigkeit und Unverfrorenheit wieder, die ihm damals widerfahren war.
Und dann? Wie ging es weiter mit seiner für die Promotion einzureichenden Dissertation, die ja im Wesentlichen aus den Ergebnissen seiner mehrjährigen Untersuchungen bestand? Sah sein blamierter Doktorvater sich dazu veranlasst, seinem Doktoranden bei diesem Promotionsverfahren irgendwelche Steine in den Weg zu legen?
Nein, es kam noch schlimmer: Seine Arbeit wurde von seinem Betreuer und Projektleiter als Promotionsarbeit angenommen, aber dieser gab dann bei jeder Gelegenheit in der Öffentlichkeit die Ergebnisse seines Doktoranden als »Fortführung seiner eigenen Arbeit« aus. Er selbst war von der Schamlosigkeit, ja Wissenschaftskriminalität seitens seines Abteilungsleiters, wie er dies uns gegenüber nannte, und vom ganzen Forschungsbetrieb in diesem Institut so angewidert gewesen, dass er dieses bald nach seiner Promotion verließ und ein zusätzliches Medizinstudium begann. Dort promovierte er schließlich im Bereich der Klinischen Immunologie zum Dr.med. Bereits während seines Medizinstudiums gelangten an ihn aus Fachkreisen der sich inzwischen immer rasanter entwickelnden Gentechnologie wiederholt Anfragen bezüglich seiner früheren, molekularbiologischen Dissertation. Dies führte dazu, dass er, kurz nach seiner medizinischen Promotion, einem Ruf auf einen Lehrstuhl für biologische Immungenetik folgte. Der Hauptgrund für diesen Wechsel zurück in sein ursprüngliches Fachgebiet war gewesen, dass es ihn nach dieser langen Pause wieder in die biologische Forschung zurückzog, mit der er angefangen hatte. Er war älter und nachdenklicher geworden und erlebte dann auch im Lauf der langen folgenden Jahre immer wieder die Freude, mit der ein zum Forschen geborener Wissenschaftler erfüllt werden kann und die so groß ist, dass er sich durch missliche Begleitumstände, die immer wieder auftreten können, von seiner Tätigkeit nicht abhalten lässt.
Diese Freude an den eigenen Entdeckungen, diesen unbändigen Drang, unsere Welt mit zu erforschen, um sie an einem wichtigen Punkt noch besser zu verstehen und damit der Wahrheit über unser Dasein näherzukommen, erlebten wir auch immer wieder besonders ausgeprägt bei unserem Vater/Schwiegervater, dem Physiker Werner Heisenberg. Wenn wir ihn fragten, was denn seine Quantenmechanik genau beinhalte, versuchte er es uns, unserem Auffassungsvermögen entsprechend, zu erklären. Und gelegentlich beendete er seine Ausführungen mit dem strahlend geäußerten Spruch: »Da habe ich dem Herrgott ein kleines bisschen über die Schulter geguckt.« Und das zu tun, auf diese Weise der Wahrheit etwas näherzukommen, war für ihn ein ganz wichtiger Sinn seines Lebens. Er ging selten mit seinen Kindern in die Kirche, und wenn diese ihn fragten, ob er denn gar nicht an Gott glaube, meinte er: »So einfach ist das nicht.« Dann erklärte er uns, dass er nach und nach seine Gottesvorstellung in eine etwas abstraktere Richtung weiter entwickelt habe, und diese blieb für ihn der Kompass seines Lebens. Daneben erlebten wir in dem Bekanntenkreis unseres Vaters natürlich auch Menschen, die in der angewandten Forschung arbeiteten und von dem starken Wunsch erfüllt waren, damit etwas für die Menschen, für ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit zu tun. Auch für diese Menschen war dies ein Sinn und damit ein fester Halt in ihrem Leben.
Diese Erfahrung war ein wichtiger Anstoß dafür, in meinem Buch (F.M.) »Das Versagen der Religion« auch Naturerleben, Naturbetrachtung und Naturforschung als eine der zentralen Möglichkeiten für eine innere Sinnfindung und Werteorientierung darzustellen. Verstärkt wurde diese Überzeugung durch das Buch von Grichka und Igor Bogdanow: »Reise zu der Stunde Null. Die Ursprünge des Universums« (Stuttgart 2008). Dort werden von vielen Physikern oder Astronomen Bekenntnisse und Sprüche als Zeugnis dafür zitiert, wie sehr sie aus ihrer Wissenschaft einen bis ins Religiöse gehenden inneren Sinn zu beziehen vermögen. So äußert etwa Albert Einstein: »Man gewinnt die Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist offenbart – ein Geist, der dem des Menschen bei weitem überlegen ist und gegenüber dem wir uns angesichts unserer bescheidenen Kräfte ärmlich vorkommen müssen.« Oder: »Das kosmische religiöse Gefühl ist das stärkste und nobelste Motiv der wissenschaftlichen Forschung.« Ähnlich urteilt der elsässische Atomphysiker und Nobelpreisträger Alfred Kastler: »Für mich als Physiker ist der Gedanke absurd, das Universum könne ›zufällig‹ entstanden sein.«[1] Und dass auch, ohne den Beruf des Naturforschers auszuüben, allein die Betrachtung der Natur zu überwältigenden Erlebnissen führen kann, die einen Hinweis auf eine Transzendenz zu enthalten scheinen und dem eigenen Leben einen Sinn geben, wird etwa in dem Ausspruch eines Theologen deutlich: »Die Sonne! Kein Laut in der grenzenlosen Weite. Außer dem Gesang der Sonne, den die Ohren nicht, wohl aber die Augen hören. … Wie tief begreiflich, dass die alten Völker in der Sonne eine Gottheit sahen … Mancher Christ, der die Sonne für einen Himmelskörper hält und sonst nichts, empfindet heidnischer als jene Alten, die vor ihr auf die Knie fielen.«[2] So waren beispielsweise auch für den französischen Komponisten Claude Debussy zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts seine überhaupt nicht kirchlich- christlichen, sondern stark naturbezogenen religiösen Gefühle bezeichnend. So ließ er sich manchmal beim ausgiebigen Betrachten von farbenstarken Sonnenuntergängen so sehr überwältigen, dass er mit dem Himmel über ihm eine gebetsähnliche Zwiesprache hielt und auch einmal gesagt haben soll, die Natur sei seine Religion. Ebenso sind uns auch Malerinnen und Maler bekannt, die nicht in traditioneller Weise an einen persönlichen Gott glauben, das Malen einer besonders schönen Landschaft jedoch als eine Art Gottesdienst betrachten, das ihrem Leben einen Sinn gibt.
Sackgasse oder neue Wege?
Im Lauf der Lektüre dieses Buches wird sich zeigen, dass der Wissenschaftsbetrieb sowie das Handeln und die Grundeinstellung des einzelnen Wissenschaftlers abhängig sind von dem in unserer Gesellschaft vorherrschenden Weltbild und den damit verbundenen Grundwerten. In den anstehenden Kapiteln werden wir deutlich zu machen versuchen, dass die vorhin exemplarisch beschriebene, von unkommunikativer Vereinzelung und Konkurrenzstreben bestimmte Arbeitsatmosphäre in dem betreffenden biologischen Forschungsinstitut durchaus dem Mainstream heutiger naturwissenschaftlicher Denkweise entspricht.
In dieser dominiert nach wie vor eine grob materialistische Anschauung von der Beschaffenheit unserer Natur. Mit dieser Anschauung einher geht, dass geistige Werte und ethische Normen nur als losgelöst von diesem materialistischen Weltbild gesehen werden und daher innerhalb naturwissenschaftlicher Forschung nicht thematisiert werden. Dieses heute weitverbreitete dualistische Denken ist das Ergebnis einer sich über Jahrtausende hinziehenden, unterschiedlichen Ausprägung des wissenschaftlichen und vorwissenschaftlichen Weltbilds, in dem das Pendel wiederholt zwischen den beiden extremen Alternativen »nur Geist« oder »nur Materie« ausgeschlagen hat.
Das heutige materialistische Weltbild ist eine Reaktion einer am Anfang der Neuzeit einsetzenden Emanzipation aus der jahrhundertelangen kirchlichen Bevormundung unseres Denkens. Diese fußte auf einem idealistischen, insgesamt aufklärungs- und naturwissenschaftsfeindlichen theologischen Weltbild, welches im Mittelalter durch scharfe Sanktionen gegen allzu eifrig naturwissenschaftlich forschende Linienabweichler gestützt wurde. Dieses Primat des geistig Religiösen wiederum hatte von der jungen christlichen Kirche im Altertum und vor allem in den frühesten christlichen Gemeinden mit hohem Blutzoll gegen das antireligiöse und rationalistisch pragmatische Machtdenken des Römischen Reichs und der griechischen Kultur hart erkämpft werden müssen. Auf diese Weise lässt sich die Kulturgeschichte des Abendlands noch weiter rückwärts verfolgen und schließlich zu einem Bild formen, welches sich bis heute mit einer Art Spiralbewegung, eines epochalen Wechsels zwischen Gegensätzen mit einer in jeder neuen Phase differenzierteren Sichtweise vergleichen lässt.
Derzeit befinden wir uns erneut an einer Weggabelung. Die in den heutigen Naturwissenschaften verbreitete, noch aus der frühen Neuzeit stammende Vorstellung von Elementarteilchen als kleinen Materiekrümelchen unserer Natur droht inzwischen ähnlich zu verkrusten wie am Ende des Mittelalters das lückenlos in sich geschlossene und von der kirchlichen Inquisition überwachte Theoriengebäude der spätscholastischen Theologie. Gegen das heute immer noch hartnäckig unseren Wissenschaftsbetrieb beherrschende, einseitig materialistische Weltbild stehen die diesem diametral entgegengesetzten, neuen Erkenntnisse der Quantenphysik. Obwohl im frühen zwanzigsten Jahrhundert experimentell voll bestätigt, ist die Quantenphysik in ihrer physikalischen und philosophischen Tragweite heute immer noch in weiten Kreisen unverstanden geblieben und scheint in Anbetracht ihrer herausfordernden und gedanklich unbequemen abstrakten Struktur auch gern abgewehrt oder ignoriert zu werden.
Das zentrale Thema des Buches wird sein, den durch die Quantentheorie herbeigeführten Umbruch in der Naturwissenschaft und die daraus resultierenden Folgen für unser Denken und Handeln aufzuzeigen. Dabei wird die sowohl weltanschauliche als auch technische Bedeutung der Quantenphysik in unserer Gesellschaft zu erörtern sein. Diese Reflexion soll nach Möglichkeit dazu beitragen, den falschen dualistischen Gegensatz zwischen »Idealismus« und »Materialismus« aufzulösen.
Seit Beginn der Philosophie haben sich viele bedeutende Philosophen über die Frage den Kopf zerbrochen, wie Geist und Materie, wie Leib und Seele zusammenhängen. Es gab immer die verschiedenen Lager: Die einen, die meinten, dass der Leib aus Materie geformt, der Geist, das Leben aber den Lebewesen von Gott eingehaucht sei und dass Materie und Geist damit zwei völlig verschiedene, unabhängig voneinander existierende Entitäten sind. Dagegen standen andere Philosophen, wie etwa Platon, der darlegte, dass die Grundlage der Welt geistig sei, dass wir aber nur einen Schatten dieses Geistigen wahrnehmen könnten und dies als die Wirklichkeit deuten würden. Mit Beginn der Neuzeit entstand die Naturwissenschaft, die Methoden entwickelte, die Natur genauer, großenteils durch Experimente, zu erforschen und zu berechnen. Dadurch konzentrierten sich die Menschen immer stärker auf die beobachtbare Materie. Und da diese Art Forschung zu vorher unvorstellbaren Fortschritten in Technik und Medizin führte, entstand die Überzeugung, dass diese Weltbetrachtung richtig und alles eigentlich nur Materie sei. Diese Sichtweise dominiert mehr oder weniger bis heute die Forschungsmethoden und die Art der Interpretation empirischer Untersuchungsergebnisse innerhalb der Naturwissenschaften, z.B. in den verschiedenen Zweigen in der gegenwärtigen Biologie. Diese betrachtet Geist und Bewusstsein mehrheitlich immer noch als Epiphänomen neurobiologischer Vorgänge. Dementsprechend gilt in der biologischen Wissenschaft ein materialistisches Weltbild als vorherrschendes Prinzip. Zu den Axiomen der Naturwissenschaften gehört der sogenannte Methodische Atheismus, d.h. Gott darf weder als Lückenbüßer für noch nicht vollständig passende physikalische Gesetze noch als Ursache von empirischen Ereignissen genutzt werden. Jede zusätzliche Suche eines Biologen nach einem inneren Sinn und nach einer geistigen Werteorientierung oder gar nach religiösen Glaubensinhalten wird in diesem System eines materialistischen Monismus gern auf eine mit naturwissenschaftlichen Wahrheiten letztlich unvereinbare Privatsache des einzelnen »unbelehrbaren« Forschers reduziert. Und da die Wissenschaft aufgrund ihrer unbestreitbaren Erfolge für die Weiterentwicklung unserer Welt große Autorität genießt, hat auch ihre Ablehnung jeglicher Art von Transzendenz einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Denken der Menschen in unserer Gesellschaft allgemein. Nicht nur werden die Menschen dann in ihrer geistigen Orientierung verarmt, sondern auch die Wissenschaft verliert leicht ihre grundlegende Zielrichtung aus dem Auge, mit ihrer Wahrheitsfindung und dem technischen Fortschritt dem Wohl der Menschen zu dienen. Und sie erliegt schließlich der Gefahr, sich aus einem kurzsichtigen, sich oft verwerflich auswirkenden Fortschritts- und Erfolgsdenken heraus bei ihrer (etwa gentechnologischen) Forschungstätigkeit skrupellos über oberste moralische Prinzipien hinwegzusetzen mit der Bereitschaft, zugunsten ihrer wissenschaftlichen Erfolge gewisse Grundprinzipien der Menschenwürde zu verletzen.
Grundsätzlich anders sieht es aus mit der die Biologie und Chemie und damit jede Naturwissenschaft grundlegenden modernenPhysik. Hier haben sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts vor allem durch die Revolution der Quantenphysik neue Türen geöffnet. Deswegen konnte auch unser Vater/Schwiegervater begeistert davon berichten, dass die Grundlage unserer Welt eben nicht kleine Materieteilchen seien, die Atome, sondern dass unsere Materie letztlich aus Geistigem, aus wunderschönen mathematischen Strukturen besteht. Darüber hinaus konnten im Laufe der Weiterentwicklung der Quantenphysik bis in das 21. Jahrhundert hinein neue Wege beschritten werden, auch die Entstehung von Bewusstsein und Psyche, also das Geistige, naturwissenschaftlich zu erklären.
Die von der Quantenphysik wieder entdeckte enge Zusammengehörigkeit von Materie und Geist ist an sich nicht neu. Vielmehr wurde schon Jahrtausende lang in den Hochkulturen des Mittelalters und der Antike diese Auffassung immer wieder von einzelnen Persönlichkeiten, darunter auch experimentierfreudigen Theologen und Philosophen vertreten, auf die wir an gegebener Stelle zurückkommen werden. Deswegen währte, streng genommen, die Unterbrechung dieser ganzheitlichen Sichtweise zwischen der beginnenden Neuzeit und dem Paradigmenwechsel der Quantenphysik im beginnenden Atomzeitalter also nur wenige Jahrhunderte.
Auf diesem Hintergrund soll der grundlegende Aufbau der vorliegenden Schrift folgendermaßen aussehen:
Als Erstes werden wir die wechselhafte Geschichte des Verhältnisses von Wissenschaft und Religion bzw. des Verhältnisses von Natur- und Geisteswissenschaft überblicksweise von den Hochkulturen des Altertums bis heute nachzeichnen und dabei zeigen, wie stark dieses Wechselverhältnis die Kultur bis heute geprägt hat. Danach werden wir uns den neuen theoretischen Grundlagen der Quantenphysik des 20. und 21. Jahrhunderts zuwenden, die eine Basis ist für eine neue Zusammenschau von Materie und Geist. Aus dem Weltbild der Quantenphysik als der Physik der Möglichkeiten und der Beziehungen ergeben sich weitere spezielle Aspekte. Sie betreffen einmal die Naturwissenschaften selbst. Zum anderen erscheinen bei der Analyse der Wechselwirkung zwischen Gehirn und Bewusstsein unter quantenphysikalischem Aspekt bestimmte Phänomene menschlichen Erlebens, menschlicher Wahrnehmung und Erinnerung sowie gewisse individuelle und zwischenmenschliche Tiefenerfahrungen in einem neuen Licht. Auch bei der Reflexion weiterer existentieller Bereiche unseres Lebens wie etwa die Frage nach einer möglichen Weiterexistenz nach dem Tode oder die nach der Willensfreiheit, kann die Einbeziehung quantenphysikalischer Vorgänge neue Perspektiven eröffnen. Aus unseren Erörterungen folgen am Ende des Buches Forderungen nach sinnvollen kreativen und kooperativen Maßnahmen im Bereich von Kultur und Wissenschaft im Dienste des physischen und geistigen Überlebens unseres Planeten.
Dieses Buch bewegt sich gewissermaßen auf einer Gratwanderung zwischen einerseits empirisch gesicherten naturwissenschaftlichen Fakten, ohne primär eine naturwissenschaftliche Abhandlung zu sein, und andererseits weitgreifenden gedanklichen Schlussfolgerungen mit einer neuen Sicht des Bewusstseins. Dabei ist es das Ziel, die zwar scharf bleibenden, aber durch die moderne Quantenphysik auch sehr dünn gewordenen Grenzen zwischen Natur- und Geisteswissenschaft bzw. Naturwissenschaft und Philosophie, Spiritualität und Religion herauszuarbeiten. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig auch immer eine klare Absage an jede Form einer parawissenschaftlichen Esoterik oder gar eines abergläubischen Spiritismus. Deswegen werden wir im Entwicklungsfluss der heutigen Quantenphysik immer streng unterscheiden zwischen empirisch Bestätigtem und bisher noch hypothetisch Gebliebenem.
Die folgende, eigentliche Kernhypothese dieses Buchs wird sich erst langsam aus dessen Erörterungen herausbilden:
Nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch in Religion, Politik und Gesellschaft beherrscht in weiten Kreisen eine destruktive, oft lebensbedrohliche Haltung von Dogmatismus, Intoleranz und Enge und eine von Angst und Machtdenken diktierte, lernresistente Grundmentalität unseren Alltag. Diese mag mit dem kausalen Denken eines lückenlos in sich geschlossenen, deterministischen Systems der klassischen Physik auf der einen und auf der anderen Seite einem davon abgespaltenen, genauso in sich geschlossenen, starren System fundamentalistischer Religion und Moralvorstellungen kompatibel sein. Die Quantenphysik als Physik der Möglichkeiten und der ganzheitlichen Beziehungen passt jedoch nicht mehr zu dogmatisch deterministischen Grundhaltungen in religiösen, politischen und gesellschaftlichen Fragen. Sie bringt vielmehr eine völlig neue Chance eines grundlegenden Umdenkens und einer Öffnung zu einem flexibel weitblickenden und von Pluralität und Toleranz bestimmten Denken mit sich. Dieses Umdenken fordert uns Menschen zu einem fortwährenden zwischenmenschlichen Dialog auf sowie zu einem Austausch unterschiedlichster Positionen auf Augenhöhe. Jede Abgrenzung und kleingeistig hybride Rechthaberei und Exklusivität, wie sie heute überall noch anzutreffen ist, entspricht nicht dem Wesen unserer Welt und ist deshalb schädlich. Es ist zu hoffen, dass dieses neue Denken und seine vielfachen Konsequenzen langfristig ein Wegweiser sein können für ein für unser globales Überleben dringend gefordertes Umdenken.
II.Die Entwicklung der Naturbetrachtung und Naturwissenschaft vergangener Epochen in Spiralbewegungen
Astronomie als Fähigkeit der Priester in der vorchristlichen Antike
Schon in vorgeschichtlicher Zeit scheinen sich die Menschen für den Sternhimmel interessiert zu haben. In den aus der Zeit von 17000 bis 15000 v. Chr. stammenden Wandmalereien in der Höhle von Lascaux finden wir eine Darstellung des Sommerhimmels sowie einzelner Sternbilder. In der Jungsteinzeit war die Verwendung eines Kalenders auf der Grundlage von Kenntnissen über Mond, Sonnenbahn und vor allem über Jahreszeiten für die Verbesserung landwirtschaftlicher Kultur lebenswichtig. Mit diesem pragmatischen Alltagsaspekt eng verbunden war die religiöse Deutung von Himmelsphänomenen. Umgekehrt mag der Beginn des Ackerbaus auch die Ausbildung von Astralkulten und den eigentlichen Beginn der Astronomie gefördert haben. Die vor etwa 7000 Jahren errichtete Kreisgrabenanlage von Goseck an der Saale, also in dem damals noch angeblich völlig unkultivierten germanischen Raum, gilt als das älteste Sonnenobservatorium der Welt.
Von einer besonders eindrucksvollen und der wohl bekanntesten prähistorischen Kultstätte Europas zeugen heute noch Reste des an die 5000 Jahre alten und seit 1986 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörigen Bauwerks Stonehenge im südlichen England. Es gibt Gründe für die Annahme, dass Stonehenge, ursprünglich hauptsächlich als Begräbnisstätte genutzt, gleichzeitig auch ein vorzeitliches Observatorium mit dem Zweck einer optimalen zeitlichen Festlegung von Aussaat und Ernte darstellte. Denn das Bauwerk war so ausgerichtet, dass am Morgen des Mittsommertags die im Jahresverlauf am nördlichsten stehende Sonne genau so über einem besonderen Stein, dem Fersenstein, aufging, dass deren Strahlen in gerader Linie bis in die im Inneren liegende hufeisenförmige Anordnung von Steinen eindringen konnten. Aber auch die Wintersonnenwende und die Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche als die vier agrarwirtschaftlich wichtigsten Zeitpunkte des Jahres konnten mit Hilfe von dessen baulicher Anordnung klar bestimmt werden. Auf die kultische und astronomische Doppelnutzung von Stonehenge weist die kreisrunde Grabanlage hin, in der anscheinend die Elite des dortigen Volksstammes begraben wurde. Außerdem wurden in der Nähe große Feste gefeiert, ein schnurgerader Pilgerweg führte von dieser Feststätte zu den religiösen Steinringen in Stonehenge. Diese religiösen Feste waren so wichtig, dass zu ihnen Menschen sogar aus mehr als tausend Kilometer entfernten Gegenden in Schottland gepilgert sein sollen. Das heißt, Astronomie und Religion waren eng miteinander verbunden, und die religiösen Führer zeigten durch ihre genaue Himmelsbeobachtung und ihr daraus resultierendes Wissen zum Nutzen der Ackerbau betreibenden Bevölkerung ihre Autorität.
Es ist kaum vorstellbar, wie es die Menschen damals ohne die uns heute zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmittel fertiggebracht haben, diese riesigen Steine an ihren Ort in Stonehenge zu transportieren und aufzustellen. Im Dienste des religiösen Kults aktivierten die Menschen alle ihre Erfindungsgaben und taten gemeinsam ihr Bestes, um damit ihrem Gott zu dienen. In neuester Zeit gibt es sogar Vermutungen, dass dort auch Musik gemacht wurde und dass die kreishafte Anordnung der Steine mit Interferenzstrukturen bei musikalischen Darstellungen zusammenhängt.[1] So war der religiöse Kult ein entscheidender Motor für die Entwicklung einer Kultur, die dann später zur Errichtung wunderbarer, kunstvoller Steinbauten führte, wie wir sie etwa in Griechenland oder der Westtürkei bewundern.
Die Entdeckung der Bronze allerdings veränderte das Leben der Menschen so stark, dass die Priester von Stonehenge und damit diese Kultstätte – und wahrscheinlich auch die Kultstätte in Goseck – ihre Bedeutung verlor. Dass aber auch in der Bronzezeit die Himmelsbeobachtung eine große Rolle spielte, zeigt die vor wenigen Jahren erst gefundene, an die 4000 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra, eine Bronzeplatte mit einem Durchmesser von etwa 32 cm aus der Bronzezeit mit Einlagen aus Gold, die offenbar astronomische Phänomene, die im Zusammenhang mit Kalendern stehen, und Symbole religiöser Themenkreise darstellen. Sie wurde auf dem Mittelberg nahe der Stadt Nebra in Sachsen-Anhalt gefunden und liegt jetzt im Landesmuseum für die Vorgeschichte von Sachsen-Anhalt in Halle. Die Bronzezeit, die neu entdeckte Möglichkeit, Metall zu gewinnen und zu nutzen, hatte also auch auf religiösem Gebiet zu einem deutlichen Umbruch geführt. Und wieder wurde für religiöse Riten das Kunstvollste geschaffen, was den Menschen damals möglich war, so dass Religion und Kultur sich wahrscheinlich gegenseitig förderten.
Anders als in Nordeuropa, wo heute die vorgeschichtliche Astronomie nur auf archäologischem Wege erforschbar ist, existieren für Ägypten und besonders für Mesopotamien bis ins 3. Jahrtausend zurückreichende schriftliche Aufzeichnungen. Die astronomischen Frühforschungen besonders in Ägypten sind wohl auf dem Hintergrund des damals dort herrschenden Sonnenkults und der Bemühungen zur Berechnung des genauen Eintritts der Nilschwemme zu sehen.[2] In der altägyptischen Religion wachten die Priesterastronomen über ihr astronomisches Wissen und insbesondere auch über eine wiederholte Korrektur des Jahreskalenders in der Weise, dass alte religiöse Feste nicht daraus verschwinden sollten.[3]
An der mesopotamischen Astronomie wiederum ist besonders bemerkenswert, wie präzise die Messungen auf Tausenden von Tontafeln in Keilschrift aufgezeichnet wurden. Von diesem Wissen profitierte auch Thales von Milet bei seiner Vorhersage der geschichtsträchtigen Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr., welche den zermürbenden Krieg zwischen den Lydern und den Medern zugunsten der frühzeitig »vorgewarnten« Lyder entschied. Einfache Formen, die Bewegung von Himmelskörpern darzustellen, nämlich Armillar(Armreif-)sphären bzw. eine »Weltmaschine« als astronomisches Gerät mit mehreren gegeneinander drehbaren Metallringen, die zusammen eine Kugel bildeten, wurden bereits von den Babyloniern genutzt und später von den Griechen weiterentwickelt. Der griechische Umgang mit astronomischen Entdeckungen war allerdings ein anderer als der der Babylonier und Altägypter. Astronomie wurde von den Griechen ausschließlich aus wissenschaftlichem Interesse betrieben, unabhängig vom praktischen Nutzen des Kalenders und ohne religiöse und astrologische Motive. Sie war daher auch nicht mehr die Angelegenheit von Priestern, sondern von Naturforschern. Das heißt, inzwischen hatten sich die Griechen ihre Schrift erfunden und damit so viel Wissen erworben, dass auch normale Bürger, unabhängig von der Religion anfingen, die Natur intensiv zu beobachten und darüber nachzudenken. Und diese geistige Freiheit führte zu etwas Neuem, zu einem Umbruch, der die Entwicklung der Kultur entscheidend voranbrachte:
Schon seit mehreren zehntausend Jahren hatten die Menschen ihre Kultur denkend weiterentwickelt. Etwa im fünften Jahrhundert vor Christus wurde den Menschen ihr Denken bewusst, und sie wurden fähig, dieses Denken als eine wichtige Kompetenz bewusst zu fördern und auf alle möglichen Bereiche anzuwenden. Auf diese Weise entstand die Philosophie