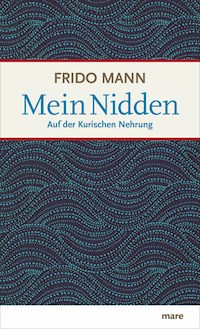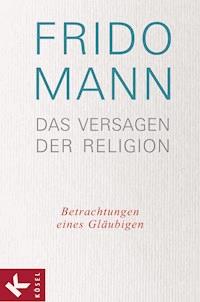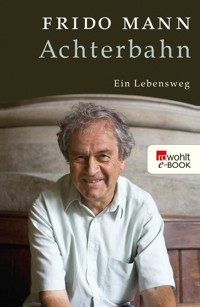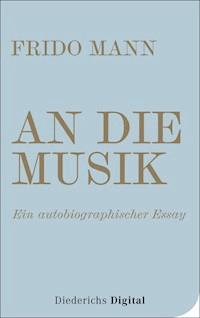
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diederichs
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der kulturgeschichtliche Durchgang durch die verschiedenen Epochen vor allem der abendländischen Musik erhebt nicht wissenschaftlichen Anspruch. In diesem autobiografisch gefärbten Essay von Frido Mann wird vielmehr der Frage nachgegangen, wann, wo und in welcher Weise Musik eine menschlich (und gesellschaftlich) aufbauende Sinnerfahrung und Werteorientierung fördert – sowohl auf kirchlich religiösem als auch auf humanistischem (auch politischem) Hintergrund. Diese Art kulturgeschichtlicher Einbettung wirft auch ein Licht auf die spezifischen Eigenheiten des Musikschaffens, ihrer Wiedergabe und Rezeption.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Frido Mann
AN DIE MUSIK
Ein autobiographischer Essay
Unter beratender Mitarbeit des Musikwissenschaftlers und Musikredakteurs Andreas Kunz
Der Diederichs Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
© 2014 Diederichs Verlag, München
In der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Weiss | Werkstatt | München
ISBN 978-3-641-15575-9
Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden,
Hast mich in eine bess’re Welt entrückt!
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf’ entflossen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel bess’rer Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!
Franz von Schober
Wenn ich an etwas glaube und eine Religion habe, dann die, dass Musik für alle da ist
Sir Simon Rattle
INHALT
VORWORT
INTRODUKTION
»Den Teufel am Hintern geküsst«. Filmische Begegnung mit dem Komponisten Norbert Schultze
Die aufbauende und die verführerische Kraft der Musik
KIRCHLICH-RELIGIÖSE BINDUNG IN MITTELALTER UND BAROCK
Musica colludium aeternitatis
Gregorianischer Choral • »Stile antico« • Das musikalische Pendant Martin Luther
Universum Bach
Bach und die Frage der Religion • Bachs Wirken bis in die Gegenwart
ZENTRIERUNG AUF DEN MENSCHEN IN KLASSIK UND FRÜHROMANTIK
Frühe Säkularisierungsbestrebungen in Italien und Frankreich
Die Venezianische Schule: Claudio Monteverdi (1567–1643) • Der Franko-Italiener Jean Baptiste Lully (1632–1687)
Von der kosmischen Harmonie zum menschlichen Individuum in der Wiener Klassik
Joseph Haydn (1732–1809) • Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) • Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Revolutionäre Vorboten der Tonalitätsauflösung
Frühe Durchbrechungen • Das Phänomen Carlo Gesualdo (1566–1613)
Zunehmende Zentrierung auf Mensch, Natur und Sprache in der deutschen Romantik
Franz Schubert (1797–1828) • Robert Schumann (1810 –1856) • Johannes Brahms (1833–1897)
BEFREIUNG AUS DER ENGE MENSCHLICHER INDIVIDUALITÄT IN SPÄTROMANTIK UND MODERNE
Licht und Schatten im Fin de Siècle
Nationalromantik: Frédéric Chopin, Bedřich Smetana, Giuseppe Verdi • Programmmusik: Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz, Franz Liszt • Schrille Zwischentöne. Dämonen, Geister, Hexen • Sehnsucht nach Erlösung bei Richard Wagner (1813–1883) • Symphonik des Glaubens bei Anton Bruckner (1824–1896) • Ausklang der Romantik: Gustav Mahler, Richard Strauss, Claude Debussy
Varianten der Moderne
Archaisches Frühlingsopfer bei Igor Strawinsky (1882–1971) •
Die »Wiener Schule« Arnold Schönbergs • Moderne und Avantgarde als »Glasperlenspiel«? • »Hoffnung jenseits der Hoffnungslosigkeit« in Thomas Manns »Doktor Faustus«
Zusammenfassender Rückblick
NEUE SINNSUCHE IN DER POSTMODERNE
Zwanzig Jahre nach Darmstadt
Musik als politische Kunst: Hans Werner Henze und Luigi Nono • Aleatorik: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, John Cage • Neue Einfachheit: Arvo Pärt • Neue geistliche Musik in Ost- und Westeuropa
Zukunft in Sicht?
Beispiel: die fünfsprachige Oper »Der Fliegende Teppich 2013 Odyssee« • »Crossovers«: multikulturell sowie zwischen »Klassik« und Pop, Rock und Jazz
Musik als Metapher
»Es« spielt und nicht man selbst • Meditative und therapeutische Impulse • Gemeinsam sind wir stark
CODA
VORWORT
Von den mehrfachen Anregungen und Impulsen aus meiner Familie ist die Musik die früheste, die stärkste und die nachhaltigste geblieben. Mein erster Berufswunsch im Alter von fünf oder sechs war, Musiker zu werden. Nach einigen Ablenkungen und Umwegen studierte ich schließlich auch Musik, wechselte dann aber nach meinem Studienabschluss zur Theologie und Psychologie und blieb nebenberuflich zeit meines Lebens passionierter Musikhörer und Klavier- sowie zwischendurch Orgelspieler.
Im Zuge meiner späten religionsübergreifenden Auseinandersetzungen mit der Frage nach individueller und gesellschaftlicher Sinnfindung und Werteorientierung spielten die Musik und meine jahrzehntelangen persönlichen Erfahrungen mit ihr eine zentrale Rolle. Deshalb geht es, in Anlehnung an mein letztes Buch »Das Versagen der Religion. Betrachtungen eines Gläubigen«, in der vorliegenden Schrift primär um die Reflexion dieser Sinnorientierung durch die Musik in der abendländischen Geschichte bis heute, mit einem Ausblick in die Zukunft. Bei den zur Sprache kommenden Epochen und Komponisten werden insbesondere auch die zeitgeschichtlichen, psychologischen und z.T. politischen Hintergründe mitreflektiert, die das Wirken der betreffenden, sowohl religiös gebundenen als auch areligiösen Musikschaffenden und deren Zeit mitbestimmt haben.
Dieses Buch ist keine musikwissenschaftliche Abhandlung. Es ist ein persönliches Bekenntnis meiner großen Liebe zur Musik mit dem Charakter eines mit autobiographischen Episoden angereicherten Essays, in dem die Sinn-Thematik im Vordergrund steht. Deshalb konzentriere ich mich, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, auf diejenigen Komponisten und auf deren Werke, mit denen mich besondere eigene Erfahrungen und Gedanken verbinden.
Mein besonderer Dank richtet sich an meine zahlreichen musikalischen Gesprächspartner, insbesondere den Musikwissenschaftler und Musikredakteur Andreas Kunz, der mich während der Abfassung kompetent und maßgeblich beraten hat, sowie den Geiger und Violinpädagogen Vesselin Paraschkevov, der das Ende dieser Schrift mit wesentlichen Gedanken zur Musikwiedergabe und zur Musikpädagogik bereichert hat. Weiterhin viele Hinweise und nachhaltige Anregungen erhielt ich von Klaus Schilde, Claudia Maurer-Zenck, Gudrun und Fritz Borchmeyer und Dirk Heißerer sowie in prägender Weise von meinen früheren Musiklehrern Hans Andreae, Christian Vöchting, Franco Ferrara, Michael Wessel-Therhorn und Arwed Henking. An der Entstehung dieses Buches mitgewirkt haben ferner die vielen geduldigen Hörerinnen und Hörer, denen ich einzelne Kapitel probeweise vorlesen konnte. Eigens danken möchte ich dem Münchner Kösel- und Diederichs-Verlag aus der Verlagsgruppe Random House, der auch diese Schrift sorgfältig und wohlwollend betreut und publiziert hat.
München, im Juli 2014
INTRODUKTION
»Den Teufel am Hintern geküsst«. Filmische Begegnung mit dem Komponisten Norbert Schultze
Goethe-Institut in São Paulo / Brasilien im März 1995 anlässlich einer Einladung zu zwei Buchvorstellungen zur Rolle der Kultur und der Wissenschaft im Dritten Reich. Als ich am Veranstaltungsort eintreffe, hat gerade die Vorführung eines nicht angekündigten Filmdokuments begonnen, welches mich vom ersten Augenblick an fesselt. Wie ich später erfahre, sollte dieser Film anhand eines besonders empörenden Beispiels die mangelnde Bereitschaft zur Aufarbeitung der braunen Vergangenheit Deutschlands zeigen.
Der Dokumentarfilm von Arpad Bondy und Margit Knapp von 1992 ist ein biographischer Aufriss des 1911 in Braunschweig geborenen Komponisten Norbert Schultze. Der Film zeigt in chronologischer Abfolge kommentierte Auszüge aus Filmen, zu denen Schultze die Musik geschrieben hat sowie von ihm während des Zweiten Weltkriegs komponierte Musicals, Soldatenlieder und Marschmusik. Häufig eingeblendet werden ausführliche Interviews mit dem Komponisten.
Es beginnt alles völlig harmlos. Schultze komponiert, nach seinem Musikstudium in Köln und München und einigen Engagements als Dirigent und Komponist und einer Anstellung als Aufnahmeleiter bei Telefunken, ab 1936 unter verschiedenen Pseudonymen die Musik zu einer Verfilmung des Hauff-Märchens »Das kalte Herz«. Er erstellt eine Opernfassung ebenfalls eines Märchens: »Schwarzer Peter« und komponiert das Musical »Nimm mich mit, Kapitän«.
Danach erfolgt die Wende. Schultze, seit 1940 NSDAP-Mitglied, nimmt, mit Beginn des Krieges, von »Propagandaminister« Goebbels einen Auftrag nach dem anderen an: einmal die Komposition der Musik zu den beiden Propagandafilmen »Bomben auf Engeland« (mit der Demonstration von aggressivem Kampffliegergeschwader zur Zeit des Polenfeldzuges 1939) sowie »Das Lied der Panzergruppe Kleist« (mit 1942 in Afrika vorwärts rollenden Panzern auf der Leinwand). Er komponiert reihenweise Soldaten- und Propagandalieder und martialische Marschmusik. Beim Anblick dieser Szenen beginnt sich alles in mir zusammenzuziehen. Seine Erstellung der Musik zum Film »Von Finnland bis zum Schwarzen Meer« während des Überfalls auf Russland im Sommer 1941 kommentiert Schultze in einem aus dem Anfang der Neunzigerjahre stammenden Interview am Klavier seine Vertonung der Filmtextzeile »Führer befiehl, wir folgen dir« zu einem Refrain. Er erzählt dabei stolz, er habe die musikalische Erstfassung dieses Refrains Goebbels persönlich vorgespielt. Goebbels habe sich danach sofort neben ihn auf die Klavierbank gesetzt, die aufgeschlagenen Noten betrachtet, ihn zur Wiederholung der Passage aufgefordert und ihn dann unterbrochen, um danach selber die Alternative am Klavier vorzuführen, die dann auch die letztgültige Version wurde: die betreffende Passage jetzt mit einer zwischen »befiehl« und »wir folgen dir« demagogisch eingeschobenen halbtaktigen Kunstpause.
Mir bleibt vollends der Mund offen, als ich sehe, mit welchem stumpfem Gleichmut der inzwischen Achtzigjährige diese widerwärtige Episode und seine eigene unrühmliche Rolle darin wiedergibt, so als handelte es sich um die Kommentierung einer niveauvollen Komposition.
Dann folgt der Gipfel: »Lili Marleen«. An sich eine stimmungsvolle Melodie mit gewissem melancholischem Einschlag, die Schultze 1938 zum gleichnamigen sentimentalen Gedicht vom Mädchen Lili unter der Laterne vor dem Kasernentor aus dem Bändchen »Die kleine Hafenorgel« von Hans Leip komponiert hat. Aber selbst dieses Lied lässt Schultze skrupellos zu propagandistischen Zwecken missbrauchen, wie er dies als Nächstes dem Betrachter des Films wieder am Klavier nonchalant bekennt. Er habe sich, so sagt er, 1939 von der Schallplattenfirma Elektrola sagen lassen, dass »die Wehrmacht im Kommen sei« und dass deswegen das betreffende Lied »Lili Marleen« in Soldatensendern ausgestrahlt und zum »Lied eines jungen Wachposten« umbenannt werden solle, und zwar jetzt mit dem vorangestellten preußischen Zapfenstreich. Schultze rechtfertigt jetzt nachträglich sein Einverständnis mit diesem Vorschlag damit, dass diese Art der Wiedergabe seines Liedes im einzelnen Soldaten ein »Heimatgefühl« geweckt hätte sowie »das sittliche Gefühl, das der Mensch braucht, um überhaupt kämpfen zu können; denn das wird auch in der Musik ausgedrückt«. Schließlich müsse auch im Krieg »Unterhaltung und Kunst geboten« werden, sagt er. Tatsächlich zieht sein anfangs nur wenig beachtetes Lied ab 1941 größte Aufmerksamkeit auf sich, als zum ersten Mal der deutsche Soldatensender Belgrad die Aufnahme mit der Sängerin Lale Andersen einige Male zum Programmschluss auflegt. Text und Melodie treffen tatsächlich bald voll die Stimmung von Millionen von Soldaten aller damals kämpfenden Armeen auf beiden Seiten der Fronten. Danach avanciert Lili Marleen in etwa fünfzig Sprachen zu einem weltweiten musikalischen »Leitmotiv« des Zweiten Weltkriegs und zum ersten deutschen Millionenseller. Auch unter den alliierten Soldaten, vor allem den britischen Truppen in Nordafrika 1941, wird das Lied oft in englischer Übersetzung mitgesungen. Vollends zum Mythos wird Lili Marleen, wie Schultze in seinem Kommentar bestätigt, als allabendlich »ohne gegenseitige Vereinbarung« (»um zehn vor zehn«) dessen Ausstrahlung mit Riesenlautsprechern über die Fronten in alle Richtungen für einige Minuten die Waffen zum Schweigen bringt und die Soldaten auf beiden Seiten der Front voller Andacht dem Lied lauschen und erst »nach dem Verklingen des letzten Tons« das MG-Feuer unvermindert weitergeht.
Richtiggehende Wut kocht in mir auf, als ich gegen Ende des Filmdokuments feststellen muss, wie in diesem skandalösen Fall nicht nur der Rattenfänger Schultze, sondern in den frühen Neunzigerjahren auch die deutsche Öffentlichkeit NS-Vergangenheitsbewältigung betreibt. Schultze komponiert nach dem Krieg munter weiter, so als wäre nichts gewesen. Er vertont wieder auf die Bühne gebrachte Märchen und schreibt die Musik zu einer langen Reihe betont ziviler, hausbackener Filme. Schultze wird 1961 Präsident des Verbands deutscher Bühnenschriftsteller und -komponisten und erhält, wie ich nachträglich verschiedentlich bestätigt bekomme, zwischen 1975 und 1996, also noch nach seinem Interview zu diesem Film, mehrere ehrenvolle Auszeichnungen, bevor er 2002 in Deutschland stirbt. Und als besonders pikanten Aspekt seines Kusses am Hintern des Teufels bezeichnet sich Schultze selbst an einer Stelle seines Film-Interviews zu allem auch noch als einen »unpolitischen Menschen«.
Als nach der Filmvorführung der eigentliche Teil der Abendveranstaltung beginnen soll, muss ich als Erstes am Rednerpult spontan einige Minuten lang meiner Empörung darüber Luft machen, zu was für ein Verführungsinstrument der in dem Film porträtierte »Musiker« die »holde Kunst« der Musik im kultur- und menschenverachtenden System der NS-Diktatur bewusst und willig hat entarten lassen. Danach endlich beginnen die für diesen Abend eigentlich vorgesehenen Buchpräsentationen zum Thema Kultur und Wissenschaft im Dritten Reich. Erst nach und nach wird mir richtig bewusst, dass das an jenem Abend in dem Film Gesehene beileibe kein Einzelfall ist, sondern, weit über das Beispiel des Nationalsozialismus hinaus, zu einem generellen Problem von Musikkomposition und Musikwiedergabe und zum Problem von Kunst überhaupt auswachsen kann und deshalb später in diesem Buch nochmals eigens angesprochen werden muss.
Die aufbauende und die verführerische Kraft der Musik
Ich bin immer wieder von Neuem verblüfft, wie stark Musik die Seele des Menschen ergreift. Sowohl als »holde Kunst« als auch als verführerisches Gift dringt Musik schneller, tiefer und nachhaltiger als Wort und Bild in unser Leben ein. Sie kann auch in ihrer einfachsten Form eine elementare Wirkung ausüben, beispielsweise als Trommel oder als Solo-Gesang. Aber jede Form von Musik wirkt natürlich nie nur in sich und völlig abgehoben von unseren Lebensverhältnissen. Sie muss immer im Kontext unserer gesamten Existenz gesehen werden. Sie wirkt gewissermaßen auf uns über unseren individuellen, familiären und sozial gesellschaftlichen Lebenskontext.
Ich bin sicher, dass meine Musikerlebnisse von frühester Kindheit an auch schon vor meiner Hinwendung zu christlicher Religiosität als Anfang Zwanzigjähriger immer wieder tiefere Erlebnisschichten in mir angerührt haben, die mehr waren, als nur in einem unreflektiert emotionalen Zustand diffuser Sehnsucht zu verharren und sich in einer Achterbahnfahrt der Gefühle um sich selbst zu kreisen. Sonst hätte ich nicht schon so früh, lange vor meiner Hinwendung zur Religion, Musik sogar als Beruf ausüben wollen. Ein nachhaltiges Bewusstsein darüber, was Musik mir wirklich bedeutet und wieweit sie mein Leben bestimmt, habe ich trotzdem das erste Mal während meiner intensiven Auseinandersetzung mit Richard Wagners Bühnenweihfestspiel »Parsifal« entwickeln können, als dieses während der frühen Sechzigerjahre zu Ostern im Zürcher Opernhaus einstudiert wurde und ich dort als junger Volontär mitwirkte.
Ich befand mich damals in einer tiefgreifenden inneren Sinnkrise, aus der mich natürlich auch andere Impulse und Hilfestellungen wieder herausholten. Aber die Musik wirkte dabei wie eine Art Katalysator. Die Folge meiner Auseinandersetzung (nur) mit diesem einen Werk Wagners war jedenfalls ein als »Erlösung« erlebter Sinnes- oder vielmehr Sinnwandel, der schließlich über lange und vielfältige Wege zu meinem Eintritt in die römisch-katholische Kirche führte und auch ein neu reflektiertes, sinnbezogenes Verhältnis von mir zur Musik erwirkte. Dieses Bewusstsein blieb über alle nachfolgenden Veränderungen meiner weltanschaulichen Position über die Jahrzehnte hinweg in mir präsent und bestimmte wie eine verlässliche Konstante und eine unverzichtbare Stütze in meinem Leben mein Verhältnis zur Musik.
Dies ist ein einzelner, individueller Lebensweg zur Musik. Letztlich dürfte es so viele Wege dazu geben, wie es Individuen gibt. Deshalb will ich weit über mein eigenes autobiographisches Beispiel hinaus der Frage nach einer Sinnfindung und Werteorientierung durch Musik ganz allgemein nachgehen und dabei auch die verschiedenen Epochen der vor allem abendländischen Musik als Ganzes in ihrem überaus spannungsvollen Entwicklungsgang verfolgen.
Wann, wo und in welcher Weise, so würde ich schließlich fragen wollen, hat vor allem die überaus vielgestaltige abendländische Musik in ihren sehr unterschiedlichen Epochen und Entwicklungsphasen dazu beitragen können, den Menschen, über jedes ästhetische Wohlgefallen hinaus, als eine Art geistiger Kompass zu dienen, ihnen einen inneren Halt zu geben und ihre emotionale und kognitive Selbstgewissheit zu festigen? Wann und wie weit war Musik in diesem Sinn eine Quelle für eine menschlich und gesellschaftlich aufbauende Sinnerfahrung und Werteorientierung, wenn nicht sogar eine Art Leitlinie für ethisches Handeln? Gibt es kulturgeschichtliche Phasen, in denen musikalisches Schaffen und die Wiedergabe von Musikwerken bei den Menschen nur wenig oder gar Schlechtes ausrichtete? War sie zu bestimmten Zeiten der besonderen Gefahr eines Missbrauchs oder einer suggestiven Manipulation der Massen ausgesetzt? Sind diese musikgeschichtlichen Schwankungen zufällig oder sind sie abhängig von den jeweiligen Zeitströmungen unserer Geschichte, von gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten und Konstellationen? Und wie wirken sich wiederum diese Unterschiede nicht nur auf das Musikschaffen aus, sondern auch auf die Wiedergabe und die Rezeption von Musik?
Ausgangspunkt meiner Erörterungen wird die kirchlich religiöse Bindung der Musik im christlichen Mittelalter mit ihren fließenden Übergängen zur Neuzeit sein. Diese Neuzeit ist fast bis in die Gegenwart hinein gekennzeichnet von einer stufenweise erfolgenden, emanzipatorischen Loslösung der abendländischen Musik aus dem sakralen Bereich. Ihr Schwerpunkt liegt seit der Wiener Klassik und vor allem der Romantik nicht mehr primär in ihrer Einbettung in eine kosmisch universale, göttliche Ordnung. Hauptmerkmal ist jetzt vielmehr ihre zunehmende Zentrierung auf die individuell emotionale Welt des Menschen und auf die ihn umgebende Natur sowie auf die dichterische Sprache. Im Zuge der zunehmend skeptischen Infragestellung des menschlichen Individuums während der bürgerlichen und industriellen Revolution strebt die Spätromantik, zunehmend zwischen Licht und Schatten oszillierend, eine Loslösung aus einer zu großen Enge menschlicher Individualität an. Dies zeigt sich in den Bewegungen der Nationalromantik, der Programmmusik und der musikalischen Umsetzung von kulturgeschichtlich aus der vor- und frühreligiösen Zeit stammenden Metaphern, Mythen- und Sagenfiguren (Geister, Dämonen und Hexen).
Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die schrittweise Auflösung der Tonalität, des Grundtonbezugs und der großen musikalischen Formen beim Übergang von der Spätromantik zur Moderne an der Schwelle zum 20. Jahrhundert mit den sowohl revolutionär aufbauenden als auch den problematischen Erscheinungen der Moderne besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zuge des zunehmenden Einsatzes der Massenmedien seit dem frühen 20. Jahrhundert gehen mit dieser Entwicklung vermehrt politische und ökonomische Formen des (verführerischen!) Missbrauchs musikalischer Botschaften besonders im Bereich der Kunstmusik einher. Bemerkenswerte hoffnungsvolle Ansätze zu einer Rückkehr in die Tonalität auf einer neuen Ebene finden sich dann in verschiedenen Strömungen der sogenannten »Postmoderne« in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, wobei sich – im Gegenzug zu Beispielen eines »Crossover« zwischen der Musik verschiedener Kulturen sowie zwischen Kunstmusik und Pop, Rock und Jazz – immer deutlichere Tendenzen zu einer zunehmenden Individualisierung und Aufsplitterung der Musik in lauter Einzelkonzepte zeigen, die eine Auflösung der Musik als Kunstform befürchten lassen.
Diese durchwachsene Entwicklung der Musik durch die Jahrhunderte wirft die Frage auf, ob, kulturgeschichtlich gesehen, künstlerische Tätigkeit einerseits erst nach ihrer Befreiung von institutionell vorgegebener, manchmal bevormundender religiöser Bindung hochwertige neue Impulse erhält oder ob umgekehrt auf die Dauer nicht doch auch, über rein ästhetische Aspekte hinaus, ein gewisses Ausmaß an stetiger, überzeugter Orientierung an inneren Werten und an einem inneren, religiösen oder auch genauso gut nicht-religiösen Sinn sowie an verantwortungsbewusstem Handeln großes künstlerisches Gelingen garantiert.
Bei all diesen Erörterungen werden in dieser Schrift nicht nur essayistische und autobiographische Aspekte eng miteinander verwoben. Zusätzlich fließen auch exemplarische Erfahrungsberichte und Gedanken ausübender Musiker und Musikpädagogen in die betreffenden Texte ein.
Musik ist schon seit Bestehen der Menschheit bestimmend für unser Leben. Neuere Untersuchungen zeigen uns, dass bereits höhere Säugetiere auf Musik reagieren. Die Wirkung auf Pflanzen oder gar Steine gehört dagegen noch weitgehend in den Bereich der Spekulation. Unbestritten dagegen ist die seelische und magische Kraft musikalischer Botschaften bei allen Naturvölkern, mit einer erheblichen Potenzierung dieser Wirkung, wenn diese Musik von Gebärden und Tanz begleitet wird und aus ihnen die Stimmen der Götter und der Dämonen zu erklingen scheinen.
Musik trifft auf ein breites Spektrum von Gefühlsregungen. Sie weckt oder verstärkt intensiv Glücksgefühle, Stolz, Lebenslust, Fröhlichkeit, Begeisterung, das Erleben von Harmonie in einer Welt kosmischer und zentraler Ordnung oder mystischer Spiritualität sowie Hingabe und Demut. Sie eröffnet aber auch den Blick in seelische Abgründe, in Zerrissenheit und inneres Chaos, Traurigkeit, Zerknirschung und Verzweiflung. »Man sagt, die Musik wirke erhebend auf die Seele. Das ist nicht wahr, das ist Unsinn! Sie wirkt, sie wirkt furchtbar – ich rede aus eigner Erfahrung –, aber keineswegs erhebend. Sie erhebt die Seele nicht, sie zerrt sie hinab, sie stachelt sie auf«, lässt Tolstoj in seiner Erzählung »Kreutzersonate« den adligen Grundbesitzer Posdnyschew sagen. So kann Musik beispielsweise auch zu Kampflust oder zu rauschhafter Hybris und triumphierendem Herrscherglück und Machtstreben aufstacheln, wie wir dies eben am Beispiel von Norbert Schultzes Nazi-Märschen und Soldatenliedern gesehen haben. Sie kann aber auch, wenn sie der uns täglich überflutenden verbalen und bildhaften Fata Morgana kommerzieller Fernseh- oder Filmwerbung unterlegt wird, völlig banal eingesetzt werden zur gezielten Steigerung kurzlebiger Konsumbedürfnisse.
Meistens wenn Musik auch sonst gekoppelt mit fixen oder bewegten Bildern erklingt, steuert sie mit unterschwelliger und damit umso wirksamerer suggestiver Kraft die emotionalen Reaktionen auf die Bilder. So kann eine den Bildern und den gesprochenen Worten unterlegte Filmmusik die durch den Filmablauf geweckten Emotionen enorm verstärken oder, je nach Musik, auch abschwächen oder qualitativ verändern. Ich kann beim Ansehen eines Fernsehkrimis schon von vornherein voraussehen, wie massiv dessen raffiniert eingesetzte Begleitmusik mich voller Spannung in die Handlung hineinziehen und mich sehr viel weniger loslassen wird als derselbe Film ohne Musik. Dies zeigt die ungeheure Macht der Musik über unser Empfinden, Erleben und Denken.
Diese sehr unterschiedlichen Wirkungen der Musik sind auch abhängig davon, um welche Art von Musik es sich handelt. Marschmusik, Siegesfanfaren und Nationalhymnen werden eher zu Wettkämpfen, manchmal auch zu gewaltsamen politischen oder kriegerischen Auseinandersetzungen animieren als ein Streichquartett-Adagio, ein Orgelchoral, ein Gospel oder eine Osterpassion, die eher zu meditativer oder religiöser Versenkung aufruft. Hingegen können ein mitreißendes Popkonzert oder innige Volksgesänge einer hochgehaltenen nationalen Tradition ein Gemeinschaftsgefühl und das Bewusstsein friedfertiger Zusammengehörigkeit stärken. Die große Vielfalt und das enge Nebeneinander höchst unterschiedlich, ja gegensätzlich wirkender Musikformen lässt den schmalen Grat zwischen Gut und Böse in besonders scharfem Licht erscheinen. Mit Musik werden Millionen Menschen in den Krieg und in den Tod geschickt. Musik in Konzertsälen, auf Freilichtbühnen oder in Kirchen dagegen kann, besonders bei überregionaler Live-Übertragung, eine zumindest kurzfristige, manchmal sogar religiös getönte Verbrüderung zwischen den Menschen bewirken, wie ich dies in unserer eher von Anonymität und individualistischer Abgrenzung gekennzeichneten Zeit sonst nur selten beobachte. Allerdings können im selben Musikstück deren individuell-psychische und deren gesellschaftlich-kommunikative (und symbolische) Funktion erheblich auseinanderklaffen. Das Abspielen einer das Wir-Gefühl festigenden Nationalhymne oder entsprechende Gesänge im Fußballstadion oder auch Protestsongs erwecken auf der Ebene der individuellen Erbauung oder Unterhaltung oft sehr andersartige Gefühle als auf der gesellschaftlichen Ebene. Es haben mir so einige Freunde in den Neuen Bundesländern versichert, dass sie heute Beethovens Neunte Symphonie noch immer nicht hören mögen, weil diese seit dem Bestehen der DDR zum Ausklang sämtlicher Parteitage der SED gespielt wurde. Auch bezüglich der Hintergrundfunktion einer unterschwellig, »nebenbei« erklingenden Musik kann für den Einzelnen deren Genuss sehr unterschiedlich entweder erhöht oder auch beeinträchtigt werden. Ein Nichtkenner klassischer Musik wird durch das Erklingen der ersten Takte des himmlischen Andante in Mozarts C-Dur-Klavierkonzert KV 467 als Hintergrundmusik einer goldprickelnden Fernsehwerbung für eine bestimmte Sektmarke möglicherweise in ein seine Konsumfreude verstärkendes Hochgefühl versetzt werden, wohingegen ein Kenner oder gar ein Musiker dabei Ekelgefühle empfinden wird und sich anstrengen muss, beim nächsten Hören oder Spielen dieses unvergänglichen Satzes den schwachsinnigen Gedanken an diesen Sekt aus seinem Kopf zu verbannen.
Musik wirkt nicht nur. Sie prägt auch, besonders in der frühesten Lebensphase.
Das Erste, was ich, sehr rasch nach meiner Geburt, in unserem kleinen, hellhörigen Häuschen im kalifornischen Carmel an der Pazifikküste über Stunden täglich zu hören bekam, waren die Bratschenklänge meines als Berufsmusiker unermüdlich übenden Vaters. Dies setzte sich zwei Jahre später in Mill Valley bei San Francisco fort, wo das Kinderzimmer meines Bruders und mir in der oberen Etage zwar räumlich etwas weiter weg von dem unten liegenden »Study« meines Vaters lag. Dafür habe ich die Klänge von dort jetzt noch im Ohr. Eher diffus sind meine Erinnerungen an die häufigen Kammermusikzusammenkünfte im selben »Study«, meist Streicher-Ensembles aus dem Kollegen- und Freundeskreis und oft mit so zahlreichen Zuhörern, dass für diese Extra-Stühle aus dem gegenüberliegenden Bestattungsinstitut ausgeliehen werden mussten. Ich war wohl des Öfteren mit dabei gewesen, und mir wurde später berichtet, dass ich als Drei- oder Vierjähriger beim Zuhören gelegentlich in besorgniserregender Weise mit rhythmischem Schaukeln und verdrehten Augen in Trance geraten sein soll. Zu meinem Musik-Bewusstsein gehörte auch, dass mein Vater fast täglich mit dem Auto über die Golden- Gate-Brücke zur Probe oder abends ins Konzert in der San Francisco Symphony unter Pierre Monteux fuhr, wo er als jüngstes Mitglied mitwirkte. Und ich erinnere mich auch an einen Besuch eines dortigen Kinderkonzerts an einem Nachmittag, zu dem mein Vater uns Kinder mitnahm und wo wir ihn im Orchester spielen hören (und sehen!) durften. Dies alles hatte zur Folge, dass mein erster, allerdings nur ein paar Jahre anhaltender Berufswunsch während der ersten Grundschuljahre war, Musiker zu werden.
Zur klanglichen Prägung junger Menschen auch ohne Musik im Elternhaus gehört, jedenfalls in Westeuropa, das häufige Läuten von Kirchenglocken, deren eigenartige Stimmung sich in jedes Herz eingräbt, wenn im selben Glockenton gleichzeitig gnadenhafte Seligkeit und Vergänglichkeit und Tod verkündet werden und dadurch ein anrührendes Gemisch aus Feierlichkeit und Melancholie entsteht. Bis zu meinem neunten Lebensjahr in den USA fehlte mir dieses Klangerleben, weil es in den USA kaum Kirchenglockengeläut gibt. Erst in Europa zogen mich dessen Klänge in ihren Bann. Möglicherweise trugen auch sie zu meinem ersten religiösen Interesse in meinem Leben bei, nachdem ich in den USA nie diesbezügliche Anregungen erhalten hatte, weder seitens meiner Familie noch in der Schule noch aus meinem Freundeskreis. Bei meinen ersten Kirchenbesuchen mit Freunden in Europa lernte ich auch die verschiedenen Varianten abendländischer Kirchenmusik kennen: die in den Gottesdiensten gesungenen Psalmen, Lieder, Lobgesänge, Kantaten und Motetten. Muslimische Gebetsrufe mit dem gesungenen Glaubensbekenntnis zum einen Gott und seinem Propheten bekam ich erst im fortgeschrittenen Alter um die Jahrtausendwende bei meinen kurzen, erstmaligen Besuchen in Marokko und in der Türkei zu hören. Sie sind allerdings nie tief in mein Inneres gedrungen, vielleicht, weil es dafür zu spät war und ich vorher über rein intellektuelles Interesse hinaus nie wirklich mit der Welt des Islam in Berührung gekommen bin und vieles in ihr mir bis heute fremd, ja unheimlich geblieben ist.
Physikalisch besteht Musik aus einer mehr oder weniger komplexen und strukturierten Überlagerung von Schallwellen unterschiedlichster Länge und Amplitude, die über unser Hörorgan als Töne, Klänge, Akkorde und Klangfolgen wahrgenommen werden und sich in der Regel zu kleineren Einheiten, Phrasen, Musiksätzen, kurzen Musikstücken und längeren Musikwerken zusammensetzen. Die akustische Wahrnehmung wird von uns in metaphysische Bedeutungsinhalte übersetzt. Diese wecken in uns Emotionen und Gedanken und versetzen den Hörer in einen besonderen inneren Zustand, der gegebenenfalls seine Einstellungen, seine Gesinnung, ja sein ganzes zukünftiges Leben verändern kann. Dieselben Klänge und Klangfolgen eines Musikstücks können allerdings sehr unterschiedliche Emotionen auslösen, je nach individuell und sozial gesellschaftlich unterschiedlichen Einstellungen oder auch aufgrund der politischen oder religiösen oder nichtreligiös weltanschaulichen Systeme, denen wir angehören. So ist zu erklären, dass dieselbe Musik in einem Kulturkreis hoch geschätzt, in einem anderen hingegen geächtet oder sogar verboten wird. Eines der in meinen Augen unrühmlichsten Beispiele aus jüngster Zeit ist das Verbot jüdischer Musik durch die rassistische Ideologie des deutschen Nationalsozialismus. Als nicht viel besser empfinde ich einige Jahrhunderte vorher die Verbannung jeder, auch geistlicher Musik durch den französischen Reformator Johannes Calvin nicht nur aus der gottesdienstlichen Liturgie, sondern auch aus dem profanen Alltag des Genfer Gottesstaates unter Todesstrafe aufgrund der angeblichen Beleidigung des allmächtigen Gottes durch die schnöde Sinnlichkeit der Musik. Ähnlich, wenngleich etwas weniger drastisch, erscheint mir die Verpönung der Orgelmusik als »des Teufels Sackpfeifen« und deren konsequenter Ausschluss aus dem christlichen Gottesdienst durch die Kirchenväter während des ersten christlichen Jahrtausends, bevor diese erst im späteren Mittelalter in vorsichtigen, kleinen Schritten wieder zugelassen wurde. Im Gegensatz dazu war es für den deutschen Reformator Martin Luther ein großes Anliegen, jedem als geistlich ausgewiesenen Liedgut im Gottesdienst einen besonderen Platz einzuräumen. In beiden Fällen bleibt die Frage interessant, wieweit es bei diesen ideologisch diktierten Verboten zum Konflikt zwischen diesem Verbot und individuellen, biographischen, anerzogenen Vorlieben kommen kann. Wieweit konnte beispielsweise ein in der Weimarer Republik lebender, begeisterter Anhänger der Musik Felix Mendelssohn-Bartholdys nach 1933 Mendelssohn verordnungsgemäß einfach aus seinem Herzen reißen, oder musste er ihn dann weiter heimlich lieben, bis ab 1945, nach dem Ende des Spuks, das Spielen von Mendelssohns Musik wieder erlaubt war? Ich muss bei dieser Frage immer wieder an den Anfang von Jiri Weils wunderbaren Roman »Mendelssohn auf dem Dach« denken. Dort haben während der deutschen Okkupation Prags zwei Funktionäre den Befehl von »Reichsprotektor« Heydrich auszuführen, von den vielen Musikerstatuen auf dem Dach des Rudolfinum diejenige von Mendelssohn aufzusuchen und zu beseitigen. Nachdem sie die Statue nicht ausfindig machen können und die schlimmsten Strafen befürchten, kommt ein Dritter auf die Idee: »Geht noch einmal an den Statuen entlang und guckt euch genau die Nasen an. Wer die größte Nase hat, ist der Jude.« Gesagt, getan. Schließlich finden sie wirklich den mit der größten Nase, legen ihm das Seil um den Hals und ziehen, bis die Statue zu wackeln beginnt. Im letzten Augenblick entdecken die beiden jedoch zu ihrem größten Schrecken, dass es sich um die Statue von Richard Wagner handelt.
Musik weckt oder verstärkt menschliche Emotionen und Erlebnisse in allen Abstufungen und Intensitätsgraden und in allen möglichen Qualitäten. Wenn sie nicht zu inhumanem (z. B. mit Marschmusik zu gewalttätigem oder kriegerischem) oder zu banalem (mittels musikalischen Werbespots zu Konsum-)Verhalten verführt, hat ihre positive Wirkung zumindest den Charakter des Wohllauts (Gefühl musikalischer Wellness). Musik ist dann in erster Linie ein ästhetischer Genuss, der, übersteigert, in einen rauschhaften Zustand führen kann. Je differenzierter und »hochstehender« ein Musikwerk ist, als desto ästhetisch wertvoller wird es aufgenommen werden können. Zu einer eigentlichen inneren Werteorientierung und Sinnfindung an der Grenze zur Transzendenz verhilft Musik erst, wenn in ihr eine ausgeprägt menschliche, außer- oder gar übermenschliche Botschaft enthalten ist, unabhängig davon, ob es sich um »Klassik« oder gehobene Popmusik und Folklore etc. handelt. Von da ist es nicht mehr weit zur »höchsten« Stufe: Musik mit als existenziell erlebten Tiefendimensionen mit gelegentlich geradezu Offenbarungscharakter und starken geistigen Impulsen (z. B. in den Passionen von Johann Sebastian Bach).
KIRCHLICH-RELIGIÖSE BINDUNG IN MITTELALTER UND BAROCK
Gott ist ein harmonisches Wesen. Alle Harmonie rühret von seiner weisen Ordnung und Einrichtung her … Wo keine Übereinstimmung ist, da ist auch keine Ordnung, keine Schönheit und keine Vollkommenheit. Denn Schönheit und Vollkommenheit bestehet in der Übereinstimmung des Mannigfaltigen.
Georg Ventzky 1742
Musica colludium aeternitatis
Gregorianischer Choral
Larkspur, Kalifornien im August 2000. Zum ersten Mal nach über fünfzig Jahren bin ich zu Besuch bei meiner inzwischen 90 Jahre alten und inzwischen weitgehend erblindeten ersten Klavierlehrerin, Marion Winkler, auch einer Emigrantin aus Europa. Marion lebt immer noch in ihrem damaligen Haus nahe bei Mill Valley, von wo aus mich meine Mutter seit meinem fünften oder sechsten Lebensjahr, bis zu unserer Übersiedlung nach Europa zwei, drei Jahre später, einmal wöchentlich mit dem Auto zum Klavierunterricht in Larkspur zu fahren pflegte. Neu in Marions Haus ist jetzt der Anbau, ein geräumiges, helles Wohnzimmer mit einem Konzertflügel am Fenster, wo wir heute sitzen und uns unterhalten.
Ein zentrales Thema unseres Gesprächs ist der Fortgang meiner musikalischen Entwicklung nach meinem Klavierunterricht bei ihr. Ich erzähle ihr von meinem in Europa sehr bald wieder aufgenommenen Unterricht bei Lehrern in Österreich, im Schweizer Internat, in Florenz und schließlich in Zürich während meiner Gymnasialzeit und von meinem Wunsch seit meinem fünfzehnten Lebensjahr, Dirigent zu werden, als ich bei meiner Großmutter lebte.
Zu Marions Belustigung schildere ich ihr dann die ungewöhnlichen Umstände des Kontrapunktunterrichts, den mein Vater mir Siebzehnjährigem während einer der seltenen Sommerferien mit meinen Eltern, diesmal an der amerikanischen Atlantikküste in Maine, privat erteilte, nachdem er von meinem Berufswunsch erfahren hatte und darüber alles andere als erbaut gewesen war. Er hatte nämlich gerade seinen Musikerberuf an den Nagel gehängt zugunsten eines spät aufgenommenen literarwissenschaftlichen Universitätsstudiums in Harvard bei Boston. Für meinen Kontrapunktunterricht wurde das schwergewichtige Harmonium meines Vaters in unser Ferienhäuschen mitgenommen, von wo aus wir es jeden Morgen zusammen mit einem Sonnenschirm an den Strand schleppten und es möglichst nahe am Ufer postierten, wo immer eine kühlere Brise wehte. Dort hatte ich dann bis zum Mittags-Lunch mehrstimmige Kontrapunktsätze im Palestrina-Stil zu schreiben, die dann am Nachmittag korrigiert wurden. Diese Vorbildung kam meinem Musikstudium zwei Jahre später sehr zugute, als ich im Rahmen meiner Ausbildung zum Dirigenten einen regulären Kontrapunktkurs zu absolvieren hatte.
Leider habe ich bei meinem Besuch bei Marion nicht das kleine, etwas verschwommene Schwarz-Weiß-Foto bei mir, auf welchem ich in Badehose und mit Sonnenbrille unter dem Sonnenschirm und einem an diesem innen befestigten und im Wind wehenden Fliegenleimpapierstreifen zur Abwehr der vielen Bremsen in gekrümmter Haltung am Harmonium sitze.
Schon während meiner Kindheit in Österreich bei Gottesdienstbesuchen zusammen mit Mitschülern oder Nachbarkindern sowie Jahre später war, wie ich Marion weiter berichte, bei der Besichtigung von romanischen Kirchen in der Toskana zusammen mit meinen Eltern wiederholt der einstimmige, liturgische Gesang gregorianischer Choräle in lateinischer Sprache an mein Ohr gedrungen. Ich weiß nicht, wieweit diese frühen Erlebnisse auf dem österreichischen Land bereits mitgewirkt haben an meiner ersten, vorübergehenden Anwandlung als ca. Elfjähriger, katholisch werden zu wollen. Sicher erinnere ich mich jedoch daran, dass mich die mittelalterlich wirkende Psalmodie der einstimmig unbegleiteten liturgischen Chorgesänge in der Messe oder im Stundengebet mit ihren Alleluja-Melodien auf den für mich faszinierend neuartigen Ganztonleitern der Kirchentonarten vorübergehend in einen Zustand tiefer innerer Ruhe versetzten. Je länger ich diese wundersamen Gesänge auf mich wirken ließ, desto mehr glaubte ich mich auch in die geheimnisvolle Welt der stundenlang geübten Kleriker- und Mönchgesänge in den mittelalterlichen Klöstern hineinversetzen zu können. Vor allem erstaunte mich, wie viele Melodienfolgen auf einer einzigen Silbe oder ganz wenigen Silben des gesungenen Bibeltextes Platz hatten. Ein besonderes Erlebnis war auch die gelegentliche Aufteilung des Chores in zwei sich gegenüberstehenden Gruppen, wovon die zweite Gruppe jeweils eine Sequenz der ersten entweder wiederholte (Responsorium) oder aber gegen ihn »ansang« (Antiphon). Sehr viel bewusster lernte ich diesen Ablauf Jahre später verstehen, wenn meine Eltern mit uns Kindern bei einigen Kirchenbesichtigungen in der Toskana zufällig in einen Gottesdienst gerieten, in dem ähnliche Gesänge erklangen. Gerne nutzte ich dort auch die Gelegenheit, in den verglasten Fresken im Kirchenraum die gregorianische Quadratnotation zu studieren. Dabei fiel mir rasch das Fehlen einer Takteinteilung auf, was für mich eine optische Bestätigung meines akustischen Eindrucks einer gewissen Endlosigkeit der Gesänge war. Die überwiegend kleinintervalligen, manchmal fast einschläfernden, aber mich zugleich in einen meditativen Bann ziehenden Gesänge wiesen mich immer wieder von Neuem auf einen weit außerhalb des betreffenden Gotteshauses liegenden und doch tief in meinem Inneren spürbaren spirituell transzendenten Bereich hin. Ich war während meines Musikstudiums immer davon ausgegangen, dass die nach dem gleichnamigen Papst Gregor dem Großen im siebten nachchristlichen Jahrhundert in Rom benannten Gesänge auch in Rom ihren Ursprung hatten, als dort die Schola cantorum gegründet wurde. Diese Auffassung gilt inzwischen jedoch als umstritten. Denn nach neueren Erkenntnissen entstanden die gregorianischen Gesänge erst im achten Jahrhundert nördlich der Alpen im Zuge der karolingischen Liturgiereform unter Pippin dem Jüngeren, indem die aus Rom ins Frankenreich überbrachten altrömischen Gesänge umgeformt wurden.
»Stile antico«
Anders als bei Kirchenbesichtigungen oder -besuchen kennengelernten gregorianischen Gesängen kam ich, wie ich Marion Winkler weiter berichte, mit der Welt des aus dem späteren Mittelalter stammenden und ebenfalls dem universalen Lob Gottes dienenden, mehrstimmigenKontrapunkt (punctus contra punctum / »Note gegen Note«) vor allem aus Büchern und Noten und im Kontrapunktunterricht meines Vaters und später im Musikstudium in Berührung. Die wichtigste und zugleich einfachste Variante des Kontrapunktstils ist immer die »Gegenstimme« einer vorgegebenen Melodie, weshalb der Begriff Kontrapunkt in seiner umfassendsten Bedeutung auch häufig gleichgesetzt wird mit Polyphonie. Die Kompositionstechnik des Kontrapunkts der Renaissance und des Barock erlebte bei Johann Sebastian Bach einen zweiten Höhepunkt. Eine weit darüber hinaus neue Bedeutung gewann sie schließlich auch im Werk von Johannes Brahms und Max Reger und in der Musik des 20. Jahrhunderts etwa von Anton Webern und Paul Hindemith sowie später auch durch gewisse dem Rock und dem Jazz zuzuordnende gegenwärtige Komponisten. Trotzdem wird der Begriff Kontrapunkt in der Regel vor allem in Verbindung gebracht mit dem stile antico des Satzmodells der Vokalmusik (Messen, Motetten und Madrigale) von Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594) mit ihrer melodisch, rhythmisch und harmonisch besonderen Ausgewogenheit. Zum Grundbestand des stile antico gehören gewisse zentrale Stimmführungsregeln wie beispielsweise die Gegenbewegung, das Parallelenverbot bzw. die verdeckten und die Antiparallelen sowie die Dissonanzenbehandlung. Das Ergebnis meiner mir im Studium aufgetragenen Beschäftigung damit ist noch heute vorhanden in Form einiger stark vergilbter Aufzeichnungen von schulischen Kompositionsversuchen, die wie eine botanische Sammlung zusammengepresster Schmetterlinge oder Blumen in einer blauen, zugeschnürten Notenmappe bei mir liegen. Wenn ich beim heutigen Anhören dieser Musik etwa im Radio oder auf einer CD von der geordneten Komplexität der vielen Kompositionsregeln des klassischen Kontrapunkts absehe und mich ganzheitlich in ein Werk von Giovanni Pierluigi da Palestrina versenke, dann lässt mich die systematische Ausgewogenheit der vielfach kompensatorisch und symmetrisch wirkenden Musik manchmal an die »Coincidentia oppositorum« von Nikolaus von Cues denken, bei welcher trotz der Vielfalt und der scheinbaren Gegensätzlichkeiten in unserer Welt alles auf die eine göttliche Harmonie eines tief in sich ruhenden, allgegenwärtigen Kosmos hinweist. Nur dass, im Vergleich zu den älteren einstimmigen gregorianischen Gesängen, beim Übergang zwischen Mittelalter und Neuzeit bewegtere und großflächigere und zugleich dichtere polyphone Klangstrukturen auf jene transzendente Welt hinweisen.
Mein mich vorsorglich zum Musikstudium im klassischen Palestrina-Kontrapunkt-Stil unterweisender Vater hatte nicht nur allgemein als Musiker einschlägige Kenntnisse auf diesem Gebiet. Er hatte sich vielmehr, schon etwa fünfzehn Jahre vor meinem Unterricht bei ihm, während des Krieges im kalifornischen Exil als Anfang Zwanzigjähriger besonders ausführlich damit befasst, als er seinem Vater auf dessen Wunsch eine ca. 30 Seiten lange musiktheoretische Abhandlung als Material für dessen Vorstudien zum »Doktor Faustus« schickte. Neben den Grundthemen wie »Der Kanon«, die klassische Harmonielehre, »Kadenz und andere Akkordfortschreitungen«, »Die Modulation« und »Konklusionen« nahm in seiner Abhandlung auch das Thema »Strenger und freier Kontrapunkt« sowie die Fuge als verwandte Form des Kanons einen breiten Raum ein. Die vielen Anstreichungen von Thomas Mann am Seitenrand durch sämtliche Themen der Abhandlung hindurch zeigen mir nicht nur, mit welchem großen Interesse dieser die musiktheoretischen Erläuterungen seines jüngsten Sohnes in seine musiktheoretisch und musikgeschichtlich ausführlichen Recherchen für seinen Musikerroman mit aufnahm, sondern auch, wie eng die aus verschiedenen Epochen stammenden Kompositionsstile doch alle zusammengehören.
Das musikalische Pendant Martin Luther
Während meines Studiums des Schrifttums von Martin Luther und der dazugehörigen Sekundärliteratur für meine spätere theologische Dissertation über dessen Abendmahlslehre stieß ich immer wieder auf Texte, aus denen – völlig im Gegensatz zum Musikhasser Johannes Calvin – Luthers besonders intensive Beschäftigung mit Musik ersichtlich wurde. Ich spürte deutlich, welchen enormen Einfluss die Beschäftigung des deutschen Reformators mit Musik auf das Bewusstsein und auf die Kirchenpraxis der evangelischen Christen bis heute ausgeübt hat. Luther maß der Musik wie der Theologie höchste Bedeutung für das Seelenheil des Menschen zu, weil sie »den Teufeln zuwider und unerträglich sei« und »solches vermag, was nur die Theologie sonst verschafft, nämlich die Ruhe und ein fröhliches Gemüte« (so in einem Brief an Ludwig Senf vom 1.10.1530).
Luther war selbst ein geübter Sänger, Lautenspieler und Liedkomponist und er kannte die Werke vieler zeitgenössischer Komponisten. Da ihm an einer starken aktiven Beteiligung der Gemeinde am Gottesdienst lag, sorgte er für eine Integration möglichst vieler deutschsprachiger Gemeindelieder in den Gottesdienst, die die lateinische Messe ersetzen sollten. Als von ihm selbst verfasst sind Dutzende von Liedern und Gesängen überliefert (das vielleicht bekannteste ist »Ein feste Burg ist unser Gott«) sowie Hymnenbearbeitungen und Psalmenlieder. Darüber hinaus übersetzte er traditionelle gregorianische Hymnen und veränderte bei Bedarf deren Melodie, um sie dem Duktus der deutschen Sprache anzupassen. Er verwendete auch Melodien von Volks- und Weihnachts- sowie von Studentenliedern, »Gassenhauer, Reiter- und Bergliedlein christlich, moraliter und sittlich verändert, damit die bösen ärgerlichen Weisen, unnützen und schandbaren Liedlein auf der Gassen, Feldern, Häusern und anderswo zu singen, mit der Zeit abgehen möchten, wenn man christliche, gute, nützliche Texte und Worte darunter haben könnte«. Die Lutherchoräle erschienen erstmals 1523 / 24 im Achtliederbuch und 1524 in Wittenberg in einem evangelischen Gesangbuch. Sie wurden zu einer Säule des reformatorischen Gottesdienstes und prägten die Geschichte des geistlichen Liedes auf dem europäischen Kontinent in nachhaltiger Weise.
Luther sah Musik auch als notwendigen Teil der schulischen und universitären Ausbildung. Er verlangte von allen Schulmeistern sowie von angehenden Pfarrern eine gewisse Gesangsausbildung und meinte, dass diese theoretische und praktische Fertigkeiten in der Musik mitbringen sollten. »Man muß Musicam von Noth wegen in Schulen behalten. […] Die Jugend soll man stets zu dieser Kunst gewöhnen, denn sie machet fein geschickte Leute.« (aus: Luthers Tischreden, Nr. 6248)
Universum Bach
Über die Frage der Einheit in der Vielfalt der Musik im Lauf verschiedener Epochen diskutiere ich während meines Besuchs auch mit Marion Winkler. Sie bestätigt meine Ansicht, dass die Art der Wahrnehmung und der Beurteilung verschiedener Musikstile so wie verschiedener Kunststile überhaupt sehr abhängig ist von der Perspektive der verschiedensten Rezipienten zu verschiedenen Zeiten. Als einschlägiges Beispiel erzählt sie mir eine früher nie von ihr erwähnte Begebenheit aus dem Leben ihrer Familie noch in Europa, bei der es allerdings nicht um Musik, sondern um die Malkunst ging.
Ein Onkel von ihr, so sagt sie, wäre in Frankreich einer der behandelnden Ärzte von Vincent van Gogh in Südfrankreich gewesen. Weil van Gogh mit seinen fast nur unverkauften Bildern so arm gewesen wäre, hätte ihr Onkel von diesem nie ein Honorar für seine ärztlichen Bemühungen verlangt. Marion wiederum habe ihrem Onkel sein Leben lang Vorwürfe gemacht, dass er nicht anstelle eines Honorars wenigstens eines von dessen Bildern erbeten hätte. Denn so wäre doch schließlich für die ganze Familie für immer ausgesorgt gewesen und auch sie, Marion, hätte nie ihr Brot mit Klavierunterricht verdienen müssen. Ja nun, so habe daraufhin ihr Onkel jedes Mal entgegnet, er habe für die oben im Speicher massenhaft herumstehenden Bilder seines Patienten nie etwas übrig gehabt. »Was in aller Welt hätte ich mit diesen Bildern anfangen sollen? Ich fand sie doch alle so hässlich«, pflegte er zu sagen.
Ich versuche Marion entgegenzuhalten, dass dem unbestritten größten Musikergenie aller Zeiten, Johann Sebastian Bach, seitens eines Kunstbanausen so etwas wohl kaum hätte widerfahren können. Unbestritten?, fragt sie gleich zurück. Dann macht sie mich auf den mir an sich bekannten und für mich noch bis heute unfassbaren Tatbestand aufmerksam, dass gerade Bach zu seiner Zeit zwar als Organist und Kantor hoch angesehen war (obwohl er bei der Besetzung der in Deutschland mitunter angesehensten Stelle des Kantors und Musikdirektors in Hamburg dem um einiges jüngeren Georg Philipp Telemann den Vortritt hatte lassen müssen!), aber dass zu seiner Zeit von seinen Söhnen vor allem Carl Philipp Emanuel bekannter gewesen war als er und dass gerade dieser sich nach dem Tod seines Vaters vergeblich für dessen Aufwertung eingesetzt hatte. Erst die entscheidende Wiederentdeckung Bachs durch die Aufführung der Matthäus-Passion durch Felix Mendelssohn- Bartholdy 1829 im Leipziger Gewandhaus machte die Bedeutung Johann Sebastian Bachs auch als Komponist sehr viel breiteren Kennerkreisen zugänglich. Seine heutige weltweite Bedeutung errang Bach allerdings erst an der Schwelle zum 20. Jahrhundert.
Da mir Marion am Ende unseres Gesprächs zum Abschied noch ihren stattlichen Konzertflügel vorführen will, setzt sie sich an ihr Instrument und spielt, zu unserem kurzen Exkurs über Bach sehr gut passend, auswendig das Es-Dur-Präludium aus dem Ersten Band von Bachs »Wohltemperiertem Klavier«. Ich lausche entzückt ihrem wunderbaren, sanft getragenen und überzeugend authentisch klingenden Spiel. Ich muss unweigerlich an einige der letzten Schallplattenaufnahmen mit Bach-Interpretationen der Cembalistin Wanda Landowska in den USA denken, die ich mir während des Winters 1954 / 55 in Florenz ergriffen angehört hatte.
Nach diesem auch musikalischen Eintauchen in das »Universum Bach« fühle ich mich umso mehr dazu gedrängt, Marion nach ihrem Spiel noch ein paar Einblicke in mein über die Jahrzehnte gewachsenes, besonderes Verhältnis gerade zu diesem Komponisten zu geben. Auch wenn ich zu Bach nie eine so intim persönliche Beziehung habe aufbauen können wie etwa zu Franz Schubert, so ist er für mich bis heute die gewaltigste Musiker-Persönlichkeit aller Zeiten geblieben, mit dessen Werk ich mich selber nicht nur am Klavier, sondern auch noch spät an der Orgel versucht habe.
Einen ersten ganzheitlichen Eindruck vom gigantischen Werk Bachs bekam ich während einer längeren Unterbrechung meines Unterrichts bei Marion Winkler, als ich, zwei Jahre nach Kriegsende, auf unserer ersten Europareise die Sommermonate in der Schweiz verbrachte.
Schon bald nach unserer Ankunft in Zürich kurz vor Ostern 1947 nahm mich mein Vater mit in eine Aufführung von Bachs Johannespassion mit dem Zürcher Tonhalleorchester unter dessen damaligen Dirigenten Erich Schmid. Es war für mich das erste Konzerterlebnis in Europa überhaupt und die erste bewusste Begegnung mit dem Werk Bachs. Der damals noch sehr junge und wenig bekannte Tenor Ernst Haefliger sang den Part des Evangelisten, und die Rezitative am Cembalo wurden von meinem späteren langjährigen Klavierlehrer Hans Andreae gespielt. Mein Vater, der neben mir saß, erläuterte mir Sechsjährigem zwischendurch mit geradezu zwingender Eindringlichkeit die Symbolik der orchestralen Begleitung von Gesang und Handlung – besonders eindrucksvoll bei dem nach dem Tod Jesu und der Bass-Solo-Arie »Mein teurer Heiland« folgenden Rezitativ: »Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus«, was, wie mir mein Vater mit einer entsprechenden Handbewegung veranschaulichte, während des Zerreißens des Vorhangs mit den von Celli und Bässen gespielten, über zwei ganze Oktaven bis zum tiefsten D absteigenden Zweiunddreißigstelnoten dargestellt wird. Unmittelbar darauf folgt das von einem dreitaktigen, heftigen tremolando der Streicher begleitete »Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf …«.
Bis zu meinem nächsten Schritt, Bach selber am Klavier zu spielen, dauerte es noch lange. Es schien bei meinen beiden ersten Klavierlehrern in Europa eine stillschweigende Übereinkunft darüber zu bestehen, Kindern nicht zu früh Bachs Musik nahezubringen. Mein aus Neapel stammender Lehrer in Florenz, Giulielmo Rosati, war der erste, der mir Vierzehnjährigem eine von Bachs dreistimmigen Inventionen zum Üben aufgab. Ich erinnere mich, dass ich damals diese Aufgabe so lustlos anpackte, dass bei meinem abendlichen, halbstündigen Üben meine Mutter bald darauf aufmerksam wurde und mich mit der Bemerkung entlastete, dass der ernste Charakter der Bachschen Musik grundsätzlich sehr schwer zu verstehen sei und Kinder in der Regel zu Bach wenig Zugang hätten, und ich würde dafür sicher noch etwas Zeit benötigen.
Aber schon nach meinem nächsten Wohnortswechsel ein knappes Jahr später von Florenz wieder nach Zürich, diesmal in das dortige Gymnasium, änderte sich dies. In meinem nebenschulischen, privaten Klavierunterricht am Zürcher Konservatorium ließ mich mein erster Zürcher Lehrer systematisch hintereinander einige von Bachs »Französischen Suiten« studieren, und ich betrieb dies jetzt mit solchem Eifer, dass der Bann bald gebrochen war und ich ab da langsam mein besonderes, bleibendes Verhältnis zu Bach aufzubauen begann.