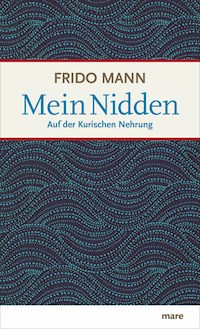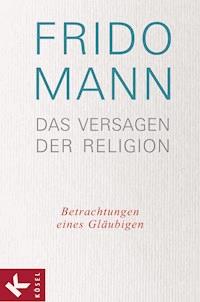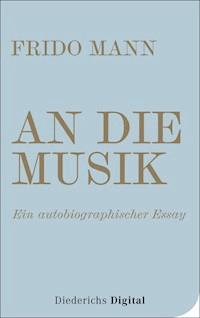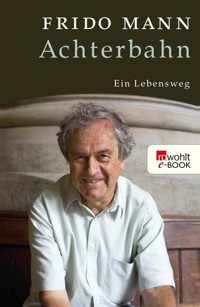
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er war der Lieblingsenkel von Thomas Mann, wie dessen Tagebuch in vielen begeisterten Einträgen bezeugt: Fridolin Mann, geboren 1940 im kalifornischen Exil als erstes Kind von Michael und Gret Mann. Jetzt erzählt Frido Mann zum ersten Mal in autobiographischer Form sein Leben: das Aufwachsen in einer ungewöhnlichen, zwischen den Kontinenten zerrissenen Familie, die frühen Begegnungen mit seinen berühmten Onkeln und Tanten, die innige Beziehung zu den Großeltern. Offen und unverblümt schreibt Frido Mann über sein schwieriges Verhältnis zum eigenen Vater, der sich mehr um seine Musikerkarriere kümmerte als um seine Söhne. Und Frido Mann schildert, welche Wege und Irrwege er selbst gehen musste, um eine ihn erfüllende berufliche Aufgabe zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Frido Mann
Achterbahn
Ein Lebensweg
Inhaltsverzeichnis
Zitat
Prolog
1. Kriegskind im amerikanischen Exil
2. Die Verpflanzung in die Kulturheimat Europa
3. Der Ausbruch
4. Die Achtundsechziger-Rebellion frisst ihre Kinder
5. Neubeginn: Psychotherapie als säkularisierte Seelsorge
6. Der Wendepunkt in den familiären Schreibschoß?
7. Geographischer und kultureller Brückenschlag und erste Vernetzungsversuche
8. Rückkehr zur Theologie oder Paradigmenwechsel?
Epilog
Namenregister
Karl Kraus
Traum vom Fliegen
Und wieder mir träumte, ich wäre geflogen,
und diesesmal war es doch sicherlich wahr,
denn ich hatte so leicht wie die Luft ja gewogen
und hatte die Knie an den Körper gezogen,
und es ging wie im Flug, im beherztesten Bogen
hoch über der schwergewichtigen Schar,
es war keine Täuschung, ich war nicht betrogen,
es flogen die Stunden, die Tage, das Jahr.
Mit fliegenden Hoffnungen vollgesogen,
so wach’ ich mit müderen Gliedern auf.
Zu Lande ist Leben; und angelogen,
vom leichtesten Trug an der Nase gezogen,
aus allen Himmeln zur Erde geflogen,
da lieg’ ich, da liegen die Lügen zuhauf.
Und trotzdem bleib’ ich dem Traume gewogen,
so läuft er sich leichter, der Lebenslauf.
Prolog
Der fünfzigste Todestag Thomas Manns. Die Hansestadt feiert ihn während einer ganzen Festwoche mit Vorträgen, Ausstellungen und Führungen und einem großen Festakt zum Abschluss.
Lübeck, 12.August 2005.Nach dem Betreten der Eingangshalle zu den «Media Docks» an der Trave arbeite ich mich durch ein Menschengewühl hindurch zum ebenfalls übervollen Vortragssaal. Bald erblicke ich meinen Gesprächspartner für das öffentliche Gespräch im Anschluss an meinen Vortrag, Professor W., der freudig auf mich zueilt und mich mit bayerischer Herzlichkeit begrüßt. Gleich danach treten auch zwei Damen vom örtlichen Organisationskomitee auf mich zu und fragen mich, ob ich denn am morgigen Sonnabend am Festakt in der Lübecker Marienkirche teilnehmen möchte – mit Bundespräsident Köhler, Marcel Reich-Ranicki und Vertretern des S.Fischer Verlags. Ich teile den Damen im geräuschvollen Rummel hastig mit, dass ich morgen ganz früh nach Berlin weiterreisen werde. Ich hatte, außer einem allgemeinen Vordruck zum Ankreuzen, nie eine persönliche Einladung erhalten. Keine Einladung? So was! Das tut uns aber leid. Können Sie nicht trotzdem kommen? Leider nicht, mein morgiger Termin in Berlin steht fest. Die beiden Damen lassen von mir ab.
Dann führt mich Professor W. in das Auditorium zu dem für mich freigehaltenen Platz in der ersten Reihe. In schützender Entfernung von mir wird die erste Reihe bereits von einer ganzen Riege hochrangiger Thomas-Mann-Experten besetzt. Einer davon hat seinerzeit meinen literarischen Erstling, den autobiographischen Roman «Professor Parsifal», im Feuilleton einer großen deutschen Zeitung scharf kritisiert. Ich mustere ihn verstohlen von der Seite, da ich ihm persönlich noch nie begegnet bin. Ansonsten sind wir offenbar beide bestrebt, mit unseren Blicken einander auszuweichen. Ich halte mich an meinem Vortragsmanuskript wie an einem Talisman fest. Ich rechne mit zumindest unterschwelligem Widerstand seitens der führenden Thomas-Mann-Germanisten gegen meine heute darzulegenden Erörterungen. Es ist mehr Kampflust als Angst in mir. Mein Vorsatz, während meines ganzen Vortrags und Gesprächs jeden Blickkontakt mit den Koryphäen in der ersten Reihe zu meiden, hilft mir, der Veranstaltung mit Gelassenheit entgegenzusehen.
Ursprünglich wollte mich die Festspielleitung heute nur zu meinen Enkel-Erinnerungen öffentlich befragen lassen. Schließlich wurde mein Wunsch akzeptiert, einen dieses Gespräch einleitenden Vortrag über das für Germanisten bisher eher unpopuläre Thema «Thomas Mann und die Frage der Religion» zu halten. Das ist mir sehr wichtig. Das Thema passt nicht nur gut zu einem runden Todestag. Es verbindet auch mich, wie ich erst sehr spät herausgefunden habe, mit meinem Großvater. Denn dieser hat in den frühen vierziger Jahren die Kindstaufe aller seiner vier Enkel in der Unitarischen Kirche von Los Angeles initiiert, mit der er während seines kalifornischen Exils in engem Kontakt stand. Noch kurz vor seinem Tod korrespondierte er von der Schweiz aus mit demselben Pastor. Ich freue mich richtig darauf, der Hörerschaft das gängige Bild vom gefühlskalten Geistesriesen zu korrigieren und die Entwicklungslinien im Leben und Werk Thomas Manns aufzuzeigen – vom jugendlichen nihilistisch-atheistischen Spötter zum christlich gläubigen Humanisten nach dem schweren Schock von Krieg, Faschismus und Heimatlosigkeit.
Einer der Germanisten in der ersten Reihe steht auf und begibt sich zum Rednerpult, um mich einzuführen. Er sagt kurz etwas über den «Mythos» meiner literarischen Rolle im «Doktor Faustus», obwohl dies gar nicht zum Thema meines Vortrags gehört. Dann steige ich die Stufen zur Rednertribüne hinauf und beginne zu sprechen. Für einen unbequemen Enkel scheint mir der Kontakt zu meinem Publikum auf Anhieb besonders gut zu gelingen. Aufmerksam und neugierig nehmen die Zuhörer jedes Wort meines Vortrags mit konzentrierter Stille bis zum Schluss auf. Auf die Fragen in dem sich an den Vortrag anschließenden Gespräch mit Professor W. berichte ich unter anderem von meiner Zusammenarbeit mit der religionsübergreifenden Tübinger Stiftung «Weltethos» und von deren Mitwirkung an unserem eurobrasilianischen Kulturprojekt.
Nach dem Ende der Veranstaltung werde ich von allen Seiten aus dem Publikum mit zustimmenden Kommentaren und Fragen bestürmt, und es werden mir Bücher entgegengestreckt, die ich signieren soll. Der Blick zu der inzwischen leeren ersten Reihe zeigt mir, dass die dort platzierte Germanistenriege offenbar als Erste sofort den Saal verlassen hat. Ich nutze den noch warmen Stuhl eines der Geflohenen, um darauf den Signierwünschen aus dem Publikum nachzukommen. Aus dem Stimmengewirr heraus vernehme ich irgendwann die Frage, welche auf den kürzesten Nenner gebrachte Lebenshaltung ich für mich als besonders wichtig ansehen würde. Der junge Mann strahlt mich an, als ich ihm spontan antworte: Die Kunst des Loslassens – was mir, noch ganz unter dem Eindruck meiner Erlebnisse wenige Tage zuvor beim Dalai-Lama in Zürich, wie selbstverständlich einfällt.
Nachdem sich der Saal langsam geleert hat, tritt zum ersten Mal der örtliche Festspielleiter auf mich zu, begrüßt mich, ohne meinen Vortrag und das nachfolgende Gespräch zu erwähnen, unverbindlich jovial und so lässig, als hätten wir uns, statt vor mehreren Jahren, noch vor einer Stunde gesehen. Jetzt lädt er mich und meinen Interviewpartner zum Lunch ein. Auf dem Weg dorthin hole ich eine Zeitschrift aus meiner Mappe. Es ist ein von ihm herausgegebenes Begleitheft zur derzeit laufenden Ausstellung «Das zweite Leben» über Thomas Mann in der Lübecker Katharinenkirche. Dort hat sich eine seiner Mitarbeiterinnen in einem Artikel folgendermaßen über mich ausgelassen:
Nach dem Tode Golos machte sich die Presse auf die Suche nach anderen noch lebenden Mitgliedern der Familie Mann und stieß auf Thomas Manns Enkel Frido, den sie bei seinen Forschungen nach den brasilianischen Wurzeln der Familie begleitete. Dieser nutzte die Popularität seines Namens, um in Paraty die Casa Mann, eine Gedenkstätte für seine Urgroßmutter, einzurichten, dabei natürlich vor allem von der brasilianischen Presse treulich begleitet.
Ich konfrontiere den Herausgeber mit diesem Passus. Er reagiert verlegen und entschuldigt sich mit der Begründung, er habe diese Stelle wohl überlesen. Meinem Hinweis auf die doch etwas merkwürdige Koinzidenz zwischen diesem Artikel und der Tatsache, dass ich auch zur morgigen festlichen Ehrung meines Großvaters nicht persönlich eingeladen wurde, begegnet er mit der Behauptung, dieses sei rein zufällig ein zweites, bedauernswertes Versäumnis, wofür er sich ein weiteres Mal entschuldigt.
Nach dem gemeinsamen Lunch in etwas gezwungener Atmosphäre werde ich erneut von den beiden örtlichen Komitee-Damen gefragt, ob ich denn nicht wenigstens heute Abend die musikalisch begleitete Lesung von Monika Bleibtreu und Dietmar Mues in der Katharinenkirche besuchen wolle. Ich sage gern zu, weil ich heute Abend ja noch hier bin. In meinem Hotel werde ich dann von mehreren Journalisten wegen des morgigen Festakts in der Marienkirche angerufen. Ein Fernsehsender möchte morgen Vormittag ein Interview mit mir in der vollbesetzten Marienkirche aufnehmen. Mit Verwunderung stelle ich fest, dass für die Medien meine Anwesenheit offenbar wichtiger ist als für die örtliche Festspielleitung, und ich verweise deshalb den Journalisten auf diese. Der Journalist reagiert mit Entsetzen, spricht von einem Skandal und versucht mehrfach, mich umzustimmen. Schließlich einigen wir uns darauf, dass wir in einer Stunde irgendwo hinter dem Hotel das gewünschte Interview führen.
Abends begebe ich mich in die vollbesetzte Katharinenkirche. Die beiden Schauspieler bringen, unterstützt von einem Gitarristen, im Wechsel die Stimmen der drei Mann-Töchter und drei Mann-Söhne über den pater familias Thomas Mann zu Gehör. Ich bin vor allem von Monika Bleibtreu beeindruckt. Ihr Vortrag überzeugt durch Klarheit und Prägnanz. Die Schauspielerin versteht es, sich in die von ihr übernommenen Rollen intensiv hineinzuleben.
Auf dem Weg durch Lübecks dunkle Gassen zurück zum Hotel. Die Altstadt überaus vornehm, aber eng und ein wenig bedrückend. Sie «riecht wahrhaft wohlhabend, stinkt sozusagen behäbig», hat der achtzehnjährige Heinrich Mann über seine Vaterstadt geschrieben. Wie mag am Fin de Siècle einem übersensiblen Patriziersohn mit einer brasilianischen Mutter hier zumute gewesen sein?
Beim Frühstück am nächsten Morgen erblicke ich unverhofft Monika Bleibtreu allein an einem der Tische. Ich warte, bis sie mit ihrem Teller zum Buffet geht, spreche sie dort an und beglückwünsche sie für ihre gestrige Darbietung. Wir kommen kurz ins Gespräch und verabschieden uns dann. Das war ein guter Abschluss. Noch bevor sich die Creme des heutigen Festakts hier einfindet, hole ich meine gepackten Koffer und verlasse rasch das Hotel in Richtung Bahnhof.
Bei jeder bisherigen Abreise von Lübeck habe ich, das eine Mal stärker, das andere Mal schwächer, gespürt, wie ein auf mir lastender Druck von mir wich. Heute jedoch, kurz vor diesem gigantischen Festakt, bei dem ich und die in der ersten Reihe Sitzenden einander glücklich losgeworden sind, ist es besonders intensiv. Als der Regionalexpress nach Hamburg losfährt und sich zuerst vom Bahnhof und dann von der ganzen Stadt immer weiter entfernt, merke ich, wie ein riesiger Stein von mir abfällt. Mich überkommt ein lang anhaltendes Gefühl der Befreiung und Erleichterung.
1.Kriegskind im amerikanischen Exil
Die pränatale Achterbahnfahrt. «Der erste Enkel, Amerikaner von Geburt». Carmel und Mill Valley. Hospiz Pacific Palisades. Erste Europareise. Das Stigma von literarischem Frühtod und Verewigung.
Kalifornien im Zweiten Weltkrieg.
Was gibt es Schöneres und Privilegierteres, als im südlichen Kalifornien aufzuwachsen, unter dessen Sonne die Zitronen im herrschaftlichen Garten und die Orangen in den endlosen benachbarten Plantagen reifen und unter dessen schattenspendenden Palmen man auf das tiefblaue Meer und die weit geschwungene Küste von Santa Monica hinunterblickt? Nicht nur die idyllische Landschaft und die mediterrane Wärme der Pazifikküste machen das Leben zu einem Paradies. Es sind auch die Menschen, die in der Villa inmitten dieses Gartens wohnen: die gelegentlich von der europäischen Kriegsfront zu Besuch weilenden Onkel und Tanten, die verlässliche und fürsorgliche Großmutter und der liebevoll zugewandte, dazu noch weltweit gefeierte und übermächtige Großvater.
Frühjahr oder Frühsommer 1940.Ein Vergnügungspark im einige hundert Meilen nördlich von Los Angeles gelegenen San Francisco. Ein seit einem Jahr glücklich verheiratetes, junges Emigrantenpaar, das Anfang des Jahres auf einem Flüchtlingsschiff unversehrt den deutschen Torpedos und Minen im Atlantik entkam und bald an die kalifornische Westküste zog. Das Paar schiebt sich richtungslos durch die Menschenmasse und lässt sich vom Lärm der Drehorgelmusik, von Marktschreiern, Schlangenbeschwörern und Schießbuden betäuben. Die beiden bleiben vor einer Achterbahn stehen. Sie beobachten, wie sich die durchgeschüttelten und benommenen Fahrgäste mit noch käsebleichen Gesichtern aus den Waggons herausschälen. Das junge Ehepaar löst an der Kasse zwei Karten. Der Kassierer blickt etwas irritiert auf den deutlich vorgewölbten Bauch der Frau und schaut den beiden kopfschüttelnd hinterher. Ja, er hat ganz richtig gesehen. Die Frau ist schwanger, hochschwanger.
Vielleicht zwanzig Jahre später erzählt mir mein Vater Michael lachend von dieser Achterbahnfahrt in San Francisco. «Als dich die Mama damals erwartete, waren wir jung und unerfahren». (er war 21, sie 24), um dann, immer noch lachend, hinzuzufügen: «Und darum bist du ja auch so missraten.»
Am 31.Juli 1940 notiert Thomas Mann in seinem Tagebuch: … Telegramm von Bibi aus Carmel, dass das Kind, ein Knabe, glücklich zur Welt gekommen. Die Großvaterschaft kommt spät und macht mir geringen Eindruck. Der erste Enkel, Amerikaner von Geburt, hat deutsches, brasilianisches, jüdisches und schweizerisches Blut, vom letzteren sogar noch von meiner Großmutter.
Erste Erinnerungen. Die eine Szene: Ich stehe zusammen mit meinem höchstens zweijährigen Bruder Toni in der hellen Sonne vor der Garage unserer Lovell Avenue 76 in Mill Valley bei San Francisco. Eine Frau auf der Straße fragt mich etwas, was meinen kleinen Bruder betrifft, sehr freundlich interessiert, aber irgendwie auch besorgt, fast kontrollierend. Ich reagiere unsicher und vorsichtig. Was will diese Frau von mir? Habe ich etwas falsch gemacht? Irgendwann lässt sie wieder von uns ab. Die zweite Szene: Ich warte in dem schon am Morgen sommerlich hellen Badezimmer meiner Großmutter Katia in Pacific Palisades darauf, von ihr angekleidet zu werden. Heute, so geht es mir durch den Kopf – oder war es gestern oder vorgestern?–, ist ein Attentat auf Hitler verübt worden. Wer ist Hitler? Er ist jedenfalls der Inbegriff des Bösen und des Lebensbedrohlichen, und irgendetwas Wichtiges und Befreiendes gegen ihn ist gelungen, worüber alle im Haus sehr froh sind. Besonders typisch ist die dritte Szene: Heiligabend in Pacific Palisades. Ich sitze mit der ganzen Familie auf dem Sofa in Großvaters Arbeitszimmer, und wir singen, begleitet vom Geigenspiel meines Großvaters, Weihnachtslieder, während das Christkind im living room die Kerzen anzündet. Erst kürzlich fand ich im Tagebuch meines Großvaters von 1945, dass nicht er, sondern mein Vater es war, der damals gespielt hat, und nicht auf der Geige, sondern auf der Bratsche. Ich war damals fünfeinhalb.
Die Unklarheit meiner Erinnerungen, ob ich mich dem elterlichen oder dem großelterlichen Haus zugehörig fühle, rührt vermutlich daher, dass meine Eltern mich schon mit eineinviertel Jahren zuerst für zwei und bald danach für durchgehend vier Monate zu meinen Großeltern gegeben haben. Ein knappes halbes Jahr nach dem Umzug meiner Großeltern im Frühjahr 1941 von Princeton nach Pacific Palisades bitten meine Eltern diese, mich – laut Tagebucheintragungen meines Großvaters – für einige Zeit zu sich zu nehmen – zur Entlastung meiner Mutter, die inzwischen meinen Bruder erwartet. Nur eine Woche nach dem Eintreffen meiner Großeltern mit mir in Pacific Palisades vermerkt mein Großvater in seinem Tagebuch am 2.Dezember 1941: Das Söhnchen mit Milchschokolade gefüttert. Herzliches Entzücken über seine Lieblichkeit, sein Lachen über Scherzerfindungen, eigene u. fremde. Meine Apostrophierung als Söhnchen im Tagebuch wird sich noch einige Male wiederholen.
Bei meiner Rückkehr nach San Francisco zwei Monate später erkenne ich meine Mutter zuerst nicht wieder. Sie reagiert erstaunt über meine zwischenzeitliche Entwicklung. Kurz nach Ostern 1942 werde ich, auf Veranlassung meines Großvaters, zusammen mit meiner Cousine Angelica, Elisabeth Mann Borgeses älterer Tochter, in Los Angeles in der unitarischen Kirche getauft. Zur Geburt meines Bruders Toni bald danach im Sommer halte ich mich wieder monatelang allein bei meinen Großeltern auf. Ich sehe zum ersten Mal meinen bereits drei Monate alten Bruder im Herbst anlässlich eines Besuchs meiner Eltern mit ihm aus Mill Valley. Mir wurde später erzählt, ich hätte bald nach Tonis Ankunft in Pacific Palisades sein auf den Fenstersims in die Sonne gestelltes leeres Körbchen hinuntergestoßen.
Eine Ferienwohnung bei Torremolinos in Südspanien im Oktober 2004.Die schönsten und beglückendsten Stunden erlebe ich immer am Abend im Wohnzimmer. Endlich am dritten Abend geht mir auf, warum. Der Blick auf das Lichtermeer an der weit geschwungenen Küste und das noch sommerliche Zirpen der Grillen im Garten. Es erinnert mich plötzlich fast überwältigend an den Blick von Großmutter Katias Zimmer in Pacific Palisades auf das hell erleuchtete Santa Monica an der Pazifik-Küste. Ab jetzt sauge ich jeden Abend stundenlang die Eindrücke in mich auf. Dieses Ineinanderverschwimmen von Gegenwart und Kindervergangenheit.
Während der regelmäßigen, mehrwöchigen Aufenthalte in Pacific Palisades im Sommer oder Herbst und meistens auch über die Weihnachtsfeiertage ab 1942 reihen sich meine ersten schemenhaften Eindrücke immer mehr zu bleibend prägnanten Bildern aneinander und runden sich langsam zu filmartigen Szenenkomplexen. Sowohl im langgestreckten, zweistöckigen Haus als auch im großen Garten kann ich mich frei bewegen. Besondere Heiligtümer bleiben das Arbeits- und das Schlafzimmer meines Großvaters, genannt Opapa. In Letzterem darf ich mich nur manchmal beim ersten Morgenkaffee beider Großeltern aufhalten, wo der Tag bereits mit angeregter Unterhaltung beginnt. Besonders erinnere ich mich an die Erzählung meines Großvaters von seinem Besuch im Weißen Haus in Washington bei Präsident Roosevelt. Ich spüre seine besondere Hochachtung vor diesem Mann und sein Bedauern, dass der nur zwei Wochen vor Kriegsende verstorbene Präsident seinen Sieg über Nazideutschland nicht mehr erleben durfte. Den Schlaganfall, den er erlitt, demonstriert mein Opapa sehr anschaulich mit einem plötzlichen Fallenlassen seines Kopfes nach vorn auf eine fingierte Schreibtischplatte. Eine Besonderheit ist auch die auf einem Sofatisch im living room stehende kleine Spieldose, aus der, wenn Großvater den Holzdeckel für mich aufklappt, «An der schönen blauen Donau» erklingt. Ich beobachte dabei fasziniert das Drehen der die Glockenklänge erzeugenden Miniaturwalze im Inneren und versuche, deren Mechanismus zu ergründen.
Im Arbeitszimmer pflegt unser Großvater meinem Bruder Toni und mir nachmittags auf dem hellen Sofa Märchen vorzulesen, von Hauff, aus Tausendundeiner Nacht und vor allem von Hans Christian Andersen. Die Rezitationsweise des meisterhaften Vorlesers ist ein solches Fest, dass ich oft schon kaum mehr auf den Inhalt des Vorgetragenen achte. Von dieser Stimme geht eine starke suggestive Kraft aus. Je häufiger und tiefer sie auf mich wirkt, desto anhaltender sind die Nachschwingungen. Ich glaube es noch heute zu spüren, wenn ich selber vorlese. Unvergesslich für mich sind auch die zahllosen karikaturähnlichen Zeichnungen, die mein Großvater sozusagen auf Bestellung für mich verfertigt hat: vor allem von dem polnischen Cellisten Bem in der San Francisco Symphony, in der mein Vater mitspielte und von dem ich meinem Großvater wohl viel erzählt habe. Diese Zeichnungen existieren alle nicht mehr, so wie auch fast alle Briefe, die mir mein Großvater bis zu seinem Tod geschrieben hat. Die ganz wenigen späten, die ich als Halbwüchsiger selbst verwahrt habe und die auch veröffentlicht worden sind, vermochte ich zu retten. Die Dutzende der noch von meinen Eltern aufgehobenen, ganz frühen Briefe meines Großvaters an mich und die Fülle seiner originellen Zeichnungen sind hingegen alle auf mysteriöse Weise verloren gegangen.
Genauso gern wie im Großelternhaus spiele ich auch draußen auf der porch, der Veranda, wo bei schönem Wetter manchmal gefrühstückt wird. Ein schier unermesslicher Tummelplatz ist der weitläufige Garten mit den Palmen und den Zitronen-, Öl- und Eukalyptusbäumen und Pfeffersträuchern und dem großen, schnell wachsenden, warmen Rasen, der allabendlich von Großmutter Mielein mit dem sich um die eigene Achse drehenden sprinkler bewässert wird. Der Bereich außerhalb des großelterlichen Grundstücks ist für mich uninteressant, fast ängstigend. Die Grenze des den Garten umzäunenden Buschwerks überschreite ich allein oder mit Toni nur selten – auf die Straße oder zu den benachbarten Orangenplantagen. Wie mir Mielein später erzählte, soll ich gelegentlich mit dem in der Nachbarschaft wohnenden, etwa gleichaltrigen Sohn des Schauspielers Sir Laurence Olivier gespielt haben, einem bei meinen Großeltern ziemlich unbeliebten Jungen namens Tarquin.
Etwas ganz anderes sind die täglichen Spaziergänge vor jedem Mittagessen zusammen mit dem Großvater. Dort plaudern wir angeregt, und ich sammle manchmal schöne Steine von der Straße auf. Irgendwann holt uns Mielein mit dem Buick ein, und wir fahren alle zusammen wieder nach Hause. Manchmal spazieren wir auf der palmenreichen Promenade über dem Strand von Santa Monica. Beim Abschreiten der Strecke dreißig Jahre später erkenne ich wieder den damals schon vom Wetter gebleichten, hellgrünen Holzverschlag, an dem wir früher jedes Mal vorbeigingen. Weitere zehn Jahre später ist das Bretterhäuschen verschwunden. Trotz der Nachbarhäuser wirkt das nur mit dünner Vegetation bewachsene, bergige Land oberhalb von Pacific Palisades recht karg und trocken, fast wild. Bei meinen späteren Kalifornienbesuchen aus Europa bin ich erstaunt über die zwischenzeitliche Kultivierung und dichte Bebauung der Landschaft. Auch die früher völlig offene Einfahrt zu unserer 1550San Remo Drive ist total zugewachsen.
Eigentlich sind es nur die Vormittagsstunden des Schreibens und die Zeit des Mittagsschlafs und der nachmittäglichen Arbeit des Großvaters, die ich nicht mit ihm verbringe. Während aller Mahlzeiten, der Spaziergänge und beim ausführlichen abendlichen Schallplattenhören ist er immer da. Beim Frühstück ist der von ihm ausgehende Duft nach Eau de Cologne am stärksten. Auch darf ich am Morgen mit einer Berührung seiner Wange prüfen, wie gründlich rasiert diese ist. Er ist ein sehr ruhiger Großvater, trotzdem präsent, auch wenn er wenig oder gar nicht spricht. Gelegentlich sprudeln Meinungsäußerungen oder Erzählungen aus ihm heraus, heiter, hell, prägnant; gesetzt und doch leicht und oft lustig. Und durch alles hindurch spüre ich, obwohl wir einander körperlich kaum berühren, seine durchgehende, verlässliche Liebe und Zärtlichkeit mir gegenüber, besonders bei den alltäglichen Begrüßungen oder Verabschiedungen.
Mielein kann mich – im Gegensatz zu meiner Mutter – beim Gutenachtsagen am Bett wohltuend am Kopf oder im Gesicht streicheln. Sie ist in erster Linie für die Mahlzeiten und die Körperhygiene und die Strukturierung des Tages zuständig. Bei ihren Einkaufsfahrten im offenen Buick in die Stadt fahren Toni und ich oft mit. Und dabei muss sie mir, immer mit einem Kopftuch vor dem Fahrtwind geschützt, ständig von Neuem die Geschichte des Hausbaus in Pacific Palisades vor dem Umzug von der Amalfi zur San Remo Drive erzählen, alle einzelnen Schritte von den ersten Entwürfen des Architekten über die vielfältigen, spannenden Bauphasen bis hin zur Hauseinweihung. Sie erzählt so wunderbar und anschaulich, dass sie mir diesen Vorgang immer und immer wieder bis zum Überdruss berichten muss.
Bei diesen Stadtfahrten nach Santa Monica, Westwood oder Beverly Hills kommt es häufig zu enervierenden Ärgernissen mit der Polizei. Wegen ihres rasanten Fahrstils und ihres gelegentlichen Falschparkens wird sie häufig von den mit lauter Sirene auf dem Motorrad oder im schwarzen Polizeiwagen vorfahrenden Beamten zum Anhalten aufgefordert, woraufhin sie jedes Mal mit erschreckend aufbrausendem Jähzorn reagiert. Als umso amüsanter empfinde ich dann beim folgenden Mittagessen ihre theatralisch vorgetragene Wiedergabe des Streitdialogs mit dem Polizisten, in dem sie, immer genau vorhersehbar, die Rollen vertauscht und das angebliche furiose Gebrüll des «Schutzmannes» mit ihrer eigenen ausgesuchten Sanftmut beantwortet. Sie kann auch zu uns Kindern sehr heftig werden. Aber das hält nicht lange vor, weil sie eine liebevolle, verlässliche und überaus besorgte Großmutter ist.
Eine fast ganz an das Hausinnere gebundene Figur ist vor allem meine Tante Erika, wenn sie gerade nicht auf Vortragsreisen oder in sonstigen, wichtigen politischen Missionen unterwegs ist. Unser Umgang miteinander spielt sich überwiegend in ihrem kleinen Zimmer in der oberen Etage ab. Dort verbringe ich oft halbe Nachmittage und höre mir ihre unterhaltsamen Erzählungen und scharfzüngigen Kommentare zu Alltagsbegebenheiten, zur gegenwärtigen politischen Lage und zu Personen aus dem öffentlichen Leben an. Besonders abgesehen hat sie es auf den amerikanischen Präsidenten Truman. Von dessen Frau behauptet sie zu meinem größten Amüsement wiederholt, sie sei eine erbärmliche Köchin und seine Tochter würde als schauerlich schlechte Sängerin vor sich hin dilettieren.
Am meisten faszinieren mich Erikas erst vor wenigen Jahren erlebte Abenteuer und ihre oft tollkühnen Einsätze auf dem europäischen Kriegs- und Nachkriegsschauplatz als Armeekorrespondentin. Ich lausche ihren Erzählungen über den Londoner «Blitzkrieg» und wie sie später im noch nicht vollständig befreiten Frankreich mit ihrem Jeep um ein Haar in eine der «deutschen Taschen» geraten wäre. Nicht weniger atemberaubend sind ihre Schilderungen, wie sie mit demselben Jeep zu Kriegsende in der zerstörten Innenstadt von Warschau wegen der Einsturzgefahr der Ruinen nur im Schritttempo fahren durfte, während draußen in den Wäldern die Wölfe hausten. Geradezu abgründig muten ihre Erlebnisse während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse an, ihre apokalyptischen Begegnungen mit den obersten Nazi-Größen in deren Gefängniszellen und wie sie sich nach dem Ende der Prozesse zufällig in unmittelbarer Nähe von Görings Selbstmord aufhielt, als plötzlich ein amerikanischer GI angerannt kam und außer sich schrie: «Göring is having the fits.» Sie scheut sich auch nicht im Geringsten davor, mir Achtjährigem die nach der Befreiung der Nazi-Konzentrationslager ans Tageslicht gelangten, grausamsten Einzelheiten zu schildern, wozu sogar in ihrer Phantasie nachgestellte Folterszenen gehören. Und auf die Frage, ob Hitler denn Kinder gehabt habe, antwortet sie mir: «Da wären höchstens Austern entstanden.» Sie vibriert vor Erbitterung und Hass gegen die von ihr selbst so hautnah erlebten Nazis und gegen die sich jetzt als Unschuldslämmer und Märtyrer hochstilisierenden Mitläufer in der deutschen Bevölkerung, die die Verbrechen überhaupt erst möglich gemacht haben. Aber schon bei den ersten Anbahnungen des Kalten Krieges wendet sich ihr Zorn genauso kompromisslos gegen die antikommunistischen Hetzer und Gesinnungsschnüffler im eigenen Land.
Voller Bewunderung höre ich immer wieder von ihren unermüdlichen Reisen landauf, landab, bei denen sie nicht davor zurückschreckt, in ihren lectures selbst die mächtigsten Politiker im eigenen Land scharf zu attackieren. Ich sehe sie noch wie eine amazonenhaft stolze Kämpfernatur und Siegesgöttin mit schwarz funkelnden Augen im living room vor dem Radio stehen, wo sie uns alle gerade die Rundfunkübertragung ihres letzten politischen Vortrags präsentiert. Es ist faszinierend zuzuschauen, wie sie ihren eigenen gesprochenen Worten zusätzlich mimisch Nachdruck verleiht. Sie ist bei ihrem Eintreten für demokratische und humanistische Werte immer auch von Kopf bis Fuß Schauspielerin. Ihre Mimik, jede Bewegung ihres Körpers, ihre Wortwahl und Artikulation erscheinen wie einstudiertes Theaterspiel, ohne jedoch künstlich oder affektiert zu wirken. Man sagt ihr in der Familie nach, sie trüge in ihrem Auftreten und ihrer ganzen Persönlichkeit besonders das kreolisch-brasilianische Erbe ihrer Großmutter Julia in sich.
Schauspielerin, Dramaturgin und Regisseurin ist Erika jedoch nicht nur versuchsweise auf der Weltbühne so wie früher in ihrem Kabarett «Pfeffermühle», sondern auch auf der Bühne des Mann’schen Theaters. Zu diesem gehört besonders auch die Einstudierung meiner Auftritte als Rezitator der von ihr verfassten Weihnachts-, Neujahrs- oder Geburtstagsgedichte, die ich vor dem im living room versammelten Familienpublikum zum Besten zu geben habe. Die geborene Veranstaltungsleiterin studiert nicht nur in ihrem Zimmer mit mir ihre von mir auswendig zu lernenden Texte ein und gibt genaue Regieanweisungen. Sie schneidert auch eigenhändig meine Kostüme und traktiert mich mit Anproben. Besonders erinnere ich mich dabei an eine breite, tiefblaue Samtschärpe, die ich, bevor ich in die Arena trete und mein Gedicht aufzusagen habe, über meine anderen Ausstaffierungen schräg über die Brust ziehe. Im Nachhinein kommt es mir so vor, als wären meine Tante und ich mit diesen manchmal an Affenzirkus grenzenden Veranstaltungen eine Art Symbiose eingegangen. Sie kann vor ihrem Vater damit glänzen, dass sie ihm mit ihrer hauseigenen Festspielproduktion wirkungsvoll seinen eigenen Liebling vorführt, und ich sichere mir damit noch stärker bei meinem Großvater die Anerkennung und die Liebe, die mir seitens meiner eigenen Eltern versagt bleibt.
Gegen Ende meiner kalifornischen Zeit 1947/48 gebe ich Erika irgendwann eine Cartoon-Geschichte wieder, mit der ich mich besonders beschäftigt habe: «The three little pigs and the big bad wolfe». Die Hauptfigur ist das jüngste und schlaueste der drei Schweinchen, welche alle zum Schutz gegen den bösen Wolf ihre Häuschen bauen. Das jüngste erstellt, statt eines leicht zerstörbaren aus Stroh oder Holz wie seine Brüder, eines aus Backsteinen, welches als Einziges den Attacken des Wolfs standhält. Erika nimmt den Faden dieser Geschichte auf und spinnt ihn gemeinsam mit mir in vielen Fortsetzungen weiter. Insbesondere die sympathische Figur des cleveren Schweinchens wird von ihr phantasiereich ausgestaltet, nimmt im Lauf der Erzählungen immer mehr menschliche Züge an und erhält schließlich den Namen Till. In einem Brief an mich vom November 1948 beschreibt Erika zum ersten Mal ausführlich ihren «literarischen» Till, die Sängerknabenfigur der ab 1953 in Deutschland erscheinenden, vierbändigen Reihe «Die Zugvögel», das letzte der vielen von Erika verfassten Kinderbücher. Till ist inzwischen endgültig ein großer, starker, netter Bub… mit blauen Augen, hellbraunem Haar geworden, mit einer Stimme, die sehr schön laut und klar ist. Als Modell für den «Till» scheint sowohl Erikas Bruder Klaus als etwa Zwölfjähriger als auch meine wohl um einige Jahre vorausgedachte Erscheinung als etwa Dreizehnjähriger gedient zu haben.
So die Erinnerungen an Erika als eine mir, ganz im Sinne ihres Vaters, emotional und geistig besonders zugewandte, liebenswerte und faszinierende Tante. Die Erika der fünfziger und sechziger Jahre in Europa wird eine sehr andere Persönlichkeit sein.
In einer ganz anderen, sehr viel verhalteneren Weise für mich bedeutsam ist mein ältester Onkel Klaus. Obwohl ich weiß, dass er sich viel mit meinem Bruder Toni und mir abgegeben hat, sowohl in Pacific Palisades als auch während seiner Besuche in San Francisco und Mill Valley, sind praktisch sämtliche Erinnerungen an ihn wie ausgelöscht. Zwei offenbar ganz frühe Bilder sind noch schemenhaft vorhanden: Ich stehe in seinem Arbeitszimmer an der Türe, sehe ihn, von Zigarettendunst umhüllt und ziemlich weit von mir entfernt, aber mir zugewandt, vor seiner Schreibmaschine sitzen, und ich frage ihn schüchtern nach jemandem, den ich im Haus suche. Er antwortet sehr sanft und freundlich. In dem anderen Bild läuft er irgendwo am Strand in Badehosen an mir vorbei. Und dann gibt es aus einer sicher späteren Zeit ein entsprechend schärferes, dafür eher statisches Familienbild im living room in Pacific Palisades. Dort unterhält er sich in einem dieser hellen und etwas klobigen Fauteuils mit seinen Eltern und Erika, in seiner typischen, meinem und auch seinem Vater etwas ähnlichen Art, manchmal am Ende eines Satzes mit dem kurzen, hörbaren Einziehen der Luft eine zusätzlich bekräftigende Zäsur zu setzen.
Es gibt für mich nur eine plausible Erklärung dafür, dass ich ausgerechnet den Onkel, der Jahrzehnte später postum eine wichtige Bedeutung für mich erhalten sollte, so weit aus meinem Gedächtnis verdrängt habe: Sein plötzlicher, für mich viele Jahre mysteriös bleibender Tod, von dem ich als Achtjähriger in der Schweiz erfuhr, nachdem ich kaum zwei Monate vorher Kalifornien für immer hatte verlassen müssen. Er sei an «Herzschlag» gestorben, wurde mir, vor allem von meiner Mutter, gesagt. Ich sehe auch noch vor mir die verschlossenen, betretenen Gesichter meiner Großeltern im Zürcher Hotel Baur au Lac nur etwa zehn Tage später, wo sie nach der Rückkehr von ihrer Schwedenreise abgestiegen waren. Als ich als Erstes vorsichtig nach seinem Tod frage, erhalte ich als Antwort nur ein abwehrend trauriges Nicken. Alles, was während der folgenden Jahre innerhalb der Familie oder auch mit Freunden über den an «Herzschlag» Gestorbenen gesprochen wird, klingt für mich immer wie ein düsteres, hilfloses und irgendwo schuldbewusstes Raunen, das ich nie verstanden habe.
Erst als ich als gerade Fünfzehnjähriger, unter dem unmittelbaren Eindruck des Todes meines Großvaters, meiner Mutter gegenüber Klaus und dessen «Herzschlag» erwähne, entgegnet sie mir schroff, fast ungehalten: «Herzschlag? Wie? Du wusstest nicht, dass er sich umgebracht hat?» Mit über sechsjähriger Verspätung erfolgt der Schock. Ich wusste, dass sich zwei Großtanten, die beiden Schwestern meines Großvaters, Carla und Julia, umgebracht hatten. Aber mein Onkel? «Warum hat er sich das Leben genommen?» Meine Mutter: «Weil er zu schnell geschrieben und nichts gelernt hat.» Das muss wieder entschlüsselt werden. Es ist die Zeit, in der mein Vater seine Bratsche an den Nagel hängte, um durch ein solides Universitätsstudium, möglichst weit weg vom Europa seines Vaters, in den USA, «etwas zu lernen». Diese Warnung galt auch mir. Ich hatte zu dieser Zeit angefangen, Sonatensätze zu komponieren und Romanfragmente zu produzieren. Klaus’ beispielhaftes politisches Engagement und seine nur mit Erika vergleichbare Charakterfestigkeit und kompromisslose moralische Einstellung hatten mich schon früh beeindruckt. Geblieben war eine latente Bewunderung für den Frühverstorbenen. «Hätte er denn nicht auch Politiker werden können?» – «Politiker?… Nein, dafür war er ein zu rücksichtsvoller Mensch», lautet die Antwort meiner Mutter. Damit kann ich noch weniger anfangen. Für die nächsten fünfundzwanzig Jahre ist das Thema für mich erledigt.
Der dritte ein- und ausfliegende Gast im Taubenschlag der San Remo Drive ist Golo, mein Patenonkel und ebenfalls eine Art Ersatzvater. Er hat in der Familie nicht das unumstrittene Ansehen Erikas oder Klaus’ und auch nicht ein vergleichbares Profil aufzuweisen. Er ist der Jüngere, der unspektakulär und still Fleißige und Kluge, aber auch einzelgängerisch Sonderbare. «Dein Onkel Golo hat die seltsame Angewohnheit, sich nicht zu verabschieden, wenn er länger das Haus verlässt», erklären mir beide Großeltern immer wieder ein wenig irritiert, aber nachsichtig. «‹Ach, bei mir ist das halt so. Wenn ich weg bin, dann bin ich eben weg›, pflegt er dann zu sagen… Aber sonst ist er ein sehr angenehmer Hausgenosse.»
Nach seiner Entlassung aus der US-Army bei Kriegsende führt er, anders als seine beiden älteren, frei herumreisenden Geschwister, eine einsame, aber geregelte bürgerliche Existenz als Geschichtslehrer in einem College im kalifornischen Claremont. Von diesem fährt er jedes Wochenende zu seinem Elternhaus. In Gegenwart seiner Eltern wirkt Golo auf mich immer etwas stiller und angespannter, als wenn wir Kinder mit ihm allein sind. Aber auch bei uns verharrt er manchmal in seiner grüblerischen und melancholischen Stimmung, gibt sich jedoch überwiegend als schlagfertiger Witzonkel. Auf eine andere nervöse Angewohnheit, die er später ablegen wird, macht mich meine Großmutter, taktloserweise in Golos Gegenwart, aufmerksam, was er nur mit säuerlicher Miene registriert: Er wickelt häufig die seitlichen Spitzen seiner Haare um den Zeigefinger und lässt sie dann eine Weile so weiter drehen. In extremen Fällen der Kränkung kann er völlig die Fassung verlieren. So etwa, als ihm einmal ein Besucher des Hauses unverfroren ins Gesicht sagt: «Wenn ich Sie mir so ansehe, könnten Sie in einem Film über Hitler diesen eigentlich sehr passend spielen.» Golo erhebt sich, brüllt den Betreffenden an und verlässt den Raum.
Golo, schon damals ein leidenschaftlicher Wanderer, nimmt uns Kinder sehr gern mit seinem Fiat Topolino auf kleine Wanderungen in den kalifornischen Bergen mit. Dort blüht er auf. So auch auf vereinzelten Fahrten zum Strand von Santa Monica. Grundsätzlich scherzt er sehr gern und nimmt uns immer wieder von Neuem durch die Erzählung origineller, teils wahrer, teils erfundener Begebenheiten für sich ein. Zu den wahren gehören die Streiche, die seine College-Studenten mit ihm treiben, etwa wenn er eines Morgens beim Betreten des Klassenzimmers sein winziges Auto auf seinem Lehrerpult stehen sieht. Schon fast ein fester, vergnüglicher Ritus sind meine mir von Golo mit gespieltem Tadel vorgehaltenen bösen, angeblichen Streiche gegen die Rektorin meiner Schule in Mill Valley, Mrs. van Loon, wegen derer diese sich regelmäßig bei meinem Onkel beklagt habe: so das Ausstreuen von Reißzwecken auf ihren Stuhl oder ihr etwas in den Weg legen, damit sie darüber stolpert. Auch von seinen Kriegserlebnissen erzählt er gelegentlich, zum Beispiel von der Überquerung des Rheins mit Lastwagen nach Aachen. Aber so viel Interessantes wie Erika hat er nicht zu berichten.
Der alles in allem sehr unkomplizierte und angenehme Umgang mit Golo wird noch bis ins Europa der frühen fünfziger Jahre bis zum Tod seines Vaters bestehen bleiben. Damals verbrachte er während der von seinem College freigestellten Monate einige Zeit bei uns in Österreich, in Florenz oder auch in seinem Elternhaus in Erlenbach am Zürchersee. Bis dahin bleibt Golo unbestritten mein Lieblingsonkel.
Das vom Schicksal geschlagene «arme Mönle», meine Tante Monika, tritt erst sehr spät in meine Erinnerung. Diese Tante führt offenbar ein Schattendasein im (in meinen Augen so riesengroßen) Großelternhaus. Eine von allen dermaßen ungeliebte Mitbewohnerin sollte ich wohl einfach nicht wahrnehmen. Dass sie etwas Entsetzliches auf der Flucht aus Europa durchgemacht hat, ist mir nur ganz unterschwellig bewusst. Erst nach und nach wird mir das Bild vor Augen geführt, wie Monika sich, nach der Torpedierung des britischen Kinderlazarettschiffs durch ein deutsches U-Boot, im eisig kalten Wasser an eine Planke festklammert und zusehen muss, wie ihr Mann Jenö Lányi neben ihr in den Fluten ertrinkt. Vor diesem Hintergrund empfinde ich nachträglich das in dieser Zeit familienintern über sie Gesagte als ausgesprochen herzlos und unfair. Denke auch schon viel darüber nach, was man mit Moni tun könnte. Ist ja auch ein ganz unseliges Problemata, schreibt Erika bereits 1941 an ihre Eltern, und auch Katia nennt sie damals ein unlösbares Problem. Erschreckend drastisch und bösartig urteilt Erika 1942: Urmimchens Putzvasen – soviel ist richtig – können nicht nutzloser gewesen sein als diese meine Schwester.
In meinem Gedächtnis voll präsent ist nur eine mir sehr nachgehende, furchtbare Szene im Haus, die 1948 stattgefunden haben muss, als Monika in einem anthroposophischen Heim untergebracht werden soll. Ich verfolge vom living room aus eine dramatische Auseinandersetzung zwischen ihr und ihren Eltern im anliegenden Esszimmer. Dabei sehe ich nur sie. Ihre Eltern sind durch die halb zugezogene Schiebetüre zum Esszimmer verdeckt. Von meiner Großmutter höre ich donnerndes Gebrüll, während mein Großvater schweigt. Monika stampft schluchzend und schreiend mit dem Fuß auf. Der Inhalt des schrecklichen Streits ist völlig nebensächlich. Ich höre nur heraus, dass Monika das Haus verlassen soll. Als das Gewitter vorüber und Monika verschwunden ist, trete ich auf meinen Großvater zu und frage ihn verängstigt, aber vertrauensvoll wie immer, was passiert ist. Er erklärt mir, dass Monika jetzt leider wegzugehen habe, und er begründet dies mit ihrer zunehmenden Untragbarkeit als Hausgenossin. Untragbarkeit? Warum? Mein Großvater antwortet sehr ruhig sinngemäß: «Früher war die Tante Moni ein ausgesprochen netter und freundlicher Mensch. Aber seit dem, was ihr damals auf dem Schiff Furchtbares passiert ist, ist sie völlig verändert, nur noch ganz schwierig und zurückgezogen und eben überhaupt nicht mehr so, dass man mit ihr zusammen sein mag.» Monika wird zeitlebens für mich die Verfemte, Zurückgesetzte bleiben. Ich werde erst als Abiturient und dann als Musikstudent, wenigstens für einige Zeit, eine gute Beziehung zu ihr haben.
Eine ganz andere Stellung als ihre vier älteren Geschwister nimmt in Pacific Palisades meine Tante Elisabeth, genannt Medi, ein. Sie hat ihre eigene Familie mit festem Wohnsitz in Chicago und besucht in größeren Abständen, immer zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern Gogoi (Angelica) und Nica (Dominica), das kalifornische Elternhaus. Manchmal ist auch ihr schon früh aus dem faschistischen Italien emigrierter Mann Giuseppe Antonio Borgese dabei. Meine Erinnerungen an sie aus dieser Zeit sind sehr blass. Meine beiden Cousinen hingegen sind mir als temperamentvolle und originelle Gespielinnen im Großelternhaus im Gedächtnis geblieben. Gelegentlich werden zu Weihnachten oder an Mieleins oder Opapas Geburtstagen irgendwelche Kinderdarbietungen zu dritt oder zu viert gebracht. Wahrscheinlich wurde für einen dieser Anlässe die in der Öffentlichkeit bekannte Schwarzweiß-Studioaufnahme mit allen vier Enkeln gemacht: wir beiden Buben in Matrosenanzügen, die Mädchen in blütenweißen Kleidchen. Meine noch klarsten Erinnerungen an die Tante Medi und den Onkel Antonio in Amerika stammen von einem Besuch meiner Familie bei den Borgeses in Chicago, vermutlich auf der Durchfahrt nach New York vor dem ersten Einschiffen nach Europa, knapp zwei Jahre nach Kriegsende.
Wieder anders sind die wenigen, eher statischen Eindrücke, die mein Großonkel Heinrich bei mir hinterlassen hat. Ich sehe ihn vor allem als irgendwo im living room in sich zusammengesunken sitzenden, schnurrigen Greis. Das deutlichste Bild von ihm existiert für mich auf seinem Schoß sitzend: über mir das altersweiße, schief geneigte, schnurrbärtige Gesicht mit hoher Stirn und Brille. Ich erinnere mich auch, dass meine Großmutter regelmäßig ihren Schwager in der Nähe von Los Angeles besucht, ihm irgendwelche Sachen gebracht und mich dazu gelegentlich in ihrem Buick mitgenommen hat. Es gibt ein Bild, das sich mir noch als Vierjährigem eingeprägt haben muss: ein dunkler, wenig gemütlicher Raum mit einem von Manuskriptstößen beladenen Schreibtisch, vor dem ich auf einem Stuhl sitze. Seitlich von mir steht eine lächelnde Frau mit großen Zähnen und welliger Frisur, und ich höre die Stimme meiner Großmutter sagen: «Das ist die Tante Nelly.»
Von den Freunden des Hauses ist Bruno Walter am häufigsten zu Gast bei meinen Großeltern. Wegen der noch bis in die Münchner Zeit zurückreichenden, engen Freundschaft zwischen seiner und meiner Familie ist er für mich der «Onkel Kuzi». Er spielt gern auf dem Flügel im living room, der auch öfters für die von meinem Vater organisierten Hauskonzerte genutzt wird, meistens mit namhaften Musikern aus der deutschen Emigrantenkolonie in der Nachbarschaft. Für mich besonders einprägsam ist das sehr häufige Anhören von Bruno Walters neuesten Schallplattenaufnahmen mit den New Yorker Philharmonikern im living room zusammen mit meinen Großeltern und Erika. Da Erika und Bruno Walters Tochter Lotte seit ihrer Kindheit ein Herz und eine Seele sind, besucht Erika auch gern die Walters in Beverly Hills. Manchmal werde ich zu diesen Besuchen mitgenommen, und wir verbringen dann ganze Nachmittage in der geräumigen Villa oder am Swimmingpool auf Liegestühlen.
Von den zahlreichen Gästen in Pacific Palisades erinnere ich mich an erstaunlich wenige. Ich weiß heute, dass die Musiker Otto Klemperer, Artur Rubinstein, Igor Strawinsky, Arnold Schönberg und Theodor W.Adorno dort verkehrt haben und dass Adorno meinem Großvater für seinen Roman «Doktor Faustus» die Gesetze der Zwölftonmusik erläutert hat. Als Schriftsteller tauchen insbesondere Franz Werfel, Lion Feuchtwanger und Bruno Frank mit ihren Gattinnen im Haus auf. Erinnern kann ich mich nur an eines der mich besonders beeindruckenden Gesichter, welches einmal beim Vorbeigehen vor der Küche länger durchs Fenster schaute, als wir dort während des großen Dinners im Hause aßen. Vielleicht sah ich dieses Gesicht auch einmal über mir in meinem Kinderbett beim Gutenachtsagen. Einer der Zeichnungen meiner Patentante Eva Herrmann zufolge muss es Bruno Frank gewesen sein.
An Eva Herrmann erinnere ich mich wohl deshalb fast so gut wie an Bruno Walter, weil sie sich in ihrer Patentantenrolle auch noch nach unserer Rückkehr aus dem amerikanischen Exil nach Europa ein wenig verantwortlich für mich gefühlt hat. Sie hat mir Briefe geschrieben (die leider verloren gingen) und mir noch zu meiner Hochzeit mehrere Bände der Cotta’schen Goethe-Ausgabe von 1828 geschenkt. Ihre Schönheit und ihr vornehmes Aussehen, welches sie gern mit ihrer etwas prätentiösen Art zur Schau trug, brachten ihr bei meinem Großvater den Spitznamen «Gemme» ein.
Dass fast alle Besucher in Pacific Palisades für mich mehr oder weniger eine anonyme Masse geblieben sind, zeigt sich auch darin, dass ich mich vor allem an kollektive Begegnungen mit ihnen erinnere. Besonders eingeprägt hat sich mir die wiederholt vorkommende Szene, wenn meine Großmutter mich gegen Ende eines jener großen Dinners vom Kindertisch in der Küche ins kerzenbeschienene Esszimmer bittet, um mich der Gästeschar vorzustellen. Als Belohnung für meinen artigen Auftritt schält sie, während ich verlegen neben ihr stehe, einen Pfirsich, steckt mir vor allen anderen zufrieden lächelnd ein besonders großes und süßes, saftiges Stück in den Mund und entlässt mich dann wieder zurück in die Küche.
Es gibt für mich allerdings noch eine ganz besondere Hausgenossin, die oft am Nachmittag auftaucht. Es ist die auch aus Deutschland emigrierte Sekretärin meines Großvaters, Hilde Kahn, eine feine, attraktive junge Dame mit glänzender Gesichtshaut und stark geschminktem Rosenmund. Sie ist mein erster erotischer Schwarm. Ich fühle mich von der sich immer diskret im Hintergrund haltenden, schönen Frau früh verzaubert. «Die Frau Kahn hat schöne Beine», bekenne ich als Sechs- oder Siebenjähriger wiederholt Mielein gegenüber. Erst als Hilde Kahn fast sechzig Jahre später in der deutschen Mann-Fernseh-Trilogie zu ihren Erinnerungen befragt wird, erfahre ich, dass meine Kinderliebe wohl auf Gegenseitigkeit beruht hat. Bei dieser filmischen Wiederbegegnung mit ihr nach so langer Zeit stelle ich mit Genugtuung fest, dass sie sich in all den Jahrzehnten eigentlich überhaupt nicht verändert hat und in meinen Augen immer noch dieselbe Schönheit ist. Während eines Kalifornienaufenthalts sehr bald nach jener Fernsehübertragung nehme ich mir vor, mit ihr Kontakt aufzunehmen, sie hoffentlich wiederzusehen. Bei der Suche nach ihrer Adresse erfahre ich, dass sie kurze Zeit vor der Fernsehausstrahlung verstorben ist. Deshalb schreibe ich an ihren Mann, Mr.Reach in Santa Monica, einen Brief, woraufhin er mich sofort gerührt anruft und wir ein langes und bewegendes Gespräch miteinander führen.
Mill Valley seit den siebziger Jahren. Nach meinem Abschied vom kalifornischen Kinderparadies als Achtjähriger darf ich dieses erst Jahrzehnte später, 1975, zum ersten Mal wiedersehen. Während all meiner nachfolgenden Kalifornienbesuche zieht mich dieser Ort immer wie ein Magnet an. Die Erinnerung daran würde mich nicht so konsequent dorthin zurückholen, wenn – für die USA sehr ungewöhnlich – dieser Ort nicht wie nach einem Dornröschenschlaf praktisch unverändert geblieben wäre: Mill Valleys Ortskern, dessen etwas höher gelegene Straßen, darunter auch unsere Lovell Avenue, mein einstiges Elternhaus, die Nachbarhäuserreihe, der dichte Wald mit dem Spielplatz mitsamt noch genau derselben Schaukel, das (nur um einen Neubau etwas erweiterte) Schulhaus, ja sogar eine immer noch mit demselben Giftgrün angestrichene, aber innen völlig verfallene, ehemalige Bäckerei zwischen Spielplatz und Schule. Immer wieder dasselbe Gemisch aus Wehmut, Vertrautheit und Staunen, das mich beim Betrachten dieser Stätten überkommt.
Der Ort ist mit dem Auto leicht erreichbar. Entweder von San Francisco über die Golden-Gate-Brücke und dann an Sausalito vorbei – das war der tägliche Weg meines Vaters in die San Francisco Symphony – oder von Norden von Berkeley über die Richmond-Brücke und San Rafael bis kurz vor der Golden-Gate-Brücke. Am Ende der langen und schnurgeraden Ortszufahrt steht noch dasselbe Sägewerk mit riesigen Brettern. Und am Ortseingang, wo früher die Greyhound-Busstation war, ist, neben immer noch demselben gewaltigen Baum, ein betonierter Parkplatz angelegt. Das erstaunlichste Phänomen ist jedes Mal die Uhr am Ortseingang auf dem Laternenpfahl, noch heute mit demselben Zifferblatt, aber mit stehen gebliebenen Zeigern.
Die Geschäfte haben sich natürlich alle verändert. Der Frisörladen an der Ecke unterhalb der Lovell Avenue, bis vor einigen Jahren immer noch mit denselben Sitzen, auf denen wir als Kind unsere Haare schneiden ließen und auf dem Toni bei dieser Prozedur immer wie am Spieß schrie, ist inzwischen verschwunden. An einer Hausmauer daneben klebten früher die Filmplakate: mit Abbildungen der amerikanischen Filmgrößen aus den vierziger Jahren: die junge Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Errol Flynn, Humphrey Bogart, Charles Laughton, Clark Gable, Cary Grant und viele andere meiner damaligen Lieblinge. Am anderen Ende des Dorfes steht heute noch das ebenfalls erst kürzlich renovierte Kino. Dessen klassische Einrichtung war noch während meiner ersten Besuche in den siebziger Jahren unverändert: der Eingang, die Kasse, unter der Toni und ich vorbeischlüpften, um nicht bezahlen zu müssen und mit dem Eintrittsgeld Popcorn kaufen zu können, dahinter die Plakatwand und der dunkelrote Samtvorhang vor dem Vorführraum.
Dieses Kino war ein Herzstück unseres Kinderdaseins in Mill Valley. Ein Jugendverbot für Kinobesuche gab es damals in Kalifornien überhaupt nicht. Wenn meine Eltern ins Kino gingen, nahmen sie uns schon in den ersten Jahren einfach mit. Ich erinnere mich besonders an eine Gewaltszene zwischen einem Mann und einer Frau, bei der ich den schlagenden Mann mit grotesk deutschem Akzent reden zu hören glaubte. Ich vermute, dass diese Assoziation etwas mit der gelegentlichen Gewalttätigkeit meines Vaters meiner Mutter gegenüber zu tun hatte sowie mit dem überaus starken deutschen Akzent, mit dem er Englisch sprach. Dazu kam meine Horrorvorstellung von Deutschland, die ich mir aus den täglichen Tischgesprächen im Eltern- und Großelternhaus bildete. Dort sickerten andauernd neue Schreckensberichte vom europäischen Kriegsschauplatz in meine Kinderohren und vermittelten mir über die Jahre hinweg das Bewusstsein, trotz meiner Zugehörigkeit zu Amerika ein Emigrantenkind, ein Fremder, irgendwie Ausgeschlossener zu sein. Auch an eine Kino-Wochenschau erinnere ich mich, in der Truman noch als Vizepräsident Roosevelts bezeichnet wurde. Andere Filmszenen wiederum wurden dann zu Hause unter meiner Regie zusammen mit Toni nachgespielt, nachdem ich ihn zu fragen pflegte: «Möchtest du heute lieber love oder crime?» Einmal übernahm ich jedoch eigenmächtig die Rolle des klugen Roosevelt und überließ meinem kleinen Bruder die des dummen Truman.
Unser Elternhaus habe ich seit den siebziger Jahren mehrere Male ausführlich besichtigt, meistens allerdings nur von außen. Von dem allerersten, mich sehr bewegenden Besuch gibt es ein Foto vor dem Haus, zusammen mit meinem Sohn Stefan etwa in dem Alter, in dem ich Mill Valley verließ. Auffällig neu seit den vierziger Jahren ist nur die große Hecke auf der Mauer am Treppeneingang zum Vorgarten. Der Blechbriefkasten mit Öffnungsklappe und rotem Blechfähnchen ist jedoch bis heute derselbe geblieben. Ansonsten gibt es immer noch die Garage wie damals mitsamt der Einfahrt, darüber das frühere Zimmer meiner Mutter mit dem kleinen Balkon davor. Rechts im Parterre das study meines Vaters, sein Arbeits- und Schlafzimmer zugleich, in dem ich als Siebenjähriger für meine Klavierstunden bei Marion Winkler übte. Dort wurde auch viel Kammermusik mit Freunden aus der Nachbarschaft oder aus San Francisco gespielt, wofür immer Stühle aus dem gegenüberliegenden Beerdigungsinstitut ausgeliehen wurden. Ganz rechts neben dem heute verglasten Hauseingang lagen früher Esszimmer und Küche. Kinderzimmer und Bad gingen oben nach hinten in den Garten hinaus. Einmal in den frühen achtziger Jahren klingelten meine Mutter und ich aufs Geratewohl an der Haustüre, und wir wurden sofort mit freundlicher Selbstverständlichkeit zur Besichtigung hereingelassen. Der ganze Vorderteil des Hauses, der mir jetzt natürlich überall winzig vorkam, war weitgehend unverändert geblieben. Dort, wo hinter dem obengelegenen Kinderzimmer früher der Garten gewesen war, in den man durch das Schiebefenster hinaussteigen konnte, waren jetzt mehrere neue, angebaute Räume.
Ganz anders als in Pacific Palisades fühle ich mich während all meiner Kindheitsjahre in Mill Valley am glücklichsten außerhalb des Hauses. Das Haus ist eng und sehr hellhörig, besonders wegen des in alle Räume hinein geöffneten Heizungsschachts. Am sichersten fühle ich mich im Kinderzimmer, in dem ich frühmorgens im Bett manchmal bei Nebel die Schiffshörner in der San-Francisco-Bucht oder abends vor dem Einschlafen meine Mutter im Treppenhaus telefonieren höre. Wenn ich nicht im steil den Hang hochsteigenden und verwilderten Garten, auf der Straße, auf dem Spielplatz am Waldrand oder bei Freunden spielen kann, halte ich mich im eigenen Zimmer auf. Aber auch da kann der Vater, wenn wir während seiner Mittagsruhe zu laut sind, die Treppe hochgepoltert kommen, ins Zimmer stürmen und uns mit wutverzerrtem Gesicht anzischen oder uns auf den Kopf schlagen. Ein weiterer sicherer Platz ist die Küche. Denn dort essen wir Kinder immer, auch abends, wenn beide Eltern ungestört im Esszimmer nebenan speisen wollen, manchmal sogar mit geschlossener Türe.
In dieser Küche hat der alte, defekte Gasherd einmal gebrannt, wahrscheinlich viel harmloser, als ich es mir damals einbildete, da ich nach meiner Erinnerung mitten in den Flammen stand, ohne dass ich diese irgendwie gespürt habe. Sehr anders verhielt es sich mit dem selbstverschuldeten kleinen Brand oben im Kinderzimmer während meiner ganz frühen Schulzeit. Wir hatten im Unterricht gerade gelernt, dass jedes Feuer ohne Sauerstoffzufuhr erlischt, was uns mit einem über eine Kerzenflamme gestülpten Glas demonstriert wurde. Abends bricht ein Gewitter los, und meine Mutter stellt uns eine Kerze ins Kinderzimmer. Ich will nun das Schulexperiment wiederholen. Da ich mich im Dunkeln nicht in die Küche hinuntertraue, um ein Glas zu holen, behelfe ich mir mit einem dachförmig dicht über die Flamme gewölbten Stück Papier. Das fängt natürlich gleich Feuer. In meiner Panik, das ganze Haus könne in Brand geraten, halte ich das lichterloh brennende Papier weiter so lange mit zusammengebissenen Zähnen in der Hand fest, bis ich mir den ganzen Daumenballen verbrenne. Ich versuche die mir dabei zugezogene, schmerzhafte Brandwunde so lange wie möglich vor meiner Mutter zu verbergen. Aber sie entdeckt sie natürlich abends beim Auskleiden im Badezimmer. Ihre Ausheilung wird mehrere Monate dauern.
In dem gegenüber dem Kinderzimmer gelegenen Zimmer meiner Mutter halte ich mich sehr viel seltener auf als in dem meines Vaters unten am Treppenfuß. Denn im Zimmer des Vaters steht das Klavier. Mein Vater hat mir später gesagt, ich sei als Drei- oder Vierjähriger beim Zuhören der dort gespielten Kammermusik mit Freunden wiederholt in Trance gefallen, mit verdrehten Augen und seltsam schaukelnden Bewegungen des Oberkörpers. Mein Vater spielt mir auch gern Schallplatten vor, beispielsweise «Peter und der Wolf», und erläutert dabei die Programmmusik besonders spannend, anschaulich und originell. Dafür besteht eine meiner täglichen Aufgaben darin, kurz vor seiner Rückkehr aus der San Francisco Symphony die Fransen seines Teppichs im Arbeitszimmer mit den Fingern gerade zu rechen. Mein Vater hat nicht lange nach meiner Geburt seine Stelle als Bratschist in der San Francisco Symphony bekommen, weswegen wir von Carmel nach Mill Valley umgezogen sind. Mit seinen einundzwanzig Jahren das jüngste Mitglied des Orchesters, will ihn sein Chefdirigent Pierre Monteux schon bald wieder entlassen, angeblich, weil er im Konzert einmal mit braunen statt mit schwarzen Schuhen erschienen ist. Aber die Intervention seines Vaters bei Monteux bewahrt ihn vor dem Hinauswurf, sodass mein Vater bis zu unserer Übersiedlung nach Europa in diesem Orchester bleiben wird.
So unberechenbar sich mein Vater als nervös überspannter Wüterich aufführen kann, so überraschend zugewandt, liebevoll und lebendig humorvoll kann er sein. Als einen der schönsten Augenblicke erinnere ich es, einmal auf seinen Schultern zu sitzen, während er von der Küche ins Esszimmer und wieder zurück geht und ich dabei aus dieser riesigen Höhe den abgründig tiefen Boden betrachten kann. Auch zu einem Kinderkonzert der San Francisco Symphony nimmt er mich manchmal mit, und ich darf von meinem Fauteuilsitz aus stolz seinem Bratschenspiel an einem der Pulte zuschauen, bis er mich wieder abholt. Eines Nachmittags darf ich mich in einem Fotostudio ablichten lassen (ein Foto, das noch bis vor Kurzem lose in meiner Fotosammlung herumlag) und mir anschließend ein wenig Marzipan aussuchen. Unvergesslich geblieben ist mir auch eine Nachtwanderung mit meinem Vater und Toni bei Vollmond durch den unheimlich dunklen Wald am Fuß des Mount Tamalpais über Mill Valley. Auf dem Heimweg verirren wir uns hoffnungslos. Mein Vater versteht uns jedoch zu beruhigen. Mit dem kleinen Toni auf seinen Schultern leitet er uns wohlbehalten zurück nach Hause. Gelegentlich nimmt er uns zum Krebsefangen am Waldbach neben der alten Mühle mit, die unserem Wohnort seinen Namen gegeben hat. Ein recht gruseliger Anblick ist es dann nur, wenn der Vater zu Hause vor unseren Augen die Tiere lebend in das kochende Wasser im Topf auf dem Herd wirft und dann begeistert den raschen Wechsel ihrer dunkelbraunen Farbe ins Rote kommentiert. Als er beim Krebsefangen einmal in den Bach stürzt, gibt er sein Missgeschick geistesgegenwärtig als eine Clown-Einlage für uns Kinder aus.
Im Vergleich zu meinem Großvater oder zu Golo erlebe ich meinen Vater im Grunde wie ein riesiges Kind mit völlig unberechenbaren und daher sehr anstrengenden, extremen Stimmungsschwankungen. Er leidet sehr deutlich unter seiner eigenen Zerrissenheit und darunter, sich selbst so wenig unter Kontrolle zu haben. Ich habe aber nie erlebt, dass er mit seiner sich manchmal plötzlich und brutal entladenden Wut wirklich mich meint. Auch Eifersucht seinerseits, weil sein Vater mich vergöttert, ihn jedoch als Kind ausgesprochen schlecht behandelt hat, habe ich nie gespürt. Nur manchmal merke ich deutlich, dass er sich mit meinem vom Großvater weniger angesehenen, schwächeren kleinen Bruder solidarisiert, wenn er mich dabei erwischt, dass ich diesen ärgere oder tyrannisiere. Dann droht er mir: «Warte nur, wenn du groß bist, dann ist der Toni stärker als du und wird dich verhauen.» Ob mein Vater stolz darauf war, einen Sohn zu haben, den sein Vater über alles liebte, weiß ich nicht. Erst sehr viel später bekennt mir mein Vater etwas verlegen, er und meine Mutter hätten erwogen, mich wegen meines engelhaften Aussehens nach Hollywood zum Film zu geben. Ich kann nicht beurteilen, wie ernst diese Überlegung je gewesen ist und was sie wieder davon abgebracht hat. Manchmal denke ich, dass es ein Machtwort von meinem Großvater war, aber das mag eine vorschnelle und ungerechte Unterstellung meinen Eltern gegenüber sein.
Meine Mutter ist im Vergleich zu meinem Vater entschieden berechenbarer in ihrer gleichmäßig unterkühlten und eher desinteressiert wirkenden Art. Ihre Beziehung zu uns Kindern besteht hauptsächlich darin, uns zu verwalten. Sie ist immer ruhig und freundlich, versorgt uns und nimmt uns auch zum Einkaufen in den Ort mit. Aber an etwas anderes kann ich mich eigentlich nicht erinnern: an irgendeine körperliche Berührung von ihr. Auch ihre Bestrafungs- oder Androhungsmethoden zeichnen sich durch besondere, angsterzeugende Subtilität aus. Schon fast ein Ritual, vor dem ich mich jedes Mal fürchte, ist es, wenn sie abends im Bad meine beschmutzte Unterhose entdeckt, das Schiebefenster öffnet, die Hose hinausstreckt und sagt: «Jetzt zeige ich deine Bäh-Hose dem lieben Gott im Himmel.» Daran, dass sie mir etwas vorgelesen hat, kann ich mich kaum erinnern – nur einmal, als ich erkältet und mit Fieber im Bett lag, las sie mir abends in ziemlich grellem Licht aus Grimms Märchen vor. Als ich sie später einmal, auch noch als Kind in der Schweiz, stolz und verlegen zugleich auf meinen mir von Großmutter Katia nahegebrachten, besonderen Charme und Liebreiz als kleines Kind anspreche, glaubt sie, mir meine vorsichtig vorgetragene Bemerkung rasch zurechtrücken zu müssen: «Du warst als kleines Kind schön, aber affektiert, und der Toni war dafür mehr herzig.»
Wir alle vier fahren, besonders in den warmen Sommermonaten, häufig über Mittag mit unserem hustenden Vorkriegs-Plymouth über den Berg zum idyllischen Stinson Beach, wo wir den sich im Pazifischen Ozean auf die Golden-Gate-Brücke zubewegenden oder von dorther kommenden Schiffen nachschauen, während wir in den Dünen picknicken oder am Strand entlanglaufen. Wenn das Wasser nicht zu kalt ist, springen meine Eltern auch einmal in die Wellen.
Jahrtausendwechsel in San Francisco Downtown, Embarcadero. Es ist der 31.Dezember 1999, wenige Stunden vor Mitternacht. Meine Frau C. und ich quetschen uns in die von Berkeley nach San Francisco fahrende, überfüllte und im Inneren von Zigarettenrauch benebelte BART (Bay Area Rapid Transit). Im Zug lauter ausgelassenes Jungvolk in Vorfreude auf das Feiern in der Stadt. Plastikflaschen mit einer braunen, vermutlich mit Ecstasy oder einem anderen Aufputschmittel versetzten Flüssigkeit werden geschwenkt. Auch nach der beengenden Fahrt unterirdisch durch die Bucht geht das Gedränge und Geschiebe unvermindert weiter. Am Hafen ist für Mitternacht ein riesiges Feuerwerk angekündigt. Irgendwann verteilt sich die Menge ein wenig. Man kann wieder atmen und freier herumlaufen. Kurz vor 24Uhr geht es richtig los. So ein reichhaltiges und rasant abgeschossenes Feuerwerk habe ich noch nie gesehen. Trotzdem kommt mir bald etwas bekannt vor. Das Krachen der Feuerwerkskörper, die euphorisch schreienden und blind lachenden Gesichter, die tanzenden Körper, der Klang der Stimmen, die Artikulation der nur bruchstückhaft zu vernehmenden Äußerungen. Habe ich das alles nicht schon einmal erlebt? Dazu noch etwa hier, an dieser Stelle? Je mehr wir uns im Stadtinneren der Market Street nähern, desto mehr dämmert es mir. Plötzlich sehe ich mich inmitten des Taumels der Siegesfeier am 8.Mai 1945.Aber ich befinde mich nicht draußen auf der Straße, sondern zusammen mit Toni und unserem Hund Micky im Inneren unseres Autos eingesperrt. Meine Eltern hatten hier den Wagen abgestellt und sich dann zu Fuß ein Stück weit durch das Gewühl der wildgewordenen Menge vorwärtstreiben lassen. Das Krachen um mich herum klingt ähnlich wie Feuerwerk. Es sind Schüsse von heimgekehrten Soldaten. Ich sehe vom Autofenster aus, wie sie im entfesselten Trubel auf der Straße ihre Munition ins Leere verschießen. Überall bis dicht um die geschlossene Fensterscheibe herum schieben sich Massen verzerrt lachender Gesichter, tobende und tanzende Körper, gestikulierende Arme und Hände. Ich höre wilde Schreie. Und überall fliegen Massen an Zeitungspapier durch die Luft. Es ist, als triebe ich in einer Taucherglocke inmitten eines Meeres überschäumender Ausgelassenheit umher. Jetzt, bei der Jahrtausendwende, sind der Klang der Stimmen, die Redeweise der Menschen und ihre Art, sich zu bewegen, mir unheimlich vertraut. Aber spätestens als wir uns wieder auf den Heimweg machen, hat mich die Gegenwart aus der Illusion geholt, immer noch oder wieder zu diesem Land und seinen Menschen zu gehören.
Nach dem Ende des Krieges dauert es noch fast zwei Jahre, bis meine Eltern mit uns einen ganzen Sommer lang ihre kurz nach Kriegsausbruch verlassene europäische Heimat besuchen werden. Die Entminung des Atlantiks braucht ihre Zeit, und meine inzwischen auch zu amerikanischen Staatsbürgern gewordenen Eltern und Großeltern (wir vier Enkel sind es schon von Geburt an) warten auf ihre neuen Reisepässe. Bei deren Erhalt werden sie ihre tschechoslowakischen Pässe zurückgeben, welche sie 1936 als aus Deutschland Ausgebürgerte geschenkt bekommen hatten, um reisen zu können. Meinem Bruder und mir wird als Vorbereitung auf unsere Reise viel über die Schweiz erzählt, nachdem meine Mutter über Briefe mit meinen «anderen», mir noch unbekannten Großeltern wieder Verbindung aufgenommen hat. Von jenen «anderen» Großeltern, auf die ich zunehmend neugierig werde, bekommen wir Kinder zur Einstimmung ein faszinierendes Schweizer Bilderbuch über den Ozean geschickt. Es ist eine Bubengeschichte vom «Schellenursli», die im von Kalifornien wirklich extrem weit entfernten, bergigen und schneereichen Engadin spielt. In den Bildern klettern die martialisch der Natur trotzenden Leute mit Nagelschuhen über Felsen und über in schwindelerregender Höhe gespannte, schmale Hängebrücken und versinken tief im Schnee. Sie wohnen in massiven, mit vielen Holzschnitzereien versehenen Häusern mit Ställen daneben und essen allerlei wunderliche Gerichte. Der auf Deutsch verfasste Erzähltext ist mit vielerlei mir recht fremdartig vorkommenden Ausdrücken durchsetzt, die uns als «schweizerisch» nahegebracht werden.
In der Zwischenzeit werde ich in Mill Valley eingeschult. Vorn im Klassenzimmer steht, neben dem Lehrerkatheder, immer eine große amerikanische Flagge aufgepflanzt. Vor dieser haben wir täglich vor Unterrichtsbeginn die Nationalhymne abzusingen, die Jungens in salutierender Haltung, die Mädchen mit der Hand auf dem Herzen. In der Klasse schließe ich neue Freundschaften. Bei gelegentlichen Raufereien im Hof kann ich meine körperlichen Kräfte messen, mit leider ernüchterndem Ergebnis. Zu mir nach Hause bringe ich nur einmal einen der neugewonnenen Freunde aus der Klasse mit: einen hochaufgeschossenen, dunkelhaarigen Jungen namens Peter. Als dieser meinem Vater begegnet, flüstert er nur noch vor lauter Schüchternheit. Deshalb gebe ich solcherlei Versuche wieder auf.
Meine beiden besten Freunde sind nicht Mitschüler, sondern Söhne meiner kanadischen Klassenlehrerin Mrs.