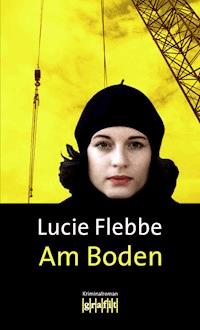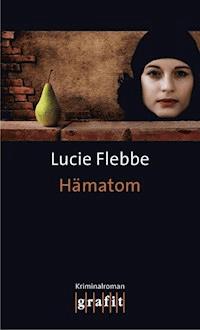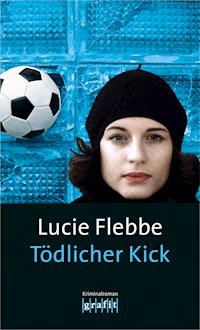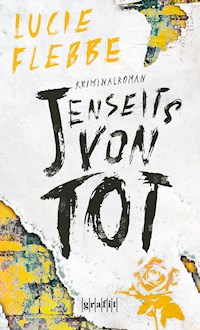Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schmutzige Geschäfte – ist unsere Gesundheit bloß eine Ware? Mieke Jentsch macht ihren Job als stellvertretende Klinikverantwortliche schon deutlich zu lange. Als ihr Vorgesetzter unerwartet Suizid begeht, rückt sie in ?die Chefposition auf und wird beauftragt, Kliniken an einen Medizinkonzern zu verkaufen. Ist der Milliardendeal die Chance, ihre Fähigkeiten endlich unter Beweis zu stellen? Doch je tiefer Mieke in die Materie vordringt, desto größer werden ihre Zweifel daran, dass ihr Vorgänger freiwillig aus dem Leben gegangen ist. Als sie das Opfer mehrerer Anschläge wird, beginnt sie zu ahnen, dass sie längst zur Schachfigur in einem tödlichen Spiel geworden ist . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Lucie Flebbe
Bad Business. Deal mit dem Tod
Kriminalroman
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack GbR, Hamburg.
Umschlaggestaltung: shutterstock/FlashMovie
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
eISBN 978-3-98708-014-2
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Lucie Flebbe kam 1977 in Hameln zur Welt. Sie ist Physiotherapeutin und lebt mit ihrer Familie in Bad Pyrmont. Mit ihrem Krimidebüt »Der 13. Brief« mischte sie 2008 die deutsche Krimiszene auf. Folgerichtig wurde sie mit dem »Friedrich-Glauser-Preis« als beste Newcomerin in der Sparte »Romandebüt« ausgezeichnet.
Für alle, die in ihren Jobs im Gesundheitswesen jeden Tag ihr Bestes geben, weil ihnen die ihnen anvertrauten Menschen am Herzen liegen – nicht der Profit
PROLOG
1994
Eigentlich stand er nicht drauf, angebaggert zu werden.
Auf ihre dreisten Annäherungsversuche war er eingegangen, weil er letzte Woche »Pulp Fiction« im Kino gesehen hatte, mit der kinnlangen schwarzen Ponyfrisur sah sie nämlich original aus wie Uma Thurman als Misses Wallace. Vielleicht kam sie ihm deshalb bekannt vor. Und ihr schwarzer Minirock und die Overknees waren verdammt heiß.
Sie packte ihn im Nacken, kaum dass sie im Wohnheim waren, wollte die Führung übernehmen. Na warte! Er verzichtete darauf, die Haustür ordnungsgemäß wieder abzuschließen, drängte sie stattdessen gegen die Wand und steckte ihr die Zunge in die Kehle.
Im gleichen Moment spürte er ihre Hand zwischen seinen Beinen. Okay, prüde war sie definitiv nicht, das kleine Kräftemessen versprach interessant zu werden. Eine echte Chance hatte sie natürlich nicht, aber das würde sie schon noch merken.
»Lass uns hochgehen.« Sie zerrte ihn zur Treppe. Anscheinend hatte sie es eilig. Sollte ihm recht sein.
Sie stolperten in den dritten Stock, die gläserne Treppenhaustür quietschte, das Flurlicht war immer noch kaputt.
Sie krallte die Finger in seine Haare, damit er den Kuss nicht unterbrechen konnte, während er in seiner Hosentasche nach dem Zimmerschlüssel wühlte.
Es dauerte einen Moment, bis er registrierte, dass das Quietschen ausgeblieben war, mit dem die Flurtür normalerweise wieder zufiel.
Irritiert versuchte er, sich umzusehen, sie hielt ihn an den Haaren fest. Deshalb nahm er die große, dunkel gekleidete Gestalt, die lautlos neben ihm auftauchte, nur aus dem Augenwinkel wahr.
»Was …?« Er schaffte es nicht, sich aus ihrem Klammergriff zu befreien.
Plötzlich war ihre Zunge weg, stattdessen drückte ihm jemand grob ein Stück Stoff in den Mund. Er wollte sich wehren, doch seine Arme wurden festgehalten. Zwei Personen drängten ihn in sein Zimmer.
Uma Thurman folgte ihnen, schloss leise die Tür.
Niemand sprach ein Wort. Das war gespenstisch.
Die anderen beiden waren kräftig. Schwarz gekleidet. Trugen Sturmmasken. Sie rangen ihn neben dem Bett zu Boden, der Größere setzte sich auf seine Oberschenkel und presste seinen linken Arm auf den Teppich. Er war schwer. Der Kleinere fixierte seinen rechten Unterarm mit dem Knie.
Scheiße.
Er brüllte gegen den Knebel an, doch der Stofffetzen erstickte jeden Laut. Er musste würgen, husten, Tränen traten in seine Augen. Er bekam keine Luft.
Als er wieder klarer sah, stand Uma Thurman neben ihm. Sie sah auf ihn herunter, während sie Plastikhandschuhe über ihre schlanken Finger streifte. Aus ihrer Handtasche zog sie einen Kabelbinder, ein Teelicht, ein Feuerzeug, einen Löffel, ein Päckchen mit weißem Pulver und eine Spritze. Legte alles auf seinen Schreibtisch.
Sein Herz raste. Er atmete laut durch die Nase.
»Was zum Teufel wollt ihr von mir?«, wollte er fragen, brachte jedoch nur unverständliche Laute zustande.
Uma Thurman sah ihn kurz an. Dann griff sie an ihre Stirn und zog sich die schwarze Ponyfrisur vom Kopf.
Ihr echtes Haar hatte sie sorgfältig abgeklebt, aber er wusste, dass es blond war. Jetzt erkannte er sie.
Er würde sterben. Heute. Jetzt.
Ihre letzte Begegnung war Monate her, aber dass er nicht gecheckt hatte, wer sie war, lag nicht nur an der Perücke, sondern auch am extravaganten Make-up mit dem schwarzen Lidschatten und den dunklen Lippen.
Sie hatte ihn absichtlich getäuscht. Und absichtlich verführt.
Um ihn zu töten.
Mit aller Kraft begann er, sich zu winden, zu treten. Er musste sich befreien, doch die Typen hielten ihn eisern fest.
Die Frau schnürte ihm mit dem Kabelbinder seinen Arm ab, bevor sie ohne Eile die Drogen aufkochte. Dann klopfte sie auf die Venen in seiner Ellenbeuge und setzte routiniert die Spritze.
OCEAN
Sie war so ein Opfer. Echt erbärmlich.
Daran änderten ein paar Millionen auf dem Konto genauso wenig wie die Tatsache, dass das hier ihre eigene Veranstaltung war. Sie war einundfünfzig Jahre alt, seit Jahrzehnten im Geschäft und fühlte sich trotzdem noch immer fehl am Platz unter so vielen Menschen. Sie hasste das Make-up und das elfenbeinfarbene Kleid, das einen aufsehenerregenden Kontrast zu ihrer dunklen Haut bildete. Sie wollte kein Aufsehen erregen, normalerweise versuchte sie, genau das unter allen Umständen zu vermeiden.
Oceans Herz klopfte gegen den Glücksbringer. Die Silberkette, an der er hing, verschwand im Ausschnitt ihres Kleides, sodass der Anhänger nicht zu sehen war. Tatti hatte ihr den Schutzengel geschenkt. Ocean drückte eine Hand auf den Talisman. Von seiner Wirkung merkte sie nichts. Am liebsten würde sie aufstehen und weglaufen, nur weil ihr gerade ein Mann einen Drink spendiert hatte.
Sie starrte das hohe Cocktailglas an, das die Frau vom Catering-Service vor ihr auf den Tresen geschoben hatte. Mit Hinweis auf den attraktiven Typ auf der anderen Seite der Bar, der ihr nun zuprostete.
Ocean wurde schlecht. Sie bereute, den abgesperrten VIP-Bereich verlassen zu haben.
Sex on the Beach. Die orangerote Flüssigkeit mit Schirmchen und Kirsche war unverwechselbar. Scheiß auf die Konfrontationstherapie, von der die Psychotante immer faselte. Die empfahl, dass sie sich beängstigenden Situationen so lange aussetzen sollte, bis die Panik nachließ. Jetzt konnte sie nur noch versuchen, nicht durchzudrehen. Doch die Übelkeit stieg weiter in ihr auf. Sie krallte die Finger um das Engelchen aus schwarzem Stein. Natürlich konnte es das Gewitter in ihrem Kopf nicht verhindern.
Denkst du, du kannst mich erst scharfmachen und dann abblitzen lassen? Das läuft nicht!
Plötzlich sitzt er auf ihr, seine Hose hängt bereits auf seinen Knien. Er zerrt ihre Arme an den Handgelenken über ihren Kopf. Sie will sich wehren, schafft es nicht. Sie ist zu betrunken, und er ist stärker.
Das Klirren rettete sie, holte sie zurück in die Gegenwart. Als sie blinzelte, erkannte sie ihr Cocktailglas, das neben dem Tresen auf dem Hallenboden zerplatzt war. Das Catering-Mädchen bückte sich bereits nach den Scherben. Doch auch der Typ kam um die Theke herum auf sie zu. Er war Brillenträger. Groß, schlank, blond. Und er konnte einen Smoking tragen, ohne wie ein steif gefrorener Pinguin auszusehen.
Ocean wurde eiskalt.
»War das eine Abfuhr, oder darf ich Ihnen einen neuen Drink bestellen?« Der Blonde lächelte.
Ocean wollte sich umdrehen und rennen, schaffte es aber nicht.
»Ich glaube, Sie haben sich vertan.« Billes Stimme klang schneidend scharf. Sie legte eine kräftige, warme Hand auf Oceans zitternden Unterarm.
»Sie können davon ausgehen, dass ich weiß, was ich tue«, entgegnete der Blonde, blieb aber trotzdem stehen.
Bille war in der Lage, eine furchteinflößende Aura wie einen unsichtbaren Schutzschild zu erzeugen. In diesem Moment hüllte ihr Schutzschirm Ocean mit ein. Das war Magie. Ocean drückte sich an sie.
»Wollen Sie ernsthaft Ocean O’Donn anbaggern, Luuk?«, erkundigte sich Bille belustigt.
Die Lippen des Mannes formten ein O – offensichtlich schnallte er erst in diesem Augenblick, wen er vor sich hatte. »Ich wollte lediglich meine Hilfe beim Aufräumen anbieten«, wich er geschmeidig aus und deutete auf die Scherben sammelnde Hostess.
»Davon möchte ich Sie keinesfalls abhalten«, antwortete Bille. Ocean wünschte sich, ein einziges Mal mit der Schlagfertigkeit ihrer Freundin reagieren zu können, statt zu glotzen wie ein erschrockenes Schaf.
Bille war dreist genug, tatsächlich zu warten, bis der Möchtegern-Märchenprinz neben der Catering-Frau in die Knie ging. Keine Sekunde hatte der ernsthaft vorgehabt, in seinem Smoking zusammen mit dem Personal Scherben aufzusammeln.
Bille zwinkerte Ocean zu. »Ich bin gerade im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und Sophie von Bitterfeld-Berlinghof. Erinnerst du dich noch an Sophie?«
Natürlich erinnerte sich Ocean, aber sie begriff, dass Bille sie diskret in Sicherheit bringen wollte. Sie ließ sich zurück in den abgetrennten VIP-Bereich schieben, zu dem nur wenige ausgewählte Gäste Zutritt hatten.
Die Frauen am Tisch kannte Ocean. Der Ministerpräsident war zum Glück nicht nur der einzige Mann, sondern auch die kleinste Person in der Runde – ein dünner Zwerg mit einem an den Enden hochgezwirbelten Schnurrbart, der beinahe lustig aussah.
»Tenwegen liebt dein Konzept von NoVictim«, raunte Bille. »Es wäre schön, wenn du selbst ein bisschen darüber erzählen könntest. Ich helfe unterdessen beim Scherbenaufsammeln.« Sie kehrte zur Bar zurück.
Oceans Verkrampfung löste sich allmählich. Sie strich ihr Kleid glatt, versuchte zu lächeln und trat an den Tisch.
MIEKE
»Ganz ehrlich, Herr Blumental, eine hundertprozentige Patientenzufriedenheit kann nur ein Betriebswirtschaftler fordern, der keine Ahnung von Medizin hat. Wir machen Menschen wieder fit fürs Arbeitsleben, aber es gibt immer Leute, die ohne medizinischen Grund in Rente wollen. Dass die keine Dankesrede schreiben, wenn wir sie arbeitsfähig entlassen, ist verständlich, oder?«
Genau wie die Rehaklinik, die sie leitete, war auch die Chefärztin eine etwas altmodische Erscheinung mit kurzen grauen Haaren und einem Strickpullunder unter dem Kittel.
Schorsch seufzte. Er hatte gerade erklärt, warum die Patientenzufriedenheit in Zukunft für die Klinik existenziell wichtig sein würde. Und Dr. Bösingfelds Einwand bewies, dass sie nichts davon verstanden hatte. Oder nicht verstehen wollte.
Mieke tippte gereizt ihren Kugelschreiber auf den Protokollblock. Sie konnte voraussagen, was jetzt passieren würde: Schorsch würde den Vortrag wiederholen. Und trotzdem keine Einsicht bei der Klinikchefin erzeugen. Die nahm ihn nämlich nicht ernst. Sein Faible für Krawatten mit Comic-Helden-Aufdruck war auch nicht gerade geeignet, Ehrfurcht bei Göttern in Weiß zu erzeugen. Heute zierten debil grinsende gelbe Schwämme mit Beinen seinen Schlips.
»In wenigen Monaten tritt ein Gesetz in Kraft, das der Rentenversicherung verbietet, ihre arbeitsunfähigen Versicherten zur Behandlung in ihre eigenen Kliniken zu schicken«, begann Schorsch geduldig noch einmal von vorn. Vielleicht würde Bösingfeld besser zuhören, wenn er mal mit der Faust auf den Tisch schlug. Oder zumindest etwas lauter wurde.
Mieke jedenfalls kribbelten ein paar spitze Bemerkungen darüber, dass sie bei Leuten mit Hochschulstudium ein gewisses Textverständnis voraussetzte, auf der Zunge.
»Der Europäische Gerichtshof hat vor einigen Jahren entschieden, dass private Kliniken im Wettbewerb benachteiligt werden, wenn die Rentenversicherung eigene Kliniken betreibt und ihre Versicherten vorzugsweise dort behandeln lässt. In Zukunft sollen die Patienten selbst entscheiden, wo sie sich behandeln lassen wollen.«
Mieke unterdrückte ein Gähnen. Sie musste zugeben, dass es auch ihr schwerfiel, Schorsch zuzuhören. Und das lag nicht daran, dass sie den Vortrag geschrieben hatte und auswendig kannte. Sein brummender Tonfall hatte eine sedierende Wirkung.
»Die Patienten werden sich an Empfehlungen ihres Hausarztes, von Bekannten oder auch an Kundenbewertungen im Internet orientieren. Ich weiß, dass Sie medizinisch hervorragende Arbeit leisten, Dr. Bösingfeld. Aber in Zukunft wird eine qualifizierte Behandlung allein nicht mehr ausreichen. Sie werden aktiv um Kunden werben müssen. Um Social-Media-Marketing, Kooperation mit Krankenhäusern und aktive Akquise von Onlinebewertungen werden wir nicht herumkommen.«
An dieser Stelle wünschte sich Mieke regelmäßig ein bisschen mehr Begeisterung für die Möglichkeiten der neuen Medien von ihrem Chef. Kreativ eingesetzt war Onlinemarketing eine kostengünstige und effektive Werbemaßnahme.
»Die meisten Menschen beziehen heutzutage nun mal ihre Informationen aus dem Internet«, referierte Schorsch unmotiviert weiter. »Werbung kann für die Marktfähigkeit des Rehazentrums entscheidend sein.«
Mieke verkniff sich ein unzufriedenes Kopfschütteln. Schorsch fehlte einfach der Biss. Als Leiter des Dezernats Kliniken war er der Vorgesetzte der Chefärzte, die sich stur stellten wie schlecht gelaunte Maultiere. Mieke hätte an seiner Stelle auf den Punkt gebracht, dass die Kliniken leer stünden, wenn sie sich nicht bewegten. Aber Mieke war nur für das Protokoll zuständig. Und Schorsch war zweiundsechzig und hatte kurz vor der Rente ungefähr genauso viel Lust auf Modernisierungen wie die Klinikleitungen.
»Wir behandeln unsere Patienten nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, Herr Blumental«, giftete Chefärztin Bösingfeld. »Untersuchungen belegen, dass körperliche Aktivität depressive Erkrankungen langfristig bessert. Fangopackungen und Massagen hingegen haben keinen nachweisbaren Effekt – auch wenn sie für mehr Zufriedenheit sorgen.«
Bösingfelds Tonfall wurde mit jedem Wort spitzer. »Vielleicht können wir mit einem All-you-can-eat-Büfett noch ein paar Pluspunkte erzielen. Allerdings würde das bei unseren übergewichtigen Patienten nicht zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes führen.«
Jemand in der Runde lachte. Wahrscheinlich die dicke Krankenschwester links hinten.
Schorsch fummelte an seinem Weihnachtsmannbart herum. Am liebsten hätte Mieke eine große Schere genommen und den Krümelfänger abgeschnitten. Leider käme dann seine SpongeBob-Krawatte noch besser zur Geltung.
»Frau Jentsch und ich haben ein Konzept erarbeitet, das Ihnen helfen soll, die Belegung Ihrer Kliniken auch in Zukunft zu sichern.«
Mieke horchte auf, als Schorsch ihren Namen nannte. Tatsächlich hatte sie das Konzept erstellt, das Schorsch bei den Klinikbesuchen vorstellte, doch Schorsch vergaß regelmäßig, das zu erwähnen.
Wenig begeistert klickte er sich durch die Präsentation, die mittlerweile zweiundvierzig Maßnahmen aufzählte, mit denen Reha-Willige auf das Rehazentrum im Ruhrtal aufmerksam gemacht werden konnten. Mieke hatte klassische Werbemaßnahmen wie Zeitungsannoncen, Tage der offenen Tür und Flyer aufgenommen. Außerdem Networking mit ärztlichen und psychologischen Praxen und Krankenhäusern der Umgebung, Messebesuche, PR durch Veranstaltungen und Vorträge, Social-Media-Marketing und über dreißig weitere Punkte.
Sie kämpfte gegen den Impuls an, sich die Haare zu raufen, denn obwohl ihre Präsentation einen dramaturgischen Spannungsaufbau enthielt, gelang es Schorsch, die Abteilungsleitungen zum Gähnen zu bringen.
Zwischen den grauen Brauen der Chefärztin bildete sich allmählich eine steile Falte. Die Arbeit, die durch Miekes Marketingkonzept auf die Kliniken zukam, sorgte nicht für Begeisterung.
Die Lethargie der Behörde nervte. Denn dass mündige Versicherte sich ihre Rehaeinrichtung aussuchen durften, fand Mieke grundsätzlich in Ordnung. Das Problem waren die Kliniken, die sich nach Jahrhunderten im öffentlichen Dienst nicht im knallharten Kapitalismus des freien Marktes auskannten. Probeberechnungen hatten ergeben, dass nach Inkrafttreten des Gesetzes in neun der zwölf Kliniken der Rentenversicherung Ruhr die Belegung dramatisch zurückgehen könnte. Es war von vierzig bis sechzig Prozent Leerstand die Rede. Nach den bisherigen Gesprächen mit den Klinikleitungen war Mieke geneigt, diese Einschätzung zu teilen. Dummerweise war es ihr Job, die sinkende Flotte wieder seetüchtig zu machen.
Ihr Diensthandy summte in der Tasche ihres Blazers. Sie warf einen kurzen Blick auf das Display und runzelte die Stirn. »Van Hoorn«, vermeldete das Gerät den Anruf des Geschäftsführers, ihres obersten Bosses. Mieke entschuldigte sich mit einem Handzeichen und verließ den Besprechungsraum, um den Anruf auf dem Flur anzunehmen.
»Rentenversicherung Ruhr, Referat Kliniken, Jentsch«, meldete sie sich vorschriftsmäßig.
»Büro van Hoorn, Höller«, antwortete eine der beiden Sekretärinnen der Geschäftsführung. »Herr van Hoorn möchte Sie um vierzehn Uhr in seinem Büro sehen.«
Mieke schluckte. Plötzlich war ihr Mund trocken, und ihr Magen zog sich zusammen wie ein schlecht verknoteter Luftballon. Als wäre sie eine Siebtklässlerin, die zum Rektor zitiert wurde. Das war albern.
»Worum geht es denn?«, versuchte sie, souverän zu reagieren.
»Eine Fortbildungsmaßnahme.« Die Sekretärin beendete das Telefonat ohne Verabschiedung.
Mieke starrte noch ein paar Sekunden auf das dunkle Display. Das mulmige Gefühl begleitete sie zurück in den Besprechungsraum.
MARVA
Sie legte der schluchzenden Frau das in ein weiches Handtuch gewickelte Bündel in den Arm. Von dem leblosen kleinen Körper war nicht viel zu erkennen. Nur das unnatürlich dunkle Köpfchen und ein verfärbtes Händchen.
Der Gynäkologe war längst verschwunden. Die rothaarige Hebamme lehnte noch immer kreidebleich an der Wand. Sie war ein paar Jahre älter als Marva, Ende zwanzig bestimmt, doch über ihre fleckigen Wangen rannen Tränen. In Deutschland verstarben nicht viele Kinder während einer Geburt. Sie war nicht daran gewöhnt.
Marva machte es nichts aus. Sie war freiwillig im Kreißsaal eingesprungen, als die Kollegen wegen der Streiks und des hohen Krankenstandes um Unterstützung gebeten hatten. Marva beobachtete die Hebamme mit den roten Zöpfen verstohlen. Sie gehörte nicht zum Team des Lindenhospitals, sondern arbeitete selbstständig. Die Geburt war als Hausgeburt geplant gewesen, und wahrscheinlich wünschte sie sich gerade, sie hätte eher den Rettungswagen gerufen. Als die Gebärende im Krankenhaus eingetroffen war, war es zu spät für einen Kaiserschnitt gewesen. Die Herztöne des Kleinen waren bereits verstummt.
Wirre Haarsträhnen hatten sich aus dem Zopf der verzweifelten Mutter gelöst und klebten an ihrem fleckigen Gesicht. Der Anblick der Frau legte unerwartet seine kalten Finger um Marvas Herz. Sie hatte nicht damit gerechnet und ärgerte sich darüber. Sie war noch in der Probezeit, und es durfte auf keinen Fall aussehen, als wäre sie ihrem Job nicht gewachsen. Marva atmete flach und kämpfte gegen den Impuls an, sich zusammenzukrümmen.
Es war nicht der Tod des fremden Babys, der ihr Angst machte. Es war die Vorstellung, Arya irgendwann tot im Arm zu halten. Oder die Vorstellung, Arya könnte sterben, ohne dass Marva sie im Arm halten konnte.
Ein halbes Jahr hatte sie ihr Baby nicht mehr gesehen. Für eine Dreijährige war das eine Ewigkeit. Und bei Emeli war sie nicht sicher. Auch Emeli war nicht sicher. Allein die Verwandtschaft mit Marva brachte sie in Lebensgefahr. Und wenn irgendjemand erfuhr, dass Arya ihre Tochter war …
Die Panik quetschte ihren Brustkorb zusammen, machte ihr das Atmen schwer. Unauffällig stützte sich Marva auf das blutverschmierte Kreißsaalbett.
Seit Wochen versuchte Frederike, Emeli und Arya nach Deutschland zu holen. Frederike war Integrationshelferin, die musste doch wissen, wie das ging. Aber es passierte nichts. Es passierte einfach nichts. Bis Marva selbst im Flieger gesessen hatte, hatte es Monate gedauert. Sie konnte nicht länger warten. Sie musste noch mal mit Frederike sprechen. Oder mit deren Chefin. Oder der Chefin der Chefin.
Sie war bereit zu betteln. Sie war auch bereit, Frederike unter Druck zu setzen. Sie hatte genug gefolterte Soldaten behandelt, um zu wissen, wie das ging. Und körperlich war sie der winzigen alten Frau überlegen. Sie würde alles tun, um Arya und Emeli wiederzubekommen, sie würde jeden Preis zahlen. Absolut jeden.
Aber in diesem Land ließen sich Probleme nicht mit Geld lösen. Und mit Gewalt auch nicht.
MIEKE
Van Hoorn ließ sie absichtlich warten. Er hatte es nicht nötig, pünktlich zu sein. Und sie konnte nicht einfach verschwinden. Taktik. Damit sie gleich wusste, wer das Sagen hatte.
Es klappte. Sie fühlte sich wie vor dem Büro des Schuldirektors, nachdem sie der Geografielehrerin mit einem Filzstift-Blasrohr eine Papier-Spucke-Kugel in die Dauerwelle geschossen hatte.
»Teppichetage« nannten die Angestellten den Flur im obersten Stockwerk der Behörde, weil nur hier ein dunkler Flauschteppich sämtliche Geräusche dämpfte. In den anderen Etagen war unempfindliches PVC ausgelegt.
Die Sekretärin hatte Mieke in der Ledersitzgruppe geparkt und erklärt, der Geschäftsführer sei noch in einem Gespräch, sie würde gleich aufgerufen werden. Das war mittlerweile zwanzig Minuten her. Sie hasste diese Machtspielchen.
»Frau Jentsch?« Weil der Teppich Irene Höllers Schritte dämpfte und die Sekretärin ein Faible für Kleidung hatte, die an Fledermausflügel erinnerte, schien sie zu schweben. Sie war ein bisschen gruselig. »Folgen Sie mir«, sagte sie.
SANNA
Sie kochte vor Wut.
Ausnahmsweise waren heute nicht Bösingfeld und Käfer die Ursache für ihre miese Laune, sondern die beiden Sesselfurzer aus der Hauptverwaltung, Blumental und »Mikaela«.
Ein Schreibtischtäter und ein Püppchen fürs Protokoll. Als Personalratsvorsitzende des Rehazentrums im Ruhrtal hatte Sanna den Auftritt der beiden Bürozombies live erleben dürfen. Die tauchten hier auf und meinten, ihnen erzählen zu können, wie Reha funktionierte.
Zum Glück hatte Bösingfeld ihnen gesagt, wohin sie sich ihre Marketingkonzepte schieben konnten. Nicht dass Sanna oft Bösingfelds Meinung wäre, aber dieses Mal hatte sie recht. Das hier war kein All-inclusive-Hotel am Ballermann.
»Reha vor Rente« war seit Jahrzehnten ihr Behandlungsauftrag – das bedeutete, dass die Rentenversicherung ihren Versicherten wieder auf die Beine half. Gemessen an der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit lag ihre Erfolgsquote bei über neunzig Prozent.
Blumentals Drohung, die Klinik würde in ein paar Monaten leer stehen, war nur ein Versuch, die Beschäftigten unter Druck zu setzen und ihnen Mehrarbeit aufzuhalsen. Dass der Onlineauftritt des Rehazentrums im Ruhrtal seit Jahren veraltet war, war bekannt. Doch wenn sie Social-Media-Marketing betreiben wollten, sollten sie jemanden einstellen und bezahlen, der sich damit auskannte.
Natürlich hatte Sanna von dem neuen Gesetz gehört, doch im Moment benötigten so unglaublich viele Menschen eine psychosomatische Reha, dass die Klinik sechs Monate im Voraus ausgebucht war. Zweiundvierzig wilde Konzeptpunkte von den Angestellten nebenbei abarbeiten zu lassen kam gar nicht in Frage.
Sanna umgriff mit der linken Hand ihre rechte Faust und drückte sie zusammen, bis ihre Fingergelenke knackten.
»Entschuldigung«, lenkte sie in dem Moment ein dünner Junge mit strähnigen Haaren ab, der vor dem Tresen des Pflegestützpunktes stand. »Ich habe Schmerzen in der linken Brustseite, ausstrahlend in den Arm. Ich denke, es ist ein Infarkt. Es muss dringend noch mal ein EKG gemacht werden.«
Kevin Homeier, Zimmer 104, Angststörung nach dem frühen Infarkttod der Mutter. Sanna brauchte die elektronische Akte nicht aufzurufen, um die Daten nachzuschlagen. Homeiers letztes EKG war heute Morgen um sechs geschrieben worden.
Sie stützte sich auf den Schreibtisch und stemmte ihre zweieinhalb Zentner aus dem Bürostuhl, um an den Tresen zu treten. »Kommen Sie, wir schauen uns erst mal Ihren Puls und Ihren Blutdruck an. Hat Ihnen schon jemand erklärt, wie Sie Ihren Puls selbst ertasten können?«
MIEKE
Sie war neununddreißig Jahre alt, hatte einen Master in BWL und machte sich immer noch in die Hose, wenn sie zum Chef zitiert wurde. Als stellvertretende Leiterin des Referats Kliniken hatte Mieke Schorsch bereits zu einigen Gesprächen mit dem Geschäftsführer begleitet. Allerdings war sie noch nie allein und noch nie so plötzlich zu van Hoorn beordert worden.
Verdammt. Es war lächerlich, dass sie nervös war.
Ihre Hände waren kalt und schwitzig, als sie hinter der Sekretärin in den Besprechungsraum trat. Der Teppich verschluckte das Klappern der Absätze ihrer Pumps.
Zwei Sekunden lang verkniff sie es sich, die Finger an der Hose ihres anthrazitfarbenen Businesskostüms abzuwischen. Dann fiel ihr ein, dass sie van Hoorn vielleicht die Hand reichen müsste. Sie wischte doch, zupfte automatisch das schwarze Shirt unter ihrem Blazer zurecht und ärgerte sich im nächsten Moment darüber.
Dann entdeckte sie Schorsch am Tisch vor der Fensterfront. Sie stutzte. Er hatte mit keinem Wort erwähnt, dass auch er zum Chef beordert worden war. Doch wegen seiner gemütlichen Weihnachtsmannoptik hatte allein die Anwesenheit ihres Vorgesetzten eine beruhigende Wirkung. Dabei wusste sie, dass er den Rauschebart wegen seiner Harley-Davidson trug.
Van Hoorn saß mit zwei Stühlen Abstand zu Schorsch am Kopfende des Tisches. Seine Anwesenheit hatte keinen beruhigenden Effekt. Er war ein nicht mehr ganz jung-dynamischer Managertyp. Einer, der Lackschuhe tragen konnte, ohne albern zu wirken.
»Nehmen Sie Platz, Frau Jentsch.« Van Hoorn deutete auf einen Stuhl auf der freien Seite des Tisches, gegenüber von Schorsch und ihm.
Sie setzte sich, legte ihren Notizblock auf den Tisch, den Kugelschreiber parallel zur Papierkante, und sah den Geschäftsführer abwartend an.
»Ich habe gehört, Frau Dr. Bösingfeld sieht noch immer keinen Anlass, die Patientenzufriedenheit stärker zu berücksichtigen.«
Es ging doch um den Termin im Rehazentrum im Ruhrtal? Die Fledermaus hatte doch was von einer Fortbildung gesagt?
»Die Gesetzesänderung tritt bald in Kraft, uns läuft die Zeit davon. Wann werden Sie Bösingfeld von der Notwendigkeit der Maßnahmen zur Belegungssicherung überzeugt haben?«
Miekes Blick wanderte zu Schorsch. Er führte die Gespräche, sie nur das Protokoll.
Van Hoorn schnalzte unzufrieden mit der Zunge. »Ich mache es kurz, Frau Jentsch. Wir haben Sie vor vier Jahren mit der Option auf die Nachfolge von Herrn Blumental eingestellt. Mittlerweile bezweifle ich allerdings, dass Sie den nötigen Biss haben, um zwölf Chefärzte mit Stummfilmdiven-Mentalität zu den nötigen Reformen zu bewegen.«
Wie bitte?
Sie hatte nicht den nötigen Biss? Es war doch Schorsch, der die Chefärzte Miekes schicker Präsentation zum Trotz regelmäßig einschläferte.
»Bisher hat Herr Blumental die Gespräche geführt«, stellte Mieke klar.
»Und soweit ich weiß, haben Sie auch nicht versucht, sich einzubringen«, fügte van Hoorn kühl hinzu. »Wir haben mehr Initiative von Ihnen erwartet.«
Wir?
Miekes Blick flitzte zu Schorsch. Der pulte nicht vorhandenen Dreck unter seinen Fingernägeln weg und vermied es, sie anzusehen.
Hatte er van Hoorn etwa gesagt, sie hätte »nicht genug Biss«? Obwohl sie seit fast vier Jahren die Zettelstapel wegarbeitete, die sich auf seinem Schreibtisch türmten? Obwohl sie sämtliche Konzepte für ihn erstellte? Während Schorsch ihre Konzepte vorstellte und mit den Chefärzten Kanapees futterte?
Mieke spürte, wie ihr die Wut ins Gesicht stieg. Ziemlich sicher wechselten ihre Wangen gerade die Farbe.
Scheiße.
Sie hatte hier vier Jahre investiert. Sie war neununddreißig. Wenn sie nicht endlich eine Position mit Verantwortung bekam, würde das nie mehr klappen.
»Wie können Sie wissen, ob ich ›den nötigen Biss‹ habe, obwohl mir nie die Projektleitung übertragen wurde?«, krächzte sie.
»Die Beurteilung Ihrer Eignung lässt darauf schließen«, entgegnete van Hoorn kühl.
»Beurteilung?«
»Durch Ihren Vorgesetzten.«
Schorsch?
Schorsch schien gestern an seiner Harley geschraubt zu haben und jetzt jede Menge Motoröl unter seinen Fingernägeln zu entdecken. SpongeBob grinste psychopatisch von seiner Krawatte.
»Du glaubst, ich bin ungeeignet für die Leitung des Referates Kliniken?«, knirschte Mieke zwischen fest zusammengebissenen Zähnen hindurch. »Obwohl sämtliche Modernisierungs- und Marketingkonzepte von mir stammen?«
»Ich habe nie gesagt, dass du nicht fleißig wärst …«, ruderte Schorsch zurück.
»Herr Blumental hat seine Einschätzung mit Hilfe von Notizen und Verhaltensbeobachtungen schlüssig begründet.« Van Hoorn schlug das andere Bein über und beobachtete das Gespräch mit sportlichem Interesse.
Notizen und Verhaltensbeobachtungen? Ein eiskalter Schauer rieselte Miekes Rücken hinunter. Theoretisch wusste sie, dass die Behörde vor Beförderungen Leistungsbeurteilungen von den Vorgesetzten anforderte. Dass sich Schorsch hinter ihrem Rücken Notizen zu ihrem Verhalten machte, war ihr allerdings nicht klar gewesen.
»Dir fehlt … die Durchsetzungsstärke«, stammelte ihr so gar nicht durchsetzungsstarker Vorgesetzter.
Mieke atmete scharf ein. »Du hast mich nicht mal meine eigene Präsentation vorstellen lassen«, fauchte sie. Und trotzdem hatte er irgendwo notiert, dass sie nicht dazu in der Lage wäre.
Verräter.
Petze.
Denunziant.
Begegne mir im Dunkeln auf dem Parkplatz, und ich mach dich kalt.
»Du hast aber auch nicht gesagt, dass du sie selbst vorstellen möchtest«, erwiderte Schorsch.
Das stimmte, musste Mieke sich eingestehen. Zähneknirschend.
»Ich mache Ihnen ein Angebot, Frau Jentsch«, mischte sich van Hoorn ein. »Sie besuchen zeitnah noch einmal ein Führungskräftetraining. Da Sie die Grundkurse schon absolviert haben, schlage ich ein individuelles Personal Coaching vor. Wir übernehmen natürlich die Kosten. Frau Höller wird Ihnen die Seminartermine zur Abstimmung schicken.«
Er lehnte sich vor und fixierte Mieke wie eine Schlange eine Maus.
»Geben Sie sich Mühe, Mikaela«, flüsterte er. »Sonst werden Sie demnächst für ein sehr, sehr gutes Gehalt im Keller Akten digitalisieren.«
MARVA
Die Hände der Frau zitterten, als sie ihre Turnschuhe schnürte. Irgendwas stimmte nicht mit ihr. So was konnte Marva wittern, doch im Fall ihrer Kollegin brauchte es keine besonders sensible Nase, die ganze Umkleidekabine roch nach ihrem Angstschweiß. Zweimal hatte die junge Frau es nicht geschafft, der verzweifelten Gebärenden den venösen Zugang zu legen, so sehr hatten ihre Finger gezittert. Schließlich hatte Marva ihr die Kanüle aus der Hand genommen und es erledigt.
Vor ein paar Tagen hatte sie die Rotblonde mit Frederike vor dem Krankenhaus gesehen. Genau wie Marva war sie also einer ihrer Schützlinge – wobei in ihrem Fall »einer ihrer Pflegefälle« wohl zutreffender wäre. Ihr Name war laut Dienstplan Alexandra Danilowa, und ihrem starken Akzent nach kam sie vielleicht aus Rumänien, Russland oder der Ukraine. Mit dem rotblonden Pferdeschwanz und den erschrockenen Augen hinter den Brillengläsern sah sie aus wie ein Teenager.
War sie nur hoffnungslos überfordert gewesen? Oder hatte sie aus einem anderen Grund Angst? Ihre Hände zitterten immer noch.
Bei Frederikes Pflegefällen konnte man nie ganz sicher sein, womit man es zu tun bekam, dafür war Marva selbst das beste Beispiel. Jede von ihnen hatte einen Preis dafür gezahlt, hier zu sein. Das Mädchen mit dem Pferdeschwanz definitiv ebenfalls.
Marva wandte sich ab, um ihre Haare zu kämmen. Im Spiegel beobachtete sie, wie ihre junge Kollegin den Moment nutzte, um ihr Shirt zu wechseln. Schämte sie sich etwa, sich vor Marva ausziehen? Marva blickte sich um, doch sie waren allein in der geräumigen Personalumkleide.
Das Mädchen griff nach seinem im Spind aufgehängten Pulli – und Marvas Blick fiel auf ihre Ellenbeuge. Oh Shit. Auf der hellen Haut hoben sich gut sichtbar Einstiche ab. Und es waren viele. Hastig schlüpfte Danilowa in einen Kapuzenpulli, dessen Ärmel bis über ihre Finger reichten.
Wow, die steckte echt in Schwierigkeiten.
Verdammt, das ging sie nichts an! Sie wollte es gar nicht wissen. Konzentriert kämmte Marva weiter, versuchte sich nichts anmerken zu lassen, während sie ihre Haare zum Zopf flocht. Sie steckte ja selbst bis zum Hals in Problemen.
Natürlich hatte sie keinen Bock, mit einem Junkie im Kreißsaal zu stehen – morgen waren sie wieder beide für die Frühschicht eingeteilt. Aber wenn die Klinikleitung von ihren zerstochenen Ellenbeugen erfuhr, würde das Danilowa den Job kosten. Den Job, der ziemlich sicher die Grundlage ihrer Aufenthaltsgenehmigung war …
Marva warf die Bürste in den Spind und griff ihren Bundeswehrparka und ihren Rucksack. Ob Danilowa zugedröhnt im Kreißsaal stand, interessierte sie nicht. Sie musste ihre eigenen Probleme lösen.
»Schönen Feierabend«, wünschte sie.
MIEKE
Sie ließ ihren dröhnenden Schädel auf das Lenkrad ihres metallicblauen Minis sinken. Ihr Blut rauschte in ihren Ohren.
Als sie endlich aus der Teppichetage raus war, war sie abgehauen. Ohne sich auszustempeln, denn sonst hätte das elektronische Zeiterfassungssystem registriert, dass sie nach dem Gespräch mit van Hoorn geflüchtet war. Und das wäre mit Sicherheit kein Zeichen von Konfliktfähigkeit und Führungskompetenz.
Am liebsten würde sie einfach losfahren, in den Wald oder ans Meer, irgendwohin, wo sie richtig laut brüllen konnte, ohne gleich in der Psychiatrie zu landen.
Sie hob den Kopf. Alle Autofenster waren zu. »Ich bring ihn um!« Sie schlug die Fäuste aufs Lenkrad. »Dieser Mistkerl! Verräter! Blödes Arschloch!«
Zwei Azubis, die ein paar Autoreihen weiter gerade in einen klapprigen Golf stiegen, sahen sich verwirrt um. Sie atmete tief durch. Ihre Hände krampften sich um das Lenkrad ihres Minis, obwohl ihr Wagen nach wie vor auf dem Parkplatz der Rentenversicherung stand. Sie rang um ihre Fassung. Sie konnte es sich nicht leisten, auszurasten. Wenn sie jetzt die Nerven verlor, würde sie ihre in Schieflage geratene Karriere endgültig versenken.
Das kam nicht in Frage. Seit vier Jahren leistete sie zweihundertprozentige Arbeit für die Behörde. Im wahrsten Sinne des Wortes: Neben ihrer eigenen Arbeit erledigte sie die von Schorsch nämlich mit. Und dieser intrigante Drecksack attestierte ihr zum Dank dafür fehlende Führungskompetenz? Weil sie seine Aufträge erledigt hatte? Statt darauf zu bestehen, die Konzepte und Präsentationen, die sie für ihn erarbeitet hatte, selbst vorzustellen?
Was sollte das? Hatte Schorsch Schiss, dass sie ihm den Chefsessel unterm Hintern wegsägte? Hätte sie mal machen sollen, bevor er sie ausgebootet hatte. Nie im Leben würde van Hoorn sie jetzt noch zur Referatsleiterin ernennen.
Moment.
Mieke schloss die Augen und zählte bis zehn, während sie ausatmete.
Cool bleiben. Sie musste sich zusammenreißen. Dieser Job war ihre letzte Chance. Nächstes Jahr wurde sie vierzig. Und mit über vierzig, ohne Referenzen in Leitungspositionen, würde sie immer die Assistentin vom Chef bleiben. Und dann würde ihre Mutter sie daran erinnern, dass sie schon immer gesagt hatte, sie solle lieber Kinder als Karriere machen.
Mieke presste ihre Stirn zwischen ihren Fäusten gegen das Lenkrad.
Sie hatte ihr Leben lang den Kopf geschüttelt über die unemanzipierte Einstellung ihrer Mutter. Die war vor dem Mauerfall trotz ihrer zwei kleinen Töchter stellvertretende Leiterin im örtlichen Konsum gewesen. Nach der Wiedervereinigung hatte sie in Teilzeit bei Aldi jobben müssen, weil Mieke und Jess keinen Hortplatz bekommen hatten. Deshalb war Mama bis heute der Meinung, dass das »System« keine Karriere für »Westfrauen« zuließ. Dass Mieke den Typen, der ihr ein sorgenfreies Mutti-Leben in einer überteuerten Altbauwohnung finanzieren wollte, vor vier Jahren in Hamburg zurückgelassen hatte, war in den Augen ihrer Mutter hochgradig dämlich gewesen.
Heute kamen Mieke zum allerersten Mal selbst Zweifel an der Entscheidung. Nicht dass sie mit Tom auf rosa Wolken geschwebt wäre, aber ihre Chance auf eine eigene Familie hatte sie damals zugunsten der Karriere verzockt.
Der Gedanke drückte ihr die Kehle zu. Heiraten und Kinder kriegen war kein Plan B mehr. Es war zu spät. Das wurde ihr zum ersten Mal bewusst. Ihre biologische Uhr stand auf fünf vor zwölf, ihre Figur hatte unter der jahrelangen Büroarbeit gelitten, und in ihrem bisherigen Leben war sie keinem Mann begegnet, mit dem eine Familie vorstellbar gewesen wäre.
Der Gelegenheitssex mit Raffael ließ sich nicht mal als Beziehung bezeichnen. Der Typ ging gar nicht.
Obwohl …
Nach diesem Tag hatte sie definitiv Ablenkung nötig.
Sie zog ihr Smartphone hervor und sendete Raffael ein Mittelfinger-Emoji und ein Fragezeichen. Dass er klare Ansagen am ehesten kapierte, machte vieles einfach. Beinahe sofort kam ein erhobener Daumen zurück, zusammen mit der knappen Frage: »20:00?«
Na also.
Sie atmete tief durch. Kapitulieren kam nicht in Frage. Von Schorsch und van Hoorn würde sie sich ihr Leben nicht kaputt machen lassen.
MARVA
»Aber es muss eine Möglichkeit geben, sie da rauszuholen.« Sie spürte die Verzweiflung aufsteigen wie kaltes Wasser.
»Tut mir leid. Ihre Schwester hat noch immer keine Visa beantragt, Marva.« Die Frau mit den wirr vom Kopf abstehenden karottenroten Haaren hob entschuldigend die Schultern. Dass sie ratlos wirkte, machte Marva rasend. Normalerweise sprühte Frederike vor Tatendrang. Jetzt sah sie aus, als würde sie aufgeben.
»Emeli versteckt sich bei meinem Onkel.« Am liebsten hätte Marva die Alte über den Schreibtisch hinweg gepackt und geschüttelt. »Wenn sie ein Visum beantragt, wird sie festgenommen.«
»Sie haben doch gesagt, Emeli war nicht für die Bundeswehr tätig?« Frederike runzelte die Stirn.
Marva knallte die Hände auf den Schreibtisch. Eine Blechdose, in der ein paar Stifte steckten, hüpfte in die Höhe. Nein, Emeli hatte nicht als Ortskraft gearbeitet, das hatte sie Frederike schon mindestens drei Mal erklärt. Emeli war sechzehn. Hörte die ihr nicht zu, oder war sie senil?
Marva war Krankenschwester beim deutschen Militär gewesen. Marva hatte sich an der Waffe ausbilden lassen, um die instabile Demokratie zu verteidigen. Marva trug keinen Hidschab. Und Marva war Atheistin.
Warum kapierten die nicht, dass das reichte, um ihre Schwester und ihre Tochter in Lebensgefahr zu bringen?
Sie fixierte die kleine Frau drohend.
Frederike war früher Lehrerin gewesen, hatte Partnerschaften mit afrikanischen Schulen ins Leben gerufen. Jetzt arbeitete sie für FamilyTogether, eine Organisation, die Familien von Geflüchteten nach Deutschland holte.
Nachdem Marva es nach Deutschland geschafft hatte, hatte man ihr erklärt, dass nur Ortskräfte, die wie sie direkt bei der Bundeswehr angestellt gewesen waren, herkommen durften. All die Dolmetscher, Bürokräfte, Fahrer und Lieferanten, die jahrelang mit Marva zusammengearbeitet hatten und jetzt verfolgt wurden, waren einfach im Stich gelassen worden.
Die Bundeswehr hatte Marva an FamilyTogether verwiesen. Frederike war mit ihr zu den deutschen Ämtern gegangen, hatte ihr eine Wohnung besorgt und den Job im Krankenhaus. Jetzt versuchte sie seit Wochen, Arya und Emeli nachzuholen – doch Voraussetzung dafür waren die verfluchten Papiere.
Marva war klar, dass Frederike tat, was sie konnte. Die ganzen Vorschriften hatte sie nicht gemacht. Trotzdem breitete sich Kälte in ihr aus. Drohte sie zu lähmen. Das war inakzeptabel. Ihre Zähne schmerzten, so fest presste sie die Kiefer aufeinander. Sie konnte Frederikes ratloses Schulterzucken nicht einfach hinnehmen und gehen. Sie musste sie zwingen, ihr zu helfen.
Langsam erhob sich Marva und trat um den Schreibtisch herum auf die alte Frau zu.
MIEKE
Mit einem Summen meldete ihr Handy eine eingehende Nachricht.
»Raffael«, las sie auf dem Display. »20:10Uhr: Wo steckst du?«
Mist, sie hatte das Date nicht abgesagt.
Mit dem Smartphone in der Hand blieb sie stehen. Ihre Entschlossenheit zerbröselte wie ein alter Keks und rieselte um sie herum auf den Gehweg. Die Sache mit Raffael war das, was in ihrem Leben noch am ehesten irgendeiner Form von sozialem Kontakt ähnelte. Und sie vergeigte auch das noch.
Der Gedanke traf sie mit Wucht in den Magen. Tatsächlich lebte sie seit knapp vier Jahren in Bochum, und die einzige Form von Anschluss, die sie gefunden hatte, war der Gelegenheitssex mit dem Chauffeur des Geschäftsführers. Sie hatte Carla und Aishe genauso in Hamburg zurückgelassen wie Tom. Allerdings waren die beiden auch nicht wirklich ihre Freundinnen gewesen, sondern die von Toms Kumpeln. Und mit ihrer Schwester hatte sie seit Wochen nicht telefoniert. Wenn Jess Bilder der Kids schickte, antwortete Mieke meist nur mit einem Bussi-Emoji.
Zumindest ihre Mutter kam einmal im Monat aus Berlin angereist, um Mieke ein paar Tupperboxen voller Milchnudeln oder Grießbrei zu bringen. Aber was sagte es über sie aus, dass ihre beste Freundin ihre Mutter war?
Der Mensch, mit dem Mieke in den letzten vier Jahren mit Abstand die meiste Zeit verbracht hatte, war Schorsch. Der dicke, nette, lustige Schorsch. Der ihrem Chef geraten hatte, sie nicht zu seiner Nachfolgerin zu machen. Mieke hatte ihm einen derartigen Verrat einfach nicht zugetraut.
Vier Jahre lang hatte sie Georg Blumental zwar nicht für die fleißigste Biene in den Waben der Rentenversicherung gehalten, aber als Kollegen und Mensch hatte sie ihn gemocht. Nie im Leben hätte Mieke erwartet, dass ausgerechnet er ihr einen Stein in den Weg legen würde.
Einen Felsen. Von der Größe eines Kleinwagens.
Dabei wusste sie doch eigentlich, dass sie niemandem trauen konnte. Doch sie würde sich nicht einfach von Schorsch ins Aktenarchiv abservieren lassen.
Ohne auf Raffaels Nachricht zu antworten, ließ Mieke ihr Smartphone in der Tasche verschwinden und wandte sich wieder dem Haus zu. Schorsch wohnte im Grünen. Für Mitte März war es angenehm warm. Der Geruch von Gegrilltem hing über dem Wohnviertel, und hinter den Einfamilienhäusern waren Stimmen und Kinderlachen zu hören.
Na toll. Hoffentlich platzte Mieke nicht in eine Familienfeier. Schorsch hatte mal erwähnt, dass seine Kinder noch recht klein waren. Seine Frau war deutlich jünger als er.
Ein dreistimmiger Gong schallte durch das Haus, als Mieke den Knopf an der Klinkerfassade drückte. Hinter sonnenblumengelben Gardinen brannte Licht, der Gong war nicht zu überhören, doch drinnen blieb alles still.
Schade. Sie war gerade sauer genug, um Schorsch zusammenzufalten. Sie war sich nicht sicher, ob sie das morgen früh noch hinkriegen würde.
Vielleicht veranstaltete er tatsächlich eine Grillparty im Garten? Dann war sie in der richtigen Stimmung, um ihm den Abend zu versauen. Vorsichtig pirschte sie sich an die Hausecke heran. Hinter dem Haus stand eine kaputte Schaukel auf dem Rasen. Eines der Seile war gerissen, sodass eine Kante des Brettes auf dem Boden hing. Zwischen einigen Büschen konnte Mieke ein paar Stühle sehen, offenbar gab es eine Terrasse. Sie schlich weiter, obwohl Schleichen natürlich unangebracht war – sie wollte schließlich nicht einbrechen. Sie sollte sich lieber bemerkbar machen. Entschlossen trat sie an die Büsche heran, die eine erhöht gelegene Terrasse vor Blicken schützten, und – zuckte zusammen.
Neben einem verrosteten Grill war ein Teakholzstuhl umgekippt.
Daneben lag Schorsch.
OCEAN
»Kommst du klar?« Bille stellte eine dampfende Tasse Tee und einen Teller mit Käsebroten vor ihr auf den Couchtisch.
Ocean trug bereits einen blau karierten Flanellpyjama und die Plüschpuschen, die wie Mäuse aussahen. Sie zog die Wolldecke um ihren Körper und nickte stumm.
Es war gelogen.
»Na schön.« Bille schob die Wärmflasche unter Oceans Kuscheldecke.
Ocean wusste, dass Bille lieber in ihrem eigenen Wasserbett schlief als auf ihrer Couch. Sie musterte ihre Freundin verstohlen. Bille war einundfünfzig Jahre alt, genau wie Ocean selbst, sah aber deutlich älter aus. Ihr Gesicht war spektakulär zerknittert. Ocean liebte jede ihrer Falten, besonders die Krähenfüße in ihren Augenwinkeln, wenn ihr Blick weich wurde und Ocean wusste, dass sie ihr keinen Wunsch abschlagen konnte.
Genau wie Ocean hatte Bille null Interesse daran, jünger oder hübscher auszusehen, als sie war. Da war sie ihr viel ähnlicher als zum Beispiel Tatti, die seit dem letzten Lifting linksseitig nicht mehr lächeln konnte.
Ocean legte absolut keinen Wert auf ihr Äußeres. Okay, mit Anfang zwanzig hatte sie sich überreden lassen, ihre Zähne und ihre Nase zu machen, weil Tatti meinte, die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen und die breite Nase, die ihre afroamerikanischen Wurzeln verriet, würden einer Modelkarriere im Weg stehen. Heute käme das unter keinen Umständen mehr in Frage. Genau wie sie gern auf eine lange Mähne verzichtete. Ihre krausen schwarzen Locken trug sie raspelkurz, und sie freute sich, dass sie endlich grau wurden. Außerdem mied sie Sport und achtete überhaupt nicht auf ihre Figur. Dass sie trotzdem höchstens die Hälfte von Billes Gewicht auf die Waage brachte, lag daran, dass sie zu essen vergaß, wenn sie allein war. Das war einer der Gründe, aus denen Bille dauernd auf Oceans Sofa schlief.
Seit Jahren bettelte Ocean sie an, bei ihr einzuziehen. Das Haus war groß genug, sie könnte ihr problemlos eine ganze Wohnung einrichten. Aber auch wenn Bille ihr sonst nichts abschlagen konnte und ihre eigene Wohnung in der Innenstadt sowieso kaum benutzte, sie gab sie nicht auf. Da war sie ein bisschen einsamer Wolf, typisch Bille eben. Eigentlich hätte gerade Ocean Verständnis dafür haben müssen, dass Bille ab und zu Abstand brauchte.
Hatte sie aber nicht.
Sie wollte nicht allein sein. Dummerweise nahm Billes Rücken die Couchübernachtungen in letzter Zeit übel. Ocean würde ihr ein Wasserbett kaufen müssen.
Sie schlang ihre Kuscheldecke enger um ihre Schultern.
»Kannst du nicht doch bleiben?«
Ocean hasste es zu betteln, jedes Mal war es wieder ein Eingeständnis, dass sie allein nicht klarkam. Doch das Haus war groß und leer. Und sie wusste, dass Bille bleiben würde, wenn sie sie darum bat.
Bille rieb sich das Gesicht. Dann erschienen die Falten in ihren Augenwinkeln. »Klar«, brummte sie. »Ich verschiebe das Acht-Uhr-Meeting morgen früh auf neun. Ohne mich können die sowieso nicht anfangen.«
Ocean wurde warm, als Bille barfuß zum Wohnungseingang tappte, um die Riegel und Sicherheitsketten vorzulegen.
MIEKE
Schorsch lag auf dem Rücken. Bewegungslos. Auf den Waschbetonplatten seiner Terrasse.
Ewig lange Sekunden stand Mieke wie gelähmt da. Schließlich sickerte die Erkenntnis, dass Schorsch Hilfe brauchte, durch den Pudding, in den sich ihr Hirn verwandelt zu haben schien. Oje. Ihr Erste-Hilfe-Kurs war zwanzig Jahre her. Jetzt verwandelten sich auch ihre Knie in Pudding, ihr Absatz versank im Rasen. Sie knickte um, fiel beinahe hin.
Zwei Stufen führten auf die Terrasse. Mieke ging neben Schorsch in die Knie. Verletzungen sah sie auf den ersten Blick keine. Doch statt des obligatorischen grauen Anzugs und einer Krawatte mit Comic-Aufdruck trug Schorsch ein ausgewaschenes Biker-T-Shirt und eine Jogginghose. War das wirklich Schorsch? Hatte er echt ein Totenschädel-Tattoo auf dem Oberarm?
Egal jetzt.
War er tot? Bewusstlos? Hatte er einen Herzinfarkt? Oder einen Schlaganfall?
Sie beugte sich über ihn, berührte mit klopfendem Herzen seine Schulter und – eine Wolke aus Alkoholgeruch hüllte sie ein.
Er war besoffen? Jetzt bemerkte sie auch die Getränkekiste neben der Terrassentür. Sie atmete auf. »Mann, Schorsch!« Mieke klopfte ihm kräftig auf die Wangen. »Wach auf!«
Schorsch gab ein Grunzen von sich und blinzelte.
Gott sei Dank.
»Geht’s?« Mieke packte seinen Arm und richtete ihn auf. »Oder brauchst du einen Krankenwagen?«
»Was ist los? Hab ich verpennt?«, murmelte er und wischte ein paar Blätter aus seinem Bart. Sein Blick wanderte zum allmählich dunkel werdenden Himmel, als wollte er die Tageszeit abschätzen.
»Es ist zwanzig Uhr dreißig«, informierte ihn Mieke.
Schorsch stützte sich auf den umgekippten Stuhl, stemmte sich hoch, schwankte beunruhigend und plumpste auf das nächste Sitzmöbel. Das Ding ächzte unter seinen zwei bis drei Zentnern. Er rieb sich die Stirn, als hätte er Kopfschmerzen.
Mieke fiel wieder ein, weswegen sie hier war: weil Schorsch ein mieser Spitzel war.
Sie setzte sich ihm gegenüber, in einen schmutzigen Stuhl ohne Polster, und schlug die Beine übereinander. »Seit fast vier Jahren arbeiten wir zusammen«, sagte sie kühl. »Wir wissen beide, dass ich seitdem alle Konzepte erstellt habe, die du präsentierst. Ich habe noch nie einen Abgabetermin überzogen. Ich decke dich sogar, wenn du nach dem Einstempeln erst mal wieder nach Hause fährst. Und du erzählst van Hoorn, ich bin nicht geeignet, das Referat Kliniken zu leiten, du Wichser?«
Mieke biss sich auf die Zunge, doch es war zu spät.
Echt jetzt? Hatte sie ihren Vorgesetzten wirklich einen Wichser genannt? Das war doch nicht möglich, dass ihr das herausgerutscht war. Selbst wenn sie in Gedanken Schimpfwörter benutzte, formulierte ihr Gehirn automatisch sachlich, sobald sie sich einstempelte. Offenbar hatte ihr Unterbewusstsein sich von Schorschs Freizeit-Outfit verwirren lassen und dieses Gespräch nicht als den Geschäftstermin eingeordnet, der es war. Dabei war sie hier, um ihre Karriere zu retten, nicht, um spektakulär zu kündigen.
Schorsch ließ den Kopf in die Hände sinken und presste sich die Daumenballen auf die Augen. Und in Miekes Brust breitete sich ein tiefschwarzes Triumphgefühl aus. Okay, es war nicht sein Totenkopf-Tattoo, das sie die Kontrolle verlieren ließ. Sie wollte ihm wehtun. Weil es ihr verdammt wehtat, dass er sie verraten hatte.
»Die Beurteilung durch den Vorgesetzten ist ein Standardverfahren bei der Besetzung von Führungspositionen«, nuschelte Schorsch undeutlich. »Schriftliche Beobachtungen sollen eine objektive Einschätzung ermöglichen.«
Schriftliche Beobachtungen? Ein Schauer kroch Miekes Rücken hinunter. Wie bei der Stasi, oder was?
»Ich habe nicht geahnt, dass van Hoorn ›übernimmt regelmäßig zusätzliche Aufgaben‹ oder ›ist jederzeit bereit, Mehrarbeit zu leisten‹ als negativ auslegt.«
Schriftliche Beobachtungen.
Ihr Kopf dröhnte, ihre Ohren rauschten. Sie würde den Scheißjob kündigen. In so einem kranken System wollte sie gar nicht arbeiten.
»… mich gefragt, ob du schon mal verlangt hast, das Marketingkonzept den Chefärzten selbst vorstellen zu dürfen.«
Schorschs Gestammel drang wie durch Watte zu ihr durch. Auf einmal drehte sich die ganze Terrasse.
»Was sollte ich sagen?« Schorsch zuckte die runden Schultern. »Dass ich selbst keinen Bock darauf habe?«
Mieke zwang ihre Aufmerksamkeit zu Schorschs Worten zurück. Gerissen hatte sie sich um die zähen Gespräche mit den Klinikleitungen tatsächlich nicht.
»Ich habe dich als meine Nachfolgerin empfohlen. Van Hoorn ist meiner Empfehlung nicht gefolgt.«
Wie bitte? Van Hoorn sollte derjenige sein, der ihre Beförderung zu verhindern versuchte? Das war doch eine Ausrede.
»Van Hoorn kennt mich gar nicht«, entgegnete sie misstrauisch. »Wieso sollte er was gegen mich haben?«
»Keine Ahnung. Vielleicht will sein Neffe den Job. Oder hast du deine Knutschkugel mal auf seinem Parkplatz geparkt?«
Was?
»Oder hast du ihn abblitzen lassen?«
Mieke wurde erst heiß, dann kalt.
Van Hoorn hatte was gegen sie? Bisher hatte sie das Gefühl gehabt, er könne sich nicht mal ihren Namen merken. Aber vielleicht lag es genau daran?
Oder …?
Sie musterte Schorsch nachdenklich. Sein T-Shirt spannte über seinem Bauch. Der Aufdruck eines auf einer Harley sitzenden Skeletts zog sich in die Breite.
Oder Schorsch log.
»Vielleicht kann ich van Hoorn von meiner Eignung überzeugen, wenn ich auch ein paar Beobachtungen notiere«, bemerkte sie kühl. »Wie, glaubst du, findet er es, dass du seit Monaten jeden Morgen nach dem Einstempeln wieder nach Hause fährst?«
Schorsch ernüchterte sichtbar. Regelmäßig tauchte er um halb acht im Büro auf, startete seinen Computer und verschwand wieder bis halb neun. Er funkelte sie an. Mieke verschränkte die Arme.
Ihr Boss zerrte an seinem Bart. »Seit Elfie ausgezogen ist, muss ich sehen, wie ich die Kids in die Schule kriege«, murrte er dann. »Mittags nehmen sie den Bus, aber morgens pennen sie einfach weiter, wenn ich sie nicht in den Hintern trete. Teenager eben.«
Seine Frau war ausgezogen? Miekes Blick wanderte an dem zweistöckigen Einfamilienhaus hinauf. Er war für zwei Teenager verantwortlich und lag abends um halb neun volltrunken auf der Terrasse?
»Diese Woche sind sie bei ihrer Mutter«, beantwortete Schorsch ihre unausgesprochene Frage. Er kannte sie viel zu gut.
»Wie lange schon?«, erkundigte sich Mieke. »Ich meine, wie lange bist du schon … allein?«
»Das Trennungsjahr ist um. Sie will die Scheidung.«
Ein Jahr? Ein ganzes Jahr?
»Und du hast nichts gesagt?«
»Wahrscheinlich habe ich gehofft, sie kommt zurück«, murmelte Schorsch müde. »Aber sie hat einen Neuen, so einen glatt gebügelten Schnösel. Jetzt versucht sie, das Sorgerecht einzuklagen.«
Er wischte sich mit dem Handrücken über die haarigen Wangen. Weinte er etwa?
Mieke wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Schorsch in einem ähnlich kaputten Leben feststeckte wie sie selbst.
»Du hast recht«, sagte Schorsch in dem Moment. »Ich hätte van Hoorn sagen müssen, dass du die Beste für den Job bist und er ein Vollidiot ist, wenn er dich nicht nimmt.«
Hm. Mieke hob eine Braue.
Schorsch schwankte leicht auf dem Gartenstuhl hin und her.
»Das kannst du ja nachholen«, schlug sie vor.
MARVA
Sie stemmte die Fäuste gegen ihre Schläfen.
Sie hatte die Nerven verloren. Sie war abhängig von Frederikes Hilfe, außer ihr interessierte hier niemanden, was aus ihrem Baby und ihrer kleinen Schwester wurde. Und sie hielt ausgerechnet Frederike ein Skalpell unter die Nase und drohte, ihr ein Auge zu entfernen, wenn sie Arya nicht nach Deutschland holte?
Nun würde ihr auch Frederike nicht mehr helfen. Verständlicherweise. Wahrscheinlich würde sie sie anzeigen. Sie würde den Job verlieren und im Gefängnis landen.
Sie würde Arya und Emeli nie wiedersehen.
MIEKE
Ihre Bürotür stand offen. Nur einen Spalt, kaum zu erkennen, wenn man nicht genau hinsah.
Sie blieb stehen. Ein flaues Gefühl breitete sich in ihrem Magen aus. Wahrscheinlich legte ihr bloß jemand eine Akte auf den Schreibtisch. Trotzdem konnte sie nicht verhindern, dass sich van Hoorn in ihre Gedanken drängte. Was, wenn er sie gestern zu erreichen versucht hatte? Wenn er gemerkt hatte, dass sie abgehauen war?
Quatsch. Sie arbeitete nicht bei der Mafia. Und sie konnte nicht wie schockgefroren vor ihrem eigenen Büro stehen bleiben. Sie gab sich einen Ruck und drückte die angelehnte Tür auf. Schorsch fuhr zusammen.
Schorsch?
Der Bärtige rückte hektisch ein paar Papiere in ihrer Ablage zurecht. Obenauf lag die Beschwerdemappe des Rehazentrums Emscherau. Die lag da allerdings schon länger, Mieke hatte sie bereits durchgesehen. Ganz sicher war Schorsch nicht hier, um den Hefter zu bringen.
»Mieke, ähm …« Er trat hinter ihrem Schreibtisch hervor und fuhr sich durch den Bart. »Ich … ähm … ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich mit van Hoorn gesprochen habe.«
War Schorsch an ihrem Schreibtisch gewesen? Spionierte er etwa schon wieder? Hatte er geprüft, ob sie Ordnung hielt? Notierte er sich gleich »Frau Jentschs Arbeitsplatz ist verdächtig aufgeräumt. Vermutlich arbeitet sie gar nicht«?
Miekes Blick flitzte über die leere Arbeitsfläche. Computer, Tastatur, Stifthalter. Eine Ablage mit noch nicht erledigten Projekten. Ein Kugelschreiber, genau parallel zur Tischkante.
Miekes vielleicht ein klitzekleines bisschen zwanghafter Ordnungssinn kam ihr nun entgegen. Sie war sicher, dass Schorsch auf ihrer Arbeitsfläche nichts verändert hatte. Am PC konnte er auch nicht gewesen sein. Im Gegensatz zu den übrigen fünftausend Beschäftigten der Rentenversicherung Ruhr notierte Mieke ihre vierundzwanzig Passwörter nicht auf einem Zettel unter der Tastatur. Codewörter speicherte ihr Gehirn automatisch. Also war er an den Schubladen gewesen.
»Und was hat er gesagt?«, erkundigte sie sich lauernd. Sie kaufte Schorsch nicht ab, dass er ernsthaft versucht hatte, ihren Hintern zu retten.
»Er besteht auf dem Führungskräftetraining.« Schorsch zuckte die Achseln.
Er war hier, um ihr mitzuteilen, dass es rein gar nichts Neues gab? Wollte er sie verarschen? Bescheuert, dass ausgerechnet sie sich von seiner gemütlichen Weihnachtsmannoptik hatte täuschen lassen. Es hatte ihr gefallen, dass Schorsch von ihrer Arbeit begeistert gewesen war. Wie ein dressiertes Äffchen hatte sie Saltos geschlagen für seine verbalen Zuckerstückchen. Vermutlich hatte Schorsch sich insgeheim totgelacht, weil es so einfach gewesen war, Mieke die ganze Arbeit machen zu lassen und selbst die Beine auf den Schreibtisch zu legen.
Dabei hatte Mieke schon im Grundkurs des Führungskräftetrainings gelernt, dass man in einer leitenden Position Arbeit verteilen können musste. Schorsch war wirklich die Idealbesetzung für seinen Posten.
»Mit der Teilnahmebescheinigung ist die Sache dann aber vom Tisch«, versicherte Schorsch in dem Moment.
»Vom Tisch?« Mieke runzelte die Stirn.
»Hat mir van Hoorn zugesagt.« Ohne Mieke anzusehen, drückte Schorsch sich an ihr vorbei. Sie registrierte, dass er nach Schweiß roch. Rasch schob er sich zur Tür hinaus und zog sie hinter sich zu.
Sekundenlang starrte Mieke ihm nach. Kalte Schauer krabbelten ihre Wirbelsäule hoch und runter. Dann zog sie die oberste Schublade auf. Im Schreibtisch herrschte ebenfalls Ordnung.
Oberes Fach: Klarsichthüllen, leere Schnellhefter, Verbrauchsmaterial wie Büroklammern, Tackernadeln, Klebchen, Textmarker.
Mittleres Fach: Kontaktdaten in einem Register. Chefärzte und Verwaltungsleiter der eigenen Kliniken und von privaten Vertragskliniken. Adressen von Krankenhäusern, die regelmäßig Patienten nach Operationen zur Reha schickten. In der Spalte daneben ein paar Müsliriegel, damit ihr Magen in den Besprechungen nicht knurrte, wenn sie sich das Frühstück gespart hatte. Okay, vielleicht hatte er einen Müsliriegel geklaut. Das wäre ihm zuzutrauen, und sie hatte die Dinger nicht gezählt.
Unteres Fach: Briefumschläge.
Wonach hatte Schorsch gesucht?
MARVA
Sie hätte Frederike nicht bedrohen dürfen.
Sie hatte gewusst, dass sie ihre Chance auf ein Leben in Deutschland riskierte. Und weil sich Frederike nicht gemeldet hatte, seit Marva die Nerven verloren hatte, hatte sie bereits geahnt, dass sie in der Scheiße steckte. Jetzt musste sie die Konsequenzen tragen, denn die Frau hinter dem Schreibtisch würde sich nicht einschüchtern lassen. Sie war ziemlich groß, kräftig gebaut. Ihr schulterlanges blondes Haar hatte sie im Nacken zum Zopf zusammengebunden, und unter ihrem ärmellosen schwarzen Shirt war nicht viel Busen zu erkennen. Dafür aber ein Tattoo an der Außenseite ihres linken Oberarms. Seeleute trugen so was. Marva hatte neben Anker, Kompass und Sextant schon alle Arten von Seemonstern auf den Körpern von Soldaten gesehen, die mal bei der Marine gewesen waren.
»Frederike hat mir von Ihrem letzten … Gespräch erzählt, Marva«, sagte die Blonde ernst. Ihre Stimme klang weiblicher, als ihr Körperbau vermuten ließ. »Sie sagte, sie seien ziemlich … nachdrücklich gewesen.«
Marva senkte den Kopf.
»Sie wissen, dass Nötigung strafbar ist?«
Marvas Herz beschleunigte sein Tempo. Sie holte tief Luft, straffte die Schultern.
»Und nun? Hat Frederike mich angezeigt? Werde ich entlassen? Ausgewiesen? Verhaftet?«
Die Blonde erwiderte Marvas Blick, ohne zu lächeln.
»Ich spreche heute als Vertreterin von WomenForWomen mit Ihnen. WomenForWomen ist eine Schwesterorganisation von FamilyTogether. Wir unterstützen Frauen in akuten Notsituationen, und wir haben ein paar mehr … Mittel, um zu helfen. Sie haben als Sanitäterin für die Bundeswehr gearbeitet?«
Marva schwieg. In ihrem Hinterkopf schrillten die Alarmglocken. Da war etwas Lauerndes in ihrer Stimme, wie bei einer Katze, die schnurrend mit dem Schwanz peitschte.
»Wenn ich richtig informiert bin, verdanken Sie Ihre Existenz einer Affäre zwischen einer afghanischen Putzfrau und einem deutschen Unteroffizier. Die Vaterschaft hat er nie anerkannt, aber er hat Ihre deutsche Schule bezahlt.«
Marva würde Frederike töten. Das hatte sie im Vertrauen erzählt.
»Sie haben Frederike erschreckt. Sie glaubt, Sie könnten unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden und würden eine Therapie benötigen.«
Marva presste die Zähne aufeinander. Kein einziges Wort würde sie mehr sagen.
»Unzurechnungsfähig kommen Sie mir allerdings nicht vor …« Die Frau musterte sie forschend. »Ich habe großen Respekt davor, wie entschlossen Sie um Ihre Tochter und Ihre Schwester kämpfen«, sagte sie zu ihrem Erstaunen. »Emeli Al-Ali ist Ihre Halbschwester. Deshalb gehe ich davon aus, dass ihr Vater ihr keinen Notsitz in einer Militärmaschine organisieren wird.«
Natürlich nicht.
Die Frau beugte sich vor. »WomenForWomen wird versuchen, Ihre Schwester und Ihre Tochter mit einer Privatmaschine auszufliegen.«
Bot die Fremde gerade an, Arya und Emeli illegal nach Deutschland zu holen? Genau das hatte Marva von Frederike verlangt. Dass die Rentnerin wirklich Kontakte zu Schleusern haben könnte, hätte sie allerdings nie gedacht.
Marva wurde heiß. Ihre Gesprächspartnerin war kein idealistischer Gutmensch wie Frederike, sie bot ihre Unterstützung nicht aus reiner Freundlichkeit an. Garantiert wollte sie eine Gegenleistung. Wenn Marva ihr Angebot annahm, wäre sie ihr etwas schuldig, und bestimmt sollte sie nicht nur ihren Hund Gassi führen.
»Was kostet Ihre Hilfe?«, erkundigte sie sich.
MIEKE
Das konnte nur ein schlechter Scherz sein. Sie prüfte noch mal die Adresse.
War korrekt. Trotzdem konnte das nicht stimmen. Führungskräftetrainings fanden gewöhnlich in Fortbildungsinstituten oder Tagungshotels statt. Sie wagte nicht, ihren Mini auf die unbefestigte Parkfläche zu lenken, auf der das Gras genauso hoch stand wie auf der Weide nebenan. Von dort aus glotzten sie zwei Ponys an. Die Straße im ländlichen Norden von Bochum besaß keinen Mittelstreifen. Und das Haus war … so was wie ein Bauernhof?
Nicht ganz. Eher ein alter Gutshof. Ein zweigeschossiges, von Efeu überwuchertes Fachwerkgebäude stand rechts vom geschotterten Innenhof. Gegenüber der Einfahrt ragte ein recht neuer Hallenbau mit Wellblechdach auf. Der Gebäudeflügel links vom Hof ähnelte vom Baustil her dem Hauptgebäude: Fachwerk und Efeu mit Holztoren, durch die ein Elefant passte. Eine Scheune oder ein Stall.
Auf einem verwitterten Eichenbalken über der Hofeinfahrt stand »Lucky Pony Ranch«.
Ranch? Im Ernst?
Wollte van Hoorn sie verarschen? Oder war die Adresse ein Druckfehler?
Hinter ihr näherte sich ein Auto auf der sonst leeren Straße. Mieke scannte die Parkfläche nach der am wenigsten matschigen Stelle ab. Schließlich lenkte sie ihren Wagen dicht an den Elektrozaun. Die Ponys guckten zu.
Sie würde nachfragen müssen, ob es hier einen Tagungsraum gab, der für ein Führungskräftetraining angemietet worden war. Sie hielt es für beinahe ausgeschlossen. Egal, dann würde sie eben wieder fahren. Zu schade. Sie griff ihre Handtasche, stieg aus und versank mit dem Absatz ihres Pumps in einer Pfütze. Matsch schwappte in ihren Schuh.
»Shit!«
Fluchend versuchte Mieke, den Schlamm am Gras abzustreifen. Klappte nicht. Wenn sie gleich wieder zu Hause war, würde sie die Schuhe in der Dusche abspülen müssen. Für die Fortbewegung auf dem groben Schotter im Hof waren die Pfennigabsätze ähnlich ungeeignet. Bis zur Haustür hatte sie sich vermutlich einen Bänderriss zugezogen.
Drei ausgelatschte Steinstufen führten zum altmodischen Eingang hinauf. Es gab weder Klingel noch Türschild, nur einen faustgroßen Löwenkopf aus Messing. Das Raubtier hielt einen Metallring zwischen den Zähnen – ein Klopfer aus einer Zeit, in der es noch keine Türklingeln gegeben hatte.
Genervt griff Mieke nach dem grinsenden Löwen und fuhr zusammen, als das Metall unerwartet laut gegen das Holz krachte.
Alles blieb still, nur die Vögel zwitscherten.
Mieke klopfte erneut. Vermutlich wohnte in der Burg eine Hundertjährige, die Samstagmorgen um halb neun die Hörgeräte noch nicht drin hatte.
Sie wartete. Allerdings nicht besonders lange. Offensichtlich war niemand hier, jedenfalls kein übermotivierter Personality-Coach, der künftigen Managern beibrachte, wie man Untergebenen in den Hintern trat.
Sie wandte sich ab und prallte zurück. Beinahe hätte sie erschrocken gequietscht, denn der Typ stand direkt hinter ihr, vor der untersten der drei Treppenstufen und – na ja, er sah wild aus.
Hätte er auf gleicher Höhe mit ihr gestanden, hätte er sie trotz ihrer Siebeneinhalb-Zentimeter-Absätze überragt, war also über eins achtzig groß. Seine graue Latzhose war beeindruckend schmutzig, dazu trug er eine rot-schwarz karierte Holzfällerjacke und Gummistiefel, in denen sich vermutlich Stahlkappen verbargen. Und er hatte eine Mistgabel in der Hand. Eine Mistgabel.
Er war unrasiert und ungekämmt, seine Locken mehr grau als braun. Die Haare hatte er im Nacken zusammengebunden, der Pferdeschwanz reichte bis auf seinen Rücken. Er stand aufdringlich dicht vor ihr, und der harte Zug um seinen Mund ließ Mieke zurückweichen, bis sie mit dem Rücken gegen die Haustür stieß. Seine schlammbraunen Augen wanderten abschätzend an ihr herunter und blieben an ihrem schmutzigen linken Schuh hängen.
Der Kerl war unheimlich. Eine schwerhörige Hundertjährige wäre Mieke lieber gewesen. Nichts wie weg hier.
»Mikaela Jentsch?«, sagte der Mann in dem Moment.
Er kannte ihren Namen. Miekes Gehirn weigerte sich zu schlussfolgern, was das bedeutete.
»Moritz Blümel.« Er wischte seine Hand an seiner Latzhose ab, wodurch sie definitiv nicht sauberer wurde, und hielt sie ihr hin. »Die Rentenversicherung Ruhr hat drei Coaching-Termine zum Thema ›Authentisches Führen‹ für Sie vereinbart.« Er hielt ihr noch immer die Hand hin.
Mieke zwang sich, sie zu ergreifen. Sein Griff war genauso unangenehm wie seine Erscheinung: hart, rau, schwielig und so fest, dass sich die Begrüßung wie ein Kräftemessen anfühlte. Sie hasste solche Spielchen, hielt aber gegen.
»In der Seminarbeschreibung steht, dass wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk benötigt werden«, bemerkte Blümel mit einem weiteren Blick auf ihre Pumps.
Mieke biss sich auf die Zunge, um nicht zu fluchen. »Ich habe nur den Termin und die Adresse erhalten.«
Gelogen. Die Seminarbeschreibung lag vermutlich in dem noch ungeöffneten Umschlag in ihrer unteren Schreibtischschublade. Mieke hatte bereits vor zwei Jahren drei Wochenseminare absolviert und zu wissen geglaubt, was auf sie zukam. Offensichtlich ein Irrtum.
Blümel rieb sich das unrasierte Kinn. »Sie wohnen vermutlich nicht direkt um die Ecke?«, erkundigte er sich.
Blöde Frage, du Bauer.
»Nein«, sagte sie mit bemüht liebenswürdigem Lächeln. »Rein zufällig wohne ich nicht am Arsch der Welt.«
Blümels harter Blick wurde noch ein bisschen härter.
»Tja, Ihr schickes Outfit wird den Tag definitiv nicht überleben«, erklärte er.
»Was?«, schnappte Mieke. »Der Anzug ist von Victoria Beckham.« Und hatte schlappe fünfhundert Euro gekostet.
»Dann hätten Sie ihn nicht zu einem Seminar in einem Stall anziehen sollen«, entgegnete Blümel gleichgültig.
»Ich wusste nicht, dass das Seminar in einem Stall stattfindet.« Mieke wiederholte die Lüge, ohne mit der Wimper zu zucken.
Blümel verschränkte die Arme vor der Brust. Offensichtlich hatte er nicht vor, etwas zur Problemlösung beizutragen.