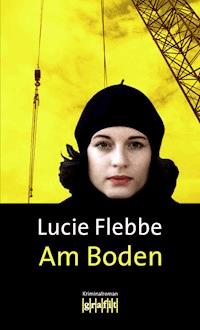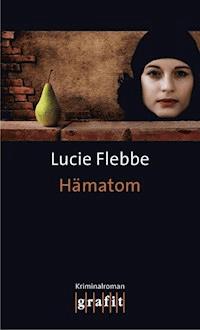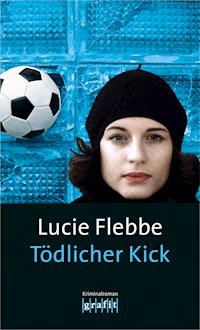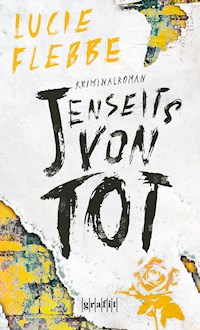Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Eddie Beelitz
- Sprache: Deutsch
Eine Suchtklinik wird zur Todesfalle Securitymann Jo Rheinhart alias ›Zombie‹ wird während seiner Schicht vor einer Suchtklinik überfallen und niedergeschlagen. Aber warum? Nichts wird gestohlen, niemand sonst kommt zu Schaden. Am nächsten Abend wird Zombie an selber Stelle von zwei bewaffneten Männern angegriffen und tötet sie in Notwehr – behauptet er jedenfalls. Kommissarin Eddie Beelitz glaubt ihm, obwohl sie weiß, wozu Zombie fähig ist. Der taucht ausgerechnet in der Suchtklinik unter, während Eddie herauszufinden versucht, was in Wahrheit geschehen ist … Der zweite Teil der Trilogie von Friedrich-Glauser Preisträgerin Lucie Flebbe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucie Flebbe
Jenseits von schwarz
Kriminalroman
© 2019 by GRAFIT im Emons Verlag GmbH
Cäcilienstr. 48, D-50667 Köln
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Diego Schtutmann (Hintergrund), Sharif Hidayatulloh (Löwenzahn)
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
eISBN 978-3-89425-749-1
ÜBER DIESES BUCH
Securitymann Jo Rheinhart alias ›Zombie‹ wird bei einer Schicht vor einer Suchtklinik überfallen und niedergeschlagen. Aber warum? Nichts wird gestohlen, niemand sonst kommt zu Schaden.
Am nächsten Abend wird Zombie an selber Stelle von zwei bewaffneten Männern angegriffen und tötet sie in Notwehr – behauptet er jedenfalls.
Kommissarin Eddie Beelitz glaubt ihm, obwohl sie weiß, zu was Zombie fähig ist. Der taucht ausgerechnet in der Suchtklinik unter, während Eddie versucht herauszufinden, was in Wahrheit geschehen ist …
DIE AUTORIN
Lucie Flebbe, geb. 1977 in Hameln, ist Physiotherapeutin und lebt mit Mann und Kindern im Weserbergland. Mit ihrem Krimidebüt ›Der 13. Brief‹ mischte sie 2008 die deutsche Krimiszene auf. Folgerichtig wurde sie mit dem ›Friedrich-Glauser-Preis‹ als beste Newcomerin in der Sparte ›Romandebüt‹ ausgezeichnet. Die Geschichte der Detektivazubine Lila Ziegler lässt sich über acht weitere Romane verfolgen.
›Jenseits von schwarz‹ ist der zweite Teil einer Trilogie um die Kriminalkommissarin Eddie Beelitz. Band eins heißt ›Jenseits von Wut‹ und der letzte Teil ›Jenseits von tot‹.
www.lucieflebbe.de
EDDIE
Adrian, 15:02 Uhr: Rechtsmedizin hat angerufen. Marvin will mit der Sektion beginnen. Wo zum Teufel steckst du?
Verdammt!
Ich legte das Handy auf den Badewannenrand, hob Lotti aus der Wanne auf das bereitliegende Handtuch und rubbelte sie nicht gerade sanft trocken.
Meinem Kollegen und Teamchef per SMS zu erklären, dass ich zwei hochbezahlte Rechtsmediziner warten ließ, weil meine fünfjährige Tochter sich mit einer kompletten Flasche Bodylotion eingecremt hatte und ich sie nicht glitschig wie eine Ölsardine bei der Babysitterin absetzen konnte, sparte ich mir.
»Hopp, anziehen jetzt!«, befahl ich und gab Lotti einen Klaps auf den nackten Hintern, woraufhin sie quietschend losflitzte.
Sollen anfangen, bin in einer halben Stunde da, tippte ich hastig zurück. Adrian würde ein Drama daraus machen.
Schuld daran, dass der Leiter des Ermittlungsteams, dem ich im Kriminalkommissariat 11 zugeteilt war, zur Dramaqueen mutiert war, war ich selbst. Dass ich mit ihm geschlafen hatte, nahm er mir nicht übel. Ihn störte, dass ich es nicht für notwendig hielt, den Sex zu wiederholen.
Obwohl unser One-Night-Stand eine einmalige Sache und mittlerweile über vier Monate her war, war Adrians männlicher Stolz noch immer empfindlich gekränkt. Dass es ihm nicht gelungen war, mich umgehend in den Streifendienst versetzen zu lassen, verdankte ich Staatsanwältin Dr. Röhmer. Die hatte unerwartet viel Verständnis für meine angespannte private Situation aufgebracht und ein gutes Wort eingelegt.
Prinzipiell war Adrians schlechte Laune allerdings nicht unbedingt ein Nachteil. Denn seit er mich nur noch langweilige Sekretärinnenarbeit erledigen ließ und die ›echten‹ Ermittlungen mit seinen neuen Kollegen Gregor, Maik und Daggi erledigte, hatte ich endlich den Halbtagsjob, den ich von Anfang an gewollt hatte. Ich brauchte keine Bereitschaft zu übernehmen und nur noch selten Überstunden zu schieben. Heute Morgen war allerdings ein Mann bei einem Streit am Bahnsteig vor eine U-Bahn gestoßen worden und die Kollegen hatten alle gut zu tun. Zurückstehen musste der ungeklärte Tod einer sechsundachtzigjährigen Frau, der absehbar auf einen Unfall oder einen Selbstmord hinauslief. Die Rechtsmedizin hatte den Termin zur Sektion der alten Dame für heute angesetzt.
So hatte Adrian mich abkommandiert, an der Leichenöffnung teilzunehmen, den Bericht zu schreiben und die Ermittlungen formal zu Ende zu bringen. Er wusste sehr wohl, dass Leichenöffnungen nicht zu meinen Lieblingsterminen zählten, und nutzte vermutlich die günstige Gelegenheit, mir eins reinzuwürgen.
Als ich die SMS abgeschickt hatte, stand Lotti in einem dünnen, hellblauen Eisköniginnen-Kleidchen aus Tüll vor mir – Anfang März bei drei Grad über null nicht die optimale Bekleidung.
Im gleichen Moment klingelte es an der Tür.
Na großartig. Wenn jetzt noch mein zukünftiger Ex-Mann auftauchte und mich wieder mit irgendwelchen Tricks dazu bringen wollte, eine Unterhaltsverzichtserklärung zu unterschreiben, lief ich möglicherweise Amok.
»Zieh noch eine Leggins drunter«, kommandierte ich Lotti weg und riss die Wohnungstür auf.
Flo stand vor mir.
»Hi.«
Flos Anblick brachte mich zum Lächeln. Meine neunzehnjährige Nachbarin sah für ihre Verhältnisse beinahe bieder aus. Das verwahrloste Straßenkind mit der zwei Hand hohen Irokesenfrisur war zu einer hübschen, jungen Frau mutiert. Ihr raspelkurzes Haar hatte jetzt seine brünette Naturfarbe und lenkte die Aufmerksamkeit auf ihr schmales Gesicht mit den schönen Rehaugen. Nur die großen Löcher an den Knien ihrer Jeans und die etwa zehn Stecker zu viel in jedem Ohr ließen ihre Vorliebe für extravagantes Styling noch erahnen. Seit drei Wochen machte Flo eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin.
»Brauchst du nur eine Tiefkühlpizza oder dauert es länger?«, erkundigte ich mich, während ich in meine Stiefel schlüpfte, die vor der Tür standen. Ihr erster Azubilohn stand noch aus und ab Mitte des Monats war Flos Sozialhilfe meistens ausgegeben und der Kühlschrank leer.
»Jo ist schon da!« Lotti schoss an mir vorbei und polterte auf Socken die Treppe hinunter.
»Kann ich mit dir reden?«, druckste Flo herum.
Irgendetwas in ihrem Tonfall ließ mich aufhorchen.
Seit der Trennung von Philipp lebten Lotti und ich in einem von drei baugleichen, graubraunen Zwanzig-Parteien-Wohnblöcken im Bochumer Norden. Die Miete war hier so günstig, dass sie bei Grundsicherungsanspruch vom Sozialamt übernommen wurde. Ich hatte also einige Nachbarn, die regelmäßig Leistungen beim Jobcenter oder Sozialamt beantragen mussten, und mehrere von ihnen hatten mittlerweile von meinen Qualitäten als Sekretärin gehört. Sie standen vor meiner Tür, wenn das Amt die Stütze kürzen wollte, das Jobcenter die Pflichtbewerbung zu schlampig fand oder ein Inkasso-Unternehmen unbequem wurde.
»Brennt’s denn?« Ich musterte Flo prüfend.
Schuldbewusst biss sie sich auf die Unterlippe, während sie mir einen zerknitterten Zettel hinhielt, der eng mit rosafarbener Schrift bedruckt war.
Ich dachte an die beiden Rechtsmediziner, die gerade ohne mich nach der Ursache für den Tod der alten Frau suchten.
Flo zog ein weißes Stäbchen aus der Hosentasche, das wie ein Fieberthermometer aus Plastik aussah.
»Ich kapier das nich. Da steht, zwei Striche ist positiv«, sagte Flo. »Wat heißt ’n dat jetz?«
Oh.
Ich schnappte ihr den Schwangerschaftstest aus der Hand.
Im gleichen Moment rumste meine Wohnungstür hinter mir zu. Und mein Schlüssel hing noch an der Pinnwand im Flur.
Stöhnend griff ich mir an die Stirn.
»Locker bleiben, Süße, das kriegen wir hin.« Meine Babysitterin Mütze brachte Chaos nicht aus der Ruhe. Vermutlich war das eine Überlebensstrategie, wenn man alleinerziehende Mutter von vier eigenen Jungs war und nebenher noch drei andere Kinder betreute.
In den letzten Monaten war die kettenrauchende Vierzigjährige mit der langen, pinkfarbenen Strähne in der graublonden Kurzhaarfrisur und dem Faible für knallbunte Armeekleidung so etwas wie meine Freundin geworden.
Ohne Mütze besäße ich möglicherweise heute noch keine Küche und hätte auch keine Ahnung, wie ich meinen wutschnaubenden Ex auf Abstand halten sollte.
»Der Papa von Jaz und Jo ist grade raus«, hatte sie auch für meine aktuelle Situation eine Lösung parat und zückte ihr Handy. »Den pfeife ich zurück. Der macht dir deine Bude in null Komma nix wieder auf.«
Neben Lotti hütete Mütze nachmittags regelmäßig auch Jaz und Jo. Die beiden Mädchen lebten im vordersten der drei zu unserem Komplex gehörenden Wohnblocks.
Die fünfjährige Jo war genauso alt wie meine eigene Tochter, zwischen Lotti und Jo war es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Jos große Schwester Jaz war elf, kleidete und schminkte sich aber wie eine Sechzehnjährige. Beide Mädchen hatten dunkle Haut, eine buschige, schwarze Afrokrause und grell lackierte Fingernägel.
Mein Blick wanderte auf die Uhr. Es gelang mir nicht, Mützes Optimismus zu teilen.
»Aufstehen, Krone zurechtrücken, weitermachen«, befahl Mütze, die mir meine Resignation anscheinend ansah. Sie hielt das Handy ans Ohr und schob mich ins Treppenhaus.
Während ich in den dritten Stock zurückschlurfte, wunderte ich mich einmal mehr, wie ich es geschafft hatte, mein Leben in eine einzige Aneinanderreihung von Katastrophen zu verwandeln.
Adrian würde mich die nächsten drei Wochen Kaffee kochen lassen, wenn ich die Sektion verpasste. Und wenn er einen schlechten Tag hatte, verpetzte er mich auch noch. Dann konnte ich morgen bei unserem Kommissariatschef Böck oder Staatsanwältin Röhmer antanzen und mir anhören, dass es für die Ermittlungen entscheidend und außerdem Vorschrift war, dass ein zuständiger Kriminalbeamter bei einer Leichenöffnung anwesend war und mit den Medizinern gemeinsam die Ergebnisse auswertete.
Und Flos Schwangerschaft, über die wir sprechen würden, wenn ich heute Abend nach Hause kam, zählte zu den echten Katastrophen.
Ich rüttelte an meiner ins Schloss gefallenen Wohnungstür, als würde sie dadurch wie von Zauberhand aufspringen. Zumindest konnte der Tag nicht mehr schlimmer werden.
»Hi«, hörte ich hinter mir im Treppenhaus jemanden sagen.
Ich drehte mich um und mir wurde klar, dass ich mich sogar in diesem Punkt geirrt hatte.
ZOMBIE
»Sie?«
So eine Scheiße, das glaubte ich jetzt nicht!
»Sie sind die Mutter von Jos Freundin Lotti?«, vergewisserte ich mich, obwohl die Antwort ja offensichtlich war.
»Sie sind Jos Vater?«
Die Polizistin guckte mich an, als wäre ein Ufo gelandet.
In dem Moment, in dem ich in ihre seltsam grünen Augen sah, war die Erinnerung wieder da. So musste es sich anfühlen, wenn ein Dumdumgeschoss in deinem Kopf explodierte.
Meine kleine Schwester liegt am Boden. Hellrotes Blut sprudelt aus der Schussverletzung, die ihren Hals zerfetzt hat. Ich presse meine Hände auf die Wunde, ohne eine Chance zu haben, sie zu schließen.
Als ich Beelitz das letzte Mal begegnet war, war meine Welt schwarz geworden. Realistisch betrachtet, verdankte ich es aber vermutlich der Polizistin, dass ich heute überhaupt noch hier stand.
Die auf den ersten Blick unscheinbare Frau mit den kurzen, dunklen Haaren, dem schlabberigen Kapuzenpulli und der zerrissenen Jeans hatte es irgendwie geschafft, Ruhe zu bewahren, während meine Welt unterging. Während ihr arroganter Kollege mich nur zu gern erschossen hätte, als ich Amok lief.
Ich hingegen war bisher … nun ja, nicht auffallend höflich gewesen. Die Entschuldigung war fällig.
Mit beiden Händen fuhr ich mir über die Haare, die ich heute zumindest zusammengebunden hatte, weil ich zur Abwechslung mal zur Arbeit gehen wollte.
»Sorry, wir hatten keinen guten Start.« Ich hielt Beelitz meine Hand entgegen, ohne auf sie zuzugehen. Es bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie Angst vor mir hatte. »Hätten Sie gleich gesagt, dass Sie Lottis Mutter sind, hätte ich mich besser benommen.«
Der forschende Blick ihrer grünen Augen verunsicherte mich. Beelitz hatte mich ausrasten und zusammenbrechen sehen und das fühlte sich an, als würde ich in diesem Moment nackt vor ihr stehen.
Misstrauisch kam sie einen Schritt näher. »Wenn Sie meine Wohnung aufbekommen, würde mir das schon reichen.«
Zögernd griff sie meine Hand. Dabei hielt sie so viel Abstand wie möglich, als wäre sie gezwungen, das sabbernde Warzenschwein im Tierpark zu streicheln.
»Zombie«, sagte ich, obwohl sie meinen Spitznamen sicher nicht vergessen hatte.
»Eddie«, antwortete sie tatsächlich.
»Eddie?« Merkwürdiger Name für eine Frau. Passte aber hervorragend zu ihren merkwürdigen Augen. Sie hatte meine Hand wieder losgelassen. Ich schloss irritiert die Faust. Ihr fester Griff kribbelte noch in meiner Handfläche.
»Einfach nur Eddie?«, wollte ich das jetzt genauer wissen.
Sie seufzte. »Eine Abkürzung für Edith.«
»Edith? Im Ernst?«
Sie legte den Kopf schief. »Im Ernst, Joseph.«
Touché.
Sie hatte sich meinen Vornamen gemerkt und betonte ihn spöttisch auf die gleiche Art wie meine Mutter: als wäre ich ein oberbayrischer Landwirt. Ich verdrehte die Augen.
»Jo«, korrigierte ich mit englischer Aussprache. »Mein Vater hieß ebenfalls Joseph und war als amerikanischer GI in Werl stationiert. Meine Mutter hat’s nicht so mit Englisch.«
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Ich hab den Namen von meiner Oma«, erklärte sie. »Die ist eine oberschlesische Kräuterhexe.«
Zu einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Leben, wäre ich in diesem Moment voll auf sie abgefahren.
Doch meine Welt war so dunkel, dass nicht mal Eddie Beelitz’ Lächeln mehr Licht hineinbrachte.
»Was ist? Können Sie mir jetzt die Tür aufmachen, Jo?«, riss sie mich aus meinen Gedanken.
»Wenn Sie mich deswegen nicht festnehmen.« Ich zog mein Schlüsselbund aus der Tasche und löste zwei der kleinen Metallhaken, die in unterschiedlichen Größen daran baumelten. Den ersten fädelte ich in das Türschloss ein. Dann schloss ich die Augen und lauschte auf das leise Klicken der winzigen Zylinder, die ich mit dem zweiten Haken einen nach dem anderen im Schloss herunterdrückte. Das Ding war so ausgenudelt, dass das wie von selbst ging. Sofort sprang die Tür auf.
Beelitz starrte mich entgeistert an. »Dafür müsste ich Sie eigentlich wirklich festnehmen.«
»Dann könnte ich Ihnen aber nicht mehr aufmachen, wenn Sie das nächste Mal draußen stehen.« Ich hielt ihr die Tür auf.
Sie zögerte. So dicht traute sie sich offenbar doch nicht an mir vorbei.
Der Geruch von Garten fiel mir auf und ich konnte mir einen Blick in ihre Privatsphäre nicht verkneifen. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Ich war schon in vielen Wohnungen in den drei Blöcken gewesen und kannte einige mit der gleichen Aufteilung. In der Wohnung direkt nebenan war ich als Jugendlicher oft gewesen, da hatte mein Kumpel Ouzo mit seinen Alten gewohnt.
In Beelitz’ Wohnung konnte ich das eisköniginnenblaue Kinderzimmer von Jos Freundin Lotti sehen. Im Wohnzimmer stand ein hammergeiler Esstisch, dessen Platte aus einer einzigen, dicken Baumscheibe gefertigt zu sein schien. Außerdem entdeckte ich ein mit Einmachgläsern gefülltes Regal und eine Matratze auf dem Boden, auf der Beelitz offenbar schlief.
Es überraschte mich selbst, dass ich einen kurzen Moment mit dem Gedanken spielte, nach ihrer Handynummer zu fragen.
Aber erstens hätte sie ihre Nummer eher Hannibal Lecter verraten als mir und zweitens sollte ich wohl erst wieder an Sex denken, wenn ich es schaffte, morgens einigermaßen regelmäßig aufzustehen.
Ich zog eine Visitenkarte aus meiner Hosentasche, kritzelte meine eigene Handynummer unter die offiziellen Daten meiner Firma und hielt ihr die Pappe hin.
»Falls ich Ihnen mal wieder irgendwo aufmachen soll, melden Sie sich ruhig.«
Wenn ich ihre Handynummer wollte, würde ich sie sowieso bekommen.
EDDIE
Rheinhart!
Keuchend lehnte ich mich von innen gegen die Wohnungstür, kaum dass ich sie hinter mir zugedrückt hatte. Mein Herz wummerte gegen mein Brustbein, die Erinnerung an seinen brutalen Griff um meinen Hals schnürte mir die Kehle zu.
Rheinhart war der Vater von Jaz und Jo?!
Wieso wusste ich das nicht?
Klar, seine Securityfirma erreichte man mit dem Auto von hier aus in wenigen Minuten. Und ich hatte auch irgendwie registriert, dass er neben Objekt-, Personen- und Transportsicherung Schlüsseldienstleistungen im Angebot hatte.
Aber ich wäre eher auf ein Zusammentreffen mit einem jodelnden Cowboy vorbereitet gewesen als mit ihm. Dabei wohnten Jaz und Jo direkt nebenan. Im ersten der drei Wohnblöcke, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Ihr Vater brachte sie vor der Arbeit rüber zu Mütze. Das bedeutete, dass der Psychopath die ganze Zeit mein Nachbar gewesen war. Dass wir seit Monaten aneinander vorbeiliefen. Und dass nicht einmal Mütze, die doch sonst alles ausplapperte, wie es ihr durch den Kopf ging, dieses winzige Detail erwähnt hatte.
Meine Erinnerung holte die Horrorfilmszene aus meinem Gedächtnis hervor und projizierte sie auf die kahle Flurwand: Der an die zwei Meter große, dunkelhäutige Typ kommt unaufhaltsam näher. Seine langen, schwarzen Locken fallen ihm in das schmale Gesicht mit dem dunklen Bart, Schweiß rinnt über die beängstigenden Muskeln seines nackten Oberkörpers. An seiner gesamten rechten Körperhälfte hängt seine Haut in blutigen Fetzen herab. An Arm, Oberschenkel und Brustkorb sind zerrissene Muskeln und blanke Knochen zu sehen. Das verweste Fleisch gibt den Blick auf seine Rippen frei, zwischen denen die aggressive Ratte, die sich gerade durch seine Eingeweide gefressen hat, die Zähne fletscht.
Und diese Horrorvision war kein Produkt meiner Fantasie. Allerdings …
Ich kniff mir in die Nasenwurzel.
Allerdings hatte Rheinhart verändert gewirkt. Beinahe verwahrlost für seine Verhältnisse. Das coole Gangster-Rapper-Outfit mit Goldkettchen war verschwunden. Mit Jogginghose, Kapuzenshirt und Turnschuhen war er verhältnismäßig normal gekleidet. Sein dunkler Bart war so lang, dass er religiösen Fanatismus befürchten ließ, und nachdem er seine Haare zusammengebunden hatte, hatte er offensichtlich nicht in den Spiegel gesehen.
Und die Arroganz war weg. Wegen der ständig spöttisch hochgezogenen Braue hatte ich schon eine Gesichtslähmung in Erwägung gezogen.
Sein Lächeln hatte seine Augen nicht erreicht.
Bei meinem allerersten Fall im KK 11 hatte ich in der Mordkommission mitgearbeitet, die sich mit dem Mord an der arbeitslosen Ronja Bleier vor dem Bochumer Jobcenter befasst hatte. Rheinhart war damals Hauptverdächtiger gewesen. Allerdings hatte sich dann herausgestellt, dass seine vierzehn Jahre jüngere, drogenabhängige Halbschwester Marleen für die Taten verantwortlich gewesen war. Bei der Festnahme war Marleen Rigowski erschossen worden …
Mittlerweile war das über vier Monate her.
Einen Moment lang fragte ich mich, was wohl aus Rheinharts Firma geworden war, in der er neben seiner eigenen Mutter jede Menge weiterer Leute beschäftigte, denen sonst niemand einen Job gegeben hätte.
Dann erinnerte ich mich an die wartenden Rechtsmediziner, schüttelte Rheinhart aus meinem Kopf und schnappte endlich meinen Schlüssel.
ZOMBIE
Ich schaffte die Spätschicht.
Zum ersten Mal seit zwei Wochen. Und ich blieb beinahe auf die Minute im Zeitplan. Dabei hätte mich die unerwartete Begegnung mit Beelitz leicht wieder ausknocken können …
EDDIE
Dank meiner Verspätung musste ich der Sektion nur zwei Stunden beiwohnen.
Die beiden Rechtsmediziner waren sich einig, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gab. Die Ergebnisse der Bluttests lagen schon vor, die Frau war definitiv durch den Inhalt der leeren Schlafmittelpackung gestorben, die ihr die Apotheke erst am Nachmittag nach Hause geliefert hatte. Ob sie die Medikamente aus Versehen oder mit Absicht genommen hatte, würden wir wahrscheinlich nicht abschließend klären können, doch Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es nicht.
Weil ein nicht unerhebliches Erbe im Raum stand, hatten Rechtsmedizin und Erkennungsdienst genau hingesehen. Doch der einzige Sohn der Verstorbenen wohnte mit seiner Frau bei Augsburg und war vor vier Wochen das letzte Mal im Ruhrgebiet gewesen, um seine Mutter zu besuchen. Als Doppelverdienerpaar ohne Kinder waren die beiden nicht auf das Erbe angewiesen.
Vielleicht aufgrund des Alters des Verstorbenen und des Umstandes, dass sie keines gewaltsamen Todes gestorben war, überstand ich die Leichenöffnung einigermaßen souverän. Vielleicht auch, weil ich einen großen Teil der Zeit damit beschäftigt war, eine Gynäkologin zu googeln, die freitags noch nach achtzehn Uhr eine Sprechstunde anbot.
Flos Gesichtsausdruck ähnelte dem eines erschrockenen Rehs. Es verunsicherte sie sichtlich, dass ich sie seit Minuten anstarrte. Doch ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie sie einem Baby das Höschen wechselte, nachdem die Windel nicht dicht gehalten hatte.
Aber mir fiel nur der Wäscheberg in ihrer Wohnung ein, den schließlich Mütze immer wieder motzend zur Waschmaschine in den Keller schleppte. Und die Essensreste, die auf dem schmutzigen Geschirr in Flos Spüle schimmelten.
Ich versuchte, mir vorzustellen, wie Flo sich zwei Mal pro Woche zu Fuß auf den Weg zum Supermarkt machte und dabei an Babybrei, Windeln und Feuchttücher dachte statt an Dosenbier und Nutella.
Schwierig.
Und ihre Lehrstelle wäre natürlich futsch.
Vielleicht ließ sich das Kinderkriegen noch verschieben, bis Flo ihr eigenes Leben einigermaßen auf die Reihe bekam? Dummerweise konnte Flo nicht mal schätzen, wann sie das letzte Mal ihre Periode gehabt hatte.
Meine Gedanken erschreckten mich. Lotti war mit Abstand das Beste, was ich in meinem eigenen chaotischen Leben zustande bekommen hatte. Und Flo hatte sich in den letzten Monaten überraschend gut entwickelt. Würde sie es wirklich nicht schaffen? Oder hatte Mütze meine Meinung beeinflusst?
Der hatte vorhin zum allerersten Mal, seit wir uns kannten, blanke Panik ins Gesicht geschrieben gestanden.
O Gott, ich kann mich nicht um noch ein Kind kümmern! Du musst Flo klarmachen, dass das eine Scheißidee ist, Eddie!
Ich starrte wieder.
Verdammt! Flo brauchte eine Ausbildung. Das war gerade ihre Chance, der eigentlich zielstrebig angesteuerten Hartz-IV-Karriere zu entkommen.
»Achtung, das wird jetzt kalt.« Die mollige, kleine Frau im weißen Kittel hatte schlechte Laune. Sie trat zwischen Flos gespreizt auf den Stuhlhalterungen liegende Beine und spritzte durchsichtiges Gleitmittel aus einer Tube auf den langen Ultraschallkopf.
Gleich nachdem ich zu Hause angekommen war, hatte ich Flo in meinen siebzehn Jahre alten, rostroten Ford Fiesta bugsiert. Das Auto hatte mir mein Nachbar Oleg besorgt. Für vierhundert Euro. Es hatte noch ein Jahr TÜV und würde danach keine weitere Plakette mehr bekommen, außerdem funktionierte der erste Gang nicht und es regnete rein – aber das war noch immer sehr viel komfortabler, als im Winter mit dem Roller zu fahren.
Pünktlich zum Sprechstundenende um sieben hatten Flo und ich im Wartezimmer der Frauenärztin gesessen. Jetzt war es halb acht, was wohl das Saure-Milch-Gesicht der Ärztin begründete. Nicht gerade behutsam führte sie den Ultraschallkopf in Flos Unterleib ein.
Wie sollte ich Flo klarmachen, wie schwierig es war, ein Kind zu versorgen, wenn sie nicht einmal einsah, dass es wichtiger war, etwas zu essen zu kaufen als eine künstliche Blume, die zu tanzen begann, wenn die Sonne darauf schien?
In dem Moment flackerte das Ultraschallbild auf dem Monitor auf, den die Ärztin mit gerunzelter Stirn betrachtete.
Oh.
Mein Mund klappte auf, ohne dass ein Wort herauskam.
Auf dem schwarzen Bildhintergrund zeichneten sich die hellen Konturen ab.
Ich erinnerte mich noch genau an den Moment, in dem ich in der siebten Schwangerschaftswoche Lottis Herz zum allerersten Mal hatte klopfen sehen. Nicht mehr als ein stecknadelkopfgroßer, pulsierender Punkt.
Auf dem Ultraschallbild vor mir erkannte ich einen großen Kopf mit einem sehr viel kleineren Körper, zusammengekrümmt wie ein winziges Alien. Ich sah einen Arm. Und die Beinchen.
Das Kind war schon fertig.
Es kam mir vor, als würde mein Kopf von Sekunde zu Sekunde schwerer werden. Ich hatte das dringende Bedürfnis, mir an die Stirn zu greifen, um ihn festzuhalten, doch ich verkniff es mir.
Flo war weder im ersten noch im zweiten Monat, das brauchte mir die Ärztin nicht zu erklären, das sah ich selbst.
»Glückwunsch, Frau Neri«, gratulierte die Medizinerin nicht besonders herzlich. »Sie werden Mutter. Mitte Oktober. Sie sind in der dreizehnten Woche.«
Flo strahlte.
Dreizehnte Woche. Damit kam ein Abbruch der Schwangerschaft nicht mehr infrage. Flo bekam definitiv ein Baby. Ihrer Vermutung nach wahrscheinlich von einem siebzehnjährigen Wohnungslosen, den sie noch aus ihrer Zeit auf der Straße kannte und der auf den vielsagenden Namen ›Rüde‹ hörte. Offenbar übernachtete der Typ gelegentlich bei ihr.
Augenblicklich schossen mir all die Dinge durch den Kopf, die in den kommenden Monaten erledigt werden mussten. Eine Hebamme suchen. Zum Amt gehen, die entsprechenden Anträge ausfüllen. Schwangerschaftsklamotten und einen Wickeltisch besorgen. Kreißsäle besichtigen. Geburtsvorbereitung.
O Gott, ich kann mich nicht um noch ein Kind kümmern!, klingelten mir Mützes Worte in den Ohren. Dass Flo alles allein organisiert bekam, konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
Eine Sekunde lang wünschte ich mir, in die Zukunft sehen zu können wie meine Oma.
ZOMBIE
Ich schaffte wieder die Spätschicht. Den zweiten Tag in Folge.
Und das, obwohl ich Witt und Heppners Flut in Dauerschleife aus dem Hochleistungssoundsystem meines Hummer H2 dröhnen ließ. Die Musik war kontraproduktiv: Die Hoffnung auf die große Flut, die dich endlich wegspült, weil dein Scheißleben doch nie besser werden wird, unterstützte mein Gehirn hervorragend dabei, morbide Fantasien zu produzieren, während ich das Gaspedal durchtrat. Das Straßenbahndepot stand als Nächstes auf meinem Plan.
Weil meine Fantasie moralische Grenzen noch nie allzu ernst genommen hatte, kreisten meine Gedanken mal wieder um den kleinen Ruck aus dem Handgelenk, der meinen Hummer H2 mit hundertfünfzig Sachen gegen die Schallschutzwand krachen lassen würde.
Weil ich in der Realität zwei dann endgültig gestörte Kinder zurücklassen würde, ließ ich es bleiben.
Außerdem war meine Karre so stabil, dass nicht sicher war, ob die Aktion tatsächlich zum gewünschten Erfolg führen würde.
EDDIE
»Das Knie ist vollkommen in Ordnung, Dietmar. Du bist eben nicht mehr zwanzig. Ich will dich einmal am Tag hier vorbeispazieren sehen, du musst in Bewegung bleiben. Und hiermit kannst du das Bein morgens und abends einreiben.«
Lotti und ich hatten den Samstagnachmittag im Schrebergarten meiner Oma verbracht, weil ich hier vor dem warmen Ofen in der winzigen Laube immer noch am besten nachdenken konnte. Lotti war unterdessen in den riesigen Kirschbaum geklettert und hatte anschließend mit meiner Oma eine Ingwerwurzel, Dill und Zitronengras zu einer scharf riechenden Paste zerstampft und mit Vaseline vermischt. Jetzt verteilte meine Oma das Zeug auf dem achtzigjährigen Knie, das auf ihrem Schoß lag.
Ich verkniff mir ein Grinsen.
Mit einundsiebzig war Oma Edith noch immer auf sehr unkonventionelle Art attraktiv. Sie trug Kräuterhexenlook mit Strickjacke und einem Rock, der ihre weiblichen Rundungen durchaus zur Geltung brachte. Ihre langen, weißen Haare lagen zu einem lockeren Zopf geflochten über ihrer rechten Schulter. Wie immer lief sie barfuß in ihrer Hütte herum.
Trotz hunderttausend Falten und ihrer nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechenden Nase konnte ein Lächeln von ihr – genau wie das von Lotti – mühelos den Sonnenschein ersetzen.
Nach einer Frau mit Kopftuch samt erschrockener Teenagertochter und einer Ökogärtnerin, die auf lokal angebauten Honig als Heilmittel schwor, war Dietmar bereits der dritte ›Patient‹, der an diesem ungemütlichen Wintertag in Omas Gartenlaube aufgetaucht war. Während meine Großmutter mit geübten, fließenden Bewegungen die Salbe einmassierte, ließ mich Dietmars zufriedene Miene vermuten, dass es ihr Lächeln war, das seinen Knieschmerz immer wieder behandlungsbedürftig werden ließ.
In der kleinen, mit Holz verkleideten Hexenhütte roch es nach den getrockneten Kräuterbüschelchen, die an den kreuz und quer unter der Decke gespannten Wäscheleinen baumelten, nach frisch aufgebrühtem Tee und dem knisternden Holzfeuer in dem alten Ofen in der Ecke, das für mollige Wärme sorgte.
Lotti hockte im Schneidersitz im Ohrensessel und löffelte Honig aus einem winzigen Gläschen. Die deckenhohen Regale an den Wänden waren vollgestopft mit Einmachgläsern und kleineren, handbeschrifteten Töpfchen und Tiegeln.
»Es geht schon viel besser, Edith.« Dietmar krempelte sein Hosenbein herunter und fummelte zehn Euro aus der Tasche. »Gehst du diesmal mit mir essen?«
Meine Oma schnaubte mit gespielter Entrüstung und schob den Alten energisch hinaus in den Nieselregen.
Seit dem frühen Tod meines Opas, den ich nicht mehr kennengelernt hatte, lebte meine Oma allein. Früher hatte ich mich oft darüber gewundert, dass sie nie auf eine Einladung einging. Seit der unschönen Trennung von meinem Noch-Ehemann Philipp sah ich die Sache allerdings mit anderen Augen. Vielleicht war Omas Verhalten klüger, als mir bewusst gewesen war …
Meine Oma nahm den aufgebrühten Tee von der Spüle und stellte mir eine Tasse unter die Nase.
»Also, noch mal von vorn«, kam sie auf unser Gespräch zurück. Sie setzte sich mir gegenüber an den ausklappbaren Holztisch. »Deine kleine Nachbarin, für die du neulich noch die ganzen Bewerbungen geschrieben hast, ist jetzt schwanger?«
Sie stützte das Kinn in die Hände. Ihre grünen Augen besaßen dunkle Sprenkel in der Iris und waren so klar, dass ich mich darin spiegelte.
»Dreizehnte Woche«, nickte ich.
»Ich soll aber nichts dagegen unternehmen, oder?«, erkundigte sich Oma samtweich.
Mein erster Impuls war, erschrocken den Kopf zu schütteln, obwohl ich diese Möglichkeit ja selbst in Betracht gezogen hatte. Als sich unsere Blicke kreuzten, hielt ich inne.
Meine Oma war als junge Frau mit ihren Eltern aus Schlesien ins Ruhrgebiet gekommen. In ihrer Heimat hatte sie bereits mit vierzehn ihrer Nachbarin, einer Hebamme, bei der Arbeit geholfen und mit sechzehn schon Geburten begleitet. Hier in Deutschland hätte sie eine Ausbildung machen müssen, um weiter als Hebamme arbeiten zu können. Da hatte sie jedoch schon meinen Opa kennengelernt und war selbst schwanger geworden.
Sie hatte ohne Ausbildung dagestanden, als mein Opa an Lungenkrebs gestorben war. Meine Mutter war gerade zehn gewesen.
Seitdem besserte meine Oma ihre Witwenrente auf, indem sie die Nachbarschaft mit Heilkräutern versorgte, Warzen besprach und Interessierten im Austausch für ein paar Eier aus der Hand las oder die Zukunft mithilfe eines Kaffeesatzes vorhersagte.
Mein Blick wanderte nachdenklich zu den Töpfchen im Regal. »Könntest du denn etwas daran ändern?«, erkundigte ich mich.
Meine Oma lachte leise in sich hinein. »Du hast angefangen, die Augen aufzumachen«, murmelte sie. »Gut.«
Ich runzelte verständnislos die Stirn. »Könntest du nicht einen Teebeutel aufschneiden und mir verraten, ob Flo das schafft?«, verlangte ich bockig, als sie schwieg.
»Ich kann doch nicht hellsehen, Eddie«, erklärte sie nachsichtig.
Ach wirklich? Mir war das eigentlich schon immer klar gewesen. »Wieso zahlen dir die Leute dann Geld dafür?«, entgegnete ich trotzdem.
Meine Oma musterte mich abschätzend. »Keine Ahnung. Sie wollen wahrscheinlich einfach meine Meinung hören. Ich bin ja nicht die Einzige, die so etwas macht. Heutzutage verzichtet man meistens auf den Kaffeesatz und gibt der Sache einen seriös klingenden Namen. Personal Coaching. Oder … lösungsorientierte Lebensberatung oder so. Ich versuche lediglich, die Möglichkeiten zu erkennen, die einem Menschen in seiner Lebenssituation offenstehen. Eine gewisse Weitsicht fällt jemandem, der in einer schwierigen Situation feststeckt, oft schwer.«
Weitsicht – das war eine Gabe, die auch meiner Mutter in die Wiege gelegt worden war. Darüber musste ich einen Augenblick lang nachdenken. Ein paar Mal hatte ich schon gedacht, dass sogar Lotti von Natur aus über diese Art von Voraussicht verfügte.
»Wenn du nicht hellsehen kannst, wieso hast du dann damals mitten in der Nacht vor der Gartenlaube auf mich gewartet, nachdem Philipp mich rausgeschmissen hatte?«, bohrte ich schließlich nach. »Das konntest du dir bei aller Weitsicht nicht ausrechnen.«
Meine Oma schwieg.
»Du hattest sogar Tee gekocht«, versuchte ich, sie festzunageln.
Meine Oma legte die Fingerspitzen aneinander. »Ich wusste, dass an diesem Abend wieder eine von Philipps Werbeveranstaltungen stattfand. Und ich konnte mir sehr wohl ausrechnen, dass es deswegen irgendwann knallen würde. Dass Philipp aus dir keine Trimmradverkäuferin machen würde, lag doch auf der Hand.«
Ich prallte zurück.
»Ich hatte vorher schon vier Mal auf dich gewartet«, gestand meine Oma schmunzelnd. »Du hast das Theater länger mitgemacht, als ich vermutet habe.«
Ich griff mir an die Stirn.
War das Scheitern meiner Ehe so offensichtlich gewesen? Warum hatte sie nie etwas gesagt?
»Was ich sehe, sage ich nur, wenn es auch jemand hören will«, beantwortete meine Oma die Frage – wie so oft, ohne dass ich sie hatte stellen müssen. »Im Gegensatz zu deiner Mutter«, ergänzte sie vielsagend. »Und natürlich kann ich nur eine Situation beurteilen, wenn ich jemanden gut kenne. Bei deiner schwangeren Freundin kann ich dir also nicht helfen. Das musst du schon selbst hinbekommen.«
Ja. Klar. Blöd nur, dass die genetisch bedingte Weitsicht meine Generation übersprungen hatte.
»Wenn ich mich nicht täusche, wird dir das auch gelingen«, widersprach meine Oma prompt.
Verblüfft hob ich den Kopf.
»Das sehe ich heute übrigens zum ersten Mal«, fügte sie hinzu und die Sprenkel in ihren grünen Augen funkelten.
ZOMBIE
Sich zu erhängen ist relativ erfolgversprechend.
Erzeugt man ausreichend großen Druck auf die das Gehirn versorgenden Arterien im Halsbereich, verliert man das Bewusstsein in Sekunden und bekommt das Eintreten des Todes gar nicht mehr mit.
Ouzos Alter hatte das damals sogar mit dem Gürtel eines Bademantels an der Türklinke hingekriegt, weil es nicht einmal des kompletten Körpergewichtes bedarf, um den notwendigen Druck zu erzeugen, und man den weiteren Verlauf nicht mehr aufhalten kann, wenn man erst weggetreten ist.
Ich würde es natürlich ein bisschen spektakulärer machen. Auf der Ruhrtalbrücke, der Aussicht wegen. Da hatte ich als Jugendlicher schon ein paar Mal gestanden.
Aber wenn man schon auf der Ruhrtalbrücke stand, wäre man eigentlich ein Idiot, wenn man sich daran aufhängen würde, statt zu springen …
EDDIE
Es war fast zehn, als Lotti sich in unserem Wohnzimmer auf der Matratze in der dicken, nach Lavendel duftenden Daunendecke eingerollt hatte und schlief.
Ich saß an meinem extravaganten Esstisch, einem frühen Werk meiner Mutter. Das Ding war gut zweitausend Euro wert. Die schwere Tischplatte hatte meine Mutter aus einer einzigen, gewaltigen Baumscheibe gefertigt, glatt geschliffen und lackiert, sodass die unzähligen Jahresringe zu erkennen waren. Ein Kunstwerk, das einen gewagten Kontrast zu meiner knallroten Sperrmülleinbauküche und den Deckenlampen bildete, die ein schwedischer Möbeldiscounter für 1,99 Euro verkaufte.
Mein Leben lang hatte ich die Kräuterhexengeschäftchen meiner Oma belächelt. Heute hatte ich zum ersten Mal das Gefühl zu begreifen, was sie machte. Und allwissend war sie offensichtlich auch nicht, denn ihre Hoffnung, dass ich jemals zu einer vergleichbar klugen Voraussicht in der Lage sein würde, war lieb gemeint, aber lächerlich.
Ich kannte kaum jemanden, der die Folgen seiner Entscheidungen so wenig absehen konnte wie ich. Sonst hätte ich mir keinen Job ausgesucht, für den ich absolut ungeeignet war. Und ich hätte keinen Mann geheiratet, der etwas grundlegend anderes unter einer Ehe verstand als ich. Und ich hätte garantiert nicht mit meinem Vorgesetzten geschlafen.
Klar war immerhin, dass Flo ein Kind bekommen würde. Das ließ sich nun nicht mehr ändern.
Seit ich Flo geholfen hatte, sich gegen die psychischen Manipulationen ihres Vaters zu wehren, fühlte ich mich irgendwie verantwortlich für sie.
Mütze ging es ähnlich.
Wir würden Flo bei den Anträgen helfen, eine Hebamme und einen Geburtsvorbereitungskurs suchen, sie zu den Vorsorgeuntersuchungen begleiten. Mütze würde zweifellos ein Kinderzimmer organisieren und Flo die alten Klamotten der Zwillinge vererben.
Bis zur Geburt im Oktober war noch ein halbes Jahr lang Zeit. Bis dahin konnte Flo viel lernen. Also locker bleiben, es gab keinen Grund, in Panik zu geraten.
Nachdenklich trat ich an mein Wohnzimmerfenster. Aus dem dritten Stock sah ich auf die zwanzig Meter entfernte, graubraune Gebäudefront des baugleichen Blocks gegenüber.
Flo wohnte parterre. Ich konnte auf ihren Balkon hinuntersehen. Meine Nachbarin stand draußen, im Licht der geöffneten Balkontür.
Sie rauchte.
ZOMBIE
Das Wetter passte hervorragend zu meiner Laune. Vom Frühling war noch nichts zu sehen. Es war arschkalt und fing auch noch an zu regnen. So konsequent, wie im Moment alles scheiße lief, würden gleich auch noch die Straßen spiegelglatt sein.
Das hatte ich von der Trödelei. Es war halb elf, normalerweise beendete ich meine Runde bereits um kurz vor zehn mit dem Kontrollrundgang an der Entzugsklinik für Suchtkranke in Eppendorf.
Dana hatte um zehn die Nachtschicht im Krankenhaus antreten müssen. Das bedeutete, sie war längst losgefahren, Jaz und Jo schliefen allein in der Wohnung. Das ging gar nicht. Auch wenn Jaz fast zwölf war und schon mal eine Weile auf Jo aufpassen konnte, sollte ich das echt nicht bringen.
Und das nur, weil ich in Selbstmordfantasien abtauchte, statt endlich meinen Hintern hochzukriegen.
Die Klinik lag am Arsch der Welt. Am Ende eines Wohngebiets zwischen Einfamilienhäusern begann der unscheinbare Feldweg, der beinahe einen Kilometer weit an Wiesen vorbeiführte, bis man die abgelegene Klinik erreichte. Nachts herrschte hier tiefste Finsternis und es konnte durchaus ein Fuchs im Scheinwerferlicht auftauchen.
Ein hoher Maschendrahtzaun umgab das Gelände. Ich lenkte den Hummer durch das breite Rolltor auf den Hof und stellte die Depri-Mucke aus.
Die Klinik an der Ruhr erinnerte ein wenig an ein ostwestfälisches Bauerndorf. So eines wie die, die man auf den Klassenfahrten ins Freilichtmuseum zu sehen bekam.
Drei weiße Fachwerkgebäude, vor die moderne Glaseingänge gesetzt worden waren, standen auf der vom Tor aus linken Seite des geschotterten Innenhofs. Auf der rechten Seite erhob sich die drei Stockwerke hohe Front der in die Jahre gekommenen Bettenburg mit Flachdach, in der die Patientenzimmer untergebracht waren. Das wusste ich, weil sich direkt an dem gläsernen Haupteingang mit elektrischer Tür das kleine Kabuff befand, in dem die Nachtschwester Dienst schob.
Ich meldete mich dort an, wenn ich meinen Rundgang begann, und wieder ab, wenn ich durch war. Die Krankenschwester war die einzige Mitarbeiterin, die nachts anwesend war.
In den drei Fachwerkgebäuden auf der gegenüberliegenden Hofseite herrschte niemals Betrieb, wenn ich auftauchte. Dort waren laut Beschilderung die Verwaltung und die Therapieräume untergebracht. Durch die Fenster hatte ich ein paar Krafttrainingsgeräte und Gymnastikbälle gesehen. Es gab sogar ein kleines Schwimmbad in einem gläsernen Anbau an der Gebäuderückseite. Zur Klinik gehörte außerdem ein weitläufiger Park mit altem Baumbestand und einem ziemlich großen Teich, um den ein Rundweg herumführte.
Das ganze Gelände war mit einem gut zwei Meter fünfzig hohen Maschendraht aus stabilem Stahl eingezäunt. Im abgelegenen hinteren Teil des Parks war die Begrenzung sogar mit Stacheldraht verstärkt. Wie im Knast. Ich wusste das, weil ich unter anderem dafür bezahlt wurde, den Zaun einmal pro Woche zu kontrollieren.
Das hatte diese Woche allerdings Oleg übernommen, als er mal wieder für mich eingesprungen war. Es war paradox, dass ich seit Jahren erfolglos versucht hatte, Oleg an die Arbeit zu kriegen und er seinen Arsch jetzt ganz von allein hochbekam, weil er Mitleid mit mir hatte.
Ich trat durch den hell erleuchteten, gläsernen Haupteingang und grüßte Nachtschwester Kiara. Sie saß hinter einer Glasscheibe wie früher die Bankangestellten an der Kasse, und las eine Klatschzeitung. Kiara freute sich, wenn ich auftauchte. Hauptsächlich, weil ich in der Vergangenheit schon zwei Mal den Gorilla für sie gespielt hatte, als es Ärger mit Patienten gab, die nach einem Spaziergang alkoholisiert in die Klinik zurückgekehrt waren. Kiara war zierlich, blondiert, Anfang zwanzig und kaute Kaugummi.
Als ich wieder durch die Automatiktür auf den Hof trat, war der Regen stärker geworden. Ich zog mir die Kapuze meines Daunenparkas ins Gesicht und vergrub die Hände in den Taschen. Die Tropfen prasselten auf das Plastikdach des schlichten Gartenpavillons, der links vom Klinikeingang unter einer Eiche stand und als Raucherecke diente. Geraucht wurde um diese Zeit allerdings nicht, nach zweiundzwanzig Uhr dreißig durften die Patienten das Gebäude nämlich nicht mehr verlassen.
Die alten Bäume waren jetzt, Anfang März, noch kahl und hielten den Regen kein bisschen ab. Ich lief außen um das lang gezogene Bettenhaus herum. Dicke Tropfen prasselten auf die Kieswege. Hinter den erleuchteten Scheiben des Aufenthaltsbereiches im Erdgeschoss konnte ich ein paar Typen Dart spielen sehen.
An der Rückseite des Klotzes war es stockfinster, obwohl viele Fenster der Patientenzimmer in den oberen Etagen erleuchtet waren. Ich kontrollierte, ob Kellertüren und Nebeneingänge wirklich verschlossen waren. Zwei breite Feuertreppen aus verzinktem Stahl führten bis aufs Dach hinauf. An der hinteren brannte Licht. Die Lampe wurde durch einen Bewegungsmelder gesteuert, wahrscheinlich war eine Katze unterwegs.
Ich lief zu den drei Fachwerkgebäuden hinüber. Dazu musste ich den Klinikhof überqueren, auf dem mein Hummer parkte. Rechts von mir lag der Park im Dunkeln.
Auf der Rückseite der Verwaltungs- und Therapiegebäude gab es noch einen kleineren, von kahlen Bäumen umsäumten Wirtschaftshof, ein langer, gepflasterter Streifen zwischen den Gebäuderückseiten und dem Zaun, der die Grundstücksgrenze markierte. Hinter dem Maschendraht begannen Wiesen und Gebüsch. Die Lichter und der Lärm der Stadt waren weit entfernt.
Die weiße Fachwerkwand hob sich in der Dunkelheit ab, genau wie die beiden hellen Fahrzeuge mit dem stilisierten Fluss auf den Türen, dem Kliniklogo. Der Bulli und der Dienstwagen parkten wie immer vor dem Zaun. Drei weitere Karren standen ein Stück entfernt.
Meine Taschenlampe hatte ich im Hummer liegen lassen. Ich benutzte sie ungern. Sobald der Strahler eingeschaltet war, nahm ich außerhalb des Lichtkegels nicht mehr alles wahr.
Plötzlich zuckte jedoch vor mir ein Lichtschein über das nass glänzende Pflaster des von Bäumen umsäumten Hofs.
Ein Einbrecher? Der sich schlauerweise informiert hatte, wann der Wachdienst üblicherweise seine Runde machte und nun glaubte, ich wäre schon durch?
Böser Fehler, du Trottel.
Reflexartig prickelte das Adrenalin durch meinen Körper. Meine Sinne stellten sich scharf und die lähmende Schwere fiel von mir ab, als hätte jemand eine Bleidecke von mir weggezogen.
Ich huschte zu den Autos im Schatten der Bäume, weil sich meine dunkle Silhouette vor der weißen Hauswand zumindest für mich selbst deutlich sichtbar abgehoben hätte.
Der Lichtkegel zuckte in die nahen Baumkronen hinauf. Eine Stimme wurde laut. Zwei Einbrecher? Kriegten sich die Idioten während des Bruchs in die Haare?
Offensichtlich.
Ein dumpfer Schlag folgte, der Lichtschein trudelte, dann rollte die Taschenlampe unter einen alten Golf. Ein breiter Hofstreifen wurde nun beleuchtet und ich erkannte zwei Personen. Einer der Männer lag auf dem Bauch auf dem Parkplatz, ein zweiter stand mit dem Rücken zu mir über ihm. Keine fünf Meter von mir entfernt.
»Hast du gedacht, du kannst vor mir weglaufen?« Der große, schlanke Typ hatte den Oberkörper des am Boden liegenden Dicklichen nach hinten gerissen. Sein Opfer hing schlaff in seinem Griff.
Der würgte ihn, begriff ich.
»Ey!« Mit einem Schritt trat ich in den Lichtkegel der Lampe. »Sicherheitsdienst! Lassen Sie den Mann los!«
Der Angreifer wirbelte herum. Der Körper seines Opfers sackte leblos auf das nasse Pflaster. Einen Augenblick lang standen wir uns gegenüber. Weil ihn mein eigener Schatten traf, blieb sein Gesicht im Dunkeln. Seine Schuhe fielen mir auf. Springerstiefel mit Stahlkappe. Von der Sorte, die AfD-Wähler bevorzugten. Mit denen prügelte ich mich besonders gern.
Im nächsten Augenblick gingen mir die Lichter aus.
EDDIE
Lotti streckte die Ärmchen über den Kopf und strampelte die Bettdecke weg.
Obwohl in ihrem Kinderzimmer ein nagelneues Hochbett mit Rutsche stand, schlief sie lieber bei mir auf der Matratze auf dem Fußboden im Wohnzimmer.
Philipp hatte sich immer aufgeregt deswegen. Er hatte mir vorgeworfen, Lotti nicht erziehen zu können, wenn sie abends zu uns ins Bett gekrabbelt war. Weil Lotti trotzdem nicht allein einschlief, hatte ich mich jeden Abend zu ihr in ihr Feenschlosshochbett gequetscht. Regelmäßig war sie nachts aufgewacht und hatte angefangen zu weinen, wenn sie gemerkt hatte, dass ich weg war.
Erst seit wir ausgezogen waren und sie mit mir zusammen im Wohnzimmer übernachten durfte, schlief sie durch.
Im Halbdunkel betrachtete ich das zufriedene, von roten Löckchen umrahmte Gesicht meines schlafenden Kindes.
Geraucht hatte ich noch nie, Alkohol getrunken nur selten, und als ich damals von meiner ungeplanten Schwangerschaft erfahren hatte, hatte ich sofort angefangen, Bücher darüber zu lesen, welche Vitamine für das Ungeborene wichtig waren. Ich hatte mich über Vorsorgeuntersuchungen informiert und mir von Oma auf die Schwangerschaftswoche abgestimmten Kräutertee mixen lassen.
Natürlich konnte ich das alles nicht von Flo erwarten.
Aber über das Rauchen würde ich mit ihr sprechen müssen.
Ich wurschtelte die duftende Daunendecke wieder heran und deckte Lotti sorgfältig zu.
ZOMBIE
Ich blinzelte.
Das Erste, was ich wahrnahm, war der summende Schmerz in meinem Nacken. Dann spürte ich den kalten, nassen Steinboden an meiner Wange. Und die dicken Regentropfen, die mich im Gesicht trafen und auf meine Jacke prasselten.
Als mein Blick auf die weiße Rückseite des Fachwerkhauses in der Finsternis fiel, war die Erinnerung schlagartig wieder da.
Fuck! Die hatten mich ausgeknockt.
Der Adolf-Fan war nicht allein mit seinem Opfer gewesen, wahrscheinlich hatte ein Kumpel von ihm Schmiere gestanden.
Mit einem Satz war ich auf den Füßen und lauschte in die Dunkelheit. Dass ich dazu in der Lage war, verdankte ich Freddies jahrelangem Boxtraining. Bis zum Erbrechen hatten wir den Knock-out geübt.
»Schneller!«
Ich verliere die Orientierung, lasse die Augen trotzdem zu, spüre nur noch Freddies Griff an meinen Schultern, der mich noch mal um mich selbst dreht. Noch mal.
»Und noch mal!«
Der Boden kippt unter mir weg, ich lande auf den Knien.
»Hochkommen! Rechte Gerade!«, brüllt Freddie mich an.
Ich gehorche, springe auf. Alles dreht sich. Noch während ich klarzukriegen versuche, wo oben und wo unten ist, fokussiere ich das zerschlissene Lederpolster in Freddies Hand und schlage mit aller Kraft zu.
Zuschlagen war heute nicht nötig.
Ich war allein. Bis auf den um mich herum niederrauschenden Dauerregen war alles still.
Mit Blicken suchte ich den Wirtschaftshof ab. Weil die kahlen Äste der Bäume bizarre Schatten warfen, hatte ich nicht sofort den Überblick. Doch nach ein paar Sekunden war ich mir sicher, dass hier nirgendwo ein Mordopfer herumlag. Ich bückte mich neben dem dunklen VW Golf mit den getönten Scheiben. Doch die unter das Auto gerollte Taschenlampe war ebenfalls verschwunden.
Trotzdem versicherte mir der summende Schmerz in meinem Nacken glaubhaft, dass ich nicht unter Halluzinationen litt. Der Typ mit den Springerstiefeln hatte hier eben jemanden gewürgt.
Oder umgebracht? Ich hatte ihn ja nicht daran hindern können.
Dann war der Wichser in diesem Moment gerade dabei, die Leiche wegzuschaffen?!
Scheiße!
Ich drehte mich auf dem Absatz um und rannte zwischen den Häusern hindurch über den Innenhof zu Nachtschwester Kiara hinter dem Glaseingang des Bettenhauses.
EDDIE
»Könntest du denn etwas daran ändern?«
Meine Oma ähnelt der Zigeunerin Esmeralda aus Walt Disneys Glöckner von Notre Dame, mit ihrer dunklen Mähne, dem bodenlangen Rock, dem breiten Lächeln und den smaragdgrünen Augen. Sie hebt einen knorrigen Stab, der aussieht, als hätte meine Mutter ihn in den Fingern gehabt, und schwingt ihn durch die Luft.
Flo greift sich an den Bauch, bricht zusammen und windet sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden.
»Seit die Moslems wieder so viel Wert auf die Tugend ihrer Töchter legen, ist das öfter nötig.«
Meine Oma altert in Sekunden, ihre Haare werden schlohweiß und ihr Gesicht bekommt tiefe Runzeln. Ich erschrecke mich, obwohl sie sich nur in die Frau verwandelt, die ich kenne.
Meine Oma ist eine Hexe.
»Wenn ich mich nicht täusche, wird dir das auch gelingen.«
Mit klopfendem Herzen zuckte ich hoch.
Lotti hatte meine Bewegung registriert und schmiegte sich an mich. Ich strich ihr eine rote Locke aus dem Gesicht.
Bescheuerter Traum. Einen Moment lang dachte ich jedoch noch über die Frau mit Kopftuch nach, die heute Nachmittag zusammen mit dem verheult aussehenden Mädchen in Omas Hexenhaus gehockt hatte …
ZOMBIE
»Herr Walther, bitte melden Sie sich am Empfang! Herr Walther, bitte melden Sie sich am Empfang!«
Die Kinderstimme von Nachtschwester Kiara schallte aus der Lautsprecheranlage durch die gesamte Klinik. Wach gewesen waren die Patienten schon vorher. Kiara und ich hatten die Namen der Typen, die unten im Aufenthaltsbereich Dart gespielt hatten, auf einer Anwesenheitsliste abgehakt und danach an alle anderen Zimmertüren geklopft, bis jemand geöffnet oder zumindest eine Antwort gebrummt hatte.
»Das ist nicht so schlimm, wir rufen sowieso jede Nacht stichprobenartig jemanden runter«, hatte die Nachtschwester gemeint. »Zum Pusten.«
Mittlerweile hatten wir vierundachtzig der fünfundachtzig Namen auf der Belegungsliste der Zimmer abgehakt. Nur das Zimmer eines gewissen Henrik Walther, Nummer 205 im zweiten Stock, war leer gewesen. Kiara hatte die Tür mit einem Generalschlüssel geöffnet.
Ein Streifenwagen stand jetzt mit blinkendem Blaulicht vor dem Glaseingang und die ersten Neugierigen schlappten in Trainingsanzug und Puschen in den Empfangsbereich.
Die beiden Streifenbullen, Kiara und ich saßen in dem mit Schreibtisch, zwei Stühlen, Kaffeemaschine und Behandlungsliege ausgestatteten Schwesternzimmer, das sich hinter der Sperrholzrückwand des winzigen Pförtnerkabuffs befand.
Ein blonder Junge mit einer Teetasse in der Hand, in der noch der Beutel baumelte, klopfte an die Glasscheibe. Der Typ war mager und bleich und sah aus wie ein Siebtklässler. In jedem Fall viel zu jung, um in einer Suchtklinik abzuhängen.
Dieser Gedanke tauchte unvorbereitet auf, es gelang mir nicht, das Aufblitzen der Erinnerungen zu verhindern.
Den mit einem Gürtel abgebundenen, dünnen, weißen Arm. Die Ellenbeuge, unter deren durchsichtiger Haut die Blutgefäße bläulich schimmerten. Die blutverschmierte Spritze.
»Da sind Sie ja, Herr Walther.« Kiara schob ein Stück der Glasscheibe zur Seite. »Wir haben an Ihrer Zimmertür geklopft?!«
Der Teenager hatte weißblonde Haare und Pickel. Er reichte mir bis zur Brust. Marleen hatte in der elften Klasse mit den harten Sachen angefangen.
»War in der Teeküche.« Verwirrt hob der Junge seine Tasse. »Ist das jetzt auch schon verboten, oder was?«
»Natürlich nicht.« Die Krankenschwester hakte den letzten Namen auf ihrer Patientenliste ab. »Damit wären dann alle da. Gesund und munter«, stellte sie fest.
Der kleinere der beiden Bullen, der meine Aussage zu Protokoll genommen hatte, wandte sich mir schulterzuckend zu. »Tut mir leid, Herr Rheinhart, mehr können wir nicht tun. Wir haben das Klinikgelände überprüft. Nichts deutet auf einen Kampf hin und vermisst wird anscheinend auch niemand. Die Kollegen vom Erkennungsdienst sind trotzdem ausgerückt und sehen sich gleich den Wirtschaftshof noch genau an.«
Mein Blick wanderte nach draußen. Der Regen schlug Blasen auf dem Pflaster. Den Erkennungsdienst konnten die sich sparen. Wenn es irgendwelche Spuren gegeben hatte, waren die längst weggespült worden.
»Vielleicht waren es nur Jugendliche, die sich beim Herumtreiben in die Haare gekriegt haben«, mutmaßte der zweite, ältere Streifenpolizist, der seinen drahtigen, kleinen Kollegen überragte, lahm. Dabei hatte ich schon dreimal wiederholt, dass zumindest das Opfer, dessen Gesicht ich im Licht der Taschenlampe hatte erkennen können, über fünfzig gewesen war.
Spöttisch zog ich eine Augenbraue hoch.
Wirklich Bock, im Dauerregen das Klinikgelände oder die Wiesen und das Gebüsch drum herum abzusuchen, hatten die beiden natürlich nicht.
»Wir haben Ihre Anzeige aufgenommen und geben den Kollegen von der Kripo Bescheid. Die sehen sich hier morgen noch mal um«, entschied der Drahtige und flüchtete, bevor ich etwas erwidern konnte.
Ich rieb mir den schmerzenden Nacken.
EDDIE
»Bist du diesmal schon umgefallen, bevor du die Rechtsmedizin betreten hattest?« Adrian grinste ein Michel-aus-Lönneberga-Grinsen.
Lässig lehnte er am Schreibtisch unseres neuen Kollegen Gregor Georgi. Der hochgewachsene Neunundzwanzigjährige mit dem Körper eines Profischwimmers und wenigen Haaren war aus dem KK 14 zu uns gewechselt. Gregor grinste mit, ohne von seinem PC aufzusehen. Es war Sonntagmorgen, aber wegen des U-Bahn-Schubsers gab es für unser Team kein Wochenende. Ich konnte nur auf meiner Ausnahmeregelung für Alleinerziehende bestehen, weil Adrian mich sowieso bei den Ermittlungen ausgeklammert hatte und mir höchstens Schreibarbeiten übertrug.
»Entschuldigung, dass ich ein Leben außerhalb der Leichenhalle habe«, sagte ich. Ich hatte mir vorgenommen, nicht mehr jede bescheuerte Bemerkung kommentarlos zu schlucken, auch wenn ich im allgemeinen Gerangel um die Hackordnung etwa genauso gute Chancen auf ein bisschen mehr Respekt hatte wie der Papierkorb neben der Tür.