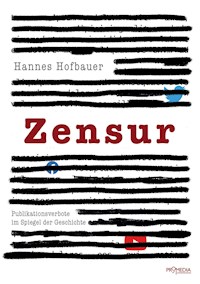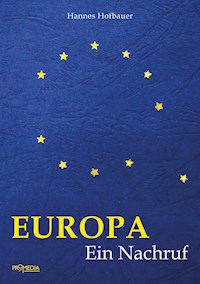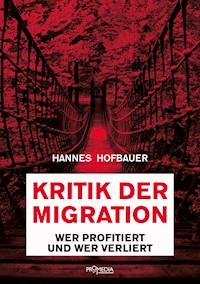15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der 24. März 1999 markierte das Ende der europäischen Nachkriegszeit. Mit dem Einsetzen der Bombardements gegen serbische und montenegrinische Städte durch die NATO eskalierte die Zerstörung des ehedem multinationalen und blockfreien Jugoslawien zur kriegerischen Intervention. Hannes Hofbauer zeichnet die Tragödie am Balkan nach. Ein Blick von außen, weltsystemisch und historisch fundiert, soll dabei helfen, die Nebel von Propaganda, die eine totale Verunsicherung in der kritischen Öffentlichkeit im Westen bewirkt haben, zu lüften. Nur so können die Konturen der Interessenslagen deutscher und US-amerikanischer Kriegstreiber nachgezeichnet und die ideologische Substanz der scheinbaren Rechtfertigung, Bomben im Dienste von Menschenrechten und Solidarität zu werfen, bloßgelegt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Hannes HofbauerBALKANKRIEG
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Hofbauer, Hannes :
Balkankrieg : zehn Jahre Zerstörung Jugoslawiens /
Hannes Hofbauer. – Wien : Promedia, 2001.
(Brennpunkt Osteuropa.)
ISBN 978-3-85371-179-8
5. unveränderte Neuauflage 2015
© 2001 Promedia Druck- und Verlagsges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Scheubmayr & Berthold Ges.b.R.
Lektorat: Erhard Waldner
ISBN 978-3-85371-179-8
eISBN 978-3-85371-841-4
Der Autor
Hannes Hofbauer, geboren 1955 in Wien, Studium der Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Er arbeitet als Historiker und Journalist. Von ihm erschienen unter anderem im Promedia Verlag: „Experiment Kosovo. Die Rückkehr des Kolonalismus“ (Wien 2008) und „EU-Osterweiterung. Historische Basis - ökonomische Triebkräfte - soziale Folgen“ (Wien 2007).
Inhalt
Vorwort
DIE ZERSTÖRUNG JUGOSLAWIENS(1991-1999)
Rückblende: Die ökonomische Krise
Von der Schuldenfalle zum Banknotendrucken
„Mr. Baker, Mr. Baker …“
Sloweniens Kampf um Eigenstaatlichkeit
Der Zoll- und Grenzkrieg
Das Mißverständnis von der nationalen Selbstbestimmung
Der deutsch-österreichische Sündenfall
Die siebte Republik
Kroatischer Nationalismus
Kroatiens Krieg
Die jugoslawische Offensive
Die Opferung Vukovars
Die endgültige Rache der Kroaten: „Blitz“ und „Sturmgewitter“
Im Herzen Europas: Krieg um Bosnien
Der nationale Moslem
Moslem? Serbe? Kroate?
Vom Referendum zur doppelten Belagerung Sarajevos
Edin läuft in den Tod
Konferenzen, Konferenzen, Konferenzen
Kriegsalltag
Massaker in Sarajevo – Embargo gegen Belgrad
Eine Werbefirma für Izetbegović
Zwei Massaker auf dem Marktplatz – und die Folgen
Bihać, Srebrenica, Goražde
Bosnien wird US-amerikanisch: Dayton
Die serbischen Kriege
Serbischer Nationalismus statt jugoslawischer Sozialismus
Serbiens Parteienlandschaft vor dem Krieg
Vojislav Šešelj
Jovan Marjanović
Djindjić-Sprecher Miroljub Labuš
SPS-Mann Miroslav Marković
Plan Avramović
Die Albaner im Kosovo
Die Vorgeschichte des NATO-Bombenkrieges
Das Massaker von Račak
Von Rambouillet bis Avenue Kléber
Wer ist die UÇK?
Clinton führte keinen Krieg
Vertreibungen stoppen!
Der NATO-Bombenkrieg
Kosovarisches Elend im Schatten des Bombenkrieges
Die ökologische Dimension des Krieges
Das NATO-Waffenarsenal
Die Heimatfront
Serbische Solidarität
Die Strategie Belgrads: Isolation durchbrechen
Die Strategie der NATO: Bomben bis zur Kapitulation
Geopolitik ist US-amerikanisch
Protektorat Kosova: ein vielfach geteiltes Land
DIE KOLONISIERUNG DES BALKANS(AB 1999)
Unter dem Schutz der NATO: Aus Kosovo wird Kosova
Serbenfreies Kosova
Kosovska Mitrovica, die verbliebene serbische Exklave
Kosovas Wirtschaft: Mädchenhandel, Raub und „Internationale Gemeinschaft“
Kosova wird Kolonie
Kosova: Aufmarschgebiet für Großalbanien?
Großalbanien oder Großkosova?
Die makedonische Frage
Der Krieg kommt nach Makedonien
Die OSZE gießt Öl ins nationale Feuer
Ahnungsloser Westen führt Regie
Montenegro: Weiße Berge und blaues Meer
Die Deutsche Mark an der Adria
Serbien: Vom Schurkenstaat zum Musterknaben
Exkurs: NATO-Verluste im Jugoslawien-Krieg
Golfkriegssyndrom in Bosnien und im Kosovo
Donau, so blau
EU-Sanktionspolitik gegen Belgrad nach dem Krieg
Der Umsturz
Otpor – Widerstand
Die Präsidentschaftswahlen 2000
Die Bulldozerrevolution
Djindjić am Ziel: Die serbischen Parlamentswahlen
Winterhilfe für Serbien
Die neue Zeit bricht an: Preisliberalisierung
Im Würgegriff des IWF
Wendephilosophie: Markt öffnen, Schulden verschieben, Hilfe erhalten
Vom „System Milošević“ zur EU-Privatisierung
Willige Verwalter Brüssels
Die staatliche Fiktion: Bosnien-Herzegowina
Der Westen läßt wählen
Die Interventionen des „Hohen Repräsentanten“
Restitutionsgesetz schafft neues Unrecht
Kroatien: Versuch eines Paradigmenwechsels – liberal statt national
Der Fall Norac
Kollektive Identität und individuelle Schuld
Von Tudjmans Tod bis zur kroatischen Identitätskrise
Kroatiens wirtschaftliche Lage
Kredit für Kündigungen
Kaufen statt investieren
Kapital fließt aus dem Land
Sozialdemokratisches „Laissez faire“
Kriegsnachwehen
Slowenien: Weg vom Balkan
NATO, EU, IWF: Fortsetzung des Krieges mit politischen Mitteln
Vom Recht zum Wert
Vom Bürger zum Weltbürger
Die NATO siegt, die EU gewinnt
Gefälschte Kriegsgründe
Opferstatistiken
Der Hufeisenplan
Die Jagd nach Slobodan Milošević: Großmachtpolitik im 21. Jahrhundert
ICTY: Das Den Haager Tribunal
Von der Verhaftung zur Auslieferung
Ein „Stabilitätspakt“ zur Kolonisierung des Balkans
Literatur
Karte: Jugoslawien 1945-1991
Vorwort
Zehn Jahre Bürgerkrieg und Krieg in Jugoslawien haben nicht nur den Balkan, sondern ganz Europa verändert. Der 24. März 1999 markierte das Ende der europäischen Nachkriegszeit. Mit dem Einsetzen der Bombardements gegen serbische, montenegrinische und kosovo-albanische Städte durch die NATO eskalierte die Zerstörung des ehedem multinationalen und blockfreien Jugoslawien zur offenen militärischen Intervention der Großmächte. Ein Blick von außen, weltsystemisch und historisch fundiert, soll dabei helfen, die Nebel von Propaganda zu lüften, die eine totale Verunsicherung auch in der kritischen Öffentlichkeit bewirkt haben. Nur so können die Konturen der Interessenlagen deutscher und US-amerikanischer Kriegstreiber nachgezeichnet und die ideologische Substanz der scheinbaren Rechtfertigung, Bomben im Dienste von Menschenrechten zu werfen, bloßgelegt werden.
Soviel zum unmittelbaren Anlaß, der mich 1999 motiviert hat, ein Buch über die Hintergründe der Zerstörung Jugoslawiens herauszugeben. Dieser schnell vergriffene Band, zu dem Karl Kaser, Wolfgang Geier, Gero Fischer, Andre Gunder Frank und Michel Chossudovsky eingeladen waren, historische, religions- und kulturgeschichtliche, geopolitische und ökonomische Zusammenhänge darzustellen, schloß mit dem Einmarsch der NATO in den Kosovo. Die Konfrontationen auf dem Balkan waren damit freilich noch nicht beendet, ebensowenig die Einmischung westlicher Mächte. Der Ablauf der innenpolitischen Wende in Serbien stellt dafür ein sichtbares Zeugnis aus. In Makedonien und Montenegro wiederum instrumentalisieren EU-Europa und US-Amerika in gewohnter Weise ethnisch-nationale Widersprüche, die in erster Linie aus unbewältigten sozialen und ökonomischen Problemen resultieren.
Nach dem Sturz von Slobodan Milošević sind sämtliche Republiken des ehemaligen Jugoslawien zum Tummelplatz ausländischer Militärs, Politiker und NGO-Vertreter geworden. Den geopolitischen Interessen der USA stehen die wirtschaftlichen Begierden der deutsch geführten EU gegenüber. Die brennende Lunte für kriegerische Auseinandersetzungen auf dem Balkan dürfte vor diesem Hintergrund auch in den kommenden Jahren nicht zum Erlöschen kommen.
Die fortgesetzte ökonomische Peripherisierung Südosteuropas sowie die nicht enden wollende territoriale und politische Destabilisierung in der gesamten Region waren Gründe genug, die Geschichte des Balkankrieges auch nach den NATO-Bombardements 1999 weiter zu verfolgen und aufzuarbeiten. Einen wichtigen Anstoß dafür gab auch die serbokroatische Übersetzung meines Textes im Verlag „Filip Višnjić“, der unter dem Titel „Balkanski rat“ erschienen ist.
Das vorliegende Buch enthält im ersten Teil eine leicht bearbeitete Fassung der Darstellung der Geschehnisse zwischen 1991 und 1999, der zweite Teil beschäftigt sich mit den Ereignissen zwischen Sommer 1999 und Sommer 2001, einer Zeitspanne, in der die westlichen Kolonisierungsprojekte für Südosteuropa deutlich hervortreten. Die Beschäftigung mit den Konsequenzen des Balkankrieges für die westeuropäischen Gesellschaften beschließt dieses Buch. Sein Zustandekommen wäre ohne die Hilfe einer Vielzahl von Freunden und Gesprächspartnern nicht möglich gewesen. Ihnen allen sei hier ein herzliches Dankeschön gesagt.
Hannes HofbauerWien, am 12. August 2001
Die Zerstörung Jugoslawiens(1991-1999)
Zurück nach Wien. Wir verlassen Belgrad am Nachmittag des 26. Juni 1991, jenem Tag, an dem Slowenien und Kroatien ihre staatliche Unabhängigkeit erklären wollten. Daß sie es bereits einen Tag zuvor getan hatten, stellte für niemanden mehr einen Überraschungseffekt dar. Während von Zagreb bis Split und vom Triglav bis Istrien neugeschneiderte Fahnen wehen und das große Mißverständnis von der nationalen Selbstbestimmung ausgiebig gefeiert wird, geht Belgrad emotionslos dem Ende eines schwülen Wochentages entgegen. Keine Demonstration in den Straßen, keine serbischen oder jugoslawischen Symbole an den Häuserfassaden, nicht einmal die Zahl der monarchistischen Wappen- und Anstecknadelverkäufer hat zugenommen. Laut ist an diesem 26. Juni nur der Autoverkehr, heiß der weich gewordene Asphalt.
Die Verrückten, so sieht man es in der jugoslawischen Hauptstadt, sitzen in Ljubljana und Zagreb. Die Sezession des Nordwestens und der Adriaküste empfinden die meisten hier als bedrohlich. Noch allerdings hoffen sie … auf die Vernunft ihrer Ex-Landsleute in Kroatien und Slowenien sowie auf die Politik der USA und der Europäischen Gemeinschaft. In Belgrad überwiegt an jenem 26. Juni 1991 die Besonnenheit.
Ganz anders Österreich und Deutschland. Die Parteinahme für die kroatischen Nationalisten und die slowenischen Christlich-Konservativen schwappt einem bereits aus der im Flugzeug verteilten Tagespresse entgegen. Von einer „nach Vorherrschaft strebenden Führung in Belgrad mit ihrer stalinistisch-ultranationalistischen Linie“ ist da die Schreibe, von einem „roten Serboslawien“ als drohende Alternative zum „demokratischen Westslawien“, womit en passant gleich eine neue, weil tagespolitisch opportune Ethnie erfunden wurde. Der Begriff Sezession ist medial verbannt, die Schwierigkeiten, die sich aus einem staatlichen Zerfallsprozeß ergeben, werden verdrängt. Es herrscht Euphorie für die Sache Sloweniens und Kroatiens, Mißgunst und Haß gegenüber Belgrad.
Der österreichische Serbenhaß speist sich aus einer gehörigen Portion Revanchismus; die „Schwarze Hand“ aus der Endzeit der Doppelmonarchie ist immer noch nicht vergessen. Gavrilo Princip, ein bosnischer Serbe und Mitglied dieser Guerillagruppe, die gegen die Besetzung Bosniens durch die Truppen der k.u.k. Armee sowie gegen die Wiener Slawenpolitik auftrat, streckte bekanntlich am 28. Juni 1914 den Thronfolger Franz Ferdinand samt Gattin in Sarajevo nieder. Der Tat folgte das große Völkerschlachten im Ersten Weltkrieg, mit österreichischem Jubel und deutschem Hurra. Deutschnationale und Sozialdemokraten begrüßten den Krieg gleichermaßen. Nur 20 Jahre nach dem Friedensschluß rückten erneut deutsche Soldaten auf dem Balkan ein, um – wie es später der UN-Generalsekretär und österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim ausdrückte, der selbst als Soldat gegen die jugoslawischen Partisanen kämpfte – „ihre Pflicht zu erfüllen“. Auch die zweite militärische Schmach Berlins in diesem Jahrhundert scheint manchen noch immer nicht getilgt.
Revanchegedanken für zwei verlorene Kriege konnte die deutsche und österreichische Berichterstattung im Sommer 1991 nicht verbergen – und wollte dies wahrscheinlich auch nicht. Von „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ bis „Die Welt“, von „Salzburger Nachrichten“ bis „Kurier“ gab es mehrseitigen, oft serienmäßig aufgemachten Nachhilfeunterricht in antijugoslawischer bzw. antiserbischer Geschichte. Wer die traditionellen Verbündeten, wer die ewigen Feinde Deutschlands und Österreichs waren, kam schnell und fast widerspruchslos unter die Leute. In dem Moment, als sich der Konflikt in Jugoslawien zuspitzte, positionierte sich die veröffentlichte Meinung in deutschen Landen deutlich wie nie zuvor: für die Auflösung Jugoslawiens. Ein Bürgerkrieg stand vor der Tür.
Rückblende: Die ökonomische Krise
Den Unabhängigkeitserklärungen der nordwestlichen Republiken ging eine tiefe ökonomische Krise voraus, die freilich gesamtjugoslawisch war und einem ähnlichen Muster folgte wie überall sonst in Osteuropa. „Schuld an der ganzen Misere sind die Kommunisten“, lautete das einfach gestrickte Argument der Jahre 1989/90, das die Misere erklären helfen sollte, in die Jugoslawien geraten war. Die Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs lagen tatsächlich schon lange zurück. Bis Mitte der 60er Jahre galt das Land als Vorbild an sozialistischer Effizienz, das Bruttonationalprodukt wuchs jährlich um 6 bis 7 Prozent. Mit Hilfe fetter US-Kredite, die Jugoslawien vom Einfluß Moskaus fernhalten sollten, wußte die Führung um Josip Broz, genannt Tito, lange Zeit sinnvolle Modernisierungsprojekte zu entwickeln. Die ersten Krisenerscheinungen machten sich Ende der 60er Jahre bemerkbar. Früher als alle anderen Länder in Osteuropa hatte man Westkredite erhalten, früher als alle anderen mußten sie zurückgezahlt werden. Bereits 1965 wurde im Zuge allgemeiner Dezentralisierung ein politischer „Polyzentrismus“ und die sogenannte „nationale Ökonomie“ auf Republiksebene eingeführt, neun Jahre später – 1974 – kam es zu einer neuen jugoslawischen Verfassung, die der Zentrale nur noch wenige koordinative ökonomische Funktionen beließ. Die Stärkung der Republiken und Regionen hatte zwei Seiten: Einerseits war sie die Antwort der Zentrale auf die ökonomische Krise, andererseits jedoch bereits Ausdruck einer national orientierten Politik in den ökonomisch stärkeren Republiken, denen damit die Möglichkeit gegeben wurde, die regionalen Erfolge aus der ungleichen Wirkung des Wachstums in den 60er Jahren mit niemandem sonst teilen zu müssen.
Die radikale Dezentralisierung erfaßte selbst das Militär. Edvard Kardelj, eine der grauen Eminenzen der jugoslawischen KP, Slowene und seit 1974 Mitglied des Staatspräsidiums, forderte offen die Regionalisierung der Armeestrukturen. In der Folge kam es auch zu einer Stärkung der republikseigenen Territorialverteidigungskräfte, die als Zivilorganisation neben der Volksarmee organisiert waren. Vor allem Frauen und ältere Männer bildeten das Rückgrat dieser kommunistischen Einrichtung. 15 Jahre später sollten die Territorialverteidigungen – gemeinsam mit abtrünnigen Volksarmisten – zum Kern der nationalen Militärapparate werden.
Regionale Autonomie auch im Politischen. Die neue 74er-Verfassung plante, ethnischen Minderheiten weitestgehende Rechte in kulturellen, sozialen und auch politischen Belangen einzuräumen. Allein, außer in Serbien kam es nirgendwo dazu. Besonders die kroatische Teilrepublik weigerte sich, der mehrheitlich von Serben bewohnten Region Lika spezielle Autonomierechte zu gewähren, wie sie in Serbien sowohl dem Kosovo als auch der Vojvodina zugestanden wurden. Der Streit um Autonomierechte bestimmte für lange Jahre die politische Szenerie in Jugoslawien.
Die Verantwortlichen glaubten vorerst, mit der Föderalisierung einen machtpolitischen Balanceakt zustande gebracht zu haben. In Wahrheit wurde damit ein entscheidender Schritt in Richtung Desintegration gesetzt. Besonders negative Auswirkungen hatte diese Entwicklung auf den Außenhandel, der ohne gemeinsames Konzept föderalisiert wurde. 1979 mündete diese Politik in eine wirtschaftliche Stagnation. Die Rückzahlung ausländischer Kredite geriet ins Stocken. Die weltwirtschaftliche Rezession der 70er Jahre hatte auch in Jugoslawien tiefe Spuren hinterlassen. Jene weltweit wirksame Krise, die im Kern den Überproduktionskapazitäten in Nordamerika und Nordwesteuropa nach erfolgtem Wiederaufbau zuzuschreiben war, stoppte nicht nur die nachholenden Modernisierungsprozesse in Lateinamerika, sondern beendete auch den Höhenflug der osteuropäischen Entwicklungsdiktaturen. Auch Jugoslawien mit seinem spezifischen Modell eines Selbstverwaltungssozialismus war vor den Auswirkungen der Krise nicht gefeit, umso weniger, als die Wirtschaft des Landes – mehr noch als die der meisten anderen osteuropäischen Länder – in den Fallstricken von Westkrediten gefangen war.
Post tragoediam rufen Wirtschaftsfachleute das Spezifische der jugoslawischen Ökonomie in Erinnerung. Anders als in den staatssozialistischen Ländern Osteuropas erfolgte die ökonomische Modernisierung Jugoslawiens nicht mit jener Brachialgewalt, die im Westen das Beiwort „stalinistisch“ erhalten hat. Im Selbstverwaltungssozialismus verblieb vergleichsweise viel Raum für regionale, betriebliche und individuelle Entscheidungen. Industrialisierung fand nicht flächendekkend statt, und eine kollektive, technologisch aufwendige Landwirtschaft bildete eher die Ausnahme. Dazu kam, daß mit dem „Export“ von Arbeitskräften nach Westeuropa gerade bäuerliche Familien zerrissen wurden. Die bodenständig Verbliebenen waren auf den Anteil ihres ins ferne Wien, München oder Düsseldorf entsandten Wanderarbeiters angewiesen. 900.000 solcher jugoslawischer „Gastarbeiter“, großteils aus der serbischen Republik stammend, werkten Mitte der 70er Jahre im westlichen Europa.
Vor dem Hintergrund einer weltweit sich verschärfenden Standortpolitik zur Erzielung komparativer Kostenvorteile im industriellen, landwirtschaftlichen und tertiären Sektor erwies sich die – wie Johann Gaisbacher sie nennt – halbagrarische und halbproletarische Struktur Jugoslawiens als einerseits besonders krisenanfällig, andererseits jedoch zäh im Umgang mit den sozialen Auswirkungen der Krise. Produkte, die im nationalen Kontext durchaus nützlich und absetzbar waren, waren unter den Bedingungen des Weltmarktes, auf dem sich Jugoslawien schon seit Mitte der 60er Jahre immer mehr bewähren mußte, zunehmend konkurrenzunfähig. Wenn in der kapitalistischen Logik die lokale Industrie nicht weltmarktfähig ist, so sind deren Betreiber, die Produzenten, gesellschaftlich gefährdet. Produktionsstätten werden unrentabel und in der Folge geschlossen. Entindustrialisierung erzeugt Unbrauchbarkeit. Die in der sozialistischen Modernisierungsphilosophie innerhalb einer Generation Proletarisierten sind plötzlich „überschüssig“. Überall in Osteuropa treten deshalb die neuen Liberalen – in ihrer Rolle als Verwalter westlicher ökonomischer Interessen – dafür ein, die unbrauchbar gewordenen Menschen, die Opfer des internationalen Konkurrenzkampfes, aus der staatlichen Fürsorge und Verantwortung zu entfernen. Die Rückkehr aufs Land mag für manche von ihnen eine zwischenzeitliche Überlebensstrategie sein, in den meisten Fällen wird jedoch durch die budgetären Sparmaßnahmen die im Kern soziale Frage zu einer polizeilichen bzw. sicherheitspolitischen oder gar einer nationalen, einer ethnischen Frage umgewandelt, die auf Dauer gerechnet viel teurer kommt als ein sozialer Lösungsversuch. Wer den Preis bezahlt, ist damit freilich noch nicht gesagt; doch genau darum dreht es sich bei all den seit 1989 über Ost- (und West-)Europa hereinbrechenden Reformvorhaben.
Das „gebirglerische“ jugoslawische Dorf legte indes jahrzehntelang eine beträchtliche Zähigkeit an den Tag. Mitte der 70er Jahre lebten immerhin noch 35 Prozent der Bevölkerung Jugoslawiens von der Landwirtschaft. Ein hoher Selbstversorgungsanteil war typisch. Agrarindustrialisierung im Sinn staatssozialistischer Ökonomien bzw. Durchkapitalisierung nach westlichem Muster fand in weiten Teilen des Landes, insbesondere in Bosnien und im Kosovo, nicht statt. Über 80 Prozent des Bodens waren privat, die erlaubte Höchstgrenze am Besitz von Grund und Boden lag bei 10 Hektar. Der Münchner Osteuropaexperte Jens Reuter ortete in Jugoslawien die niedrigste Wachstumsrate der Agrarproduktion im Nachkriegseuropa. Seiner 1987 geäußerten Meinung nach konnten damals 6,7 Millionen jugoslawische Haushalte ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr über den regulären Lohn decken. Überweisungen von Verwandten aus Westeuropa waren zum Überleben ebenso notwendig wie der Rückgriff auf teilsubsistente Lebensformen auf dem elterlichen oder großelterlichen Bauernhof, der auch von der Mehrheit der städtisch gewordenen Nachkriegsgeneration nicht aufgegeben wurde. Schwarzarbeit und Schmuggel ergänzten die Palette der familiären Ökonomie.
Anpassungen an die Erfordernisse des Weltmarktdiktates, das in Form der Kreditgeber Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF), deren Mitglied Jugoslawien von Anfang an war, auf Reduktion sozialer Leistungen und Abbau unrentabler Betriebe drängte, stießen auf heftigen Widerstand bei der Bevölkerung. Einerseits flüchteten die betroffenen Arbeiter und Rentner in die teilsubsistente Welt ihrer Vorfahren, andererseits kam es auch zu sozialen Kämpfen. So im Frühjahr 1987, als in vielen Teilen Jugoslawiens – insbesondere in Kroatien – gestreikt wurde. Die Protestierenden wandten sich gegen ein von der Regierung verordnetes Einfrieren der Löhne, das Ende 1986 zeitgleich mit massiven Preiserhöhungen für Fleisch, Zucker und andere Grundnahrungsmittel verordnet worden war. Im Juli 1987 wurde dann staatlicherseits verlautet, 7.000 defizitäre Betriebe müßten geschlossen werden, was 1,5 Millionen Menschen arbeitslos gemacht hätte. Betriebsversammlungen und Diskussionsveranstaltungen während der Arbeitszeit sowie „unerlaubtes Fernbleiben“ vom Arbeitsplatz nahmen zu. Die soziale Bombe tickte, zumal – einem Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom 27. März 1996 zufolge – der durchschnittliche Reallohn eines jugoslawischen Arbeiters in der ersten Hälfte der 80er Jahre um 40 Prozent zurückgegangen war.
In der zweiten Märzwoche 1991, also noch vor Ausbruch irgendwelcher territorialen Kämpfe, erschütterten „IWF-riots“ – ähnlich jenen, die man sonst aus Ländern der Dritten Welt kennt – die Belgrader Innenstadt. Eine von der Serbischen Erneuerungsbewegung (SOP) des Vuk Drašković initiierte Demonstration gegen die Medienpolitik von Slobodan Milošević’ Sozialistischer Partei (SPS) kippte in eine soziale Revolte deklassierter und arbeitsloser Jugendlicher. Mehrere zehntausend wütende Demonstranten eroberten die für die Demonstration ursprünglich gesperrte Belgrader Innenstadt, schleuderten Pflastersteine und Betonplatten gegen die Sicherheitskräfte, die ihrerseits von Tränengas und Gummiknüppel ausgiebig Gebrauch machten. Die Demonstranten lieferten sich zwei Tage lang Barrikadenkämpfe mit der serbischen Miliz. Nach offiziellen Angaben wurden ein Polizist und ein Demonstrant getötet sowie 80 Personen teilweise schwer verletzt. Am zweiten Tag fuhren Panzer der Jugoslawischen Volksarmee in den Straßen von Belgrad auf und beruhigten die Lage. Ein letzter, allerdings hilflos gewalttätiger sozialer Protest war damit unterdrückt worden, bevor die nationalen Argumente Straßen und Parlamente in allen Teilrepubliken in Beschlag nahmen.
Vor dem Hintergrund einer ernsthaften wirtschaftlichen Krise verschärften sich die regionalen Auseinandersetzungen um die knapper werdenden finanziellen Ressourcen. Der Kampf der Republiken begann.
Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen mögen diese politische Verschärfung erklären helfen. Der staatlichen Statistik entnehmen wir, daß im letzten Vorkriegsjahr die Einkommensunterschiede der fast 24 Millionen Jugoslawinnen und Jugoslawen enorm waren. Slowenien verfügte über ein achtmal so hohes Pro-Kopf-Einkommen wie der Kosovo. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 5.500 US-Dollar pro Kopf lag die kleine nördliche Republik 1990 vor den EG-Staaten Portugal (4.300 US-Dollar) und Griechenland (5.300 US-Dollar). Kroatien und die Vojvodina folgten mit den Kennziffern 3.400 bzw. 3.200, danach Serbien mit 2.200 US-Dollar, allerdings inklusive der Vojvodina und dem Kosovo gerechnet. Der Kosovo bildete mit mageren 730 US-Dollar BIP/Kopf das Schlußlicht. Die relative Position des Kosovo innerhalb Jugoslawiens hatte sich im Lauf der letzten vier Jahrzehnte zudem dramatisch verschlechtert. Zwischen 1950 und 1990 vergrößerte sich das Entwicklungsgefälle zu Slowenien um das Doppelte; allerdings gewährleistete das hohe Wachstum nach dem Krieg, daß es auch zum Ansteigen des Lebensniveaus in den ärmeren Republiken und Regionen kam.
Dramatisch auch die Rückgänge in der industriellen Produktion, die zu einem nicht unbeträchtlichen Teil der verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt zuzuschreiben waren. Zwischen 1990 und 1991 ging die Erzeugung von Industrieprodukten um ein Fünftel zurück. Das Realeinkommen sank um weitere 15 Prozent, womit es auf das Niveau der frühen 70er Jahre abgesackt war. Inflationsrate und Arbeitslosigkeit stiegen beträchtlich. Das für 1991 befürchtete und schließlich auch eingetretene Ausbleiben der Touristen aus dem nördlichen und westlichen Europa leerte die Staats- und Republikskassen zusätzlich. 30 Prozent aller Deviseneinnahmen – das hieß: fast 5 Mrd. US-Dollar – waren noch Mitte der 80er Jahre aus dem Geschäft mit den Sonnenhungrigen gemacht worden, wobei Kroatien davon mit 80 Prozent der Löwenanteil zufloß. Die Trennungstragödie ließ diesen Geldstrom versiegen.
In Serbien und Montenegro, wo die statistische Datenlage lange Zeit vergleichbare Zahlen lieferte, weisen Domaschke und Schliewenz in ihrem Buch „Spaltet der Balkan Europa?“ für das Jahr 1993 einen offiziellen Arbeitslosenanteil von 25 Prozent aus. Das waren 750.000 Menschen, die in Folge der wirtschaftlichen Krise ihren Job verloren hatten; weitere 500.000 befanden sich mit gekürzten Gehältern auf Zwangsurlaub, ganz zu schweigen von den damals bereits 700.000 Flüchtlingen, die aus Kroatien und Bosnien gekommen waren und keine Beschäftigung fanden. Jens Reuter nimmt für „Rest-Jugoslawien“ einen Anteil von 35 Prozent der Bevölkerung an, der 1993 unter der Armutsgrenze lebte. Die Lebenshaltungskosten stiegen zu diesem Zeitpunkt, als Jugoslawien bereits unter dem UN-Embargo litt, rasant. Ähnlich war die Lage in Makedonien, noch schlimmer – aufgrund des Krieges – in Kroatien und Bosnien.
Ein innerjugoslawischer Wirtschaftskrieg ging dem Schießkrieg voraus. Slowenien und Serbien boykottierten einander bereits seit 1989/90, gegenseitige Einfuhrverbote bestimmten die Wirtschaftspolitik; ehedem gemeinsam entwickelte Energiekonzepte, republiksübergreifende Zulieferungen im Industriebereich, ja letztlich sogar die Zolleinnahmen wurden zum Kampfmittel Nord gegen Süd, Süd gegen Nord, Republik gegen Republik. „Die verfeindeten Machthaber betrachteten die Wirtschaft von Anfang an als Mittel des gegeneinander geführten Kampfes, wobei die Schädigung des Gegners wichtiger schien als der eigene Nutzen“, schrieb der Ökonom M. Lazić (vgl. Domaschke/Schliewenz, S. 27).
In dieser seit 1990 zunehmend unlösbaren wirtschaftlichen Situation, in der die Republiken den Staatshaushalt mehr oder weniger offen torpedierten, versuchte Ministerpräsident Ante Marković mit Hilfe ausländischer Kreditgeber eine Stabilisierungsmaßnahme nach der anderen. Sein Credo hieß: Sanierung des Staatshaushaltes, Eindämmung der Hyperinflation, Konvertibilisierung des Dinars. Doch die Sanierungsversuche endeten im Debakel: Der staatliche Sparkurs ließ die von der Krise erschütterten heimischen Betriebe im Regen stehen. Die zugleich verordnete Marktöffnung gab Jugoslawien dem scharfen Wind des internationalen Wettbewerbs preis, der sich im Lauf des Jahres 1990 zum Orkan steigerte. Innerhalb von wenigen Monaten verordnete Marković eine radikale Importliberalisierung. Waren 1989/90 nur 15 Prozent aller Importe zoll- und bewilligungsfrei, so existierten Mitte 1991 so gut wie keine Beschränkungen mehr. Die totale Marktöffnung hatte verheerende Folgen für sämtliche jugoslawischen Produktionsbetriebe.
Dumping-Waren aus Südostasien und Westeuropa überschwemmten die Geschäfte. Holländische Blumen, deutsche Gurken und eine Reihe anderer landwirtschaftlicher Billigprodukte bedrohten die Substanz der jugoslawischen Landwirtschaft. Im Jahr 1990 wurden landwirtschaftliche Güter um 900 Mio. US-Dollar exportiert und um 1,8 Mrd. US-Dollar importiert. Und das in einem traditionellen Agrarexportland. Unter dieser bei der Belgrader Jugend als „Kiwi-Zeit“ bekannten brachialen Westöffnung kam es immer wieder zu Protestaktionen der Bauern. Einmal wurden von aufgebrachten Dörflern Landstraßen blockiert, ein anderes Mal leerten protestierende Bauern hektoliterweise Milch vor staatliche Ämter, um damit gegen die von IWF und Marković erzwungene Marktöffnung zu Felde zu ziehen. Marković hatte, unter dem Druck seines geistigen Mentors Jeffrey Sachs vom IWF, eine ganze Reihe von volkswirtschaftlichen Zerstörungen angerichtet: Zum Beispiel ließ er 1990 Billigmilch aus Ungarn importieren, eine weitere Provokation für die serbischen und bosnischen Bauern, die – ganz im Gegensatz zu Ungarn – kleinräumig wirtschafteten. Ähnlich hatte übrigens zur selben Zeit Polens Finanzminister Leszek Balzerowicz IWF-Forderungen exekutiert: In polnischen Regalen standen Anfang der 90er Jahre Milchprodukte aus Frankreich, woher sie – ironischerweise EU-preisgestützt – importiert wurden.
Die Belgrader Schaufenster waren Mitte 1991 voll mit West-Kaffee, Stereoanlagen aus Südkorea und Japan, Alkoholika aus Schottland usw. Slowenische, kroatische und serbische Produkte verschwanden demgegenüber aus den Regalen. Die Krise des Autoherstellers Zastava verdeutlichte das schier unauflösbare Strukturproblem, in das die jugoslawische Wirtschaft geraten war. Zastava produzierte an mehreren Standorten, Autoteile kamen aus Kroatien, Serbien und Slowenien. Der billigste und beliebteste Pkw zwischen Titograd/Podgorica und Ljubljana war ein gesamtjugoslawisches Produkt. Nun boykottierten einzelne Republiken die Auslieferung von Teilen, andere hoben dafür Exportzölle ein. Ausländische Kunden stornierten Pkw-Aufträge. Gleichzeitig kamen relativ billige südkoreanische und taiwanesische Autos ins Land. Daewoo-Taxis waren in Belgrad schon damals keine Seltenheit mehr. Während dem jugoslawischen Staat also das Devisengeschäft entging, wurde die Handelsbilanz immer negativer. Märkte schützen, hätte wohl in dieser Situation das oberste ökonomische Gebot geheißen. Ministerpräsident Ante Marković tat im Verein mit dem IWF das genaue Gegenteil. „Für den IWF gilt nur, daß das Budget saniert wird“, klagte damals der jugoslawische Ökonom und Akademiemitglied Kosta Mihajlović, „aber mit dieser Marktöffnung ist ja gerade das nicht zu gewährleisten.“ Dem Währungsfonds schob auch der serbische Außenhandelsminister und frühere IBM-Manager Slobodan Prohaska einen Gutteil der Schuld an der wirtschaftlichen und politischen Misere in die Schuhe: „Die radikale Öffnung der Märkte ist unsinnig, weil wir so ganz sicher nicht zu unserem Geld kommen, um die Schulden zurückzahlen zu können“, meinte er im Juni 1991 gegenüber dem Autor.
Der stetig steigende Druck des IWF, der zu einer raschen Verarmung der Bevölkerung beitrug, bewegte die Regierung der serbischen Republik mit ihrem Präsidenten Slobodan Milošević dazu, an Mindesterrungenschaften sozialistischer Existenzgarantien festzuhalten, wie sie in den Jahrzehnten nach 1945 aufgebaut worden waren. Den mit politischen Parolen gewürzten Widerstand in den Straßen von Belgrad im März 1991 schlug die Regierung noch gemeinsam mit der Bundesarmee nieder. Die ins nationale Aufbegehren gewendeten sozialen Proteste konnte oder wollte Milošević nicht unterdrücken; sie boten ihm das gesellschaftliche Potential für seine politische Machterhaltung. Deshalb wurde er in der Folge zum Feindbild Washingtons, welches vorerst in der Inkarnation von Weltbank und Währungsfonds, später in Form von NATO-Kampfflugzeugen auftauchte und Jugoslawien in seiner Staatlichkeit und Territorialität vernichtete. Bereits Ende 1990 begann die serbische SPS, die von den Bundesorganen unter Ante Marković vorangetriebenen ultraliberalen Wirtschaftsreformen zu boykottieren.
Von der Schuldenfalle zum Banknotendrucken
„Waren, Kapital und Arbeit müssen sich überall in Europa frei bewegen können … Gesetze, welche die Rolle des Marktes unterdrücken, bedürfen einer Deregulierung“, meinte der neue Ministerpräsident Ante Marković anläßlich seiner Antrittsrede Anfang 1989. Wie radikal die vom IWF geforderte Kapitalisierung einer bis dahin im wesentlichen vergesellschafteten bzw. in Teilen subsistenten Gesellschaft gedacht war, zeigte sich bereits in den ersten Maßnahmen der von Jeffrey Sachs ausgearbeiteten Programme. Im Lauf des Jahres 1989 ließ die gesamtjugoslawische Regierung eine Hyperinflation in der Höhe von 1.000 Prozent ins Land ziehen, was die jahrelang angesparten Dinar-Sparguthaben der Bevölkerung mit einem Schlag entwertete. Die Hyperinflation diente zur Abschöpfung jener Geldmengen, die im neuen, konvertibel ausgerichteten System auch in ihrer Nachfragefunktion nicht mehr gebraucht würden. Man konnte selbiges nach 1989 in fast allen „Reformstaaten“ beobachten. Nicht dollarisierbare Geldmengen waren für den Weltmarkt insofern gefährlich, als Investitionen oder Importe in ein Land ohne entsprechende Dollar- bzw. DM-Konvertibilität keinen kapitalistischen Sinn ergaben. Deshalb mußten die angesparten Werte der Bevölkerungsmehrheit enteignet werden. Gegen ein solches Schockprogramm wandte sich die serbische Führung mehrmals, um – wie es in den entsprechenden Depeschen an die Bundesbehörden hieß – „die Verarmung der Massen zu stoppen“. Vergebens.
Das erste Halbjahr 1990 war dann von einem rigorosen Stabilisierungsprogramm geprägt, das Löhne wie auch Preise amtlich einfror und den Dinar in ein festes Verhältnis zur DM zwang. Dieser „Konvertibilitätspakt“ wies alle Eckpfeiler einer veritablen Schocktherapie auf: restriktive Geldpolitik mit Budgetsanierung, Abbau von Subventionen und Sozialleistungen, Öffnung der Märkte für ausländische Anleger sowie einen Plan zur Kapitalisierung vergesellschaftet gewesener Betriebe. Dafür sollte es einen weiteren Beistands-Kredit der Weltbank geben, nachdem sich IWF und „Pariser Club“ der staatlichen Gläubigerbanken noch im August 1989 geweigert hatten, über Umschuldungen zu verhandeln. Die Umsetzung des Austeritätsprogramms war eine Voraussetzung für den Erhalt einer weiteren Kredittranche; die „Zerschlagung des gesellschaftlichen Sektors und der sozialistischen Selbstverwaltung“ mußte, laut IWF-Diktion, parallel dazu vonstatten gehen.
Jugoslawien war bereits lange in den Fallstricken der internationalen Kreditgeberorganisationen gefangen. Anfang 1991 betrug der Schuldenberg gegenüber ausländischen Banken 16 Mrd. US-Dollar. In den 80er Jahren mußten damals noch kommunistische Politiker – ähnlich dem Modell Ceauşescu in Rumänien – tiefgehende soziale Einschnitte tätigen, um den Schuldendienst, also Zinszahlungen und andere Obligationen, vornehmlich an US-Banken zurückzahlen zu können. Die stattliche Summe von 30 Mrd. US-Dollar floß zwischen 1981 und 1991 unter dem Titel „Schuldendienst“ aus dem Land. Kapital ging (und geht) von Ost nach West.
In den ersten Tagen des Jahres 1991 setzte die serbische Regierung unter Milošević dem Marković-Sachs-Plan ein Ende. Schon seit geraumer Zeit war der gemeinsame Staatshaushalt von Slowenien und Kroatien boykottiert worden. Slowenien weigerte sich, die Zolleinnahmen aus den Grenzstellen abzuliefern; es verfügte mit dem geographischen Monopol, alle nach Westeuropa führenden Straßen und Bahnübergänge auf seinem Territorium zu wissen, diesbezüglich über ein gewichtiges Druckmittel. Und Kroatien hob zu jener Zeit von bosnischen und serbischen Abnehmern interne Abgaben auf Erdöllieferungen ein. Über den größten jugoslawischen Hafen Rijeka führte die Pipeline ins Land; der Aufschlag für den Weitertransport zu den Binnenrepubliken stellte in Wahrheit einen Exportzoll dar, der, wie die Slowenisierung der Zollpolitik, jegliche gesamtstaatliche Konzeption unterlief. Bereits 1983 hatte Ljubljana offiziell alle seine Zahlungen an den „Fonds für unentwickelte Gebiete Jugoslawiens“ eingestellt. Mit Hinweis auf die hohen Kosten, die Regionen wie der Kosovo verursachen würden, hatte sich Slowenien aus der jugoslawischen Regionalpolitik zurückgezogen.
Beträchtliche Mitverantwortung für die ökonomische Desintegration der letzten gemeinsamen jugoslawischen Jahre lag auch bei der serbischen Regierung. Ab Anfang 1990 belastete Belgrad slowenische Waren mit einem Importzoll und betrachtete damit – nach dem Auszug der slowenischen Vertreter aus dem Bund der Kommunisten am 14. Januar 1990 – die nördlichste Teilrepublik ökonomisch als Ausland. Um den Besitz erfolgreicher Exportfirmen wie den Küchengerätehersteller Gorenje spielten sich dramatische Szenen ab. Belgrad scheute nicht davor zurück, zum Mittel der Enteignung zu greifen. Als zur Jahreswende 1989/90 der Sanierungsplan des Ante Marković beschlossen wurde, dessen Schlagworte Liberalisierung, Deregulierung und Konvertibilisierung des Dinar lauteten, führten die monetaristischen Reformen mit ihrer Verknappung der Geldmenge kurzfristig tatsächlich zu einer Konvertibilität der Landeswährung. Der Dinar sollte für ein halbes Jahr im fixen Verhältnis von 7:1 zur DM stehen. Das spontane Vertrauen selbstverwalteter Betriebe, aber auch privater Personen in diese vermeintliche Stabilität brachte viel Geld in die Banken. Vladimir Gligorov, der Balkan-Spezialist des Wiener Institutes für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), schätzt die damals „von der Straße geholten“ Reserven auf 11 Mrd. Dollar, die plötzlich verfügbar waren. Die dezentrale Struktur des Landes erlaubte es den seit Frühjahr 1990 an der Macht befindlichen nationalen Regierungen, allen voran Tudjmans HDZ, per Zugriff auf die kroatische und slowenische Nationalbank die frisch angehäuften Reserven zu requirieren. Serbien kam in diesem Rennen um Dinar und Dollar zu kurz.
Vor diesem Hintergrund eines voll entbrannten Wirtschaftskrieges zwischen den Republiken holte Serbien zum großen Schlag aus. Unmittelbar nach dem orthodoxen Weihnachtsfest bemächtigte sich Milošević der Notenbank der Bundesrepublik und ließ für umgerechnet 1,8 Mrd. US-Dollar Dinar drucken. Damit wurden in den folgenden Tagen ausständige Löhne von Staats- und Gemeindebediensteten – Soldaten, Lehrern, Ärzten, Krankenschwestern – ausbezahlt. Dem IWF-Sanierungsplan, der ja gerade auf der Geldverknappungspolitik und den Lohnkürzungen beruhte, war damit der Todesstoß versetzt. „Bankraub“ und „Falschgeld-Skandal“ riefen slowenische und kroatische Politiker. Westliche Finanzblätter titelten mit empörten Losungen: „Entmachtung der Nationalbank“ und „Serbiens Selbstbedienungssozialismus“ hieß es beispielsweise in der „Neuen Zürcher Zeitung“, die den Zugriff der serbischen Autoritäten auf die Notenbank scharf kritisierte. Daß ein solcher technisch überhaupt möglich war, lag an der Struktur der seit ihrer Gründung nicht unabhängig funktionierenden Notenbank. Große Unternehmen und Republiken fühlten sich de facto als Eigentümer der Banken, auch der Notenbank. Sie waren es noch aus sozialistischen Zeiten gewohnt, eintretende Verluste früher oder später von Bankseite her abgedeckt zu bekommen. Insofern hatte die Praxis, die Notenpresse einzuschalten, Tradition. Der versuchte „Konvertibilitätspakt“ des IWF war mit einer solchen Praxis freilich nicht kompatibel.
Die inflationsanheizende Maßnahme von Slobodan Milošević, in Krisenzeiten auf die Druckerpresse der Notenbank zurückzugreifen, noch dazu ohne jede Rücksprache mit IWF-Washington, stempelte ihn zum Feind der freien Marktwirtschaft. Damals, im Januar 1991, mag im Westen jener Meinungsumschwung vorbereitet worden sein, der letztlich zur Isolierung Serbiens und zur Zerstörung Jugoslawiens geführt hat. Jeffrey Sachs jedenfalls übersiedelte von Belgrad nach Laibach, offensichtlich, weil sein Zwangssanierungsprojekt in ganz Jugoslawien nicht mehr durchsetzbar schien und er von nun an auf die nördlichen Teilrepubliken setzte. 1992 wurde die Mitgliedschaft Jugoslawiens bei IWF und Weltbank – bis Mai 2001 – „eingefroren“, weil man sich zwischen den Republiken nicht über die Verteilung der Schulden und des Eigentums einigen konnte. Dies hinderte allerdings Washington nicht daran, Kroatien und Slowenien in die internationalen Finanzklubs aufzunehmen.
„Mr. Baker, Mr. Baker …“
Freitag, 21. Juni 1991, 15 Uhr. Im Belgrader Palast der Föderation tummeln sich zirka 50 Fotografen und Kamerateams. Der Mann vom Security Check prüft alle technischen Geräte, bevor er die Journalisten einläßt. Für die Anerkennung meines Fotoapparates als Fotoapparat muß ich im Extrazimmer Blitzlicht und Auslöser betätigen. Das wohltönende „Klick“ macht den Sicherheitsbeamten zufrieden, er wendet sich dem ORF-Kamerateam zu.
Einige Minuten vor 15 Uhr 30 öffnet sich der slowenische Saal, nach kurzer Belehrung in serbokroatischer Sprache stürmen die 50 Bildreporter über die Türschwelle in das holzgetäfelte Zimmer. Auf zwei Fauteuils sitzen der slowenische Präsident Milan Kučan und US-Außenminister James Baker, Wachsfiguren gleich. Kučan versucht sich ein lockeres Lächeln abzuringen, Baker verzieht keinen Mundwinkel. Die schnellsten Kamerateams stehen unmittelbar hinter einer achtlos gezogenen Kordel, die den Abstand Objekt/Fotograf markiert. Jeder Schritt darüber hinaus wird von US-Bodyguards mit rüdem Zurückstoßen beantwortet. Nach zwei Minuten ist der Spuk vorbei. Zirka zehn Sicherheitsbeamte treiben die Journalisten wie eine Herde aus dem Saal, der nun zum Besprechungszimmer der Weltpolitik wird. Nach 35 Minuten wiederholt sich das Ritual. Diesmal sitzt der serbische Präsident Slobodan Milošević neben Baker, Ort des Geschehens ist nun der serbische Saal des Palastes der Föderation. Nach Milošević folgt Tudjman. Bei der abschließenden Pressekonferenz habe ich den Dreh heraußen: erste Reihe, ständig von hinten Richtung Kordelabsperrung gedrängt. Diesmal ist es allerdings umgekehrt. Nicht Baker sitzt bereits, bevor die Meute den Saal stürmt, sondern die Meute steht und rückt, bevor Baker eintritt. 40 Minuten läßt er auf sich warten. Ich bewundere die lebensgroße Tito-Statue, die schon Jahre in derselben Position verharrt. Mir tun bereits nach einer halben Stunde die Füße weh. 21 Uhr. Der jugoslawische Außenminister Budimir Lonćar, Baker und eine zwanzigköpfige Expertenschar betreten – von Sicherheitspersonal eingekreist – den Raum. Kurze Ansprachen am Rednerpult. „Wir wollen nicht, daß sich die Geschichte für Jugoslawien wiederholt“, spielt Baker auf die zwei Weltkriege an, an deren Ende die Geburtsstunde eines jeweils neuen Jugoslawien stand. „Wenn sich Slowenien in einigen Tagen unabhängig erklärt, werden wir diese Erklärung nicht anerkennen.“ „Mr. Baker, Mr. Baker“, fallen ihm gegen Ende seines Statements zirka zehn bis zwölf JournalistInnen gleichzeitig ins Wort. Gnädig deutet er auf eine jugoslawische Kollegin. Ihre Frage ist längst beantwortet. Ob Baker optimistisch sei in bezug auf die Jugoslawien-Krise, will eine französische Journalistin vom Weltaußenminister erfahren. Der weicht aus. Drei Minuten später sitzen die Kollegen hinter ihren Laptops oder Lenkrädern, unterwegs für die Spätnachrichten. Bizarre journalistische Innenwelt.
Draußen, in der zweiten Wirklichkeit, beginnt fünf Tage später der Kampf der Völker. Im Vielvölkerstaat Jugoslawien ein grausamer Kampf. Titos Föderalismus ist mausetot.
Sloweniens Kampf um Eigenstaatlichkeit
Am 25. Juni 1991 spätabends beschlossen Zagreb/Agram und – ganze kurze Zeit danach – Ljubljana/Laibach mit indirekter Rückendeckung Deutschlands und Österreichs einseitig die Unabhängigkeit ihrer Teilrepubliken. Der jugoslawische Ministerpräsident Marković, wirtschaftspolitischer Gegenspieler des serbischen Führers Milošević, nahm diese Erklärung nicht zur Kenntnis und befahl der Volksarmee die Sicherung der Staatsgrenzen. Von slowenischen Bürgerwehren besetzt gehaltene Zollstationen wurden daraufhin von der Volksarmee angegriffen. Nach wenigen Tagen Zoll- und Grenzkrieg, in dem die slowenischen Paramilitärs über 1.000 jugoslawische Soldaten gefangennahmen, zog sich die Armee in die Kasernen zurück. Jugoslawien war kein Staatsganzes mehr.
Die Medien der westlichen Welt, insbesondere jene in Deutschland und Österreich, verurteilten das Vorgehen der Bundesregierung. Ironischerweise hatten in jenen Tagen mit Ministerpräsident Marković und Außenminister Lonćar zwei kroatischstämmige Politiker die entscheidenden jugoslawischen Positionen inne.
Der spätere Serbenhaß äußerte sich im Sommer 1991 in deutschen Landen noch als Haß auf Gesamtjugoslawien. Die Unterstützung der Sezessionisten speiste sich ökonomisch aus dem Wunsch nach einer praktizierbaren Erweiterung des deutschen Einflußbereichs (sowie insgeheim einer erhofften touristischen Germanisierung Istriens nach dem Vorbild Mallorcas), religiös aus der uralten weströmischen Verbundenheit mit Kroaten und Slowenen sowie aus der zivilgesellschaftlichen Sprachgebärde, den ethnisch-national motivierten Widerstand gegen die zentrale Staatsgewalt als Selbstbestimmung zu interpretieren. Gerade letzteres bewirkte in der Folge einen verheerenden, kriegstreiberischen Effekt, der auch heute – nach zehn Jahren Krieg und Zerstörung – in den westeuropäischen Gesellschaften noch nicht als solcher erkannt worden ist.
Bereits Mitte der 80er Jahre traten slowenische Nationalisten auf den Plan, die – etwa zeitgleich mit dem berühmten Memorandum der serbischen Akademie der Wissenschaften – auf nationale Unabhängigkeit drängten. Im Oktober 1984 beschloß die geeinte politische Führung in Ljubljana Schritte gegen die jugoslawische Volksarmee. Verteidigungsminister Veljko Kadijević schreibt darüber in seinem 1993 auf serbokroatisch erschienenen Buch „Meine Vision vom Zerfall“. Demnach wurde schon damals slowenischerseits ein Plan ausgearbeitet, wie der letzte starke Überrest einer gesamtjugoslawischen Identität – die Volksarmee – föderalisiert werden sollte. Die entscheidende Rolle bei der angestrebten Zerschlagung der bewaffneten Zentralmacht kam der slowenischen Parteijugend zu; ein geschickter Schachzug, konnten doch die alten, zu Nationalen konvertierten KP-Kader damit rechnen, daß Jugendliche schon aus sehr persönlichen Interessen gegen das Heer Sturm laufen würden. Und so kam es auch. 1988 forderte man dann in Laibach offen den Rückzug der Armeekommandantur sowie die Gründung einer eigenen Truppe auf Republiksebene.
Rund um die Jugendzeitschrift „Mladina“ hatte sich bereits eine Gruppe von Nationalisten gebildet, die ihren Hauptfeind in der jugoslawischen Volksarmee ausmachte. Ihre Leitfigur war der spätere slowenische Verteidigungsminister Janez Janša. Im Mai 1988 veröffentlichte „Mladina“ unbestätigte Gerüchte, denen zufolge ein Einsatz der Volksarmee gegen die slowenische Teilrepublik unmittelbar bevorstand. Ein Unteroffizier stellte entsprechende Materialien bei, die nie geprüft worden waren. Nachdem Unteroffiziere in aller Regel keinen Überblick über große strategische Planungen besitzen, muß man davon ausgehen, daß Janša und seine Freunde mit der Veröffentlichung dieser Anschuldigungen eher eine Provokation Belgrads im Sinn hatten. Schon zuvor war Jugoslawien in der Zeitschrift „Nova revija“ brüskiert worden. 1987 erschien eine Sondernummer zur Frage der slowenischen Eigenstaatlichkeit. Proteste aus Belgrad blieben unbeantwortet. Statt dessen wurden die slowenischen Attacken gegen die Zentrale immer heftiger.
Die Person Janez Janša spielte bei der Lostrennung Sloweniens vom Staatsganzen eine undurchsichtige und bis heute nicht geklärte Rolle. Als Chefredakteur der Jugendzeitschrift „Mladina“ kämpfte er, ganz im Stil eines westeuropäischen Alternativbewegten, für die Einführung des Zivildienstes; drei Jahre später, mittlerweile zum slowenischen Verteidigungsminister befördert, zeichnete er für den Schießbefehl gegen die – unbewaffnete – Volksarmee verantwortlich; und kurze Zeit darauf verschwand er, von Korruptionsvorwürfen begleitet, von der politischen Bildfläche.
Parallel zur Radikalisierung im Inneren Sloweniens vollzog sich der Bruch der slowenischen KP mit den Kommunisten der anderen Republiken. Im September 1989 beschloß das Laibacher Parlament eine Verfassungsänderung, die die Möglichkeit eines einseitigen Austritts Sloweniens aus dem Staatsganzen vorsah. Damit war eine jugoslawische Verfassungskrise heraufbeschworen. Eine einseitige Abspaltung einzelner Teilrepubliken war in der föderativen Verfassung Jugoslawiens nicht vorgesehen. Im Januar 1990 zog die slowenische Delegation aus dem 14. Parteitag des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens aus, nachdem ihr Antrag, das Land in einen losen Bund selbständiger Republiken umzuwandeln, gescheitert war. Kurz darauf, im April 1990, wurden die Kommunisten in Laibach von der Macht abgewählt; eine christlich-konservative, national orientierte Parteienkoalition unter dem Namen „Demos“ (Demokratische Opposition) stellte mit Lojze Peterle den ersten postkommunistischen Ministerpräsidenten Sloweniens. Als Präsident blieb dem kleinen Land Milan Kučan, ein in der Wolle der Partei gefärbter, nun allerdings vom multinationalen zum nationalen gewandelter Politiker erhalten.
Die Sezession erfolgte Schlag auf Schlag. Am 23. Dezember 1990 rief die neue Regierung nach völkischer Zustimmung: 88 Prozent der Sloweninnen und Slowenen sprachen sich in einer Volksabstimmung für die Lostrennung von Belgrad aus, für einen Kleinstaat, der zwar ohne historischen Vorgänger auskommen mußte, aber dafür mit einer unklaren Zukunftsvision ausgestattet war: „Heim nach Europa“, was immer damit gemeint war.
Zwischenzeitlich hatten die Laibacher Behörden auch im praktischen Umgang mit der postkommunistischen Demokratie Belgrad die Zähne gezeigt: Im Dezember 1989 verbot die örtliche Polizei kurzerhand eine von Serben angemeldete Demonstration in der nördlichsten Teilrepublik. „Aufklärung über die serbische Politik im Kosovo“ wollten die Demonstranten laut Anmeldungstext betreiben; ähnliche Manifestationen fanden überall im Land statt, dem serbischen Nationalgefühl wurde dabei breiter Raum gegeben und Slobodan Milošević als Vater der serbischen Erneuerung gefeiert. In Slowenien wollten die politisch Verantwortlichen von „serbischen Berufsdemonstranten“, wie sie die zu erwartenden Manifestanten verächtlich nannten, nichts wissen; ganz nach dem Motto: Wenn schon Nationalismus, dann der unsere.
Am Abend des 25. Juni 1991 war es dann soweit. Das slowenische Parlament beschloß die Unabhängigkeitserklärung – gegen den Willen der jugoslawischen Zentrale, gegen den ausdrücklichen Wunsch der USA und gegen die Empfehlung der Europäischen Gemeinschaft.
Der Zoll- und Grenzkrieg
Am Morgen des 26. Juni 1991 wechselten Mitglieder der slowenischen Territorialverteidigung die Schilder an den Grenzübergängen zu Österreich, Ungarn und Italien aus und besetzten die Grenzstationen. Anstelle von „Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien“ wurden nun Emailtafeln mit der Aufschrift „Republik Slowenien“ montiert. Nur einen Tag später, um vier Uhr früh, rückten jugoslawische Einheiten aus ihren Kasernen aus, um die Hoheit über die Zollstationen wieder zu erlangen. Dramatische Stunden hielten die Welt in Atem.
Am österreichisch-slowenischen Grenzübergang in Radkersburg/Gornja Radgona sah die jugoslawische Tragödie ihre ersten Menschenopfer. Der ORF war live dabei, als eine Gruppe von sechs oder sieben Volksarmisten, mit erhobenen Armen und weißer Fahne, um die Ecke des von slowenischer Territorialverteidigung in Beschlag genommenen Zollhauses bog. Teilweise mit nacktem Oberkörper und gänzlich unbewaffnet, hatten sie sich offensichtlich bereits ergeben, als eine Maschinengewehrsalve in die Gruppe fuhr. Zwei jugoslawische Soldaten fielen vornüber ins Gras. Der TV-Sprecher kommentierte knapp und sarkastisch, daß dieses Friedensangebot wohl gescheitert sei. In den Spätnachrichten wurde die Sequenz gekürzt wiederholt. Während allerdings im Live-Krieg am Nachmittag eindeutig zu sehen war, daß hier slowenische Territorialstreitkräfte wehrlose Soldaten der Volksarmee, die die Hände erhoben hatten, be- und erschossen, blieben am Abend Täter wie Opfer medial anonym, unbenannt.
„Die Soldaten der Bundesarmee hatten weder einen Schießbefehl noch die zum Schießen erforderliche Munition“, stellte der Balkanexperte und Einsager der deutschen Bundesregierung, Jens Reuter, in seinem Bericht an das Bonner Parlament klar. Niemand in der jugoslawischen Generalität hatte daran gedacht, daß sich die Einnahme der Grenzstationen – und um die ging es am 27. Juni 1991 – zu einer kriegerischen Auseinandersetzung entwickeln würde. Deshalb waren 2.000 Soldaten von der in Slowenien stationierten Jugoslawischen Volksarmee ohne Munition zu den Grenzübergängen kommandiert worden, um die Slowenen zur Übergabe der Zollstellen zu bewegen. Sämtliche Bewegungen der jugoslawischen Armee waren dem slowenischen Verteidigungsministerium bekannt, weil slowenische Offiziere die Aufmarschpläne weitergegeben hatten; was wiederum die jugoslawische Generalität wußte, ohne daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
Meldungen vom heldenhaften Sieg des „David“ Slowenien gegen den „Goliath“ Jugoslawien entbehren also jeder Grundlage. Daß sie bis heute nicht nur in Laibach lanciert werden, soll den Mythos von der nationalen Geburt Sloweniens nähren helfen. Tatsächlich hatte sich das von keinem Staat der Welt anerkannte Slowenien der jugoslawischen Grenzkontrollstellen auf dem Territorium seiner Republik bemächtigt. Offensichtlich auf Befehl Laibachs wurde scharfe Munition ausgegeben, insgesamt mehr als 50 unbewaffnete jugoslawische Soldaten wurden getötet, Kasernen der Volksarmee von der Außenwelt abgeriegelt, ein Versorgungshubschrauber abgeschossen und die Grenzstellen besetzt gehalten. Als daraufhin General Veljko Kadijević MiG-Bomber gegen die Grenzstationen und den Laibacher Flughafen einsetzte, trat sofort der slowenische Präsident Milan Kučan auf den Plan und handelte einen Waffenstillstand aus. Innerhalb von sieben Tagen war der kriegerische Spuk zu Ende. 60 Tote, 150 Verletzte und 1.700 gefangene jugoslawische Soldaten, so lautete die traurige Bilanz.
Sogar österreichische und deutsche Fernfahrer, die zufällig im ehemaligen Krain unterwegs waren, beteiligten sich an der Ausschaltung der jugoslawischen Volksarmee, ohne daß dies im Westen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hätte. Im Gegenteil – sie wurden vor laufender Kamera als Helden der Befreiung gefeiert. So etwa der aus Stainz stammende 40jährige Stefan Sp., der voll Stolz am Grenzübergang Spielfeld berichtete, von der slowenischen Miliz eine Maschinenpistole erhalten zu haben. „Sie gaben mir eine MP, und dann ging es richtig los“, ließ der Steirer verlauten. „Gemeinsam mit slowenischen Territorialstreitkräften wurde ein Panzer der Bundesarmee überwältigt, es wurden vier Gefangene gemacht.“ Der TV-Interviewer war sichtbar stolz, einen echten Krieger gefunden zu haben, einen, der es den Serben so richtig gezeigt hatte.
Auf diplomatischem Parkett suchte die Brüsseler Außenminister-Troika, bestehend aus dem holländischen, dem luxemburgischen und dem italienischen Chefdiplomaten, eine Stabilisierung der angespannten Lage. Bereits am 7. Juli 1991 war die „Deklaration von Brioni“ unterschriftsreif. Laibach, Agram und Belgrad hatten sich darauf geeinigt, die Unabhängigkeitserklärungen der nördlichen Republiken auf drei Monate auszusetzen. Die Volksarmee sollte Slowenien verlassen, UN-Beobachter zogen in Laibach ein. Das jugoslawische Staatspräsidium stimmte am 18. Juli dem Truppenabzug aus Slowenien zu, nur der kroatische Vertreter Stjepan Mesić sprach sich dagegen aus. Er forderte einen gleichzeitigen Abzug der Truppen aus Kroatien. Es sollte – abgesehen vom kaum ernstgenommenen Alleingang Litauens – bis zum 23. Dezember 1991 bzw. bis zum 15. Januar 1992 dauern, daß Slowenien und Kroatien von Deutschland und Österreich bzw. von den übrigen EG-Staaten internationale Anerkennung zuteil wurde. Schon am 13. August 1992 zog Belgrad nach und erkannte Ljubljana und Zagreb als frischgekürte europäische Hauptstädte an. Bis dahin floß allerdings – in Kroatien – noch viel Blut.
Das Mißverständnis von der nationalen Selbstbestimmung
Ideologisches Kernstück der jugoslawischen Desintegration bildete die These vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, die ohne jedes kritische Hinterfragen als Recht zur Errichtung eines eigenen, ethnisch möglichst homogenen Nationalstaates postuliert wurde. Im gesellschaftlichen Milieu des Balkans – das wußte jeder, der es wissen wollte – konnte diese Zielvorstellung nur in den Krieg führen. Wo 30 und mehr Völkerschaften auf engstem Raum miteinander leben, ist die Volkszugehörigkeit als Kriterium für eine territoriale Einheit ein Unding. Selbstbestimmung in ihrer rein nationalen Ausprägung, die noch dazu den Wunsch nach territorialer Exklusivität beinhaltete, war letztlich der Treibriemen für ein bislang zehnjähriges Völkermorden in der Region. Ideologisches Vorbild dafür stellten die Assimilationsprozesse dar, die im Westen des Kontinents im Zuge der bürgerlichen Revolutionen zur Herausbildung von ethnisch homogenen Staatsnationen geführt hatten; auch hier verliefen sie, wie die Beispiele der Bretonen, der Korsen, der Basken oder der Iren zeigen, keineswegs ohne Zwangs- und Gewaltanwendung.
Vorbilder für ethnische Homogenisierungen, Umsiedlungen oder gewaltsame Vertreibungen gibt es in der Geschichte viele. Von der Ausrottung der Armenier in der Türkei, der türkisch-griechischen Umsiedlungsaktion im Jahr 1923 bis zu den Vertreibungen der 12 Millionen Deutschen aus Osteuropa im Gefolge des Zweiten Weltkrieges oder den Massakern an den guatemaltekischen Indianern in den 80er Jahren kann allein das 20. Jahrhundert schreckliche Geschichten erzählen. Die menschheitsgeschichtlich größten, brutalsten und gleichzeitig perfektesten ethnischen Säuberungen sind allerdings aus den Siedlergesellschaften des weißen Mannes zu vermelden, aus Nordamerika und Australien. Dort wurde jeweils ein ganzer Kontinent gesäubert, um den weißen Neusiedlern Platz zu schaffen. Im Heimatland der meisten NATO-Generäle gilt die ethnische Säuberung Amerikas – glaubt man an die Kraft der Bilder im Filmgenre des „Western“ – bis heute als heldenhaft und identitätsbildend. Die US-Hauptstadt Washington trägt nach wie vor den Namen eines der erfolgreichsten ethnischen Säuberer, George Washington, der als General und später als Präsident zahlreiche Indianerstämme von der ethnischen Landkarte strich. Wie unglaubwürdig müssen multikulturelle Appelle US-amerikanischer Politiker aus jenem Washington in balkanischen Ohren klingen!
Die einfache Formel von der Anerkennung neuer Nationalstaaten als Mittel zur Verhinderung von Bürgerkrieg in Jugoslawien hat sich – soviel kann nach der jugoslawischen Tragödie im nachhinein niemand bestreiten – als kriegstreiberisch erwiesen. Ohne daß daraus allerdings bisher irgendwelche Konsequenzen gezogen wurden.
Zudem haben Regierungen und Oppositionen in deutschen Landen von Anfang an den Nationalismus geschürt, indem sie gute und schlechte Nationalismen auseinanderdividierten. Serbisch wurde dabei von deutschen Medien und Politikern durchwegs mit denunziatorischen Adjektiven belegt, während slowenisch, kroatisch und – später – bosnisch sowie kosovo-albanisch einen sympathischen Klang erhielt. Daß dieser nicht lange anhalten wird bzw. im Fall von Kosovo-Albanien bereits von hörbaren Gegentönen getrübt ist, entspricht letztlich den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen im Westen, die positive und negative nationale Zuordnungen schnell und scheinbar mühelos wechseln können. Das wiederum unterstreicht die Instrumentalisierbarkeit der nationalen Frage.
Titos Kampfgefährte, Milovan Djilas, sollte recht behalten. Im Juli 1991, als die Debatte um das Für und Wider der staatlichen Anerkennung Sloweniens und Kroatiens in der Europäischen Union ihren Höhepunkt erreicht hatte, warnte er in der Wiener Tageszeitung „Die Presse“: „Die Anerkennung der Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien durch Deutschland, Österreich oder andere Staaten wird direkt zu einem Bürgerkrieg in Jugoslawien führen. Dieser Krieg würde von unvorhersehbarer Dauer sein und könnte, so fürchte ich, durch die Intervention internationaler Organisationen oder das Eingreifen der Großmächte nicht gestoppt werden.“ Der aus Montenegro stammende Politiker und Philosoph, der auch als Schriftsteller Weltruhm erlangt hat, gehörte bis 1954 zum engsten Kreis um Staats- und Parteiführer Tito; sein Buch „Die neue Klasse“ machte ihn zum Dissidenten. Mehrere Jahre verbrachte Djilas in jugoslawischen Gefängnissen, bis er 1966 begnadigt wurde. Auch dem Autor gegenüber äußerte sich die graue Eminenz des Titoismus im Juni 1991 äußerst pessimistisch über die Zukunft des Landes. Der Nationalismus habe, so Djilas, überall den Kommunismus überlebt, auch deshalb, weil es in Jugoslawien keine Mittelklasse gegeben habe. Direkt prophetisch dann Mitte Juli 1991 sein Entwurf eines Zukunftsszenarios in „Die Presse“: „Die Sezession Kroatiens würde einen Aufstand der serbischen Minorität zur Folge haben. … Es würde daraufhin zu einem Krieg zwischen den Teilstaaten kommen – Kroatien auf der einen Seite, Serbien und Montenegro auf der anderen. Und was noch schlimmer und schrecklicher ist: Der Krieg in Bosnien und Herzegowina würde auch ein Religionskrieg sein …“ Auch das Kosovo-Drama war, folgt man Milovan Djilas, vorhersehbar: „Ein Krieg in Bosnien bedeutet Massaker auch an der Zivilbevölkerung. Das wiederum könnte die Initialzündung für einen Aufstand der Kosovo-Albaner gegen Jugoslawien sein.“
Nationale Selbstbestimmung mit dem Ziel von Eigenstaatlichkeit konnte nur in die jugoslawische Katastrophe führen. Die deutschländischen Anerkennungspolitiker von Wien bis Bonn wollten davon nichts wissen und nahmen bewußt den Bürgerkrieg in Kauf. Ein tatsächliches Schüren des jugoslawischen Bürgerkrieges wirft Veljko Kadijević, der letzte gesamtjugoslawische Verteidigungsminister, vor allem den Deutschen vor. Schon in den 80ern, so Kadijević in seinem Buch „Meine Vision vom Zerfall“, strotzte der bundesdeutsche Militärgesandte in Belgrad nur so vor Serbenhaß. Sprüche wie „serbische Schweine“ oder „Nur ein toter Serbe ist ein guter Serbe“ machten im – offensichtlich gut belauschten – Botschaftsgebäude der BRD die Runde. Kadijević weiter: „Deutschland bemühte sich nicht um eine friedliche Lösung, sondern um den Bürgerkrieg, auf daß sich die Völker Jugoslawiens nie wieder werden einigen können. Es ist nicht auszuschließen, daß Deutschland sogar später auf dem Balkan herrscht“, schrieb der General 1993. Für viele mögen solche Voraussagen zu jener Zeit verschwörungstheoretisch geklungen haben. Nur sechs Jahre später allerdings standen deutsche Truppen in Makedonien, Albanien und im Kosovo, bereit zum Einmarsch in Montenegro. Djilas und Kadijević, so unterschiedlich sie auch im innerjugoslawischen Diskurs politisch Position bezogen, behielten mit ihren Warnungen recht. Der slowenische Separatismus sollte zum Schlüssel für die westeuropäische und US-amerikanische Osterweiterung in diesem Raum werden, der Auftakt für ihre militärische, politische und wirtschaftliche Präsenz auf dem Balkan.
Der deutsch-österreichische Sündenfall
„Anerkennung oder Krieg“ hieß die politische Devise, die von Deutschlands CDU/CSU/FDP-Regierung wie auch von den österreichischen Konservativen und Grünen jener Tage in die Welt hinausposaunt wurde. Der Sommer 1991 war außenpolitisch vom Thema der staatlichen Anerkennung Sloweniens und Kroatiens geprägt. Die Wirklichkeit zeigte allerdings sehr bald, daß der Slogan „Anerkennung oder Krieg“ keine Alternative in sich barg, sondern nur die Beschreibung der historischen Abfolge darstellte: Erst Anerkennung, dann Krieg.
Zur gesellschaftlichen Konsensbildung in der nationalen Frage wesentlich beigetragen haben die Grünen. So wie im Frühjahr 1999 die BRD-Minister Joseph Fischer, Jürgen Trittin und andere den NATO-Bombeneinsatz gegen Jugoslawien akzeptierten und damit Krieg als politisches Mittel zur Lösung von Konflikten in der Generation der 68er gesellschaftsfähig machten, waren die Grünen bereits im Frühjahr und Sommer 1991 kriegstreiberisch, als sie die slowenischen und kroatischen Bestrebungen nach nationaler Eigenstaatlichkeit unterstützten.
Die Rolle der österreichischen Grünen ist dabei besonders bemerkenswert. Von den damals insgesamt acht grünen Parlamentsabgeordneten waren zwei kroatischstämmig, einer slowenischstämmig und die Fraktionsführerin mit einem Kroaten verheiratet. Nun mag man einwerfen, daß der Muttersprache in aufgeklärten Kreisen wohl keine politische Bedeutung beigemessen werden dürfe. Mag sein; der ethnisch-nationale Traum hat die grüne Fraktion jedenfalls erfaßt. Bereits im Frühjahr 1991, als erste diesbezügliche parlamentarische Aktivität im Westen, forderte Grünabgeordneter Andreas Wabl die Anerkennung der bevorstehenden kroatischen und slowenischen Sezession. Sein klerikaler Kollege Karel Smolle von der Minderheit der österreichischen Slowenen hatte bereits damals enge Kontakte zur neuen national-konservativen Regierung von Lojze Peterle in Laibach geknüpft. Kurze Zeit darauf schied Smolle aus dem österreichischen Parlament aus und stieg zum slowenischen Botschafter in Wien auf. Ein weiterer Österreicher, der Adelige Janko Vranyczany, erhielt einen hohen kroatischen Staatsposten: er, sein Leben lang im Sold der österreichischen Tourismusindustrie, wurde nun kroatischer Tourismusminister. Und der ehemalige österreichische Generalkonsul in Zagreb, Johann Dengler, stieg zum persönlichen Berater von Franjo Tudjman auf.
Nach der Ausrufung der slowenischen Unabhängigkeit begann auch die Rechte für die Anerkennung der Eigenstaatlichkeit mobil zu machen. Am 17. September 1991 kam es auf Antrag von Jörg Haiders FPÖ zu einer parlamentarischen Sondersitzung in Wien, deren Ziel die sofortige Anerkennung Sloweniens und Kroatiens war. Doch noch fehlte der österreichischen Regierung das Placet aus Bonn; offiziell getrauten sich SPÖ und ÖVP keinen Vorstoß zu, obwohl ÖVP-Außenminister Alois Mock kaum verhohlen für die Anerkennung der Sezession der nördlichen jugoslawischen Teilrepubliken Stimmung machte.
Was de jure noch auf sich – besser gesagt: auf die EG-Gremien – warten ließ, war de facto längst Realität: Slowenien wurde wie ein unabhängiger Staat behandelt. Ministerpräsident Peterle, Außenminister Rupel und Parlamentspräsident Bučar gaben einander im österreichischen Bundeskanzleramt die Türklinken in die Hand, fast keine TV-Nachrichtensendung kam ohne Interview mit einem slowenischen Politiker aus – während jugoslawische Bundespolitiker oder gar serbische Führer nie ins Bild und schon gar nicht auf die Tonspur rutschten. Politik und Exekutive ließen auch martialische Auftritte von kroatischen Nationalisten auf Österreichs Straßen zu. So jene denkwürdige Demonstration am 3. August 1991, bei der 2.500 Schachbrett-Fahnen schwingende Kroaten auf dem Wiener Stephansplatz ihrem frisch gekürten Außenminister Zvonimir Šeparović zujubelten. „Kein Land für Frieden“, schmetterte Šeparović ins Mikrophon, „nicht einen Zentimeter.“
Nicht nur auf diplomatischem Parkett war die Anerkennung Sloweniens eingeleitet. Auch im handfesten Wirtschaftsbereich manifestierte sie sich. So unterzeichneten Mitte September der österreichische Wirtschaftsminister Schüssel und sein slowenischer Amtskollege, Energieminister Tomsić, ein Protokoll über eine enge Zusammenarbeit auf dem Energiesektor. Es ging dabei um die völlige „Neuordnung der Energiewirtschaft Sloweniens“, wie das Arbeitspapier titelte. Der Ausbau der Kraftwerksprojekte an der Save stand im Mittelpunkt. Dafür wurde die Sava AG gegründet; ihr Geschäftsvolumen betrug umgerechnet 1 Mrd. DM. Österreich sollte daran zu 60 Prozent beteiligt sein. In Energiefragen war Slowenien mit diesem Abkommen zum 10. österreichischen Bundesland geworden.
Regierungsamtliche Drehscheibe für ständige Provokationen Belgrads und Rotor der gebetsmühlenartigen Wiederholung des Grundsatzes „Anerkennung oder Krieg“ war der österreichische Außenminister Alois Mock. Er war es auch, der in einem beispiellosen Akt der Verhöhnung Jugoslawiens den slowenischen Politiker und späteren Außenminister Dimitrij Rupel in die österreichische KSZE-Delegation integrierte – wohlgemerkt: noch vor der Ausrufung der slowenischen Unabhängigkeit. Am 20./21. Juni 1991 tagte in Berlin die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und diskutierte – mit Rupel als getarntem slowenischen Mitglied – über den Zerfall Jugoslawiens sowie dessen Ausschluß aus der KSZE, der kurz darauf erfolgte. Der sowjetische Außenminister Edvard Schewardnadse hatte seine Amtskollegen schon im Dezember 1990 davor gewarnt, den Zerfall Jugoslawiens zuzulassen, ansonsten völkische Wiedergeburten auch die Sowjetunion bedrohen würden. Seine Stimme wurde nicht gehört.
Wenige Tage später, anläßlich der kroatischen und slowenischen Unabhängigkeitsfeiern, reisten vier österreichische Landeshauptleute (in ihrer Position Ministerpräsidenten deutscher Länder vergleichbar) nach Ljubljana und Zagreb, um die Abspaltung von Belgrad zu feiern. Auch Wiens sozialdemokratischer Bürgermeister, der zum Jahrestag der deutschen Vergrößerung am Wiener Rathaus die schwarz-rot-goldene Fahne aufziehen ließ, war mit unter den ersten Gratulanten für das neue Kroatien.
Schon zuvor ging der konservative Abgeordnete Felix Ermacora, ein für die UNO arbeitender Völkerrechtsexperte, in Wien öffentlich mit der Idee hausieren, man möge Slowenien die Chance geben, sich als 10. österreichisches Bundesland der Donaurepublik anzuschließen. Laibach lehnte dankend ab.
Allerlei abstruse Vorstellungen über die Neuordnung auf dem Balkan kursierten. Österreichs Konservative und Grüne versuchten sich als Vorhut der deutschen Außenpolitik zu profilieren. Je radikaler ein Gesamtjugoslawien abgelehnt und je schwerer Belgrad brüskiert wurde, desto sicherer konnte man sich der Zustimmung in den Medien freuen.
Die medialen Lobbyisten für die Zerschlagung des Vielvölkerstaates in nationale Einheiten saßen in den führenden deutschen Blättern. FAZ, „Die Welt“ und „Bild“ trommelten mit der vermeintlichen Alternative „Anerkennung oder Krieg“. Und wer wollte schon Krieg? Damals, im Sommer 1991, war er noch nicht populär. Als der „Spiegel“ Anfang Juli 1991 mit dem Aufmacher „Völkergefängnis Jugoslawien: Terror der Serben“ titelte, hatten sich die Eckpfeiler der deutschösterreichischen Außenpolitik im Medienwald endgültig verankert. Es war nur noch eine Frage von Zeit und Geld, bis die gesamte Europäische Gemeinschaft dem deutschen Weg folgen würde.
Der britischen Regierung kam Bonn in Fragen der Sozialcharta entgegen, die zu jener Zeit zu einer Grundsäule der Maastrichter Verträge hätte werden sollen. London wurde sozialpolitische „Autonomie“ erlaubt. Und für die Empfängerländer Spanien, Portugal, Griechenland und Irland füllte sich auf wundersame Weise der Budgettopf mit Mitteln aus den Brüsseler Ausgleichsfonds. Westeuropa war also schnell ins deutsche Boot geholt. Zur Jahreswende 1991/92 konnte stolz verkündet werden: Europa hat zwei neue Staaten – Slowenien und Kroatien.
Kritik an der raschen und Belgrad bewußt isolierenden deutschen Anerkennungspolitik war Ende 1991 wenig zu hören. Stimmen aus der UNO wurden – wie später während des Bürgerkrieges auch – kaum veröffentlicht oder sogar verschwiegen. So erinnern sich heute nur noch wenige daran, daß UN-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar als seine letzte Amtshandlung einen Appell an EG-Vermittler Lord Carrington richtete, alles zu unternehmen, damit Deutschland Kroatien nicht anerkenne, ansonsten „ein dramatischer Kampf um jugoslawische Territorien ausbrechen“ würde. Erst nachdem Jahre später die Folgen der gesellschaftlichen Ethnisierung in Bosnien tragisch und teuer zu spüren waren, meldeten sich Kritiker, die hinter die weltpolitischen Kulissen jener Monate blicken ließen. Stellvertretend sei Richard Holbrooke genannt, Washingtons Sonderbeauftragter für Bosnien, der in seinen Memoiren den Durchmarsch der Deutschen in Sachen kroatischer Sezession zu Protokoll gibt: „Doch Genscher“, schrieb Holbrooke im Jahr 1998, „schlug die Warnungen seiner alten Freunde in den Wind. Ganz untypisch ließ Deutschland seine Muskeln spielen. Auf dem entscheidenden Treffen der europäischen Außenminister Mitte Dezember des Jahres 1991 erklärte Genscher gegenüber seinen Kollegen, Deutschland werde, sollten die anderen EG-Staaten nicht mitziehen, Kroatien notfalls auch im Alleingang anerkennen …“
Die siebte Republik
Überall im krisengeschüttelten Jugoslawien erhielten die nationalen Fliehkräfte politischen Rückenwind. Die serbische Nomenklatura unter Slobodan Milošević konvertierte 1989 beim Gedenken an den heldenhaften christlichen Widerstand gegen die Osmanen im Kosovo polje zur nationalen Kraft; in Kroatien und Bosnien erklommen Anfang der 90er Führer wie Franjo Tudjman und Alija Izetbegović die höchsten politischen Ämter; die beiden hatten wegen nationalistischer bzw. muslim-fundamentalistischer Umtriebe schon mehrfach Bekanntschaft mit Gefängniszellen gemacht; in Makedonien besann man sich der nationalen Eigenheiten; Sloweniens ökonomische Überlegenheit definierte die wirtschaftlich am höchsten entwickelte Region aus der balkanischen Brüderschaft hinaus; das Selbstbestimmungsrecht der albanischstämmigen Kosovaren war seit Jahrzehnten ausschließlich national definiert; und auch vor Montenegro und der Vojvodina machten regionalistische Fliehkräfte nicht halt.
Einzig die „siebte Republik“, wie die jugoslawische Volksarmee immer wieder genannt wurde, kannte keine nationale Heimat. Der Soldat war Jugoslawe. Diese keineswegs unbekannte Tatsache wurde anläßlich der nationalen Begehrlichkeiten in Zagreb, Ljubljana und – später – Sarajevo schlicht ignoriert. Auch die westlichen Unterstützer der sezessionswilligen Kräfte machten sich über Zustand und Selbstdefinition der Armee offensichtlich keine Gedanken. Mit dem lapidaren Hinweis, die Mehrheit der hohen jugoslawischen Offiziere seien Serben, glaubte man eine ausreichende Analyse unternommen zu haben. Doch dies diente nur der Feindbildpflege.
„Die Streitkräfte der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien schützen die Unabhängigkeit, die Souveränität, die territoriale Gesamtheit und die durch die Verfassung festgelegte gesellschaftliche Ordnung …“ So steht es im Artikel 240 der jugoslawischen Verfassung. Ihr Eingreifen in sezessionistische Vorgänge war vorprogrammiert. Und es wurde auch offen diskutiert. So zum Beispiel auf einer von Verteidigungsminister Veljko Kadijević einberufenen Kommandeurskonferenz am 13. November 1990, deren Ergebnisse teilweise in der Zeitschrift „Europäische Sicherheit“ nachgelesen werden können. Dort sind sich jugoslawische Generäle eindeutig ihrer historischen Verantwortung für den Fortbestand der Sozialistischen Föderation bewußt. Ihre Analyse der Weltlage erwies sich – nachträglich gesehen – als relativ zutreffend: Dem russischen Präsidenten Michail Gorbatschow unterstellte General Marijan Čat, für die Interessen der USA zu arbeiten, Deutschland wurde als Beherrscherin Europas beschrieben, Ungarn als unzuverlässiger Nachbar, der sich bereits auf dem Sprung in Richtung NATO-Mitgliedschaft befände, Jugoslawien sei durch die NATO bedroht, und der kroatische Präsident Tudjman würde demnächst militärische Hilfe von außen erbitten.
Damals, im November 1990, klangen solche Bemerkungen in den Ohren westlicher Beobachter wie Verschwörungen. Heute, nach der NATO-Landnahme des Kosovo, der Übernahme von militärischer Kontrolle in Albanien, Bosnien und Makedonien, nach dem allseitig sichtbaren Einfluß Deutschlands und der USA in Kroatien müssen den jugoslawischen Generälen geradezu hellseherische Qualitäten bescheinigt werden. Das balkanische Drama war indes auch mit der klarsten Analyse nicht zu verhindern.
Daß die „siebte Republik“ nicht in die Verhandlungen um die nationalen Unabhängigkeiten miteinbezogen wurde, war der vielleicht schwerwiegendste Fehler aller Beteiligten. Bereits der slowenische und kroatische Unabhängigkeitskampf begriff die Volksarmee als fremd und feindlich, obwohl auch Slowenen und Kroaten unter ihren Waffen standen.
Sobald eine politische Einigung über den Austritt der einzelnen Republiken aus dem Staatsverband erzielt war, zeigte sich die Generalität der Volksarmee kooperativ. Slowenen wurden aus den Kasernen entlassen und auch kroatische Soldaten bereits ab Juni 1991 demobilisiert. Bis Februar 1992 hatten alle kroatischen Soldaten die Volksarmee verlassen. Im Fall Bosniens komplizierte sich die Auflösung der „siebten Republik“, die zu einer Armee ohne Staat geworden war, allerdings wesentlich. In dieser Republik war der personelle Bestand überwiegend lokal, bosnisch.
Bosnien-Herzegowina galt schon zu Titos Zeiten als Heerlager Jugoslawiens. Hier standen die größten Bunkerbauten, die unterirdischen Fluganlagen, hier lagerten die größten Waffenarsenale. Das gebirgige, zentral gelegene Bosnien beherbergte das Herzstück der jugoslawischen Armee.