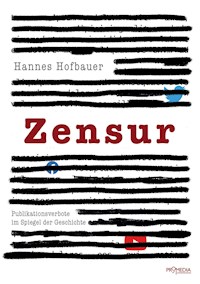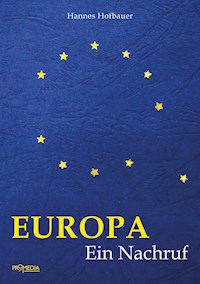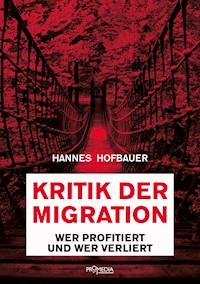15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als einer der jüngsten Staaten Europas hat die Slowakei seit ihrer Gründung am 1. Januar 1993 eine außergewöhnliche Entwicklung durchgemacht. Außenpolitisch ist die Epoche seither vom Ringen um eine westliche bzw. östliche Ausrichtung geprägt, während das Land innenpolitisch zwischen sozial-nationalen und ultra-liberalen Ansätzen pendelt. Diese für die Slowakei paradigmatische "doppelte Orientierung" wurzelt tief in ihrer Geschichte. Hannes Hofbauer und David X. Noack zeichnen den Weg des Landes dementsprechend historisch nach und legen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Aufarbeitung der zeitgeschichtlichen Ereignisse nach dem Umbruch des Jahres 1989.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hannes Hofbauer/David X. Noack Slowakei
© 2012 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien Lektorat und Gestaltung: Stefan Kraft
ISBN: 978-3-85371-802-5 (ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-349-5)
Fordern Sie einen Gesamtprospekt des Verlages an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected]
Autoren
Hannes Hofbauer, geboren 1955 in Wien, ist Wirtschaftshistoriker und Publizist. Seit mehr als 20 Jahren bereist er insbesondere die Länder des ehemaligen Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe und Jugoslawiens. Im Promedia Verlag sind von ihm u. a. erschienen: „EU-Osterweiterung. Historische Basis – ökonomische Triebkräfte – soziale Folgen“ (2. Auflage 2007) und „Experiment Kosovo. Die Rückkehr des Kolonialismus“ (2008).
David X. Noack, geboren 1988 in Berlin, hat Politikwissenschaft, Geschichte und Militärgeschichte in Greifswald und Potsdam studiert. Er schreibt als freier Journalist unter anderem für die „Junge Welt“, das „Eurasische Magazin“ und die „Österreichische Militärische Zeitschrift“.
Vorwort
Die Slowakei ist – gemeinsam mit Tschechien – der jüngste Staat der Europäischen Union. Mit der Ausrufung der Unabhängigkeit am 1. Januar 1993 trat auf friedlichem Weg ein neues Subjekt in die internationale Staatengemeinschaft. Das Land sollte in den folgenden Jahrzehnten eine außergewöhnliche Entwicklung durchmachen. Fast rhythmisch auftretende radikale Richtungsänderungen in politischer und sozio-ökonomischer Hinsicht prägten das Bild sowohl nach innen wie nach außen. Dass die Folgen dieser ausgiebig und vergleichsweise kompromisslos betriebenen Suche nach einer neuen Orientierung immer nur schlaglichtartig in der Weltpresse diskutiert wurden und werden, mag der Kleinheit des Landes geschuldet sein und mit dem Hang zur Ignoranz gegenüber Ereignissen im Osten allgemein zu tun haben. Zu Unrecht, wie die Entwicklung des jungen Landes zeigt.
Die Beschäftigung mit der Slowakei hält vielfältige Erkenntnisse bereit, die weit über ein enges nationalgeschichtliches oder landespolitisches Wissen hinausgehen. Wir erfahren etwas über die Neuformierung politischer Eliten und Oppositionen nach dem Zusammenbruch von Warschauer Vertragsorganisation und Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, über die Probleme beim Aufbau einer kapitalistischen wirtschaftlichen und sozialen Ordnung mitten in der Phase des Auseinanderbrechens der tschechoslowakischen Staatlichkeit, über den Druck des Westens in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht auf der einen und die soziale Beharrlichkeit der Bewohnerinnen und Bewohner auf der anderen Seite und über die Schwierigkeiten bei der Zähmung schrankenloser gesellschaftlicher Deregulierungen.
Mit der Kurzformel der „doppelten Orientierung“ des Landes und seiner Bewohner beschreiben wir die von gänzlich unterschiedlichen Positionen aus operierenden, parallel stattfindenden Hinwendungen nach West und Ost sowie nach links und rechts. Nirgendwo sonst in Europa haben über zwei Jahrzehnte hinweg Parteienkonstellationen sowohl auf der sozial-nationalen wie auch auf der liberalen Seite soweit von links bis rechts gereicht. Beide Seiten wollten damit die ganze Gesellschaft repräsentieren, haben aber doch nur jeweils die Hälfte vertreten.
Die „doppelte Orientierung“ reflektiert in gewisser Weise auch die wirtschaftlichen Verhältnisse im Inneren und die außenwirtschaftlichen Beziehungen des Landes. Der Drang westeuropäischen Kapitals nach Osten, politisch vertreten durch die Brüsseler Union, trug zur Zerstörung lokaler Strukturen bei, während gleichzeitig die traditionellen Bindungen mit Russland in energiewirtschaftlicher und schwerindustrieller Hinsicht aufgrund ihres potenziell erpresserischen Charakters keine gangbare Alternative einer Ostintegration boten. Mit dem Beitritt der Slowakei zur Europäischen Union 2004, dem der Aufbau des EU-weit größten Automobilclusters vorausging, war die wichtigste Wegstrecke in Richtung peripherer Westintegration zurückgelegt.
Gesellschaftlich und kulturell bleibt die „doppelte Orientierung“ des Landes indes bestehen. Sie wurzelt tief in der Geschichte. Deshalb haben wir uns entschlossen, der schwerpunktmäßig politischen und sozio-ökonomischen Beschreibung der Jahrzehnte nach 1989 einen historischen Teil voranzustellen. Unsere Spurensuche beginnt im frühmittelalterlichen „Großmährischen Reich“, als sich hier an March und Donau ein – slawisches – Mittelreich zwischen Ost und West etablieren konnte. Seine Symbole sollen heute in Form von neu aufgerichteten Denkmälern nationalen Halt bieten. Von der magyarischen Landnahme über die deutsche Kolonisierung bis zum habsburgischen „Oberungarn“ stand der später Slowakei genannte Landstrich jahrhundertelang politisch, ökonomisch und kulturell unter äußeren Einflüssen, bis sich nach dem Ersten Weltkrieg eine gemeinsame tschechisch-slowakische Republik formierte. Hitlers „Schutzstaat“ zwang das Land unter die Logik des deutschen „Großraums“. Im Anschluss an die Befreiung durch die Rote Armee orientierte man sich gemeinsam mit Prag nach Moskau, bis nach 1989 der mühsame Weg in Richtung Westen angetreten wurde.
Ein Buch wie das vorliegende, in dem ein junger Berliner und ein älterer Wiener Historiker zusammengearbeitet haben, kann nicht ohne Hilfe Dutzender Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde entstehen. Stellvertretend für sie alle sei an dieser Stelle Ingo Koschenz für seine allumfassende, auch historische Expertise, Joachim Becker für seine ökonomische Sachkenntnis und Andrea Komlosy für ihr Fachlektorat gedankt. Den Leserinnen und Lesern wünschen wir, dass die vielen von uns geführten Diskussionen sich fruchtbar auf einen möglichen Erkenntnisgewinn auswirken mögen und dass ihnen darob auch die Slowakei verständlicher wird, Land und Leute näher rücken.
Hannes Hofbauer, David X. NoackWien/Berlin, im August 2012
Slawische Ursprünge (500–907)
Seit dem 5. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung ist der Raum zwischen Donau, Pannonischer Tiefebene und Tatra-Gebirge ohne Unterbrechung besiedelt. In der als Bronzezeit bezeichneten Epoche bis 700 v. u. Z. erlebte der westliche Karpatenbogen eine wirtschaftliche Blütezeit. Der Kupferbergbau florierte. Die Zentren der damaligen Kupferproduktion, wie beispielsweise die Gegend um das heutige Spišský Štvrtok im Zipser Gebiet, befanden sich nachweislich über Handelswege mit dem Schwarzen Meer und der kretisch-mykenischen Kultur im Austausch.
Nach dakischen und thrakischen Bevölkerungsgruppen prägten die Kelten für ein paar Jahrhunderte bis etwa zur Zeitenwende des Jahres 0 die Lebensweise auf dem Gebiet der späteren Slowakei, bevor germanische Stämme wie die Markomannen und Quaden sich hier niederließen. Ihre Nachbarschaft zum Römischen Reich füllte die militärischen Aufzeichnungen der Großmacht am Donaulimes, den Rom zeitweise auch mit linksufrigen Befestigungsanlagen schützen ließ. Vorstöße der damals stärksten Armee in Europa sind bis ins heutige Trenčín erfolgt, wie auch die Anwesenheit des römischen Kaisers Marc Aurel im Tal des Hron-Flusses historisch dokumentiert ist.
Der Zusammenbruch des weströmischen Reiches gegen Ende des 4. Jahrhunderts korrespondiert mit den Vormärschen germanischer Krieger aus dem Norden in Richtung Süden und Osten sowie mit dem Einfall der Hunnen aus dem Osten, die im Jahr 375 den Don überschritten. Das Ende Roms, symbolhaft mit der Plünderung der Hauptstadt 410 datierbar, brachte auch das Ende der römischen Geschichtsschreibung mit sich. Aufzeichnungen über historische Ereignisse wurden rar und ungenau. Im Klima dieser als „Völkerwanderung“ bezeichneten Epoche siedelten sich gegen Ende des 5. Jahrhunderts slawische Stämme von Osten und Nordosten kommend entlang der Karpaten und der Donau an. Nicht vorhandene schriftliche Zeugnisse lassen eine Identifikation dieser Neubewohner hauptsächlich über die Verbreitung einer bestimmten, sogenannten frühslawischen Keramik zu. Mitte des 6. Jahrhunderts war der Raum der heutigen Slowakei jedenfalls zu einem guten Teil slawisch geworden.
In der Auseinandersetzung mit den aus der Mongolei kommenden awarischen Reiternomaden im Osten und dem fränkischen Vorstoß aus dem Westen bildete sich Mitte des 7. Jahrhunderts unter Führung des fränkischen Kaufmannes Samo für kurze drei Jahrzehnte ein stammesübergreifendes, vorwiegend slawisches Herrschaftsgebilde, das als das erste seiner Art in Mitteleuropa angesehen werden kann. Manche Historiker sprechen von diesem „Reich des Samo“ als einer „slawischen Konföderation“. Weitere fränkische Vorstöße führten in einigen Fällen zur Vertreibung, in anderen zur erzwungenen Assimilierung der Awaren, die zuvor eine gesellschaftliche Oberschicht gebildet hatten. Parallel mit dem Ende des awarischen Khanats im Jahr 813 formierten sich an der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert slawisch dominierte Fürstentümer in der Region. Pribina nannte sich der von Nitra aus herrschende Slawenführer, während am Unterlauf der March/Morava Fürst Mojmír regierte. Letzterem gelang es um das Jahr 830, die beiden Territorien zu vereinen. Die Literatur hat später diese knapp 80 Jahre – bis 907 – bestehende herrschaftliche Konsolidierung „Großmährisches Reich“ genannt. Seinen von Anfang an expansiven Charakter erklären Historiker wie Ján Steinhübel1 mit dem ökonomischen Zwang, die siegreichen Krieger, die nichts anderes als den Waffengang als Beruf gelernt hatten, weiter beschäftigen zu müssen.
Das „Großmährische Reich“
Der Terminus geht auf den oströmischen Kaiser Konstantin VII. Porphyrogenetos zurück, der dem zu seiner Blütezeit riesigen Reich, das die Slowakei, Böhmen, Mähren, Schlesien, die Lausitz und Ungarn umfasste, den Namen Magna Moravia, „Großmähren“, gab. Er tat dies Mitte des 10. Jahrhunderts, also eine Generation nach dem Ende des slawischen Großreiches. Die Namensgebung war also keine zeitgenössische. Sie bezieht sich mutmaßlich auf den Fluss Morava/March, der das Gebiet durchflossen hat. Als Zentren galten Nitra/Neutra und Devín/Theben. Am linken Donauufer nach der Mündung der Morava/March dürfte es einen regen wirtschaftlichen Umschlagplatz gegeben haben. Mehrere überregionale Handelswege kreuzten die Ebene, die sich von dort nordöstlich bis Nitra erstreckt. Von der Ostsee führte die seit langem bestehende Bernsteinstraße (bei Carnuntum) Richtung Süden zum Apennin bis Rom; die Donau verband das alte Zentrum Regensburg mit dem Schwarzen Meer und der Kiewer Rus in Richtung Norden sowie nach Byzanz in Richtung Süden.
Das nach 800 unter Karl dem Großen erstarkte Frankenreich suchte nach willfährigen Verbündeten im Osten. Also nutzte Karls Enkel, Ludwig der Deutsche, im Jahr 846 eine sich bietende Gelegenheit, den machtbewusst auftretenden Fürsten des expansionshungrigen Großmährischen Reiches, Mojmír, abzusetzen und an seiner statt dessen Neffen Rastislav von Nitra auf den Thron zu heben. Mit der erhofften Willfährigkeit Rastilavs war es indes nicht weit her. Im Gegenteil: unter Rastilav erlebte das Slawenreich an der March nicht nur eine territoriale Konsolidierung, sondern auch eine kulturelle Blütezeit, die noch 1000 Jahre später die nationalen Romantiker des 19. Jahrhunderts ins Schwärmen gerieten ließ. Der kruden Diplomatie ließ Frankenkönig Ludwig 855 einen Waffengang gegen die Slawen folgen, die diesen jedoch 859 zurückschlagen konnten. Die politische Selbstständigkeit blieb gewahrt. Rastislavs Nachfolger, Fürst Svätopluk, der 871 den Thron bestieg, dehnte die Herrschaftsgrenzen des Slawenreichs weiter aus.
Die Slawenapostel Kyrill und Method
Die Franken hatten ihren militärischen Vormarsch in Richtung Osten um 800 von einer christlichen Missionierung begleiten lassen. Von Salzburg aus wurden Bischöfe ausgesandt, um den slawischen Heiden Gottesfurcht zu lehren. Schon unter der Herrschaft Pribinas kam es mutmaßlich im Jahr 828 zu einer ersten christlichen Kirchenweihe auf dem Gebiet der heutigen Slowakei in Nitra.2 Das politisch erstarkte und vom Frankenreich weitgehend unabhängige Großmährische Reich unter Rastislav war den christlichen Riten nicht abgeneigt, sah jedoch in der bayrisch-salzburgischen Missionierung eine inakzeptable kulturelle Einmischung von außen. Also wandte sich Rastislav gleichzeitig an den weströmischen Papst Nikolaus I. mit der Bitte, eine vom Frankenreich unabhängige großmährische Kirchenprovinz zu etablieren, und an den byzantinischen Kaiser Michael III. um missionarischen Beistand. Rastilav rief nach Kirchenmännern, die die slawische Volkssprache beherrschten. Michael III. erkannte sogleich die geopolitische Chance zur Schwächung Roms und der Franken und entsandte 863 ein griechisches Brüderpaar mit Gefolge ins Großmährische Reich. Kyrill (Konstantin) und Method waren Gelehrte aus Solun/Thessaloniki und mit der slawisch-makedonischen Sprache vertraut.
Aus einem eigens für die örtliche slawische Liturgie geschaffenen Alphabet, der Glagoliza mit ihren 40 Buchstaben, entwickelte sich in der Folge die kyrillische Schrift. Tatsächlich war es dem großmährischen Fürsten Rastilav mit dem Coup dieser zweiten Christianisierungswelle gelungen, eine den Menschen verständliche Kirchensprache einzuführen. Während Rom und Byzanz bis dahin überzeugt waren, dass die einzig möglichen Gottessprachen das Lateinische, das Griechische und das Hebräische seien3, beteten und predigten die Gläubigen an der Donau auf slawisch. Mit im Gepäck brachten Kyrill und Method das Doppelkreuz der byzantinischen Patriarchen, das heute das slowakische Wappen ziert.
Die Mission aus Bayern kam zum Erliegen. Weltliches und religiöses Zentrum der ersten großmährischen Blütezeit war das spätere Mikulčice, ein Ort, der bereits seit der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts existiert hatte.
Diese großmährische Eigenständigkeit sollte allerdings nicht lange andauern. Nachdem Papst Hadrian II. die slawische Wirklichkeit in der Mitte Europas anerkennen musste und Method in den Rang eines Bischofs mit eigenem großmährischen Bistum erhob, läuteten im Frankenreich die Alarmglocken. Rastislav erging es wie seinem Onkel Mojmír. Im Jahre 870 wurde er von fränkischen Truppen gefangen genommen, die kurz darauf auch Bischof Method zuerst übel zurichteten und später in Gewahrsam nahmen. Rastislavs Neffe Svätopluk übernahm das Fürstenamt. Sein Kampf um die Freilassung Methods endete mit einem Kultursieg des Westens. Zwar durfte der griechisch-slawische Bischof im Jahr 873 ins Großmährische Reich zurück, wo er 880 den Bischofssitz in Nitra einnahm, zugleich verbot ihm der mittlerweile neu ins römische Pontifikat gewählte Johannes VIII. allerdings den Gebrauch des Slawischen für die christliche Liturgie. Nach dem Tod Methods 885 wurden auch die Predigten wiederum in lateinischer Sprache gehalten. Ein Jahrzehnt später, im Jahr 894, zerfiel das Großmährische Reich.
1 Ján Steinhübel, The Duchy of Nitra. In: Mikuláš Teich/Dušan Kováč/Martin Brown (Hg.), Slovakia in History. Cambridge 2011, S. 16
2 vgl. Roland Schönfeld, Slowakei. Regensburg 2000, S. 13
3 vgl. Josef Spetko, Die Slowakei. Heimat der Völker. München 1991, S. 21
Magyarische Landnahme (907–1147/49)
Das 10. Jahrhundert sah den Vorstoß magyarischer Reiternomaden. In kurzer historischer Abfolge drangen sie in den Siedlungsraum des Großmährischen Reiches zuerst vom Osten her kommend ein, um dann 50 Jahre später, nach ihrer verheerendsten Niederlage 955 auf dem Lechfeld, ein zweites Mal, diesmal vom Westen her, in den Karpatenbogen einzuwandern.
Mobilisiert wurden die aus den Steppen nördlich des Asowschen Meeres stammenden Magyaren nach einem verlustreichen Kampf gegen Stämme der Petschenegen in den Jahren 895/96. Ihre Verdrängung trieb sie westwärts. Unter der Führung Arpáds überrannte die halbnomadisch lebende Reitergesellschaft in wenigen Jahren die Territorien bulgarischer Fürstentümer östlich der Theiß, um kurz darauf großmährische Gebiete zu erreichen. 907 vernichteten die Magyaren ein bajuwarisches Heer an der Donau bei Bratislava, das bei diesem Anlass erstmals schriftlich – unter dem Namen Brezalauspurc – Erwähnung findet. Das Jahr 907 markiert auch das Ende des Großmährischen Reiches. Knapp 40 Jahre sollte es dauern, bis der Vormarsch der Magyaren in Europa gestoppt werden konnte. Die Schlacht am Lechfeld 955 bildet dabei eine der bedeutendsten Zäsuren der europäischen Geschichte. Dort gelang es einem gemischten Aufgebot an germanischen und slawischen Heeren unter dem aus dem Luidolfinger Adelsgeschlecht stammenden Frankenkönig Otto, dem späteren Kaiser Otto I., die Reiterkrieger aus dem Osten zu besiegen.
Ihre Niederlage war für ganz Europa kulturbildend. Die magyarischen Heerführer Bulscu und Gyula waren sieben Jahre zuvor in Konstantinopel getauft worden und trugen den Titel eines „Patricius“ des (ost-)römischen Reiches.4 Ihr Jahrzehnte andauernder Waffengang durch halb Europa, im Zuge dessen auch ferne Städte wie Bremen an der Nordsee geplündert und in Brand gesetzt worden waren, kann zumindest aus kulturpolitischer Sicht als Stellvertreterkrieg für Byzanz angesehen werden. Am Lech bei Augsburg standen einander die Heere der lateinischen und der griechischen Welt gegenüber. Der Sieg Ottos, der sich noch am Schlachtfeld von Benediktinermönch Widukind zum „Imperator“ proklamieren ließ, schaffte die Voraussetzung für seine spätere Kaiserkrönung in Rom 962. Erst damit wurde das von Karl dem Großen proklamierte Reich „römisch“ und dauerhaft. Das Römische hatte in der Mitte Europas über das Griechische gesiegt. Otto ließ Bulscu noch am Schlachtfeld hängen, während die Reste des ungarischen Heeres den Rückzug nach Osten antraten. Arpáds Nachfolger Géza und dessen Sohn Vajk transformierten Ungarn in der Folge zum Vorposten der weströmischen Christenheit. Als „Stefan der Heilige“ wurde Vajk mit der Schwester Kaiser Heinrichs II. verheiratet und damit eine Allianz mit dem Westen besiegelt, die geopolitisch ohne große Unterbrechung bis 1945 Bestand haben sollte.
Nach dem Tod Gézas im Jahre 997 festigte sich der Herrschaftsbereich der Arpáden unter der Stephanskrone. Die Machtübernahme polnischer Herzöge rund um Trenčín im ersten Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts blieb eine kurzfristige Episode. Herrschaftskämpfe zwischen deutschen und ungarischen Ansprüchen auf Vasallendienste der lokalen Bevölkerung prägten die frühmittelalterlichen Jahrhunderte, dynastische Streitigkeiten unterschiedlicher Geschlechter standen auf der Tagesordnung.
Insgesamt wirkte sich die Landnahme der Magyaren für die Slawen im Raum der späteren Slowakei von Anfang an negativ aus. Vor 955 waren viele von ihnen versklavt worden. Wer konnte, floh vor den Reiterheeren in die dichten Wälder des Nordens. Die „Zivilisierung“ der Ungarn nach deren (west-)römischer Christianisierung beließ die Slawen als Unterworfene, änderte jedoch ihr Abhängigkeitsverhältnis. Nun nahmen die magyarischen Neusiedler die Positionen von Grundeigentümern und Lehnsherren ein, sie stellten den Grundadel, während der überwiegende Teil der slawischen Bevölkerung als Leibeigene ihr Dasein fristete. Definiert war diese Ordnung indes nicht als nationale oder ethnische, sondern als ständische mit ethno-sozialen Bezügen. Die Abhängigkeit vom Grundadel bestimmte den Grad der bäuerlichen Unterdrückung. Diese nach der Schlacht am Lechfeld 955 errichtete Feudalordnung sollte – mit wenigen Adaptionen – fast 900 Jahre bis 1848 das Leben in der heutigen Slowakei bestimmen: Der Adel war ungarisch, die Städte deutsch, die abhängigen Bauern slawisch.
4 Viorel Roman/Hannes Hofbauer, Transsilvanien. Siebenbürgen. Begegnung der Völker am Kreuzweg der Reiche. Wien 1996, S. 31. Siehe auch: Attila Zsoldos, Das Königreich Ungarn im Mittelalter (950 – 1382), in: István György Tóth, Geschichte Ungarns. Budapest 2005, S. 49
Deutsche Kolonisierung (1149–1526)
Herrschaftsgeschichtlich von geringer Symbolkraft, gibt das Jahr 1149 wirtschaftshistorisch eine geeignete Zäsur ab, um ein neues Kapitel der Region nicht nur in diesem Buch aufzuschlagen. 1149 markiert das Ende des 2. Kreuzzuges, der zwei Jahre lang gedauert und mit einer Niederlage der Päpstlichen geendet hatte. Dem slowakischen Historiker František Bokes zufolge sahen die aus deutschen Landen über die Donau flussabwärts und anschließend wieder in ihre Heimat retour ziehenden Kreuzzügler mit eigenen Augen, wie dünn der „slowakische“ Landstrich in jenen Jahren besiedelt gewesen war.5 Mehr als das persönliche Erleben dürfte allerdings das Bevölkerungswachstum in den deutschen Ländern dazu beigetragen haben, dass dort die Bereitschaft zur Auswanderung gegeben war. Die ungarischen Könige erhofften sich von den deutschen Siedlern Impulse zur wirtschaftlichen Modernisierung. Mitte des 12. Jahrhunderts wurde unter König Géza II. systematisch damit begonnen, Fachkräfte aus dem Westen des Kontinents anzuwerben. Die Familien kamen vornehmlich aus Sachsen, Schlesien und dem mittleren Rheinlauf und fanden im Norden Ungarns, am Fuße der Hohen Tatra, rund um Poprad und in der Gegend von Zips6, ideale Bedingungen zur Ansiedlung im Rahmen von Koloniegründungen vor.
Die ersten Siedler aus dem Westen nahmen militärische Funktionen wahr. Als Bauern vom ungarischen König eingeladen, wurden ihnen Wohnstätten im fernen Nordosten des Landes zugewiesen, damit sie einen Schutzwall gegen nomadisierende Völkerschaften aus dem Osten bildeten. Die Einwanderer brachten moderne landwirtschaftliche Produktionsmethoden mit. Zu den von ihnen eingeführten technischen Neuerungen gehörten der Bau von Wassermühlen, der Wendepflug, mit dem es anders als beim traditionellen Hakenpflug möglich war, die Erde nicht nur aufzuritzen, sondern umzuwenden, sowie rationellere Schmiedetechniken.7 Bislang menschenleere Gebiete wurden urbar gemacht und Wälder gerodet, nachdem die durch die neuen Ackerbaumethoden produktivere Landwirtschaft nun mehr Menschen ernähren konnte. Nicht zuletzt aufgrund der deutschen Kolonisten nahm die Bevölkerungsanzahl beträchtlich zu. Schätzungen gehen davon aus, dass zur Mitte des 14. Jahrhunderts jeder vierte Bewohner auf dem Gebiet der Slowakei deutscher Muttersprache war. Ihnen wird von karpatendeutschen Autoren nicht nur eine ökonomisch zweifellos vorhandene modernisierende Kraft zugeschrieben, sondern auch eine assimilierende Funktion für die ungarische Herrschaft. So ist Josef Spetko davon überzeugt, dass es des fremden Elements der Deutschen (und nicht nur der Deutschen) bedurfte, um auf die Ungarn einen „kultivierenden Prozess der Verwandlung“ in sesshafte Bauern auszuüben.8 Die slawischen Leibeigenen kommen in solchen Huldigungen der deutschen Kolonisation nicht vor.
In zeitgenössischen Abhandlungen wurden die Siedler aus deutschen (oder wallonischen) Landen durchwegs als „hospites“, Gäste, bezeichnet. Sie waren entscheidend an der Gründung von Städten beteiligt und führten eigene Stadtrechte wie das „Nürnberger“, das „Magdeburger“, das „Iglauer Recht“ oder die „Zipser Willkür“ ein. Erste bürgerliche Freiheiten waren damit garantiert. So wurden persönlicher Besitz, die Ausübung eines Handwerks, die Nutzung von Feldern und Wäldern, fallweise die Befreiung von Pflichten gegenüber dem Landesherrn sowie die Wahl bestimmter Positionen innerhalb der Bürgerschaft verrechtlicht und kodifiziert. Die Stadtgründungen selbst blieben dem König oder dem Grundherren vorbehalten.
Mitten in diese gesellschaftliche Neuordnung, mit der auch der slowakische Bergbau einer neuen Blütezeit zustrebte, brach das Land unter dem Ansturm mongolischer Reiterheere zusammen, die Ungarnkönig Béla IV. und seiner Armee am 11. April 1241 in der Schlacht von Muhi (bei Miskolc) eine schwere Niederlage zufügten. Das Jahr 1241 steht für eine Zäsur, die für Ungarn zwar extreme Bevölkerungsverluste und Verwüstungen mit sich brachte, deren Konsequenzen interessanterweise jedoch nicht von langer Dauer waren. Der Mongolensturm war so überraschend vorüber, wie er gekommen war. Beim Wiederaufbau des Landes musste nicht auf vorhandene Strukturen Rücksicht genommen werden.
Die Blütezeit des Bergbaus
Schon vor dem Einfall der Mongolen erhielten mit Tyrnau/Trnava 1238 und Karpfen/Krupina die ersten Siedlungen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei ein vom König verliehenes Stadtrecht. Nach dem Rückzug der Mongolen folgten Neutra/Nitra, Sillein/Žilina, Leutschach/Levoča (1271), der 24 Ortschaften umfassende „Bund der Zipser Städte“ und andere.
Als große Bergbausiedlungen jener Zeit gelten Schemnitz/Banská Štiavnica, Kremnitz/Kremnica und Neusohl/Banská Bystrica an der Gran/am Hron. Mit dem Namen Schemnitz verbindet sich auch ein eigenes Stadtrecht, das Schemnitzer Recht, das Abbau und Schürfrechte der Edelmetalle regelte. Unter der neuen Oberherrschaft der Anjou, die den in männlicher Linie ausgestorbenen Arpaden auf dem ungarischen Thron folgten, kann das 14. Jahrhundert als glanzvolle Ära des slowakischen Bergbaus bezeichnet werden. Im „goldenen“ Kremnitz förderte man Gold, im „silbernen“ Schemnitz Silber und im „kupfernen“ Neusohl holte man jenes Erz aus dem Berg, das der mangelnden technologischen Kenntnis wegen anfangs nach Italien transportiert werden musste, wo aus dem Gestein Silber von Kupfer getrennt wurde.
Der oberungarische Bergbau erlangte Wichtigkeit für halb Europa. Kremnitzer Münzanlagen prägten goldene Dukaten, die bis nach Deutschland und Italien ihre herrschaftlichen Abnehmer fanden.9 Und für den europäischen Kupferabbau erreichte Neusohl eine marktbeherrschende Stellung. Monopolgesetze und ein eigenes Ausfuhrverbot für rohes, nicht gemünztes Gold im Jahre 1325 sicherten dem Landesherrn enorme Profite. Die örtliche Bevölkerung, insbesondere die slawisch sprechende, profitierte freilich nicht davon.
Ein Wortbruch im fernen Konstanz am Bodensee hatte dann unerwartete Folgen auch für die oberungarischen Bergbauzentren. 1415 war der böhmische Reformer und Revolutionär Jan Hus trotz versprochenen freien Geleits vom päpstlichen Konzil zu Konstanz als Ketzer verurteilt und öffentlich verbrannt worden. Sein Tod löste soziale Unruhen in ganz Mitteleuropa aus, die nur vordergründig als rein religiös interpretiert werden können. Um 1428 drangen hussitische Heere in die vorwiegend deutsch besiedelte Stadt Neutra/Nitra ein. Die Deutschen galten ihnen aus zwei Gründen als Feinde: sie profitierten mehr als andere Bevölkerungsgruppen vom Bergbau und wurden kollektiv für das Todesurteil gegen Jan Hus verantwortlich gemacht. Mit einem Sieg über königliche Truppen im Jahr 1430 festigten die hussitischen Sozialrebellen ihre Positionen in Oberungarn. Einer ihrer Führer, Johann Giskra (Ján Jiskra) kontrollierte mit seinen bewaffneten Aufständischen über fast zwei Jahrzehnte weite Teile des Landes. In Kremnitz ließ er eigene Goldmünzen prägen. Erst König Mathias Corvinus besiegelte das Ende der insbesondere vom städtischen Bürgertum als Schreckensherrschaft empfundenen Hussiten. Es bedurfte jedoch privater Investoren, um die danieder liegenden Bergbauzentren wieder in Schwung zu bringen. Wieder war es eine ungarisch-deutsche Allianz, die sich der Geschicke des Landstriches annahm, diesmal allerdings keine herrschaftliche, sondern eine des Kapitals. Johann Thurzo, ein ungarischer Patrizier und Waffenhändler aus Leutschach, pachtete im Jahr 1475 eine Reihe von Bergwerken, darunter jene in Schemnitz, Kremnitz und Neusohl, wobei er es besonders auf die Kupfergewinnung abgesehen hatte, die für moderne Waffenproduktion unerlässlich war. Als ihm für seine hochfliegenden Pläne das Kapital zu knapp wurde, holte er den damals wichtigsten Bergwerksindustriellen Europas mit ins Boot: Jakob (III.) Fugger aus Augsburg, genannt „der Reiche“, investierte in ein gemeinsames Unternehmen. Die Allianz der Fugger-Thurzo-Gesellschaft mit Sitz in Neusohl/Banská Bystrica wurde, wie auch in adeligen Kreisen üblich, privat mit einem Ehevertrag zwischen den beiden Familien besiegelt.
Die slowakische Erzförderung gedieh und warf enorme Gewinne ab. Die Bergknappen sahen davon jedoch wenig. Und die leibeigenen Bauern zu Anfang des 16. Jahrhunderts litten unter der Raffgier der Grundherren. Mehrmals entlud sich ihre Wut, insbesondere im großen ungarischen Bauernaufstand des Jahres 1514, dem sich ungarische und slowakische/slawische Bauern gleichermaßen anschlossen. Ihr Führer, György Dózsa, soll mit bis zu 100.000 Aufständischen Angst und Schrecken unter den Adeligen verbreitet haben.10 Den Bergarbeitern ging es nicht besser. Ein Knappenaufstand im Jahr 1525 dokumentiert die soziale Not der städtischen Unterschichten.11 Erstmals waren es Arbeiter, die von Neusohl ausgehend über ganz Oberungarn bis ins ferne Ofen/Buda ihre Stimmen und Waffen erhoben. Die vorrückenden Osmanen unter dem jungen Sultan Süleyman, die 1526 die entscheidende Schlacht im südungarischen Mohács gewinnen sollten, trafen auf ein sozial zerrüttetes Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung mit Herren und Besitzern unzufrieden waren.
Das elende Landleben
Während die Städte im 15. Jahrhundert eine Blütezeit erlebten, herrschte auf dem Dorf das blanke Elend. Die Feldwirtschaft betreibenden Menschen waren großteils Leibeigene oder Fronbauern, für die sich in der Zeit der Anjou die Bezeichnung „Jobbágy“12 durchsetzte. Ein schier undurchschaubares Gewirr an grundherrlichen Zwangsabgaben und Frondiensten, unter denen die Landbevölkerung zu leiden hatte, wurde nach und nach vereinheitlicht. So war es bald in ganz Ungarn üblich, den sogenannten „Neunten“13, den neunten Teil des landwirtschaftlich erzeugten Produktes, an den Grundherren abzugeben. Der „Zehnte“ blieb der Kirche vorbehalten. Dieses System der Abgabenwirtschaft unter der ungarischen Krone blieb im Kern bis 1848 bestehen. Auch die Machtübernahme der Osmanen änderte daran kaum etwas.
5 Zit. in: Josef Spetko, Die Slowakei. Heimat der Völker. München 1991, S. 29
6 vgl. Roland Schönfeld, Slowakei. Regensburg 2000, S. 22
7 Karl-Peter Schwarz, Tschechen und Slowaken. Der lange Weg zur friedlichen Trennung. Wien 1993, S. 18
8 Spetko, Slowakei, S. 123
9 Spetko, Slowakei, S. 190
10 Dušan Škvarna, Geschichte der Slowakei. In: Slowakei. Klagenfurt 2010, S. 18
11 Schönfeld, Slowakei, S. 33
12 Zsoldos in: Tóth 2005, S. 116
13 ebd., S. 117
Adel gegen Krone (1526–1848)
Als am 29. August 1526 der junge Jagiellonen-König auf dem ungarischen Thron, Ludwig II., am Schlachtfeld bei Mohács im Fluss ertrank, änderte sich die geopolitische Landkarte Europas ein weiteres Mal. Sultan Süleyman, der Prächtige, hatte in diesem Sommer des Jahres 1526 das osmanische Heer erfolgreich in die Mitte Europas geführt. Das historische Ungarn hörte damit zu existieren auf. Noch im selben Jahr erhoben zwei Männer den Anspruch auf den ungarischen Königsthron. Im Schatten des osmanischen Machtzuwachses kämpften der aus einem regionalen Adelsgeschlecht stammende Johann Zápolya und der Habsburger Erzherzog Ferdinand, später als Ferdinand I. zum römisch-deutschen Kaiser erkoren, um die Vorherrschaft. Ferdinand leitete seinen Anspruch auf die ungarische Krone aus dem jagiellonisch-habsburgischen Erbfolgevertrag zur Regelung der Nachfolge im Sterbefall ab. Johann Zápolya hingegen konnte auf die Rückendeckung der ungarischen Stände zählen, die ihn Mitte Oktober 1526 in Tokai zum König wählten. Zwei Monate später ließ sich Ferdinand in Pressburg die ungarische Königskrone aufsetzen. In dieser Doppelherrschaft manifestierte sich eine bereits langfristig bestehende Feindschaft zwischen dem fremden Herrschergeschlecht und dem lokalen Adel.
Nach jahrelangen, kriegerischen Auseinandersetzungen konsolidierten sich drei Verwaltungsgebilde auf dem Territorium des früheren Ungarn. Siebenbürgen wurde zu einem eigenen Fürstentum, das der Hohen Pforte in Konstantinopel tributpflichtig war und in der westlichen Historiographie als Vasallenstaat bezeichnet wird. Kernungarn mit Buda kam als Vilajet, als türkische Provinz, direkt unter die Oberherrschaft des Sultans, während Westungarn, Teile Kroatiens und die Slowakei habsburgisch wurden ... und es bis 1918 blieben. Dass auch Ferdinand für seinen ungarischen Königstitel jährlich Tribut an den Sultan abzuliefern hatte, ist hierzulande weniger bekannt, weist jedoch auf das osmanisch-habsburgische Kräfteverhältnis in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hin.
Wirtschaftlich haben die Jahrzehnte dauernden dynastischen Auseinandersetzungen um die Herrschaft in (Ober)-Ungarn tiefe Spuren hinterlassen. Der Bergbau war davon besonders betroffen. Bürgerkriegsähnliche Zustände schreckten jeden potenziellen Investor ab. Jene, die ihr Geld in die Anlagen gesteckt hatten, flohen aus den einst blühenden Städten. Die slowakischen Gruben verfielen. Da konnten auch verzweifelte protektionistische Maßnahmen nicht mehr helfen. Und als König Ferdinand im Jahre 1544 mit einem Verbot der Kapitalausfuhr auf die immer stärker werdende Abwanderung von Bergwerksbesitzern reagierte, gab auch eine der reichsten Familien Europas, die Fugger, ihr slowakisches Engagement auf.14 Es oblag dem Wiener Hof, mit einer Art von Notverstaatlichung den Fuggerschen Kupferbergbau in Neusohl in ärarische, höfisch-staatliche Verwaltung zu übernehmen. Langfristig sollte sich das für die Habsburger lohnen. Im 18. Jahrhundert erreichte der slowakische Bergbau unter der merkantilistischen Wirtschaftsführung von Franz Stephan von Lothringen, dem Ehemann Maria Theresias, der in der slowakischen Literatur František Lotrinský genannt wird, eine letzte Blüte.
Der Kampf um die Seelen
Nachdem die Habsburger im Sommer 1541 einen weiteren, entscheidenden Feldzug gegen die Osmanen verloren hatten und das für kurze Zeit eingenommene Buda neuerlich, diesmal für 125 Jahre räumen mussten, erhoben sie das nordungarische Pressburg/Pozsony zur Hauptstadt des nun stark verkleinerten christlichen Ungarn. Seit 1536 (bis 1848) war es Sitz des Landtages und ab 1563 Krönungsstadt. Insgesamt 17 habsburgische Potentaten wurden hier, knapp unterhalb der Mündung der March in die Donau, zu ungarischen Königen gekrönt. Von Maximilian I. (1563) bis Ferdinand V. (1830) zog die Pressburger Burg eine herrschaftliche Spur durch die Geschichte Ungarns. Die Zeremonie für die einzige Frau, die es auf den Thron geschafft hat, Maria Theresia, war Chronisten zufolge die prunkvollste.
Mit der slowakischen Geschichte haben diese Ereignisse so gut wie nichts zu tun. Pressburg/Pozsony/Bratislava diente den Habsburgern als Statthalterei für den Anspruch auf das große Ungarn. Solange ihnen ein solches durch die osmanische Präsenz verwehrt blieb, mussten sie sich mit dem westlichen und dem nördlichen, stark slawisch besiedelten Teil zufrieden geben. Zur Sicherung dieser Herrschaft entstand entlang der gesamten Grenze des verkleinerten Königreichs eine ganze Kette von Befestigungsanlagen, für die die besten italienischen Baumeister engagiert worden waren. Am eindrucksvollsten kann die Bollwerkfunktion dieses christlich-habsburgischen Ungarn noch heute in Komarno/Komarom bewundert werden.
Das Terrain, auf dem der Machtkampf zwischen lokalem, großteils ungarischem Adel und der von den Habsburgern vereinnahmten Krone am augenscheinlichsten stattfand, war der religiöse Glaube. Hinter dem als kulturelle Auseinandersetzung geführten Streit standen Fragen des politischen und wirtschaftlichen Einflusses. Über Jahrhunderte wussten die ungarischen Magnaten die geteilte Herrschaft über Ungarn geschickt im eigenen Interesse zu nutzen.
Bereits 1521 hatte der Erzbischof von Gran/Esztergom im Namen des Papstes den Bann über Martin Luther verhängt. Der unter dem König tagende ungarische Landtag erließ daraufhin 1523 ein Gesetz, das es erlaubte, Protestanten, wo immer sie aufgegriffen wurden, unverzüglich als Ketzer zu verbrennen.15 Die vernichtende Niederlage bei Mohacs (1526), von dessen Schlachtfeld auch fünf papsttreue Bischöfe nicht zurückkehrten, ließ die katholischen Erlässe zur Makulatur verkommen. Es war den Osmanen und ihrer Mischung aus religiösem Desinteresse und Toleranz, mit der sie den neuen Untertanen entgegenkamen, zu verdanken, dass sich die protestantischen Lehren landauf und landab schnell verbreiteten. In den slowakischen Städten waren es anfangs die deutschen Bürger, die lutherisch, calvinistisch, anabaptistisch oder nach Art Zwinglis zu beten anfingen. Der ungarische Adel folgte bald und das Augsburger Bekenntnis wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum populärsten christlichen Glauben auf slowakischem Territorium.16 Um 1570 existierten über 900 evangelische Pfarren in der Slowakei.17 Einzig die westslowakische Achse Pressburg/Bratislava – Tyrnau/Trnava verblieb unter katholischem Einfluss, auch deshalb, weil hier die nahe habsburgische Gewalt am intensivsten ausstrahlen konnte. Und der Wiener Hof mit seiner Pressburger Dependance blieb Zeit seines Bestehens dem Papst in Rom treu, der katholischen Mission verpflichtet.
Die Gegenreformation kam geplant und war jesuitisch. Das Erzbistum Esztergom diente dabei als Drehscheibe. Erste Erfolge bei der Rekatholisierung konnten bei einzelnen westungarischen Adelsfamilien wie den Pálffys und Esterházys verbucht werden. Ihre Heimholung unter das strenge Kreuz des Herrn, das jede Liturgiesprache außer der lateinischen verbot und protestantische Reformen als Ketzerei wider den Papst begriff, führte dem damaligen Verständnis von Religion und Kultur entsprechend auch sämtliche Untertanen der re-missionierten Magnaten in den Schoß Roms zurück.
Parallel zur Rekatholisierung versuchte der habsburgische Landesherr – wie auch in den österreichischen Ländern – seine Macht mit absolutistischen Reformen zu stärken. Traditionelle adelige Ämter wurden aufgelöst bzw. in ihren Funktionen beschnitten, neue, direkt dem König unterstellte eingerichtet und der Adel einer Steuerpflicht unterworfen. Was in Österreich und Böhmen funktionierte, stieß in Ungarn jedoch auf manifesten Widerstand. Das gesamte 17. Jahrhundert hindurch sah antihabsburgische Aufstände, geführt von ungarischen Magnaten, begleitet von deren slowakischen Untertanen.
Die Muster dieser Aufstände ähnelten einander. Immer waren es hoch angesehene Feudalherren, die von Adelsversammlungen zum Kampf gegen das Haus Habsburg ermächtigt wurden. In langen Feldzügen gingen sie, von Siebenbürgen und dem Osten der Slowakei kommend, gegen die katholischen, absolutistischen Zentren im Westen vor, eroberten Pressburg und ließen sich zum ungarischen Gegenkönig ausrufen. Die zumindest indirekte, jedenfalls logistische Unterstützung der Osmanen war ihnen sicher, das Wohlwollen Frankreichs ebenso. Gabriel Bethlen, Emmerich Thököly und Franz (II.) Rákóczi gingen als Rebellen wider den habsburgischen Thron in die ungarische Geschichte ein. Ihre Heere spiegelten – wie auch das königliche habsburgische – ein Völkergemisch, in dem die Slawen jedenfalls eine quantitativ wichtige Rolle spielten und einen hohen Blutzoll zu entrichten hatten.
Mit der osmanischen Niederlage vor Wien im Jahre 1683 und der Zurückdrängung der Osmanen aus Kernungarn änderte sich die geopolitische Großwetterlage ein weiteres Mal. Der habsburgische Regent Leopold I. zwang seinen ungarischen Gegenspieler Emmerich Thököly zur Flucht ins Osmanische Reich. Alles Evangelische wurde katholisch gemacht, die protestantischen Kirchen geschlossen, das Kirchengut eingezogen, Pastoren zum Abschwören der ketzerischen Lehren gezwungen, Widerständige auf Galeeren gezwungen und in einem Schauprozess in Prešov/Eperies 24 Anhänger Luthers – Deutsche, Ungarn und Slowaken – öffentlich hingerichtet.18 Der Friedensschluss von Karlowitz/Sremski Karlovci im Jahre 1699 beendete die türkische Präsenz, ganz Ungarn kam unter das habsburgische Zepter. Der ungarische Adel blieb auch ohne indirekte osmanische Unterstützung dem habsburgischen Herrscherhaus skeptisch bis feindlich gesinnt.
Der slowakische Robin Hood: Juraj Jánošík
Slowakische Identifikationsfiguren machen sich im Angesicht des Kampfes ungarischer Feudalherren gegen den habsburgischen Thron und den Begehrlichkeiten großteils deutscher Bürgerstädte im historischen Kontext jener Zeit rar. Eine der wenigen, die es über die Jahrhunderte geschafft hat, im kollektiven Gedächtnis zu verbleiben, ist die Person des Juraj Jánošík. 1688 als Sohn leibeigener Bauern im nordwestslowakischen Terchová geboren und von Kindesbeinen an mit der Fronarbeit konfrontiert, nützt er seinen Militärdienst zur Desertion und muss sich in der Folge versteckt halten, um regelmäßigen militärischen Streifungen zum Aufgreifen von Deserteuren zu entgehen. Als Führer einer Räuberbande erlangt Jánošík einen legendären Ruf, der jenem Robin Hoods oder des österreichischen Grasel ähnlich ist. Zu seiner Berühmtheit trägt vor allem der sozialrebellische Charakter seiner Bande bei, die ihre Überfälle auf reiche Kaufleute und Adelige als Umverteilungsaktionen darstellen kann. Einer ersten Verhaftung im Jahre 1712 entzieht er sich durch Flucht, was seinen märchenhaften Ruf als scheinbar unbesiegbaren Helden der Armen verstärkt. Am 18. März stirbt Jánošík nach kurzem Prozess durch Erhängen in Liptovský Svätý Mikuláš.19 Bereits in den 1920er-Jahren hat ihn die slowakische Historiographie und noch mehr das romantische Volksempfinden zu einem Volkshelden stilisiert, was er auch im kollektiven Bewusstsein der kommunistischen Epoche geblieben ist.
14 Josef Spetko, Die Slowakei. Heimat der Völker. München 1991, S. 194
15 Spetko, Slowakei 1991, S. 37
16 Viliam Čičaj, The period of religious disturbances in Slovakia. In: Mikuláš Teich/Dušan Kováč/Martin Brown (Hg.), Slovakia in History. Cambridge 2011, S. 80
17 ebd., S. 74
18 Roland Schönfeld, Slowakei. Regensburg 2000, S. 43
19 Schönfeld, Slowakei, S. 44
Slowakisches Erwachen (1785–1918)
Um einen Zeitpunkt für jene nationale Erweckung, die von romantischen Autoren als slowakische Wiedergeburt bezeichnet wird, zu finden, hält die Geschichte eine ganze Reihe von möglichen Daten bereit, die allesamt brauchbar wären und doch wieder als eigentliche Zäsur nicht taugen. Wir haben uns für jenen Moment entschieden, an dem Joseph II. die Leibeigenschaft aufhob. Unter dem Eindruck aufklärerischer Schriften dekretierte der Reformkaiser im Jahr 1785 die Abschaffung der Leibeigenschaft für die ungarischen Länder.20 Damit blieben Millionen in grundherrlicher Abhängigkeit gehaltene Bauern zwar in Untertänigkeit gegenüber den Feudalherren, wurden aber Menschen mit persönlichen Freiheiten. Vor allem für die slawisch sprechende Mehrheit auf dem Gebiet der späteren Slowakei war dieses Datum also von zentraler Bedeutung. Denn anders als Magyaren oder Deutsche waren die allermeisten von ihnen besitzlos, hatten keine Bürgerrechte in der Stadt und noch weniger Grund und Boden auf dem Land. Die Aufhebung der Leibeigenschaft eröffnete für so manchen von ihnen erstmals persönliche Aufstiegschancen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!