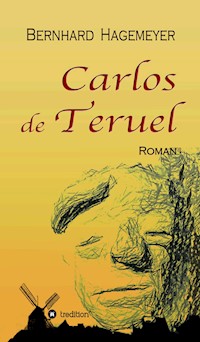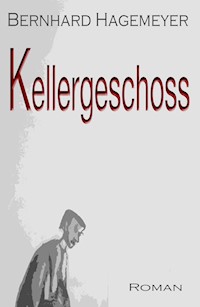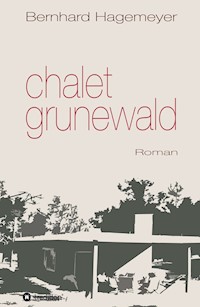8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Balkenstube – vielen ein Fremdwort. Auf dem Dachboden alter Häuser, ein enger Raum unter dem Schrägdach, Schlafstätte oder Abstellkammer. Oberstübchen – Ort der Erinnerung. In seinem Roman mit dem außergewöhnlichen Titel bearbeitet der Autor Bernhard Hagemeyer die Problematik von Verstrickungen mit dem Nationalsozialismus. Archive werden studiert und Briefwechsel aufgestöbert, die manche Überraschung zu Tage fördern. Archivar Piepenschroer ist von Archivdirektor Dr. Büsensen, vom neo-völkischen Gedankengut besessen, nach Tannenhues abkommandiert, um im ausgelagerten Archivmagazin des Ministeriums über Verwicklungen von Persönlichkeiten mit dem NS-Regime zu forschen. Er wird immer tiefer in einen inneren, schmerzhaften Konflikt getrieben: Soll er Licht in die dunkle Vergangenheit bringen und NS-Verbrechen aufdecken oder aber Spuren verwischen und Ergebnisse vernichten? Dabei wird er mit seiner eigenen Lebenslüge konfrontiert. Nur Ellen, Wirtin der Dorfkneipe, die selbst unter dem traumatischen Erlebnis einer brutalen Vergewaltigung leidet und darüber ihr Gottvertrauen verloren hat, steht ihm fürsorglich bei. In dieser vorsichtigen Begegnung zweier Menschen, die nie richtig gelernt haben, Nähe und Vertrautheit zuzulassen, berichtet Piepenschroer nur ihr über unfassbare Zusammenhänge in seinem Lebensweg. Er spricht von Erkenntnissen, die allein durch Erinnerung möglich sind, und führt sie in das Haus der Anámnesis, das er in seiner Balkenstube auf dem Dachboden des Archivmagazins baut. Ellen versteht die Metapher nicht und bekommt Angst. Genealoge Düsterkoven, nach Tannenhues gereist, um seine wissenschaftlichen Arbeiten abzuschließen, erfährt durch einen Zufallsfund vom Schicksal des jungen Ehepaares Grünebrede. Er stößt, von Piepenschroer tatkräftig und entgegen dessen Auftrag unterstützt, auf NS-Verstrickungen seines ehemaligen Geschichtslehrers Coblus und schließlich auf unglaubliche Verflechtungen in seiner eigenen Vita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Balkenstube
Bernhard Hagemeyer
Balkenstube
Roman
© 2018 Bernhard Hagemeyer, Balkenstube
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
E-Book:
978-3-7469-6107-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Meiner Familie
1
Düsterkoven kam sich dumm vor. Er konnte sich die Zusammenhänge nicht erklären. Etwas schien aus den Fugen geraten.
Vor einigen Tagen machte er eine merkwürdige Bekanntschaft. Es war während einer akademischen Veranstaltung von Prof. Buckebruek, gesponsert von einem europäischen Lobbyisten-Verband, als ein Herr auf ihn zutrat, sich mit Hagenkötter vorstellte und ihn geradewegs fragte, ob er, Düsterkoven, mit ihm, Hagenkötter, Ernst Hagenkötter sein Name, mög-lich-er-wei-se verwandt wäre.
„Sie werden gleich die Beziehungskiste öffnen“, ermunterte Düsterkoven, „schießen Sie los!“
Hagenkötter erzählte von einer Cousine seiner Großmutter, die den Onkel seines Vetters, ein Düsterkoven ... Sie lachten, weil Hagenkötter sich im Familiengestrüpp verhedderte. Und das wenige, das Düsterkoven über seine Familie hätte beitragen können, wollte er nicht preisgeben. Warum sollte er?
Sie standen mit anderen geladenen Gästen, die sich die Welt schönredeten, an einem Stehtisch, als plötzlich für Sekunden das Licht ausfiel. Ein Blitz, gefolgt von einem kurzen krachenden Donnerschlag, hatte offenbar ganz in der Nähe eingeschlagen.
Als wäre nichts passiert, meinte Hagenkötter: „Ich habe von Professor Buckebruek, mit dem ich eng befreunde bin, von Ihrer Doktorarbeit, die Sie bei ihm schreiben, erfahren und, wie ich soeben feststelle, da auch Sie nicht so recht in unserer Sippschaft zuhause sind ...“
Düsterkoven wog bedenklich den Kopf. „Na, ja“, warf er amüsiert ein.
„ ... denke ich, Sie sollten mal - zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn Sie verstehen, was ich meine - nach Tannenhues fahren und dort in einem ausgelagerten Archivmagazin des Ministeriums einen Familienarchivar namens Piepenschroer aufsuchen. Der Mann dort, ein ausgewiesener Experte, mir persönlich von einem Ministerialbeamten, Archivdirektor Dr. Büsensen persönlich empfohlen, kann Ihnen bestimmt weiterhelfen.“
Während er sprach, strich er mit Daumen und Zeigefinger über seinen eminent dicken Schnauzbart oder gestikulierte weit ausholend mit seinen Armen, hob die Augenbrauen, rollte die Augen und hielt den Blick schräg nach oben gegen die Decke gerichtet. Dann wieder hatte er auf die Uhr geschaut, auf seine manikürten Fingernägel und dabei den rechten kleinen Finger derart affektiert zur Seite gespreizt, dass es unmöglich war, einen protzigen Siegelring zu übersehen.
Düsterkoven hatte den Eindruck, sein angeblicher Verwandter wollte sich tiefer Dunkelheit an etwas erinnern. Vergessenes, tief Versunkenes aus dem Gedächtnis zurückholen. Er fühlte sich unangenehm berührt, spürte etwas Beklemmendes, um nicht zu sagen Irritierendes, das von Hagenkötter ausging.
„Ja, warum nicht? Sind wir wirklich verwandt?“, fragte er mit einem skeptischen Grinsen.
Erneut schreckte ein harter, schließlich dumpf ausrollender Donnerschlag die Gesellschaft auf. Piepenschroer? Tannenhues? Wo liegt das? Hagenkötter? Von einem Onkel oder Vetter Ernst hatte er noch nie etwas gehört. Wie hieß der Archivdirektor noch?
„Könnte dich jedenfalls interessieren, oder?“, duzte Hagenkötter ihn ungeniert und schmeichelte, ihm eile der Ruf eines genialen Genealogen voraus.
Düsterkoven hätte sich nachhaltiger erkundigen sollen - dann wäre das Gespräch schnell beendet gewesen. Mehr noch: Ein perfides Lügengebäude wäre zusammengebrochen.
Aber er kam nicht dazu. Professor Buckebruek war herbeigeilt und hatte das Gespräch unterbrochen: „Düsterkoven - wir müssen los! Ich muss mit Ihnen reden.“
Auf dem Weg zur Garderobe, weiter zum Ausgang antwortete Buckebruek auf Düsterkovens Frage, wer dieser Hagenkötter sei: „Notar, gleichwohl ein Schwätzer, ein unangenehmer obendrein. Das Archiv liegt unter jedem wissenschaftlichen Niveau, die Fahrt nach Tannenhues können Sie sich schenken, und der Mann dort ist bibliografisch unbekannt.“
Düsterkoven half seinem Professor in den Mantel, der sich artig bedankte. „Im Übrigen sind Staatsexamina angesagt, Düsterkoven“, fuhr er fort, „Klausuren zu begutachten und ich zähle auf Sie.“ Er drohte mit erhobenem Zeigefinger, weil er wusste, wie Düsterkoven, sein wissenschaftlicher Mitarbeiter, seinAmanuensis, wie man in Akademikerkreisen zu sagen pflegte, reagieren würde: Je mehr er abriet, umso widerborstiger konnte Düsterkoven reagieren und sich für das Gegenteilige entscheiden.
In diesem Moment beschloss Düsterkoven trotzig, in den nächsten Tagen einen Herrn Piepenschroer in Tannenhues aufzusuchen.
Die Fahrt in seiner schwarz-rot lackierten2CV-Limousine bereitete ihm Freude. Selbst wenn er nicht so schnell fahren konnte und gelegentlich von rasenden, fluchenden oder wild gestikulierenden Autofahrern überholt wurde - dieEnte, wie er sein Auto liebevoll nannte,belohnte ihn mit einem unvergleichlichen Freiheitsgefühl.
Das Verdeck zurückgerollt und das halbgeteilte Fenster hochgeklappt, ließ er den linken Arm lässig im Fahrtwind hin- und herpendeln und flötete, so gut er konnte, ein Liedchen vor sich hin. Plötzlich war etwas gegen den Rahmen der Windschutzscheibe geknallt. Er musste derart scharf abbremsen, dass der Wagen zu schlingern begann und aus der Spur geriet, er es aber dennoch schaffte, ihn, nur einen knappen Meter vom Straßengraben entfernt, zum Stehen zu bringen. Mit dem Kopf wäre er beinahe gegen das Lenkrad gestoßen, hätte er sich nicht instinktiv mit beiden Händen am Lenkrad abgestützt. Die Handgelenke schmerzten. Auf der Beifahrerseite der Frontscheibe klebten lange, braunweiße Federn, offenbar die eines größeren Vogels. Entsetzt stieg er aus, schaute sich um, ging einige Meter die Straße zurück, suchte das vermutlich schwer verletzte Tier am Straßenrand, im Graben und auf der anderen Straßenseite – nirgends. Schockiert, auch traurig, dass er der sterbenden Kreatur nicht hatte helfen können, setzte er die Fahrt fort.
„Was will ich eigentlich?“, fragte er laut und ließ den linken Arm wieder aus dem Fenster baumeln. Abgesehen davon, dass ihm Hagenkötter einen dürftigen Hinweis und Buckebruek ihm abgeraten hatte, wusste er nicht genau zu sagen, was ihn nach Tannenhues zog. Er wusste es auch später nicht; denn er hatte die Frage nie klar und deutlich sich selbst gestellt.
„Wird sich zeigen. Der Weg entsteht im Gehen“, gab er sich selbst zur Antwort und erinnerte sich an den spanischen Dichter Antonio Machado und dessen GedichtCaminante - Wanderer, da ist kein Weg. Im Gehen entsteht der Weg. Deine Spur ist der Weg. Sonst nichts. Schaust du zurück, siehst du den Pfad, der nie mehr begangen wird. Nur Kielspuren im Meer.
2
Der Einzug eines Memoirenberaters und Familienarchivars in ein ausgelagertes ministerielles Archivmagazin im ehemaligen Tannenhueser Pfarrhaus hatte sich auch in der Bevölkerung herumgesprochen. Die Regionalpresse hatte berichtet. Jetzt kamen sie wieder. Meist jüngere Leute, die Piepenschroer die Vergangenheit ihrer Vorfahren brachten: Verschlossene oder aufgebrochene Tagebücher, Tonbänder, zerfledderte Fotoalben, mit Bildern aus glücklichen Kindertagen und von jubelnden Soldaten, die begeistert in die Schlachten des Ersten Weltkrieges gezogen waren. Vor allem aber Briefe: Kriegserlebnisse und Todesnachrichten über Gefallene im Zweiten Weltkrieg. Traumata aus Konzentrationslagern oder Gefangenschaften. Schicksale der aus Deutschland Geflohenen oder aus dem Osten Vertriebenen. Sorgfältig gebündelte Liebesbriefe, zum Teil noch mit getrockneten Blümchen geschmückt. Dokumente und Schriftstücke, die man zwar nicht wegwerfen, aber auch nicht bei sich zuhause aufbewahren wollte.
Anders als die Jugend hatten ältere Herrschaften erkannt: Man müsse die Vergangenheit dem Vergessen entreißen. Eine ältere Dame, klein, auffällig elegant gekleidet, allerdings mit einem Gesicht, das an den Querschnitt eines Baumes erinnerte, der, jahrelang ausgetrocknet, tiefe Furchen aufwies, meinte, sie sei zu alt für die Vergangenheit. Sie gab vor, Schriftstellerin zu sein. Sie hättebiografisches Material aus unterschiedlichen Kreisen und Zeiten gesammelt und bereits Unmengen an Tagebüchern, Briefwechseln, Lebensaufzeichnungen und Fotografien erhalten. Sie hätte erst darüber ein Buch schreiben wollen. Ein Erinnerungsbuch. Dem Vergessen widerstehen. Der Vergangenheit ein Echo geben. Doch jetzt würden ihre Kräfte versagen. Sie hatte das so poetisch formuliert, dass er einen roten Kopf bekam, die Kisten in den Flur stellte, die Dame mit einem angedeuteten Handkuss und „Ich kümmere mich drum!“ verabschieden wollte.
Ob er eigentlich wisse, in welchem Gemäuer er arbeite, wollte die Frau wissen. Sie machte keine Anstalten zu gehen, freute sich offensichtlich, einen Gesprächspartner gefunden zu haben. Sie sprach mit heiserer Stimme und so leise, dasser nicht sicher war, ob er sie richtig verstand.
„Nein, ja, schon, natürlich“, stotterte er. „Sind Sie von hier, aus Tannenhues?“
„Ich will Sie von Ihrer Arbeit nicht abhalten, guter Mann. Geh gleich wieder.Im Januar 1933 war der katholische Pfarrer dieser Gemeinde verstorben. Noch auf dem Sterbebett hielt er seinen Kirchenküster Bröselamm an, das alte Pfarrhaus als Gemeinde- und Familienarchiv zu pflegen. Die baufällige Kirche werde zukünftig nicht mehr genutzt, entweiht und kirchenrechtlich geschlossen. Und somit sei auch er, Bröselamm als Sakristan, nicht mehr gefragt. Er möge sich aber um das Archiv kümmern und als Kirchenbuchführer nützlich machen. Mit Genehmigung derobersten Heeresleitung, wie Bröselamm das bischöfliche Vikariat nannte, hatte er das leerstehende Pfarrhaus bezogen und als sogenannter Gemeinde- und Familienarchivar gearbeitet.“
Die Frau machte eine kurze Pause. Holte tief Luft, schnaubte sich die Nase, stopfte das Taschentuch recht umständlich in ihre Handtasche, so als wolle sie sich Zeit nehmen, um ihren Gedanken neu zu formulieren. Schließlich sagte sie: „Nach Hitlers Machtergreifung da hatte er viel zu tun, der Bröselamm. Da wurde die Bevölkerung gezwungen, angemessene Beweise für ihre arische Abstammung vorzulegen. Wir waren schon einmal hier. Damals wollten wir in die Kirchenbücher schauen und Abschriften von Tauf-, Geburts- und Heiratsurkunden. Ariernachweise. Ahnenpässe. Wer keinen judenfreien Stammbaum beibringen konnte, wurde aus dem Staatsdienst entlassen oder mit Berufsverbot belegt. So war das früher. Das wissen Sie sicher. Aber was Sie nicht wissen: Bröselamm hielt die Hand auf. Wer kein Geld hatte, bekam keine Beglaubigung. Die meisten verschwanden daraufhin im Nirgendwo. So war das damals!“, wiederholte sie, wandte sich zum Gehen und kam zurück. „Einige Jahre nach dem Krieg hatte er sich noch durchgewurstelt, dann war er mit einem Mal verschwunden. Ich wollte ihn sprechen, zur Rede stellen. Pustekuchen! Die Vergangenheit schien sich in alle Richtungen zu verkrümeln.“
Piepenschroer wusste nichts mit dem Wort anzufangen. Pusteblume, ja, aber Pustekuchen? Er war versucht zu fragen, warumzur Rede stellen?Er nickte nur und zeigte mit hochgezogenen Augenbrauen vorgetäuschtes Interesse. Die Frau drehte sich ab und sagte eher beiläufig: „Was ich Sie noch fragen wollte: Kennen Sie einen Herrn Coblus? Oder einen Herrn Träfter?“
Piepenschroer verneinte, spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss, und die alte Dame sah ihm an der Nasenspitze an, dass er log. Da schob sie den Ärmel ihrer Bluse hoch. Als sie ihm eine blauschwarz tätowierte Nummer auf dem Unterarm zeigte, sie dennoch lächelte, verstand er nicht, was in ihm vorging. Er sah nur die Traurigkeit, die in ihren Augen lag. Nachdem sie gegangen war, stand er lange so da im Türrahmen - bis ihm bewusst wurde, wie kalt es war.
•
Die Nachbarn wollten sich weder an die Zeit, noch an die näheren Umstände von Bröselamms Flucht erinnern. Über den ehemaligen Küster auch nur einen Satz zu verlieren, lohne nicht, hatte jemand, der am Tresen in der KneipeIm Krug zum grünen Kranzeneben Piepenschroer stand, spitz entgegnet, als das Gespräch auf seinen Vorgänger kam. Man müsse unter die Vergangenheit auch mal einen Schlussstrich ziehen. Die Geschichte ruhen lassen. Man lebe schließlich im Jahre des Herrn 1975 - „zwanzig Jahre her, als wir den Krieg verloren hatten“, hatte er gemault. Die Alliierten hätten mit aller Akribie nach Nazis geforscht. Da müsse man nicht päpstlicher sein als der Papst. Und der Alte aus Rhöndorf, der Adenauer, hatte mit dieser Haltung schon Recht. Dann fingen sie wieder an zu schnüffeln, die sogenannten Achtundsechziger, die selbsternannten Revoluzzer. Und Sie? Ich kenne Sie gar nicht. Was machen Sie überhaupt hier?“, fragte der Mann. Der Bierschaum hatte einen weißen Schnurbart hinterlassen, den er mit dem Handrücken abwischte.
„Nichts ist denkbar ohne ein Vorher“, antwortete Piepenschroer und wunderte sich über seine Ausdrucksweise, die er sich längst abgewöhnt hatte.
Eine Frau, zwei Hocker weiter, schaute zu ihnen rüber. Piepenschroer hatte den Eindruck, weil sie so energisch mit dem Kopf gewackelt hatte, sie würde dem Mann widersprechen.
„Ich will Ihnen mal was sagen“, hob der Mann den Zeigefinger, „die deutsche Geschichte besteht aus mehr als diesen zwölf Jahren. Das sollte auch bei Ihnen angekommen sein. Unser Pfarrer hier, Gott hab ihn selig, pflegte bei ähnlichen Gesprächen zu sagen: Damals weigerten sich die Leute, die Realität wahrzunehmen. Es gibt kein Ende der Geschichte.Wenn Sie Weltgeschichte aus der Nähe betrachten, sehen Sie gar nichts!Die Zeit vor und die Zeit nach 1933. Wahrnehmungsverweigerung bis zu partieller Blindheit. Und das gebe ich Ihnen noch mit auf den Weg, was unser Herr Pastor, Gott hab ihn selig, sagte:Gehen Sie davon aus, dass wir nicht Gefangene unserer Vergangenheit sind. Ich für meinen Teil gestalte meine Zukunft schon selbst. Bin Gewinner. Nicht Verlierer. Also, guter Mann, ich bin weder geschichtsvergessen noch geschichtslos. Es gibt kein Ende der Geschichte. Das war’s, mein Herr! Lassen Sie uns in Ruhe! Guten Tag! Und einmal muss auch Schluss sein“, polterte er weiter, sodass sich die Frau jetzt doch zu Wort meldete.
Piepenschroer fand, das könnte ein interessantes Kneipengespräch werden. Rede, Widerrede, schimpfen, drohen und jammern: Stammtisch eben.
„So ist es!“ rief die Frau und klatschte in die Hände. „Man kann die nachfolgende Generation nicht ständig mit der Vergangenheit konfrontieren und damit ihre Zukunft belasten. Vergangenheit ist Geschichte!“, rief sie. Dann trat sie ganz nah heran: „Sicher gab es Schuld und Irrtum, aber ob die Jugend von diesen alten Geschichten noch etwas hören will? Und wir Deutschen hatten unter Hitler wieder das Gefühl bekommen, Herr im eigenen Haus zu sein. Jetzt gibt man uns die Schuld. Spionieren in unserem Privatleben herum. Pfui, Teufel! Der Bröselamm, das war ein anständiger Kerl. Der wusste zu unterscheiden zwischen Ariern und Nichtdeutschen. Gott, es war die Zeit! Unser Leben! Wir waren jung! Hatten keine Vergangenheit. Jetzt plötzlich will man sie aufdecken. Wir leben heute in der Gegenwart. Und damals waren wir in dem Alter - da stellte man keine Fragen. Und wenn, bekam man keine Antworten. Man vertraute einfach. Es war jedenfalls üblich ...“ Sie machte plötzlich ein Pause, holte ihr Bierglas und trank es leer. „... sind Sie etwa auch so ein Naseweis? Hier im Archiv?“, fragte sie, drehte Piepenschroer den Rücken zu, ohne ihm Gelegenheit für eine Antwort zu geben oder eine Frage zu stellen. „Man hält es nicht im Koppe aus!“, rief sie und bat Ellen, die Wirtin, um einen Schnaps.
Piepenschroer überlegte kurz, ob er von sich erzählen sollte. Er hätte von der Wirklichkeit, von seiner Geschichte als Erfahrung erzählt und beiden die Wahrheit ins Gesicht gesagt - die Wahrheit, die mehr schmerzt als die Lüge. Doch er beließ es dabei. Er musste ohnehin zurück. Besuch hatte sich angemeldet.
3
Kommen Sie herein. Piepenschroer, Alois Piepenschroer mein Name.“ Horst-Heinrich Düsterkoven wäre beinahe über die niedrigen Türschwelle gestolpert, wartete höflich, machte einen schnellen Diener und stellte sich vor: „Angenehm, Endenich, Fritz Endenich. Danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben, Herr Piepenschroer!“ und folgte ihm durch einen langen schmalen Flur in einen seltsam eingerichteten Raum.
„Was treibt Sie zu mir? Nehmen Sie Platz, Herr Endenich, wo immer Sie möchten.“ Viel Auswahl hatte Düsterkoven nicht. Während er sich in einen verschlissenen Korbsessel setzte, sagte er: „Es geht um einen Forschungsauftrag.“ Wortlos, leicht vor sich hin schmunzelnd, legte er seine Visitenkarte auf den Tisch. Wie leicht ihm der Name über die Lippen ging!
„Darf ich?“, fragte er und nestelte eine Zigarette aus einem Zigarettenetui. Piepenschroer nickte und kramte seinerseits eine Pfeife aus der Jackentasche. Das Pfeife ansteckende Ritual sichtlich genießend, stopfte er den Tabak erst leicht, dann fester in den Pfeifenkopf, steckte ihn mit einem Streichholz nur oberflächlich in Brand, drückte mit dem Zeigefinger leicht nach, erneut ein brennender Streichholz, zwei, drei kräftige, paffende Züge hintereinander - lässig erwartungsvoll ließ er sich in seinen Schreibtischsessel fallen und lehnet sich weit zurück. Sein Kopf verschwand im dicken Rauchnebel.
Der Mann ruht in sich selbst, dachte Düsterkoven, steckte sich die Zigarette mit einem edlen Gasfeuerzeug an und inhalierte tief. Erst jetzt bemerkte er, daß Piepenschroer zwar einen feinen Nadelstreifenanzug, an den Füßen aber braun-weiß karierte Pantoffeln trug.
„Ein entfernter Verwandter, ein Freund meines Professors Buckebruek, hatte mich auf Sie aufmerksam gemacht. Ein merkwürdiger Mensch zwar. Aber wenn es der Wahrheitsfindung dienlich ist...“, lachte Düsterkoven etwas zu laut. „... aber er hatte Ihr Archiv lobend erwähnt und Sie als wissenschaftliche Koryphäe wärmstens empfohlen, wenngleich Prof. Buckebruek meinte, in ...“
Piepenschroer schien nicht zuzuhören, rümpfte die Nase und ging in die Küche. „Reden Sie nur weiter. Hole etwas zu trinken“, rief er von dort und brachte auch seinem Besucher ein Glas Wasser mit. Dann legte er sein Jackett über eine Stuhllehne, kniete sich vor eine Wand und machte einen Kopfstand. „Lassen Sie sich nicht stören. Ich höre zu!“, brummte er von da unten und ließ die ausgelatschten Hausschuhe herunterfallen.
Düsterkoven verschlug es die Sprache und wartete, bis Piepenschroer seinen Kopfstand beendet hatte. Einmal mehr fragte er sich, warum er überhaupt hierher gekommen war. Schließlich ließ er seiner Fantasie freien Lauf und fuhr fort: „Möglicherweise passt die von meinem Vetter erwähnte Idee mit dem anspruchsvollen Promotionsthema zusammen. Hoffe ich wenigstens.“ Schließlich stand er auf, drückte die Zigarette aus und machte Anstalten zu gehen. Was sollte er hier? Buckebruek hatte recht - verlorene Zeit.
„Nun zur Sache, Herr Endenich.“ Piepenschroer nahm mit hochrotem Kopf wieder Platz. „Wie wär’s, wenn Sie ... aber bitte: Behalten Sie doch auch Platz! Sie sprechen von einer wissenschaftlichen Studie, richtig? Von einem Forschungsauftrag.“
Düsterkoven druckste herum. Kramte aus seiner Jackentasche einen Zettel, den er schon seit Wochen mit sich herumschleppte. „Ich muss das ablesen“, lachte er wieder:„Die Genealogie der Soziologisierung in der Ökonomietheorie des 20. Jahrhunderts, familiengeschichtlich dargestellt anhand von vornehmlich privaten Unterlagen aus Handwerkerfamilien in mittelständischen Kleinstädten.“
Piepenschroer lehnte sich weit zurück, grinste und paffte gedankenverloren seine Pfeife: Möglicherweise - hatte sein Besucher Endenich wirklich dieses Wort benutzt? Aber nicht gedehnt, wie sein früherer Vorgesetzter im Ministerium, Archivdirektor Dr. Gustav Büsensen. Und der hier? Erzählte und lachte. Warum diese Nervosität? Eine Familiengeschichte als theoretische Abhandlung oder als Spiegel der Vergangenheit? Wie hatte vor kurzem das alte Mütterchen gemeint:Der Vergangenheit ein Echo geben.Richtig - das war als Archivar sein Job. Er wird seinen Besucher bei Gelegenheit, sollte sie sich mal ergeben, fragen, wie der Verwandte hieß. Er glaubte, ihn zu kennen. Mög-lich-er-wei-se versteckte er sich hinter einer Maske. Masken trugen alle. Auch Fratzen. Hassfratzen, hinter denen nichts als Trümmer, stinkender Unrat und schneidende Gefühlskälte steckten. In diesem Moment, während ihm das Wort Maske durch den Kopf ging, musste er schmunzeln. Er erinnerte sich an seinen grotesken Auftritt während der ministerialinternen Osterfeier vergangenen Jahres: Er hatte sich als Weihnachtsmann verkleidet und auf Pappe ein fotografiertes Konterfei von Büsensen geklebt. Der Schnauzbart etwas zu wuchtig, dennoch: Idee und Ausführung fand er, im Spiegel betrachtet, gelungen. Als er zu den bereits feiernden Kollegen gestoßen war, sein Gesicht bedeckt mit der Chef-Papp-Fratze, hatte er gerufen:Mög-lich-er-wei-se kommt zu Ostern auch der Weihnachtsmann!Das Riesengelächter hörte er jetzt noch. Aber ein überaus beleidigter Büsensen hatte mit hochrotem Kopf und noch heller als sonst leuchtenden, abstehenden Ohren umgehend die Veranstaltung verlassen. Danach war die verschwiegene Verbundenheit zwischen ihnen beendet. Nachhaltig gestört wenige Tage später auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Eisiger Dauerfrost. Im Hintergrund hatte Büsensens Sekretärin, Fräulein Tösse, die Strippen gezogen: Früher die Freundlichkeit in Person. Plötzlich ein Eisblock. Kratzbürstig, streng, harsch und laut im Tonfall hatte sie ein Dickicht von finsteren Intrigen, Anfeindungen und Gehässigkeiten gesponnen. Zwischen den Kollegen tiefe Bruchlinien. Von Büsensen nur noch gespielte Freundlichkeit. Lautes Gepolter, Brüllen und Türenschlagen. Er selbst hatte in seiner Not versucht, den Krampf am Arbeitsplatz mit einer betont skurriler Garderobe, auch mit flotten Sprüchen zu überspielen, mal mit lautem, unbeherrschtem Lachen, mal in seinem rheinischen Singsang so leise vor sich hin blubbernd, dass ihn niemand mehr verstand. Simulierte schwere Alterssichtigkeit, wenn er statt seiner kreisrunden Bügelbrille einen Kneifer mit dicken Gläsern auf seinen markant vorstehenden, schmalen und nach vorn spitz zulaufende Nasenrücken klemmte und die Umwelt nur noch schemenhaft wahrnahm. Oder ein Lorgnon aus der Jackentasche fingerte, herumdruckste und dabei immer wieder ein böse klingendes Kichern von sich gab. Alsbald hatte er sich nicht nur einen rotbraunen Bart, sondern auch seine Nasenhaare wachsen lassen und sein strohgelbes Haar mehr und mehr der Natur gehorchend oben luftig, unten dafür umso länger getragen. Lockerte es gelegentlich mit Dauerwellen auf. Seine Theatralik wirkte wie die einer alten, eigensinnigen, gouvernantenhaften Diva, zunehmend abstoßend und unsympathisch. Fehlte nur noch, dass er Rouge auflegte und seine schmalen Lippen mit lila Farbe schminkte. Er war verzweifelt und wusste es: Er hatte seine Mitte verloren. Heute konnte er darüber lachen. Als Familienarchivar. Memoirenberater. Hier in seinem Tannenhueser Archiv, in das ihn Büsensen abkommandiert hatte.
„Ich kümmere mich drum“, murmelte Piepenschroer und grinste. Er tat so, als nähme er seinen Besucher gar nicht wahr und wich seinem fragenden Blick aus.
„Was sagten Sie? Warum grinsen Sie so verschmitzt, Herr Piepenschroer? Was habe ich zu Ihrer Erheiterung beigetragen?“, fragte Düsterkoven.
Piepenschroer stand auf, reichte ihm zum Abschied die Hand und begleitete den Besucher grußlos mit sanftem Druck durch den langen, schmalen Flur zur Haustür nach draußen.
„Ach nichts. Habe mich an etwas erinnert. Hat nichts mit Ihnen, Herr Endenich, zu tun“, antwortete Piepenschroer und setzte wieder eine ernste Mine auf. „Aber, Herr Endenich, warten Sie. Laufen Sie nicht weg!“
Piepenschroer eilte zurück.
„Verdammte Scheiße!“, hörte Düsterkoven ihn brüllen.
„Was ist passiert?“
„Verfluchte Kiste! Hexenschuss! Hier Unterlagen, Papiere und sonstiger Kram in diesem albernen, rot lackierten Wäschekorb, den ich schon längst hätte sichten sollen. In die Abfalltonne kommt nichts. Erinnerungen gehört nicht auf den Müll! Ich bin kein Müllschlucker, abgefüllt mit Aktenordnern und Fotoalben! Sehe ich aus wie ein Altpapiersammler? Hier, ein alter, abgegriffener Schuhkarton voller Briefe. Hab mal reingeschnuppert. Von einem jungen Mädchen ein Tagebuch mit aufgebrochenem Schloss. Das könnte Sie mög-lich-er-wei-se interessieren. Vielleicht ist es etwas für Sie. Damit könnten Sie, Herr Endenich, ja schon mal anfangen. Wahrscheinlich von geringem Interesse. Aber wiederbringen!“
Tief gebeugt, mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt er sich am Türrahmen fest und sah misstrauisch hinterher, wie Düsterkoven hocherfreut, den Wäschekorb unterm Arm, zu seinerEnteging. Zurück im Archiv, drehte er die Heizung bis zum Anschlag auf. Ihn fröstelte trotz der sommerlichen Wärme.
Auf geschwungenen Landstraßen ging es in der leicht hügeligen Landschaft zurück durch Felder und Wälder, mal durch kleine Ortschaften, vorbei an gepflegten Bauernhöfen, dort Streuobstwiesen, hier Obstplantagen oder Viehweiden. Ich hätte die Windschutzscheibe von blutverklebten Vogelfedern reinigen sollen, dachte er. Anhalten wollte er deshalb nicht.
Fritz Endenich
Genealoge
Akademischer Amanuensis
„Die Visitenkarte ist unvollständig“, murmelte Piepenschroer und strich mit dem Mittelfinger über den Namen: Feinster Stahlstich auf Elfenbeinkarton. Er schaute auf die Rückseite. Telefonnummer handgeschrieben: Ist die Sechs nun eine Null oder die Null eine Sechs? Eigenartig. Was ist denn ein Amanuensis? Im Lexikon steht: Hilfsassistent eines Wissenschaftlers,HiWi.Damit konnte er nichts anfangen. Da Piepenschroer aber von Beruf wegen nichts wegwarf, legte er die Karte in die Schreibtischschublade zu Medikamenten und zu seiner Mundharmonika. Unbeobachtet, spielte er darauf schon mal Volkslieder. Oder sang a cappella:
In einem Polenstädtchen. Da fand ich einst ein Mädchen. Das war so schön.
Er kannte alle Strophen auswendig. Lang, lang ist es her, dass er den Gassenhauer mal mehr, mal weniger begeistert mitgesungen hatte. Ein unangenehmes Gefühl beschlich ihn. Gedanken eilten davon und kamen mit Bildern zurück.
Damals - das Datum wird er nicht vergessen - am 20. April 1933 hatte er mit Büsensen eine Vereinbarung getroffen, um nicht zu sagen einen Pakt geschlossen. Und auf den Tag genau zwanzig Jahre später, hatte er als Spätheimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft beschämt, in abgerissenen Wehrmachtsklamotten vor ihm gestanden und um Hilfe gebeten. Als Büsensen ihn vorwurfsvoll auslachte, da wusste er nicht an sich zu halten, hatte bitterlich zu weinen begonnen und Büsensen von seinem Kriegstrauma erzählt. Daraufhin hatte ihn Büsensen in seiner zynischen Art geantwortet:Haben wir uns dir, oder hast du dich uns aufgedrängt? Du, Piepe, hast nichts Besseres verdient als eine Bettelsuppe!Die würde er ihm großzügig gewähren unter einer Bedingung: Es müsse imVerein Mythogarttatkräftig mitarbeiten und ihn bei der Herausgabe seiner ZeitschriftDie neue Kakerlakejederzeit unterstützen. Da hatte er einmal mehr per Handschlag, zugleich hoffnungsvoll und irritiert zugesagt. Daraufhin sorgte Büsensen für eine Einstellung im Ministerium. Zunächst im Personenstandsregister, dann im Dezernat für kulturelle Angelegenheiten, Abteilung 2, Referat 21/22 Archivgut, Zentrale Dienste, Verwaltungsangestellter. Mehr wollte er auch nicht. Derzeit nicht. 1953, er war schon 38 Jahre alt. Festes Einkommen, sichere Pension später. Ihm gefiel die Arbeit schließlich. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen war angenehm. Mit einigen fühlte er sich sogar freundschaftlich verbunden, mit BüsensenIn Treue fest, durch Kampf und Sieg, wir halten durch!Sie verstanden sich, solange sie über ihre frühere, gemeinsam verbrachte Zeit schwiegen. Aber er litt unter der Einsamkeit des Schweigens, weil es ihn an jene Zeit erinnerte. Es war die Angst vor der Erkenntnis, die nur durch Erinnerung gewonnen und die zu seinem inneren Konflikt geführt hatte, ein Konflikt, der nicht durch Schweigen gelöst, eine Angst, die nur durch Erinnerungsarbeit überwunden werden konnte. Er war sich dessen sehr wohl bewusst; dennoch wollte er sich nicht erinnern und hatte sich damit abgefunden, nicht nur mit seinem inneren, unterschwelligen Konflikt, sondern in ständiger Angst leben zu müssen. Er hatte Angst vor seinem eigenen Schweigen, und Büsensen wusste um seine Lebenslüge.
Nun war es vor wenigen Monaten, April 1975: So konnte es nicht weitergehen. Er hatte nach der Osterfeier mit seinem Aufritt als Weihnachtsmann von Büsensen das Angebot bekommen,Ordnung ins Chaosdes Tannenhueser Archivs zu bringen.
„Du machst das schon, Piepe. Hast früher ja auch in der Kacke gewühlt. Warum nicht morgen durch stinkende Kanäle kriechen? Dafür reicht dein Spatzenhirn allemal!“ Als er das mit einem breiten Grinsen so dahinsagte, wusste er, dass Piepenschroer zusagen würde. Er war leicht zu gängeln. So kannte er ihn. Als er versprach, ihm eine kleine Abschiedsfeier unter Kollegen zu geben, hatte Piepenschroer herumgedruckst und um einige Tage Bedenkzeit gebeten. Er hätte, meinte Büsensen, die offizielle Verabschiedung auf den 20. April 1975 legen wollen. Leider sei das ein Sonntag. Damals, vor dreißig Jahren in Berlin, wären die lautesten Glückwünsche aus den Kanonen der Roten Armee gekommen. Damit könnte er heute nicht dienen, hatte er lauthals gelacht.
Erst, als Büsensen dieses Datum erwähnte, hatte er eingewilligt, ohne zu wissen, worauf er sich einließ. Er hatte nicht aufgeschaut, nichts gesagt, nur mit dem Kopf genickt. Er wusste nicht, was, ob er überhaupt etwas sagen sollte. Er hatte zum Fenster rausgeschaut. Dicke Regentropfen klatschten gegen die Fensterscheiben und verdunkelten Büsensens Büro. Er hatte gleichzeitig gespürt: Es widerte ihn an, und er erkannte, dass er sich abermals etwas in die Tasche log.
•
Büsensen kam gern zu spät. So auch zu Piepenschroers Verabschiedung. Er glaubte, auf diese Art und Weise seine Wichtigkeit im Hause unterstreichen zu können. Mimte er in seinem Dünkel den Großen Hans, ohne achtunggebietend stattlich gewachsen zu sein, dehnte er Worte in eine be-deu-tungs-vol-le Länge, rollte gleichzeitig seine Augen und richtete den Kopf schräg nach oben halb-links gegen die Decke. Auffallend für seine leicht gekrümmte Körpergröße und seinen fülligen Leibesumfang - ein wohlgenährter Bauch wölbte sich weit über den Hosenbund - waren die kleinen, runden und deutlich abstehenden Ohren, sein streng rechts gescheiteltes, dunkelbraunes Haar, dazu eine zerfurchte Gesichtshaut. Vor allem aber sein enormer, schon leicht angegrauter Schnauzbart unter einer rötlichen Knollennase.
Dr. jur. Gustav Büsensen, Jahrgang 1913, ehemals Rechtsanwalt und Notar, war im November 1946 mit Hilfe von zwei Persilscheinen entnazifiziert worden -anständig, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, unfreiwillig verstrickt, treu, gehorsam und pflichterfüllend. Er bekleidete imMinisterium für Erziehung, Wissenschaft, Forschung und Kulturdie Position eines Archivdirektors.
Kaum hatte Piepenschroer widerstrebend zustimmend genickt, lud Büsensen zu einer kleinen Feier unter Kolleginnen und Kollegen ein, um mit vorgestanzten Floskeln, ohne Gefühl für eine ungezwungene, natürliche Ansprache seinen allseits geschätzten Mitarbeiter Piepenschroer in den, wie er sagte, zwar vorzeitigen, gleichwohl verdienten Ruhestand zu verabschieden.
„Da Sie hier bei uns so erfolgreich, weil umsichtig, korrekt und zuverlässig über so viele Jahre gearbeitet haben, möchte ich Ihnen, lieber Piepenschroer, gerne anbieten, sich vor Ihrer endgültigen Pensionierung einem Außenmagazin in der Gemeinde Tannenhues zu widmen. Ein Archiv - das ultimative Sich-Erinnern. Eine Identitätsressource ersten Ranges. Wie Sie mög-lich-er-wei-se wissen oder auch nicht, egal -, ist es unserer ausgelagerten Zentralstelle für Genealogie angegliedert und wird seit einigen Monaten nicht mehr betreut.“
Alles Militärische ging Büsensen ab. Er sprach bedächtig. Früher er eher abgehackt, kurz und bündig mit martialisch gerecktem Kinn. Gelegentlich auch in einem zynischen, beleidigenden Befehlston. Aber wer ihn kannte – niemand besser als Piepenschroer – wusste, wie scharfzüngig, bissig, ja boshaft er werden konnte.
„Tannenhues, zwar ein kleiner, aber nicht unscheinbarer Ort. Erst recht nicht, wenn Sie, Piepenschroer, die niedrige Schwelle überschreiten und dort tätig werden“, fuhr er fort, zog den Mund breit auseinander und dabei die Schultern hoch bis zu den rot schimmernden, abstehenden Ohren. Vergeblich versuchte er, ein Kichern zu unterdrücken.
Jemand räusperte sich laut und vernehmlich. Sonst herrschte schneidende Stille im Raum.
„Es wäre ja auch für einen bewährten Mitarbeiter zu früh, die Seele baumeln zu lassen. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass Sie, verehrter Piepenschroer, mög-lich-er-weise untätig zuhause herumhängen, stupide in der Hängematte schaukeln oder Däumchen drehend vor dem sicher neuen Fernseher einschlafen. Das dürfte nicht Ihre Welt sein.“
Er ging auf ihn mit einem kalten Grinsen zu und machte eine Andeutung, als wollte er ihm freundschaftlich den Arm um die Schulter legen.
Piepenschroer trat erschrocken einen kleinen Schritt zurück. Ihm schoss die Schamesröte ins Gesicht. Auf seiner Stirn flossen in kleinen Rinnsalen mehr als tausend Schweißperlen.
„Wichtigtuer“, flüsterte Silke Ennert ihrer Kollegin ins Ohr und gab ihr einen leichten Schubs mit dem Ellenbogen, „gleich wischt er sich wieder durch seinen Kakerlakenbart.“
Sie mussten schmunzeln. Diese seltsame Bezeichnung Kakerlakenbart verstand nur, werDie Neue Kakerlakekannte, eine von Büsensen monatlich herausgegebene Zeitschrift des VereinsMythogart e.V.,in Ministerien und Kommunen wegen seiner germanophilen, deutsch-nationalen Gesinnung weit verbreitetes, offensichtlich auch gern gelesenes Vereinsblatt. Die Auflage war in den letzten Monaten gestiegen, und die Firmen schalteten mehr und mehr teure Anzeigen. Es war Fräulein Ennert, die belesene, immer kritisch eingestellte Kollegin aus der Personalabteilung, die den sonderbaren Titel mit Büsensens groteskem Schnäuzer auf einen Nenner brachte:Kakerlakenbart.Sie mochte den Archivdirektor nicht. Er war ihr unheimlich. Warum, wusste sie nicht. Sie sah in ihm ein schwarzes, hohläugiges Nichts. Wie hatte sie es einmal gegenüber einer Kollegin formuliert? Der Kakerlakenbart besteht aus einer gähnenden Gemütsleere.
Büsensen strich mit der linken, mit der rechten Hand durch seinen wuchtigen Schnauzbart. Sodann fuhr er mit weit ausholender Gebärde fort, als dirigiere er ein großes Symphonieorchester: „Dort, in dem, wie gesagt, nicht unscheinbaren Städtchen“ - abermals unterdrückte er ein Kichern, sodass jetzt einige zu feixen begannen „unweit unserer Landeshauptstadt, liegen Unterlagen von Familien aus ganz Deutschland. Authentische Quellenschätze, die dringend bearbeitet werden müssen. Das habe ich der Bürgermeisterin von Tannenhues, Frau Ortrud de Putaly, versprochen und dabei sofort an Sie, lieber Piepenschroer, gedacht. Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, hier im Ministerium auf das Archiv zurückzugreifen. Falls erforderlich. Einsehen, was sonst verschlossen bliebe. Ich selbst werde Sie mit zusätzlichem Material versorgen. Und, Piepenschroer, 11. Gebot, nicht vergessen: Der Überlieferungszusammenhang muß gewahrt bleiben. Wie sagte schon der alte Goethe: reinliche, ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere. Und wie sage ich? Fusselfreie Ablage!“
Fräulein Tösse schlich mit verkniffenem Gesicht herein. Flüsterte ihm etwas ins Ohr.
„Das ist jetzt nicht wichtig“, blaffte er zurück. „Die kann warten. Oder morgen wiederkommen. Machen Sie einen Termin!“
Sie versuchte es erneut. Büsensen winkte energisch ab.
„Ich meine, gestatten Sie mir, das sagen zu dürfen, verehrter Piepenschroer: Nichts soll unter eine Decke des Schweigens gekehrt werden oder im Verborgenen verkümmern. Es gilt herauszufinden, was über die Zeit des Nationalsozialismus bislang unbekannt geblieben ist. Jeder Stein muss umgedreht werden. Na, etwas schwierig, bei dem alten Gemäuer dort. Aber Sie verstehen schon, was ich meine. Nicht zuletzt geht es um Deutungshoheit von Persönlichkeiten. Sie, Piepenschroer, ein Mann mit beachtlichem, historischem Sachverstand, würden somit den Historikern für Editionen verdienstvolle Beiträge zur Erinnerungskultur des Landes leisten.“
Büsensen warf wieder bedeutungsvoll die rechte Hand nach vorn und steckte gleichzeitig die linke Hand in die Hosentasche.
„Alois Piepenschroer, der Memoirenklempner! Entschuldigung: Memoirenhandwerker! Besser noch: Der Memoirenberater! Sie sollten sich das mal überlegen, lieber Freund! Mög-lich-er-wei-se könnte Sie das interessieren. Und das i-Tüpfelchen: Sie sind völlig frei in Ihrer Arbeitszeitgestaltung.“ Büsensen war bemüht, betont liebenswürdig zu sein, entschuldigte sich nochmals für den verbalen Ausrutscher Memoirenklempner und hob das mitSekt extra trockengefüllte Wasserglas. Tank aber nicht. Wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Nach einem längeren Blickkontakt klopfte er ihm kameradschaftlich, etwas zu burschikos auf die Schulter und verließ hastig die Abschiedsfeier.
„Ich hab noch zu tun! Fusselfreie Aktenlage, Sie verstehen!“, brummte er im eiligen Hinausgehen, mehr ein Rennen, drehte sich kurz um und rief: „Morgen scheint die Sonne wieder!“
Die Tür fiel geräuschvoll ins Schloss. Vom Korridor hörte man ein diabolisches Lachen.
Piepenschroer war entsetzt. Er hätte kotzen können. Warum sagte Büsensen nicht die Wahrheit? Er hatte doch längst zugesagt! Heute kein Wort über das zerrüttete Arbeitsverhältnis, statt dessen: „Lieber Piepenschroer“, „Seele baumeln lassen“, „Hängematte“, „Däumchen drehen“, „Memoirenklempner“ und dieses „Mög-licher-wei-se“. Besser wäre gewesen: „Lang ersehnter Ruhestand.“ „Endgültige Trennung.“ - „Auf-Nim-mer-wie-der-sehen.“ - „Ausschei-den.“ - „Niemand ist so schlecht wie sein Ruf, niemand so gut, wie sein Nachruf und jetzt spricht die Leiche aus dem Keller.“ Er hatte es sich verkniffen. Herabgesetzt und gedemütigt wäre es ein Vor-sich-hin-stottern geworden.
4
Die Schlüssel zum Archiv in der Tasche, hatte er sich auf den Weg zum geräumigen Kirchplatz ins ehemalige Gemeindehaus gemacht. Ein süß-saurer Geruch lag in den schmalen Gassen. Eine Katze schreckte auf und rannte vor ihm weg. Ein schmuckes, denkmalgeschütztes Fachwerkhaus oder einen Glaspalast mit hochflorigen Teppichen und gedimmten Kristallleuchtern hat er nicht erwartet. Da lag es - nackt und stumm. Eine eigenartige Stille ging von dem Gebäude aus. Jeweils zwei Fenster links und rechts des Eingangs, die Tür eingefasst in gehauenen Steinen, im Türsturz gemeißelt die Jahreszahl 1798, mit Kreide durchgestrichen. Daneben stand gekritzelt, kaum lesbar, von Wind und Wetter verwaschen, eine Jahreszahl. Bevor er die niedrige Schwelle übertreten konnte, musste er mit ganzer Kraft gegen die schwere, von Holzwürmern gefurchte Haustür drücken. Nur widerwillig, stöhnend ließ sie sich öffnen. Eine Frau war stehen geblieben und fragte, was er hier zu suchen hätte. Er gab keine Antwort. Schüttelte nur den Kopf. Sie werde die Polizei informieren, ein Einbrecher mache sich am Archiv der Bürgermeisterin zu schaffen, drohte sie mit erhobenem Zeigefinger. „Am helllichten Tag!“, hatte sie geschimpft und sich getrollt. Die kalte Nüchternheit der Räume, ein stickiger, muffiger Modergeruch, der ihm entgegenschlug, jagte ihm einen gehörigen Schrecken ein. Im langen, engen Flureingang hingen Spinnengewebe von der Decke. Auf dem Holzfußboden lag ein Friedhof von toten bunten, gelben und weißen Schmetterlingen. An der Wand, neben Kleiderhaken, hing ein Telefon, darunter stand ein Schränkchen mit Telefonbuch, ein Zettel mit Namen und Telefonnummern, in ehemaliger Sütterlinschrift von zittriger Hand geschrieben.
In der Küche ein Kohleofen mit Herd, darauf Töpfe und Pfannen, das Ofenrohr war angerostet und aus der Fassung gerissen. Auf dem mit rotweißkariertem Wachstuch bespannten Küchentisch standen ein Wasserglas sowie eine ungespülte, dicke Krankenhaustasse. Bröselamm hatte das Haus fluchtartig verlassen haben. Die Uhr an der Wand war stehengeblieben: fünf nach zwölf.
Im Vorratsraum neben der Küche roch es feuchtkalt. Im Wandregal standen leere und gefüllte Einmachgläser mit Pflaumen und Kirschen, dicken Bohnen und Beerengelee, Phiolen mit langem Hals und dickem Bauch, darunter Saftflaschen, Pullen mit Wachholderschnaps und Falscher-Fuffziger-Likör. Kommt aus dem Teutonengebirge. Weder Schnaps noch Likör. „Ni fu ni fa“, murmelte er ärgerlich.
Im ehemaligen Wohn- und Esszimmer, das aussah wie ein schlecht möbliertes Büro, standen zwei überdimensional große Bauernschränke, voll gestopft mit Schuhkartons aus weicher, grauer Pappe, Berge von Aktenordnern, mit Baumwollbändern gebündelte Fotoalben, fleckige Mappen in jeder Größe. Von einem Archiv keine Spur. Das reinste Chaos. Die Mitte des Raumes nahm ein überdimensional großer Eichentisch ein, dahinter ein wuchtiger, verstaubter Schreibtischdrehsessel, an der Wand lehnten zwei gammlige Korbsessel, vollgepackt mit alten Zeitungen. Dahinter waren einige Kisten versteckt, offen oder mit einer Kordel zugeschnürt. Er rüttelte vergeblich an den eingeklemmten Fenstern. Lange war hier nicht mehr gelüftet worden.
Im ersten Stock führte ein kurzer Flur zum Schlafzimmer. Die Tür quietschte, sonst waren da keine weiteren Geräusche als der knarrende Fußboden. Vergilbte Zeitungen und Zeitschriften lagen auf dem Boden. Auch Mäuseköttel. Tote Fliegen und Bienen. Bettzeug, Plumeau und Kopfkissen wirkten nicht wie frisch aufgeschüttet. Vergilbte Gardinen hingen vor verdreckten Fenstern. Ein dunkelbraun bezogenes Sofa könnte er unten ins große Zimmer stellen, zwar nicht passend zu den vergammelten Korbsesseln - aber immerhin eine bescheidene Besucherecke. Der Kleiderschrank war bis auf einige Bügel leer geräumt. Über dem Nachttisch hing ein gerahmtes Bild, Nachdruck einer IkoneMadonna mit Kind. Daneben war ein kleiner Weihwasserwandhalter angebracht, schlichte braune Keramik, eingearbeitet ein einfaches Kreuz. Darunter standen zwei dicke weiße, halb herunter gebrannte Kerzen.
Elender Gestank schlug ihm im Badezimmer entgegen. Auch hier verstreute Mäuseköttel. Aufgescheuchte Kakerlaken huschten unter heruntergefallenem Mörtel. Eine Motte flog auf und flatterte zum Licht. Das Fenster war mit Pappe verschlagen.
In der Mitte des Flures führte eine Stiege hoch zum Dachboden. Die nur wenigen Stufen endeten abrupt an der Flurdecke vor einer Luke. Eine ähnliche Dachbodentreppe hatte er bei Frau Schildmacher gesehen, die Vermieterin seiner Zweizimmerwohnung. Sie hatte ihm zu verstehen gegeben, er hätte dort oben auf der Balkenstube nichts zu suchen.