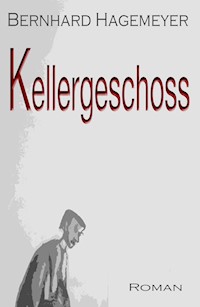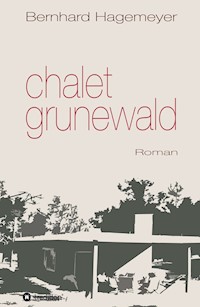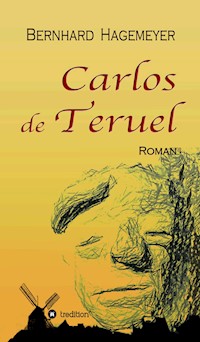
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Carlos de Teruel" - ein politischer Roman über Spaniens schwierige Vergangenheit. Ein aktuelles, schnell gelesenes Buch zum gegenwärtigen Diskurs: Die Wunden sind nicht verheilt, der alte Streit ist wieder aufgeflammt - ein Beitrag zur historischen Erinnerung. Carlos Pamedo, ein junger Spanier aus der Kleinstadt Teruel in der Provinz Aragón, überlebt im Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) einen Granat- und Bombenhagel der Legion Condor, eines geheimen Luftwaffenverbandes der deutschen Wehrmacht. Er gerät in Gefangenschaft der Franquisten und wird in ein französisches, nach deutschem Vorbild errichtetes Internierungslager deportiert. Erst 1971 entlassen, kehrt er in ein Spanien zurück, das vor einem politischen Neuanfang steht. Die Franco-Diktatur geht dem Ende entgegen. Als UCD-Abgeordneter der Cortes will er von der Vergangenheit nichts mehr wissen, einen Schlussstrich ziehen, seine persönliche, politische Zukunft nicht mit traumatischen Erlebnissen belasten, und schaut nach vorn. Er führt jedoch einen erbitterten, nahezu aussichtslosen Kampf gegen das Erinnern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Carlos de Teruel
Roman
Bernhard Hagemeyer
Carlos de Teruel
Roman
Impressum
Bernhard Hagemeyer, Carlos de Teruel
© 2019 Bernhard Hagemeyer, Bonn
Layout, Gestaltung und digitale Zeichnungen vom Autor, book-art.eu
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
E-Book: 978-3-7482-2323-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Meiner Familie
1
Ich begreife nicht, was in mir vorgeht. Den Blick gesenkt, die Ellenbogen und den Kopf aufgestützt, denke ich mit fiebriger Ungeduld, aber auch mit Schaudern an den kommenden Morgen.
Marisol, neben mir am Küchentisch, ihr Gesicht steingrau, nimmt eine Tablette ein, leert das Glas Wasser in kleinen Schlucken und schaut mich dabei fragend an. Da nimmt sie meine Hand, drückt sie fest. Spürt sie meine Beklemmung, die Unruhe, auch die aufkommenden Zweifel?
Auf der spanischen Hochebene von Aragón fällt in dieser Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 1937 die Temperatur auf minus 18 Grad, und der Schnee liegt an einigen Stellen bereits bis zu einem Meter hoch.
Jaime stochert im Kamin und legt einige Holzscheite nach, damit die Wärme auch über Nacht anhält. Trotzdem spüre ich die Eiseskälte, die durch Ritzen in Fenstern und Türen, selbst durch schmale Fugen im Holzfußboden an meinen Beinen hochkriecht.
Esteban geht auf Horacio zu und gibt ihm einen leichten Stoß in die Seite. Den Kopf stolz erhoben, ruft er, den linken Arm stramm in die Höhe gereckt, die Faust geballt: „¡No pasarán! - Sie werden nicht durchkommen! Wenn über unser Teruel die republikanische Trikolore und die Flagge der Interbrigaden flattern, werden wir es nicht zulassen, dass sie zurückkommen: ¡No pasarán!“
„Wir werden dabei sein, wenn die Republikaner unsere Stadt stürmen, wenn sie Gebäude für Gebäude sturmreif schießen und die nationalistischen Franquisten, diese faschistischen Falangisten, zum Teufel jagen“, behauptet Jaime überschwänglich, sonst eher wortkarg, und wirft einen weiteren Holzscheit derart heftig in die Glut, dass die Funken sprühen.
„Wir werden sie verteidigen, unsere Republik, unsere niña bonita, das schöne Mädchen!“, sage ich mit bedächtiger Stimme, fast ist es ein Flüstern.
Mit dem Stummel einer brennenden Zigarette steckt sich Jaime eine neue an. Im Tonfall unterschwelliger Gereiztheit stichelt er: „Nur ein versponnener Idealist, wie du, Carlos, ist in der Lage, unserer Republik einen derartigen Namen zu geben.“
„Meinst du nicht auch, dass sie diesen romantischen Namen verdient?“, springt Marisol mir bei. „Sie ist ohne Blutvergießen, lächelnd gekommen - ohne Blutvergießen“, wiederholt sie.
Er senkt den hochroten Kopf, runzelt die Stirn und schaut durchs Fenster in die dunkle Nacht.
Draußen tobt ein heftiger Schneesturm.
Als habe er es klopfen gehört, rennt Esteban zur Tür und horcht. Zurück ruft er mit zitternder, sich überschlagender Stimme: „Die werden sich ergeben, unser militärisch unwichtiges Provinzstädtchen Teruel vergessen und sich auf Madrid konzentrieren.“ Mit seiner schweren, schwieligen Hand hämmert er auf die Tischplatte, als gelte es, sich auf diese Weise Mut zu machen.
„Und wir werden unsere niña bonita zurückerobern“, meint Horacio mit heiser, gepresster Stimme, jedoch mit einer Miene, als spüre er den Boden unter seinen Füßen wanken. Seine Augen, sonst eher ungewöhnlich ausdrucksstark, sehen leicht entzündet, farblos und wässrig aus.
In dieser merkwürdigen Mischung aus Begeisterung und dem Gefühl der Angst sitzen wir zusammen, bekräftigen nunmehr fest entschlossen per Handschlag, uns am frühen Morgen, noch in der Dunkelheit, auf den Weg zum Hauptquartier der Republikaner zu machen und uns beim Comandante Valentín González zu melden, den Esteban El Campesino, der Bauer, nennt.
2
„Fertigmachen zum Untergang!“, spottet Jaime, robbt sich aus dem Schlafsack und rudert derart heftig mit den Armen, dass seine Gelenke knacken.
Wir trinken heißen Tee und essen mit Olivenöl getränktes Brot. Marisol schüttet Rotwein in unsere botas, Weinbeutel, die wir bei uns tragen. „El Campesino, ein legendärer Haudegen“, ruft Esteban und grinst verschlagen.
Horacio sagt nichts, nickt nur zustimmend.
Meine Zweifel habe ich im Traum zurückgelassen. „¡Pasaremos! - Wir werden durchkommen“, knurre ich und schüttle mir die nächtliche Kälte aus den Gliedern. Stärker als sonst in der Früh muss ich mein rechtes Bein nachziehen.
Um uns aufzumuntern, tönt Esteban wieder: „¡No pasarán! - Sie werden nicht durchkommen!“
Der Schneesturm hat sich gelegt. Wir packen wortlos unsere Sachen, steigen in Stiefel oder feste Schuhe, ziehen ein, zwei Pullover an, darüber mit Wolle gefüllte Jacken und treten durch die Tür ins Freie.
Noch in der Stille der Nacht gehen wir schweigend Seite an Seite, sehen unseren nebligen Atem vor uns und hören das Knirschen der Schritte im Schnee. Mit Stöcken in den Händen machen wir kurze Schritte, damit wir nicht ausrutschen und hinfallen.
Marisol hält den Kopf gesenkt, scheint in Gedanken versunken, zögert und geht ungewöhnlich langsam.
Es wird die eisige Kälte sein, die uns entgegenschlägt, vermute ich und frage. „Was ist mit dir?“
„Yo que sé, was weiß ich“, antwortet sie und verharrt eine Weile. Hat sie es sich anders überlegt?
„Wenn du nicht willst - es ist deine Entscheidung“, gifte ich bärbeißig, als sie stehen bleibt, „du warst, wie wir alle, fest entschlossen und hast zugesagt, im Lazarett zu helfen, den Schwerverletzten, Verwundeten beizustehen. El Campesino kann jede Hand gebrauchen. Was ist mit deiner niña bonita?“
Sie hat das Nachsehen, sie wird nicht dabei gewesen sein, denke ich und überlege, ob es weniger mit der Kälte, als vielmehr mit ihrem Alter zusammenhängen könnte. Sie hätte sich entschieden gewehrt, würde ich auch nur einen einzigen, laut gedachten Gedanken darauf verschwenden.
„Es ist deine Entscheidung“, wiederhole ich trotzig, bemüht um einen weniger gereizten Tonfall. Da dreht sie sich auf dem Absatz um und kehrt mir abrupt den Rücken zu. Ich bin sprachlos, um nicht zu sagen fassungslos, begreife es nicht und mache eine wegwerfende, wütende Handbewegung.
„Dann mach, was du willst!“, schreie ich sie an, schaue mich im Weggehen aber noch einmal zu ihr um. Ich will wissen, ob sie es sich nicht doch noch anders überlegt hat, sehe allerdings, wie sie sich trotz der klirrenden Kälte vor dem Haus auf eine Holzbank niederlässt. Da sitzt sie: Die Füße von sich gestreckt, den Kopf nach vorn geneigt, die Arme auf den Knien abgestützt und die gefalteten Hände im Schoß vergraben. Sie wirkt noch kleiner, als sie in Wirklichkeit ist. Während die anderen weitergehen, dann aber doch stehenbleiben und geduldig auf uns warten, setze ich mich zu ihr.
Wir sehen uns nicht an. Schweigen. Jeder wartet, bis der andere etwas sagt.
Es ist nicht das Alter, denke ich jetzt. Es ist etwas anderes. Hatte sie nicht gestern Abend meine Unruhe gespürt? Fürchtet sie um mich?
Schließlich sagt sie leise, doch mit fester Stimme, mitten in der Nacht sei sie mit dem Gefühl aufgewacht, ihr Bett sei hin- und hergeschaukelt worden, jemand habe an ihrem Bett gerüttelt, habe auf ihrer Bettkante gesessen und sie angesprochen. Ihr Körper habe dermaßen gezittert, dass sie jetzt immer noch nicht wisse, was richtig und was falsch sei. „Yo que sé“, wiederholt sie, wischt sich Schweißperlen von der Stirn und geht ins Haus. Sie scheint Fieber zu haben, fürchte ich und gehe ihr nach.
„Du bist kreidebleich“, sage ich, „ich habe Angst, dass du krank wirst. Wenn wir zurückkommen, werden wir über alles reden“, schlage ich vor. Ihr Gesicht hellt sich ein wenig auf. Sie sagt aber nichts, nickt nur und macht sich am Kamin zu schaffen.
Es wird kein Spaziergang werden. Vielleicht ist es das, was sie unschlüssig macht, überlege ich. Dass wir zu jung seien und glauben könnten, es sei ein Ausflug ins Abenteuer. Jemand hatte zu Esteban gesagt, wir sollten uns beim Comandante El Campesino melden und zur Muela de Teruel gehen, dem Terueler Backenzahn, eine bewaldete Hügelkette. Wie oft haben wir dort als Kinder gespielt!
Die anderen rufen ungeduldig. Ich muss los, verabschiede mich von ihr mit einem langen abrazo, einer herzhaften Umarmung, und sie zeichnet mir mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn. „Es ist zwecklos. Es sind Windmühlen“, seufzt sie. Mit ihren kleinen und rauen, jedoch warmen Händen zieht sie meinen Kopf zu sich herunter und sagt mit leiser Stimme: „¡Adiós, Carlito, hijo! Auf Wiedersehen, Carlito, mein Sohn“ und gibt mir viele liebe, laut schmatzende Küsse auf die Wangen. Ihr Gesicht totenbleich schiebt sie mich, Tränen in den Augen, durch die Tür in die Stille des Schnees.
Draußen hat der Schneesturm ein weißes Gespinst, einem Leichentuch gleich, über Teruel gelegt.
3
Wir Männer, etwa gleichaltrig um die zwanzig, fünfundzwanzig Jahre, sind seit Kindesbeinen befreundet. Auch wenn wir uns nur sporadisch sehen, hält die Freundschaft trotz unterschiedlicher Lebenswege, die wir bisher gegangen und nun entschlossen sind, weiterhin gemeinsam zu gehen. Esteban, ein Hüne von Kerl, immer mit Mütze auf dem Kopf und langen Haaren, arbeitet als Schweißer in einer Metallfabrik und hält den Kontakt zu den Republikanern, zum Comandante. Jaime, ein Schalk, klein, leicht schielend und schiefem Kopf, aber zäh wie Leder, verdingt sich mal hier, mal dort als Hilfsarbeiter in Lagerhallen oder als Helfer in der Stierkampfarena. Horacio, groß gewachsen, unser Intellektueller, ein philosophisch begabter Bücherwurm, der sich an der Universität herumtreibt und für Schöngeistiges, weniger für Tun und Handeln zuständig ist. Wir nennen ihn El Flaco, weil er so dünn und bleich ist wie ein Gerippe. Aber auch deshalb, weil er gelegentlich in seiner geschwollenen Redensart seinem römischen Namensgeber nacheifert, dem Dichter Quintus Horatius Flaccus. Er ist ein Sprechdenker - ihm kommen die Gedanken beim Reden. Ich, etwas kleiner als er, dafür kräftiger gebaut, unterrichte an der Terueler Schule, wo Jaime auf dem steinharten Fußballplatz schon mal den Schiedsrichter gibt. Gleich zu Beginn des Krieges, kaum dass die Franquisten und faschistischen Blauhemden Teruel eingenommen hatten, warfen sie mich raus, zahlen allerdings das Gehalt bis heute weiter. Ich war und bin nicht böse drum, trug zum Rausschmiss meinen Teil bei; denn ich konnte im Lehrerkollegium meine Klappe nicht halten. Trage auch heute noch meine Gesinnung auf der Zunge.
Marisol, eine um zwei Jahre ältere, unverheiratete Schwester meiner Mutter, von kleiner, gedrungener, gleichwohl kräftiger Statur, nannte ich zunächst Tía Mari, Tante Mari, eine Zeit lang nur Sol und als jugendlicher Erwachsener Marisol. Ihr schwarzes Haar trägt sie eher kurz als halblang mit strengem Scheitel, wodurch der Eindruck verstärkt wird, ihre ohnehin nicht sehr tief liegenden Augäpfel träten hervor. Ihre dicht zusammengewachsenen Augenbrauen und ein sich abzeichnender Frauenbart …, nein, Marisol ist keine schöne Frau. Sie trägt stets ein schwarzes Kleid mit langen Ärmeln. Wahrscheinlich möchte sie auf diese Art und Weise auch einen starken Haarwuchs auf den Armen verdecken. Aber das habe ich erst viel später vermutet.
Ich wohne bei ihr, seit ich denken kann und noch früher. Wir leben in einer Finca zurückgezogen auf dem Land, unweit von Teruel und der Muela.
Meine Mutter muss wie Marisol ebenfalls klein, doch schmächtiger gewesen sein. Kaum erwachsen, starb sie 1917 im Kindsbett mit nicht einmal zwanzig Jahren. Der Arzt hatte sich schnell entscheiden müssen: Würde er nichts tun, würden Mutter und Kind noch während meiner Geburt sterben. Unternähme er etwas - so hatte es mir Tía Mari erzählt, wann, weiß ich nicht mehr -, dann stünde er vor der Alternative: entweder die Mutter oder das Kind. Unter katholisch ethischer Betrachtung hätte er das Leben der Mutter zu retten; aus medizinischer Sicht, da die Mutter derart geschwächt sei und die Geburt eh nicht überleben würde, das Kind. Da hätte sie, meine Tante, gesagt, sie übernähme die Sorge um den neuen Erdenbürger. So fiel dem Arzt die Entscheidung leichter, und ich erblickte im Dezember 1917 das gar nicht so helle Licht der Welt. Während zwischen Frankreich und Deutschland ein erbitterter Krieg geführt wurde, lag über Spanien das soziale Elend.
Marisol ließ mich noch am Tag der Geburt auf den Namen Carlos Gregorio Pamedo García taufen und nannte mich, auch noch als Erwachsener, Carlito, Karlchen. Sie hatte nie behauptet, meine Mutter zu sein; dennoch war sie für mich meine Mutter, liebenswürdig, immer bemüht, mir ein richtiges Zuhause zu geben, zart einfühlend, aber auch mit einer kaum merklichen Atmosphäre von Distanz. So bleibt sie mir in lieber Erinnerung. Aber als ich mich einmal mehr nach meiner leiblichen Mutter Rosamaría erkundigte - ich war etwa zehn, elf Jahre alt und sollte eine Internatsschule in Valencia besuchen -, drückte sie mir wortlos, ohne Vorbereitung, geschweige denn mit zarten Andeutungen einen Brief in die Hand, den ihr meine Mutter, als sie mit mir schwanger ging, geschrieben hatte. Ich bat sie, ihn mir vorzulesen. Sie tat es widerstrebend, und in ihrer Stimme lag ein leichtes Zittern.
Querida, liebe Mari,
einen Brief muss ich mal wieder schreiben. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es tun sollte oder nicht. Aber wenn es mir dann bis zur Kehle vollsitzt, denke ich, verschaffe dir Erleichterung und schreib der Mari. Was es ist, kannst Du Dir denken, oder auch nicht. Gott hat es so gewollt. Ich kann mich gar nicht freuen, aber des Kindes wegen muss ich es ja tun. Hilf mir mit Beten, dass es ein gesundes, rechtschaffendes Kindchen gibt. Du wirst schimpfen, obwohl Du gar nicht weißt, wie es ist und besonders jetzt, da Enrique auf und davon ist. So Gott will, komme ich Dich zur Geburt besuchen. Allein schaffe ich das nicht. Ich hoffe, Du wirst wohl verstehen, wie mir oft zu Mute ist. Besos y un abrazo, tu hermanita Rosa.
Damals hatte ich den Inhalt des Briefes nicht richtig verstanden, nur, dass meine Mutter meinetwegen traurig war, ohne dass ich Schuld auf mich geladen hätte. Vielleicht aber hatte ich in ihrer Gebärmutter auf dem Ischiasnerv gedrückt oder mit meinen Händchen stoßend und Beinchen strampelnd zu sehr gegen ihren Bauch getreten und ihr Schmerzen zugefügt, ich aber zum Ausdruck bringen wollte: „Ich freue mich, dass ich lebe, ich will hier raus!“ War ich ein Missverständnis? Auch hatte ich verstanden, dass ich einen Vater hatte, der mich zwar gezeugt, aber von mir nichts wissen wollte. Hatte er sich jemals nach mir erkundigt? Ich nahm es zur Kenntnis wie die Tatsache, dass ich bei meiner Tante aufwuchs.
Als ich mal fragte, wo mein Vater jetzt wäre, hatte sie allerdings abweisend, um nicht zu sagen ruppig geantwortet: „Erzähl ich dir später, davon verstehst du jetzt noch nichts.“ Später hatte ich verstanden: Mein Erzeuger floh 1917 mit einundzwanzig Jahren, kaum dass er von der Schwangerschaft erfahren hatte, nach Barcelona und verschrieb sich den Anarchisten. Er wollte die Revolution - sonst nichts und vertraute nur auf eines: Auf die Macht der Gewalt. In seinen Augen war ein guter Anarchist derjenige, der die verhassten Land-Polizisten, die paramilitärische Guardia Civil, wenigstens einmal überfallen, der eine Granate geworfen oder eine Eisenbahnlinie gesprengt hatte. Eines Tages zeigte sie mir ein Bild in einer Tageszeitung: „Das ist Enrique, dein Vater“, sagte sie und verwies auf einen Mann, der im strammen Schritt, das Gewehr geschultert, mit entschlossener, ernster Miene in die Kamera schaut, begleitet von einer blonden Frau und einem anderen, nicht weniger entschlossenen Krieger. Die rechte Hand zur Faust geballt, trug er auf dem linken Arm ein etwa fünfjähriges, erschrocken dreinblickendes Kind. Seine kleinen Hände suchten Halt in der Uniform meines Vaters. Den Mund, die Augen weit geöffnet, schien es einen Schuss gehört oder in der Nähe eine Explosion, jedenfalls etwas Angsteinflößendes vernommen zu haben. Vielleicht war es nur ein scheuendes Pferd, das den Jungen geängstigt hatte.