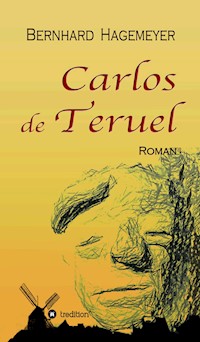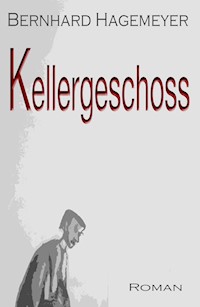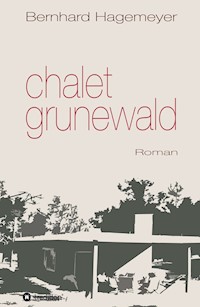
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die junge Familie Loewenberg flieht 1938 aus Berlin und findet wie Zehntausend andere Zuflucht im südamerikanischen Uruguay. Ihre Tochter Ines lernt den nach Montevideo entsandten Politik- und Wirtschaftsberater Franz Bernardt kennen. In Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis, anhand von Fotografien, Briefen und Dokumenten aus ihrem Elternhaus wird er konfrontiert mit den Folgen der Judenpolitik der NS-Diktatur. Erfährt über Opfer und Täter. Und über Hans Globke, Oberregierungsrat im Berliner Reichsinnenministerium, von 1953 -1963 Chef des Bonner Kanzleramtes. Der biografische Roman zielt auf eine geschichtliche Unmittelbarkeit, gestützt auf der Grundlage historisch belegter Tatsachen und den Erinnerungen einer noch lebenden Zeitzeugin, Ines Loewenberg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Chalet Grunewald
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum
Bernhard Hagemeyer, Chalet Grunewald
© Copyright: Bernhard Hagemeyer, Bonn, 2018
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Umschlaggestaltung: hagemeyer-art.de
ISBN 978-3-7469-3432-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bernhard Hagemeyer
Chalet Grunewald
Biografischer Roman
FürPablo, Judith,Jacob, Paula,Elias, Leonard
Inhalt
I Im Spagat
Am Fluss der bunten Vögel
II Kein Nicht-Ereignis
Túpac Amaru
III Wahrheit wie Balsam auf Wunden
Zeittafel, Quellen- und Literaturauswahl
Das Licht begann zu flackern. Er verharrte einen kurzen Moment, legte das Buch zur Seite und schloss die Augen. Ohnehin las er unkonzentriert über den jungen Baron und dessen Liebe zu Edgars Mutter. Edgar tat ihm leid.
Vom Brandenburger Tor her waren rhythmische Trommelschläge zu hören.
Dann war stockfinstere Nacht.
Vorsichtig tastete er sich vom Wohnzimmer den Flur entlang zur Küche, zündete eine Kerze an, hantierte auf dem Tisch und wartete. Schließlich erledigte er die notwendigste Abendtoilette, blies die Kerze wieder aus, ging zu Bett und kuschelte sich unter das federweiche Plumeau. Einschlafen konnte er nicht, stand auf und öffnete das Fenster einen Spalt weit.
Eiseskälte schlug ihm entgegen.
Auf der Straße kamen Jugendliche im Gleichschritt um die Ecke. Einige trugen brennende Fackeln. Plötzlich rannten sie los. Richtung Tiergarten.
Er verriegelte das Fenster, kroch zurück ins Bett, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und starrte ins Leere.
Montag, der 30. Januar 1933.
Das sechsundzwanzigste Jahr gemäß der Loewenbergschen Zeitrechnung.
I
Im Spagat
Am 2. Oktober 1907, als Mutter und Kind die schwere Geburt in der Berliner Keithstraße 13 glücklich überstanden hatten, rief Vater Loewenberg, von stattlicher Natur, streng zurückgekämmt das dunkle Haar, charakteristisch ein markanter, tiefschwarzer Schnauzbart, die familieninterne Zeitenwende aus. Seine Frau Margarete, eine geborene Lewy, legte das Datum so fest: „Das war vor oder nach Fritzchen.“ Wenn sie ihrem Sohn Egon, „sieben Jahre vor Fritzchen geboren“, nur knapp die Umstände schilderte, die zum allzu frühen Tod seines älteren Bruders Herbert geführt hatten, sagte sie: „Das war ein Jahr vor Fritzchen. Herbert wurde von heute auf morgen krank, und kein Arzt konnte ihm helfen. Er starb an einer Hirnhautentzündung“. Oder wenn er nach seinen Großeltern fragte, antwortete sie: „Zwei Jahre vor Fritzchen verschied deine Großmutter, Amalie Cohn, und sechs Jahre davor dein Großvater Wolf Loewenberg, promovierter Philologe, Schuldirektor. Sie heirateten 1861 in Posen und zogen nach Berlin. Also sechsundvierzig Jahre vor Fritzchen.“ Jedes Mal, wenn sie von einer Urlaubsreise nach Marienbad erzählte, sich gern an die erholsame Zeit erinnerte und nachrechnete, schüttete sie sich derart herzhaft aus vor Lachen, dass ihr wohlbeleibter Körper bebte.
Weniger begeistert war Egon. Sehr bald musste er feststellen, dass nicht mehr er, sondern Fritz im Mittelpunkt der Familie stand. Er wollte von seinem Vater wissen, wo das Baby auf einmal herkäme. Mit einer hingenuschelten Antwort konnte er nichts anfangen. Das Kindermädchen druckste herum und fand, da müsste er seine Mutter fragen. Die zeigte ihm des neuen Erdenbürgers Füßchen und bat ihn, stets recht lieb gegenüber seinem Brüderchen zu sein, nahm Egons rechte Hand, und beide streichelten vorsichtig zärtlich über Fritzchens schwarzes Haar.
Am späten Nachmittag, dem 10. Februar im Jahr zwei der Loewenbergschen Zeitrechnung, brachte ein reitender Bote dem Berliner Sängerdoktor, wie Richard Loewenberg in der Welt der Oper und des Theaters genannt wurde, eine eilige Depesche aus der kaiserlichen Residenz.
Mit viel Aufwand wird in Berlin und anderen Städten der 50. Geburtstag von Kaiser Wilhelm II. zelebriert. Eine Anzahl SPD-Abgeordneter nimmt im Deutschen Reichstag nicht an den Feierlichkeiten teil, liest Johannes Gebhardt, promovierter Rechtsanwalt und Notar in Frankfurt an der Oder in der Zeitung. „Richtig!“ – meint er, legt das Blatt zur Seite, steht auf und zwirbelt mit drei Fingerspitzen seinen Schnurrbart, mal links, mal rechts, brummt vor sich hin: „Wir haben keine monarchische Staatsform nötig. Was wir brauchen, ist eine parlamentarisch demokratische Republik mit liberaler Verfassung! Die Regierung sollte nicht mehr einem Monarchen, sondern dem Parlament verantwortlich sein! Das wird dauern! Ohne Revolution wird das nicht gehen.“
Dann liest er diese Überschrift: Jüdische Geheimorganisation! Verschwörung gegen den Kaiser? „Das wird ja immer schöner. Die Leute haben den Verstand verloren!“
Eine weitere, die gestrige Abendausgabe der Berliner Zeitung. Die Absicht des preußischen Innenministers werde in aller Deutlichkeit begrüßt, heißt es. Den meisten Juden wohnt der unbesiegbare Drang inne, ihre Vornamen zu verändern. Die Behörden sollen der jüdischen Namensführung erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lassen.
„Sorgen haben die!“, schreit er. Rudert wild mit den Armen. „Haben die keine anderen Probleme, außer Prostata mit gestörtem Harndrang?“ Mit der Faust schlägt er derart heftig auf den Schreibtisch, dass ihm die Hand schmerzt. Mühsam hält er einen Hustenanfall zurück. Dennoch holt er aus dem Humidor eine Zigarre, prüft genüsslich ihren Aromagehalt, entzündet einen spanischen Zedernholzspan und setzt sie in Brand.
11. Februar 1909, unter Lokales und Vermischtes fällt ihm ein Name auf: Dr. Richard Loewenberg. Er hatte von einem in Berlin anerkannten Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehört. Sich vorgenommen, ihn aufzusuchen, den Namen jedoch vergessen. Jetzt kommt er ihm wieder unter: Zur Konsultation Dr. med. Richard Loewenberg. Gerade erst hatte er gelesen, Eduard VII., König von England, weile bei Kaiser Wilhelm II. zu Besuch.
„Gut für Preußen. Ein Frauenheld, dieser King! Wahrscheinlich hat er neben der Königin seine Freundin, die hübsche Alice Keppel mitgebracht“, murmelt er, zieht an der Zigarre und unterdrückt ein erneut heftiges Husten. Nun steht in der Zeitung, der englische König habe diesen Arzt um medizinischen Rat gebeten. Gebhardt liest seiner Frau Helene vor, die zur Tür hereingekommen war: „Der hohe Gast unseres Kaisers hat sich leider infolge rauen Wetters einen leichten Bronchialkatarrh zugezogen. Die Behandlung hat hauptsächlich ein Berliner Arzt übernommen, der auf Wunsch des Leibarztes des Königs hinzugezogen wurde. Dr. Richard Loewenberg ist ein bekannter Laryngologe.“
Er sei kein Sänger, denkt er, aber hier lese er etwas über eine Dame, eine Gesangskünstlerin, in die der König offensichtlich verliebt war und während des inoffiziellen Mittagessens gern neben ihr gesessen hätte. „Helene, hör dir das an, was die Madame der Postille zu erzählen weiß, unter dem Mantel der Verschwiegenheit, vertraulich, versteht sich, sonst stünde es ja nicht hier: Ich merkte,daß er sich nicht wohl fühlte und keine gezwungene Konversation machen wollte. Wir saßen auf einem niedrigen Sofa – na, na, da hatte Majestät vermutlich Gesangsunterricht!“
„Hat das die Sängerin gesagt, oder ist das dein Senf, den du dazugeben musst?“
„Hör zu und unterbrich mich nicht ständig: Der König wollte rauchen, obwohl er stark hustete. Plötzlich hustete er wieder und sank auf das Sofa zurück; die Zigarre fiel ihm herunter, seine Augen wurden starr, und er war ganz blass und rang nach Atem. Ich dachte: ‚Mein Gott, er stirbt; ach, warum nicht wenigstens in seinem eigenen Lande!’ Ich bat ihn, den Doktor zu nehmen, der täglich zu mir kommt und mir noch diesen Morgen eine Inhalation verordnet hat; das hat mir sehr gutgetan. Der König ließ ihn noch am Abend kommen. Das ist Dr. Loewenberg, der Laryngologe!“
„Ein was?“
„Laryngologe! Ja, das sagte ich doch, ein Facharzt, spezialisiert auf Kehlkopferkrankungen, ein anerkannter Mann, wenn er vom Leibarzt des englischen Monarchen hinzugezogen wird und auch diese Sängerin betreut. Er scheint ein Gerät oder so eine Art Sprühflasche zur Behandlung des Kehlkopfes zu benutzen. Vielleicht hat er so etwas Ähnliches erfunden. Darüber schreiben sie nichts. Ich werde Loewenberg aufsuchen, wenn ich nach Berlin komme.“
„Und wer ist diese Sängerin? Willst du die auch beehren?“ Johannes Gebhardt geht darauf nicht ein, meint aber, die Dame sei offensichtlich eine Geliebte des Arztes: „Hier steht: Er sagte mir später, dass er ihm, dem König von England, geholfen und er ihn zum nächsten Morgen wieder bestellt habe.“
Mit weitausholender Geste nimmt er den Telefonhörer ab, bittet das Fräulein vom Amt um die Vermittlung eines Ferngesprächs nach Berlin. Eine Verbindung kommt nicht zustande.
Wenn er den Anschlusszug von Berlin nach Frankfurt/Oder nicht versäumen will, muss Hermann Paul Gebhardt den Frühzug von Breslau nach Berlin jetzt noch erreichen. An diesem Morgen aber, Freitag, 18. Juli 1930, wacht er spät auf. Mit befreundeten Kommilitonen hat er am Vorabend seine Promotion zum Doctor jurisprudentiae ausgiebig mit einem Zug durch die Gemeinde gefeiert.
Aufgeschreckt, Hals über Kopf in die Kleider, stürmt er die schmale Holztreppe hinunter auf die Straße. Rennt zum Bahnhof. Abgesperrt. Er verlangt von einem Wachmann, durchgelassen zu werden.
„Nein, mein Herr. Ich habe den Befehl, niemanden durchzulassen“, sagt der Wachtmeister. Rückt die Pickelhaube gerade.
„Kriege ich den Zug nicht, verpasse ich den Anschluss in Berlin nach Frankfurt/Oder zu meinen Eltern“, insistiert Gebhardt, reißt seine Studentenmütze vom Kopf und schleudert sie auf das Trottoir. Er ist immer noch ein Tollkopf. Darf froh sein, dass der Schutzmann dies nicht als aggressives Verhalten ansieht.
„Befehl ist Befehl. Ich kann keine Ausnahme machen“, sagt der Polizist in einem schon etwas schärferen Ton. Gebhardt hebt seine Kappe auf, klopft sie aus und versucht, sich am Schupo vorbeizudrängen.
„Bitte keinen Ärger! Ich lasse Sie sonst festnehmen!“
„Sie haben nicht die geringste Veranlassung, mich zu hindern. In wenigen Minuten fährt mein Zug“, schimpft er zurück.
„In wenigen Minuten ist gut! Dann läuft der Zug des Herrn Reichspräsidenten Paul von Hindenburg hier ein. Verdünnisieren se sich, und zwar zack zack!“
Gebhardt trollt sich. Auf dem Bahnhofsvorplatz bleibt er vor einem Mann stehen, der ihm bekannt vorkommt. Lauthals lacht er auf. Robert Saenger, sein alter Freund aus der Frankfurter Schulzeit, hätte ihn nicht wiedererkannt. Dessen Haar, früher leicht gelockt und blond, jetzt dunkelbraun, hat sich zu einem spärlichen Haarkranz zurückgezogen.
„Was für eine Überraschung. Robbi in Breslau! Was machst du denn hier? Dem Paule zujubeln?“, fragt er, gibt ihm einen Klaps auf die Schulter. Saenger ist nicht weniger überrascht. Wie lange ist es her, dass sie sich nicht gesehen haben! Er versucht nachzurechnen. Schmunzelt. In seiner Erinnerung ist ihm besonders ihre gemeinsame Zwergenrolle am letzten Kindergartentag präsent. Statt einen artigen Zwerg zu mimen, hatte Hermchen zur allgemeinen Erheiterung des Publikums den Tanz eines wütenden Rumpelstilzchens aufgeführt. Von den Zuschauern erhielt er lebhaften Beifall. Mutter Gebhardt war nicht amüsiert.
„Weißt du noch, dein Zwergenaufstand?“ Er kommt mit seinen Erlebnisberichten nicht weit. Jetzt wird auch der Bahnhofsvorplatz für Fußgänger gesperrt.
„Was treibt dich hier her, Robbi?“, fragt Gebhardt erneut, hat geringe Lust auf Memoiren.
„Ich arbeite seit einigen Monaten hier als Journalist. Bin beim Evangelischen Presseverband für Schlesien. War nicht so einfach, einen Job zu finden. Und du?“
„Komm mit auf einen Kaffee oder auf ein Bier. Ist zwar früh am Tag. Hab gestern meinen Doktor gemacht. Ich geb einen aus.“
„Herzlichen Glückwunsch, Hermchen, alter Freund und Kupferstecher!“, sagt Robert, klopft ihm erfreut und heftig auf die Schulter. „Ja gern, ich muss eben in die Redaktion. Ich stelle dir einen netten Kollegen vor, mit dem ich noch etwas zu besprechen habe. Der ist evangelischer Theologe, arbeitet hier als Korrespondent. Will Schriftsteller werden. Ich war der Meinung, du hättest auch Journalismus gelernt.“
„Nein, mein Vater sagte immer: ‚Junge, lerne was Anständiges, werde Rechtsanwalt!’ Die Journaille - nichts für ungut! hätte mich schon interessiert“, sagt Gebhardt und gibt seinem früheren Kumpel einen freundschaftlichen Stoß gegen den Arm.
Erneut werden sie von einem Wachtmeister davon abgehalten, eine Straße zu überqueren. In diesem Moment fährt eine Autokolonne vorbei. Im Fond des letzten Wagens sitzt ein stattlicher Herr mit ausladender Hutkrempe. Grüßt die zurückgedrängten Fußgänger am Straßenrand mit einer undeutlichen Handbewegung. Eine Frau antwortet mit einem flüchtigen Kreuzzeichen.
„Das ist der Fürst-Erzbischof Adolf Kardinal Bertram. Auf dem Weg zum Bahnhof, um vor Hindenburg einen Hofknicks zu machen.“
„So, so“, meint Gebhardt, „merkwürdig, ein Fürst als Kardinal. Muss man den kennen?“
Die Straße ist freigegeben. Sie wursteln sich durch den aufgestauten Verkehr, eine Querstraße links, die nächste links, kreuzen eine Hauptstraße, biegen rechts ab und dann nur noch einige Schritte bis zur Redaktion.
„Sag mal, Robbi, du und Evangelischer Presseverband? Wie passt das zusammen?“
„Ich hatte Glück, dass sie mich genommen haben. Fragten nicht. Also habe ich nichts gesagt. Nein, das war so: Eines Tages musste ich zum Chef. Der sagte, ‚Saenger, es wäre gut, wenn Sie mir demnächst Ihren Taufschein einreichen könnten.’ Als ich noch etwas hinzufügen wollte, legte er den Zeigefinger auf seinen Mund und gab mir zu verstehen, ich sollte die Klappe halten. Ich sagte nur: ‚Ja, selbstverständlich, Herr Direktor. Bringe ich Ihnen vorbei.’ Ende des Gesprächs. Ich habe in meiner Verzweiflung den Kollegen Olafsson ins Vertrauen gezogen. Wirst ihn gleich kennenlernen. Der meinte trocken: ‚Geh zu meinem Vater, der ist Pastor.’ Zu dem bin ich hin. Eine viertel Stunde später war ich Christ. Protestantisch getaufter Jude.“
„So, so“, stottert Gebhardt, „so geht das“. Er macht eine Pause. „Merkwürdig“, wiederholt er.
„Ja, so einfach geht das. So zu leben nicht. Ich stehe jetzt in ständigem Konflikt, unter nervlicher Anspannung, die ich nur aushalte, weil ich sonst arbeitslos wäre.“
„Den Spagat hielte ich nicht aus.“
„Musst du, wenn du nicht verrecken willst. Und da niemand im Hause fragt oder dumme Bemerkungen macht, komme ich zurecht.“
„Merkwürdig! Wie du das durchstehst! Das sind leider keine verbalen Ausrutscher. Dahinter steckt System. Robbi, mein Lieber, wenn du in diesem Verein arbeitest, verrate ich dir kein Geheimnis. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Getauft oder nicht getauft – der Taufschein hilft dann auch nicht weiter.“
„Einmal Jude, immer Jude. Ich weiß. Wir sind da. Bin gleich zurück“, sagt Saenger und rennt ins Pressehaus. Gebhardt wartet vor der Tür, raucht eine Zigarette. Er versteht nicht, wieso Robbi, um in einer evangelischen Organisation zu arbeiten, sich hat taufen lassen.
Nach einigen Minuten kommt Saenger in Begleitung des Kollegen Sven Olafsson. Es hat leicht zu regnen begonnen. Sie nehmen, so schnell es geht, den Weg zur Bastei, Gebhardts Stammkneipe. Kaum haben sie Platz genommen, legt Gebhardt los: „Was halten Sie, Herr Olafsson, vom protestantischen Antisemitismus?“
Überrascht, auch etwas verlegen reibt Olafsson sein linkes Ohrläppchen, schürzt die Lippen vor, trinkt einen Schluck Bier, wischt sich den Schaum von den Lippen und sagt: „Ich bin der weitaus Ältere, bin Protestant, meine Frau ist jüdisch und ich heiße Sven. Herzlichen Glückwunsch zur Promotion!“
Er hebt das Glas, Gebhardt tut ihm gleich und nimmt so das freundschaftliche Du an. Olafsson sagt: „Was wir heute erleben, ist nichts anderes als Radau. Der Antisemitismus sitzt tief in der Gesellschaft. Ist besonders in Kirchenkreisen verwurzelt.“
Saenger nickt zustimmend.
„Sind wir uns dessen bewusst?“, fragt Gebhardt, „Wir sind so aufgewachsen und haben uns arrangiert oder, was viel grauenhafter ist, daran gewöhnt.“
„Dekanatsbezirkssynoden allerorten im gleichen Tenor“, versucht Saenger eine Antwort, macht eine längere Pause, überlegt, ob er das, was er gerade denkt, im Beisein seines Kollegen aussprechen soll. Er gibt sich einen Ruck: „Ausgesprochen erschreckend unser Sonntagsblatt. Aufrufe, den Antisemitismus zu fördern. Hör ich auch in der Redaktion, Sven. Im Blatt Licht und Leben liest man von Mal zu Mal deutlicher: Der Antisemitismus sei eine gesellschaftliche Sitte. Von Boykott und völkischem Kampf ist die Rede: Berechtigt, notwendig undman müsse sich die jüdische Herrschaft nicht gefallen lassen. Der Abwehrkampf gegen rassische und geistige Überfremdung sei christliche Pflicht.“
Olafsson zieht aus der Aktentasche eine Kladde hervor, blättert darin vor und zurück und sagt: „Immer, wenn ich einen Satz finde, der zu diesem Thema etwas aussagt, schreibe ich es auf. Falls es interessiert: Ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durchteufeltes Ding ist´s um diese Juden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Oder: Man soll ihre Synagoga oder Schulen mit Feuer anstecken ... unserem Herrn und der Christenheit zu Ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien ... ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre ...“
Er überfliegt die eine, die andere Seite: „Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder einen Stall tun ... dass man ihnen nehme alle ihre Betbüchlein ... auch die ganze Bibel und nicht ein Blatt ließe ... dass man ihnen verbiete, bei uns ... öffentlich Gott zu loben, zu danken, zu beten, zu lehren bei Verlust Leibes und Lebens ... dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe ... Sie sollen daheim bleiben ... dass man ... nehme ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold. Summa: ... dass ihr und wir alle der ... teuflischen Last der Juden entladen werden ... Also tue man hier auch, verbrenne ihre Synagogen, verbiete alles, was ich droben erzählt habe, zwinge sie zur Arbeit und gehe mit ihnen um nach aller Unbarmherzigkeit wie Mose tat in der Wüste und schlug dreitausend tot, dass nicht der ganze Haufen verderben musste.“
„Da hast du dem Luther aufs Maul geschaut,“ meint Gebhardt, „was haben die Juden ihm getan?“
„An sich nichts. Als er jung war, hatte er versucht, sie zu seiner Reformation zu bekehren. Judenmissionierung. Erfolglos, wie man weiß. Daraufhin drehte er den Spieß um. Er wurde ihr Feind. Als er starb, soll er gesagt haben: Ihr sollt diese Herren nicht leiden, sondern wegtreiben.“
„Wenn man es genau nähme, müssten Juden und Christen zusammenstehen. Gegen den Antisemitismus kämpfen. Das Neue Testament ist ohne das Alte nicht denkbar“, sagt Saenger.
„Die Katholiken waren nicht viel besser. Die haben ebenso über Jahrhunderte lang den Boden aufbereitet. Warnten vehement vor einer wachsenden jüdischen Gefahr. Die heutige Judenhetze wird von der katholischen Kirche nicht nur geduldet, sondern von ihren offiziellen Organen aktiv vertreten. Der Übergang von den mittelalterlichen Vorurteilen bis heute hat in der katholischen Kirche einen seiner wichtigsten Baumeister. Sie hatten allerdings nicht unseren wortgewaltigen Junker Jörg und sein Manifest Von den Juden und ihren Lügen.“
Saenger bittet den Kellner um einen Kaffee. Noch ein Bier er würde den Tag nicht überstehen. Gebhardt steht auf.
„Ich bin weg. Morgen fahr ich zurück nach Hause. Werde meinem alten Vater von euch erzählen. Ihn von dir, Robbi, grüßen, auch, dass ich den Fürst-Erzbischof-Kardinal gesehen habe. Das wird ihn wahnsinnig beeindrucken. Ich muss pischn und dann auch los“, sagt Gebhardt, gibt beiden die Hand und Saenger zusätzlich einen kameradschaftlichen Klaps auf die Schulter: „Mach’s gut, alter Freund! Wir sehen uns später. Wo und wann auch immer.“
Er geht zum Wirt, bezahlt die Zeche und läuft eilig zur Toilette. Als er zurückkommt, dankt Saenger für die Einladung. „Wenn du mal in Berlin bist und nicht weißt, wo du pennen sollst, dann besuch meine Mamenju. Bestell ihr viele Grüße!“, lacht Saenger, weil ihm das jüdische Wort für Mutter eingefallen war. Lange hatte er es nicht mehr benutzt.
„Warte, Gebhardt, diesen lesenswerten Artikel kann ich dir geben“, ruft Olafsson und kramt in der Kollegtasche, „für die Zugfahrt. Lektüre von einem protestantischen Intellektuellen.“
Gebhardt murmelt im Hinausgehen: „Wäre ja mal ein Thema: Christentum und Antisemitismus - Antworten zum Nationalsozialismus.“
Tags darauf liest Dr. Hermann P. Gebhardt im Zug nach Berlin den Aufsatz und unterstreicht mit einem Bleistift den Satz: Die zunehmende Judenfeindlichkeit ist ein Frevel an Gott. Er blättert zurück. Wer ist der Autor? Jochen Keppler. Theologe. Den Namen wird er sich merken.
Die PensionHirschberg, die er gewöhnlich aufsucht, ist geschlossen. Die Eingangstür mit einem Judenstern verschmiert. Die letzte Tram nach Moabit kann er soeben noch erwischen. Er klingelt mehrmals, nun etwas länger an ihrer Wohnungstür.
„Ja, ja. Komm ja schon“, ruft sie, zieht den Hausmantel fester zu, streicht rasch durch ihr zerzaustes Haar und öffnet die Tür. Jedoch nur so weit, wie es die Türkette erlaubt. Sie schaut ängstlich durch den Türspalt.
„Guten Abend, Muttchen Saenger.“
„Hermchen Gebhardt! Ich glaub es nicht! Komm rein. Es ist spät“, sagt sie und entfernt die Türkette mit zittriger Hand.
„Robert hat mir gesagt, ich könnte bei dir übernachten, wenn ich in Berlin bin.“
Eine Wandleuchte im Flur wirft nur spärliches Licht. Ein seltsam muffiger Geruch schlägt ihm entgegen.
„Das ist gut, dass du da bist. Ich habe Angst. Junge, was bist du groß geworden!“
Sie nimmt seinen Kopf in beide Hände, zieht ihn zu sich herunter und drückt einen lauten Schmatzer auf die Stirn. Er ist überrascht. So klein, gar buckelig hatte er Robbis Mutter nicht in Erinnerung.
„Hast du zu Abend gegessen? Setz dich. Hier am Couchtisch. Knips die Stehlampe an. Bier habe ich nicht. Ich mache dir einen Tee. Und ein Brot“, sagt sie.
In ausgelatschten Pantoffeln schlurft sie in die Küche. Irgendetwas fehlt ihr, denkt er, verkneift sich jedoch ein Schmunzeln.
„Herzlichen Dank, Muttchen. Ich sage immer noch Muttchen. Wie früher in Frankfurt. Darf ich? Wir haben uns lange nicht gesehen.“
„Aber wiedergekannt“, ruft sie freudestrahlend und schlägt die kleinen, schmalen Hände zusammen. „Wie geht’s deinen Eltern? Du hast Robbi getroffen?“
Sie zuckt ein-, zweimal mit den Mundwinkeln.
„Hat er dir erzählt?“
„Er wurschtelt sich schon über zwei Jahre durch. Wie immer.
Bitte, nimm Platz!“ Wieder dieses Zucken um den Mund.
„Ja, er schafft es ganz gut. Arrangiert sich. Wovor hast du Angst?“, fragt er, setzt sich in einen Sessel unter der Stehlampe und fragt, ob er rauchen dürfe. Sie nickt kurz. Als Aschenbecher stellt sie ihm den Unterteller einer Kaffeetasse hin. Ihr Arzt hat ihr das Rauchen verboten.
„Soll ich keine Angst haben? Sie haben mir gedroht!“, sagt sie mit erhobener Faust. „Stell dir vor, Hermchen, kaum dass die Nazis die Wahlen gewonnen haben, ich meine die kürzlich vom
31. Juli 1932, stell dir vor: Fast vierzig Prozent! Da ging es wieder los. Haben den Rademacher von gegenüber verprügelt. Grölend sind sie durch die Straßen gezogen und direkt auf sein Geschäft zu. Klebten dort ein Plakat ans Schaufenster: Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht beim Juden! Und nebenan: Die Juden sind unser Unglück! Meidet jüdische Ärzte! – geht nicht zu jüdischen Rechtsanwälten! Dann ist der raus und wollte das Plakat abreißen.“
Gebhardt hält verschämt seine Hand vor den Mund. Er ist todmüde. Aus der Küche flötet der Wasserkessel.
„Die haben sofort auf ihn eingeschlagen“, fährt sie fort, „und als er am Boden lag, gab ihm einer noch einen Tritt gegen den Kopf. Jetzt liegt er im Krankenhaus. Halbtot. Ich wollte dazwischen. Aber da sagte einer zu mir: Hau ab! Dich kriegen wir auch noch! Jetzt dachte ich, als es klingelte, das wären diese Halunken. Ich habe wahnsinnige Angst. Der arme Rademacher. Stell dir vor: Niemand wusste, dass er jüdisch ist. Er vielleicht am allerwenigsten.“
„Robbi und sein Kollege haben mir erzählt, was in den Kirchen gedacht und in ihrer Presse geschrieben wird. Da sind einige gefährliche Brandstifter zugange.“
„Und die Braunhemden sind ihre willigen Vollstrecker. Nein, das ist wirklich nicht über Nacht, nicht wie Pech und Schwefel vom Himmel gefallen. Die nationalistischen Vereine machen mir Sorgen. Der Schreihals an erster Stelle!“
Gebhardt möchte darauf etwas erwidern, hat sich aber den Mund mit Brot und Käse vollgestopft. Nickt nur zustimmend.
„Warum unterhalten wir uns nicht über Kino, Theater oder Hurenböcke? Hermchen, seit Jahren haben wir uns nicht gesehen, kaum bist du fünf Minuten hier und schon reden wir über die, vor denen wir streng genommen Reißaus nehmen sollten.“
Er schluckt.
„Über Hurenböcke reden wir, ohne sie beim Namen zu nennen“, lacht er und rudert weit ausholend mit den Armen. Beinahe hätte er die Stehlampe neben dem kleinen Couchtisch umgestoßen. „Der antisemitische Hass liegt in der Luft.“
„Das fing nicht nur mit dem Kaiser an. Aber auch. Der war ja der Überzeugung, sein Sturz sei ein Werk einer jüdischen Weltverschwörung. Es wäre seine einzige Rettung gewesen, hätte er vor dem Krieg die deutschen Juden unter Giftgas gesetzt.“
Sie schaut zur Wohnungstür.
„Ich höre noch den Satz: Knallt ab den Walther Rathenau, die gottverfluchte Judensau!“, wirft er ein.
Eigentlich möchte er nichts mehr sagen, hat seinen Hunger gestillt und will nur schlafen.
„Der Brüllaffe, wenn der am Ruder ist, wird all das umsetzen, was er gesagt hat. Macht er jetzt schon! Mein Gott, der arme Rademacher.“ Wieder ein Blick Richtung Tür. Ein Zucken der Mundwinkel.
„Hat es geklingelt?“, fragt sie.
„Nein, ich habe nichts gehört.“
Er schweigt eine Weile, dann sagt er: „Das katholische Zentrum ist nicht antisemitisch angehaucht, oder? Vielleicht schaffen die es, die Braunen einzugrenzen.“
„Bist du dir da sicher? Sicher bin ich mir, dass in ihren Reihen Antisemiten sitzen. Geben es offen zu. Möchtest du noch einen Tee?“
Er verneint mit einem Kopfschütteln.
„Von Religion habe ich keine Ahnung. Aber Christentum ohne Judentum gleich Irrtum.“
„Einige lehnen den Antisemitismus ab. Mit welcher Begründung? Nicht, um Juden zu schützen, sondern weil sie fürchten, wenn die Judenfrage erledigt ist, es auch ihnen an den Kragen geht. Erst Juda, dann Roma!“
Sie streicht hastig durch ihr Haar, kratzt nervös hier und dort auf der Kopfhaut. „Oder wenn die Antisemiten sich im Kampf gegen das Jüdische unchristlicher Mittel bedienen.“
„Wie bitte? Was sind denn erlaubte christliche Mittel?“
Sie bittet ihn um eine Zigarette. Hektisch beginnt sie zu rauchen. Es ist mehr ein Paffen.
„Hermchen, dir fallen die Augen zu, und ich rege mich auf. Soll ich nicht, sagt der Arzt. Aber da kann man doch nicht anders, als auf die Palme gehen!“
Abermals zuckt es um ihre Mundwinkel. Blickt zur Tür.
„Robbi hat sich taufen lassen?“, fragt er, obwohl er ein langes Gähnen unterdrücken muss.
„Hat er dir erzählt? Stell dir vor! Von mir aus. Ähnliches hat mein Vater gemacht. Seinen Namen geändert. Das eine für die Psyche, das andere für die Physe! Es fing bei Bismarck an ...“
Sie lacht etwas gequält, inhaliert einen tiefen Zug und bekommt einen heftigen Hustenanfall. Drückt die Zigarette aus, hastet in die Küche und schlägt sich zwei, drei Handvoll Wasser ins Gesicht, trocknet es mit dem Ärmel ihres Hausmantels und trinkt einen kräftigen Schluck.
„Da fing es an“, ruft sie von dort, „da änderten viele Juden ihre jüdisch klingenden Namen wie Cohn, Levy oder Danziger in Müller, Meier oder Schulze.“
Sie lässt sich in einen für ihre Körpergröße viel zu wuchtigen Ohrensessel fallen, schaut um sich, zur Wohnungstür.
„Mein Vater hieß früher Cantorowitz. Als er vor der Hochzeit auf Wunsch seiner zukünftigen Frau, meiner Mutter, Gott hab sie selig! diesen im wahrsten Sinne des Wortes witzigen Namen ändern wollte, ging das nicht in Cantor, weil er in der jüdischen Gemeinde nicht der Kantor war. Also ließ er sich in Saenger umbenennen. Das soll jetzt alles wieder zurückgedreht werden? Sich taufen lassen, anderer Name und so weiter – das nannte man Assimilation. So ein Blödsinn! Stell dir vor: Es gab einmal eine deutsch-jüdische Emanzipationsepoche. Ich weiß, wovon ich rede. War in Charlottenburg schließlich zuständig für kulturhistorische Belange. Wir waren gleichberechtigte Staatsbürger. Frei von jeglicher Diskriminierung. Nicht ganz, aber so weit, dass wir uns arrangiert hatten. Das kannst du heute vergessen. Das war in längst vergangenen Tagen. Schau dich um: Theater, Kino, Musik, Malerei, Wissenschaft – Deutschland ohne Juden. Unvorstellbar.“
„Das geistige Klima ist vergiftet von antisemitischer Pest und rassistischer Cholera.“
„Mir kann keiner erzählen, dass man das nicht mitbekommt, was sich da auf den Straßen abspielt. Die Nazi-Propaganda nicht abkriegt. Die Sozialdemokraten sind die einzigen, die am konsequentesten den Antisemitismus ablehnen. Aber ihre Partei wird als Judenschutztruppe diffamiert. Wie heißt es so schön: Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Ist nicht vonmir. Von Liebermann. Kürzlich hing hier auf der Straße ein Plakat: Schmiert die Guillotine ein mit Judenfett. Blut muss fließen, Judenblut. Entschuldige, dass ich so viel rede. Berufskrankheit.“
Sie lacht.
„Dass du immer noch nicht müde bist, Muttchen Saenger!
Ich bin platt wie eine Flunder. Ich leg mich hier aufs Sofa. Wenn du morgen früh aufstehst und ich bin nicht mehr da, sitze ich im Zug nach Frankfurt. Also: Schon jetzt besten Dank für deine Gastfreundschaft.“
„Schlaf gut. Ich hab mich gefreut, dass du gekommen bist.“ Sie windet sich aus dem tiefen Ohrensessel und gibt ihm zum Abschied die Hand.
„Wirst du Robbi treffen? Ich mach mir solche Sorgen! Was soll bloß werden? Ich habe Angst um ihn.“
Er schweigt. Dann wünscht auch er eine gute Nacht, legt sich auf die Couch, löscht das Licht der Stehlampe und kann trotz seiner bleiernen Müdigkeit nicht sofort einschlafen.
1898, noch zu Kaisers Zeiten in Aachen geboren, mittelgroß, schlank, mit lichtem, dunkelbraunem Haar und weit ausladenden Geheimratsecken, schmale Lippen, scharfzüngig, nicht ohne rheinischen Humor, promovierter Jurist, im Dezember 1929 als Regierungsrat und Hilfsreferent endgültig in den preußischen Staatsdienst übernommen, stand Dr. Hans Maria Globke eine glänzende Beamtenkarriere bevor. Bereits mit zweiunddreißig Jahren war er im Innenministerium zum Leiter des Verfassungsreferats ernannt worden. Jene unscheinbare Abteilung, dem das Personenstandsreferat mit Namensänderungsangelegenheiten zugeordnet ist. Jetzt fürchtet er um seinen Posten. Was er offiziell über das Vorhaben des Reichskanzlers Franz von Papen zu lesen und hinter vorgehaltener Hand zu hören bekommt, ist nicht anders zu interpretieren als ein Schlag gegen Preußen. Ein Putsch! 20. Juli 1932. Da macht man ihm, dem kundigen Verwaltungsbeamten nichts vor. Die Ministerialverwaltung wird im vorauseilenden Gehorsam und in sicherer Erwartung einer Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten einer personellen Säuberung unterzogen. Republikanisch gesinnte Beamte werden in den vorzeitigen Ruhestand versetzt oder beurlaubt. Monarchisten geduldet. Ein befremdliches Gefühl beschleicht ihn. So etwas wie Unsicherheit. Vielleicht auch Angst.
Mit einem Bundesbruder aus Bonner Studentenzeiten, Biername Bönnsch, sitzt er im Kranzler bei einer Berliner Weiße mit Schuss - Waldmeistersirup. „Ausgerechnet jetzt“, sagt Globke, „genau zwei Jahre später erfolgt die Absetzung der preußischen Regierung. Der Preußenschlag!“
„Das wird ohne Personaleinsparung nicht abgehen“, nuschelt Bönnsch im rheinischen Singsang, seit etlichen Jahren Mitglied des Preußischen Landtages. Er schaut verlegen zu Globke. Hat nicht viel Zeit. Trinkt hastig den letzten Schluck. „Neugestaltung der Länder. Machtverschiebung zugunsten des Reiches.“
„Gegen eine Verwaltungsreform, auch gegen eine Gleichschaltung habe ich nichts“, meint Globke, „selbst dann nicht, wenn man dem Reich mehr Zuständigkeiten einräumt.“
„Was wir bisher vorfinden, ist reinstes Chaos. Da könnte mal jemand Ordnung hinein bringen. In die politische Administration. Wenn du verstehst, was ich meine. Am 31. Juli wird es Neuwahlen zum Reichstag geben. Dann sehen wir weiter.“
„In einer Woche! Die Nationalsozialisten, das pfeifen die Spatzen von den Dächern, werden die Wahlen haushoch gewinnen. Was wird aus mir? Aus dir?“
„Ich weiß mir zu helfen. Das musst du pragmatisch angehen. Das hast du doch gelernt, Globke! Ich hab zu tun. Die Leute warten. Wir sollten uns häufiger treffen. Mach’s gut! Danke für die Einladung!“
„Ich sollte zum Oberregierungsrat befördert werden. Daraus wird wohl nichts. Vorläufig nicht“, sagt er im Hinausgehen und verabschiedet sich missmutig gestimmt. Seine Hoffnung, der Bundesbruder würde ihm zur Seite stehen, hat sich nicht erfüllt.
Ruhe bewahren ist jetzt besser. Er ist weder monarchistisch, noch nationalsozialistisch, noch deutsch-national eingestellt, sondern ein treuer Diener des Staates. Darüber hinaus, wie Bönnsch, Mitglied der Zentrumspartei, der politische Arm der katholischen Kirche, die wiederum jede Staatsform von Gott gegeben ansieht. Er hält sich bedeckt und tut seine Pflicht. Außerdem ist er als Sachverständiger für Verfassungsfragen so gut wie unentbehrlich. Er arrangiert und engagiert sich. Arbeitet an den Richtlinien zum Preußischen Ermächtigungsgesetz sowie dem Gesetz über die Anpassung der preußischen Verwaltung an das nationalsozialistische Regierungsprogramm mit. Sein Fachwissen wird gewürdigt. Er ist verblüfft, aber nicht wirklich überrascht und darf bleiben. Die preußische Verordnung von 1919 über Namensänderungen und die Entscheidungshoheit über die Zuständigkeit zur Änderung von Familiennamen und Vornamen hat er dahingehend geändert, dass ein Entscheidungsvorbehalt zugunsten des Preußischen Ministers festgelegt wird. Eine Weichenstellung von grundsätzlicher Relevanz. Der Minister, so hat er vorgeschlagen, müsse sich in allen Fällen die Möglichkeit zur endgültigen Antragsbescheidung vorbehalten. Und der hat es ihm gelohnt. Ist mehr als zufrieden. Dennoch bleibt ein merkwürdiges Gefühl.
„Über Anfragen auf Änderung des Familiennamens entscheide ich“, sagt sein Minister. Globke hat verstanden. Er meint ihn, den zuständigen Beamten. Das heißt, die Entscheidungsbefugnis nachgeordneter Behörden wird begrenzt und er, Globke, wird zukünftig entsprechende Richtlinien darüber verfassen, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung bei weiterzuleitenden Anträgen von Bedeutung sind. Genau genommen schreibt er nichts Neues.
„Wir müssen uns beeilen“, mahnt der Minister, „wie gesagt, für den 21. November 1932 ist der Termin über die Zuständigkeit von Familiennamen gesetzt. Da können Sie auf die Ihnen hinlänglich bekannte Verordnung aus dem Jahr 1919 zurückgreifen.“
„Nicht nur darauf“, weiß Globke, „sogar auf den Erlass vom 12. Juli 1867.“
„Man verlangte bisher nur eine kurze Erklärung für eine Namensänderung, wie es früher hieß, oder?“
„Das geht selbstverständlich nicht. Nein, sie ist zu begründen. Vollumfänglich.“
„Ein Landgerichtspräsident soll wieder verfügen?“
„Auch das nicht. Wurde 1928 rückgängig gemacht.“
„Eventuell der Regierungspräsident?“
Mit den kleinen Fingern bohrt der Minister erst ins linke, dann ins rechte Ohr.
„Vielleicht“, meint Globke, „aber eher nein. Wenn er die Zuständigkeit hat, gilt es jetzt, die Gelegenheit ist günstig, Antworten zu geben.“
„Wie ist mit einer Namensänderung von Ausländern zu verfahren? Dürfen sie verdeutscht werden?“
„Das kann von Rechts wegen nicht angehen. Das kann man nicht gestatten.“
„Sputen Sie sich, Globke, wir haben keine Zeit zu verlieren. Melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben. Kurzer Dienstweg. Sie verstehen schon! Wir sehen uns morgen früh. Bis dann!“
Nach diesem Gespräch - er empfand es als außergewöhnlich ehrenhaft und anerkennend, dass ihn der Minister höchstpersönlich zu sich bestellt hat - nimmt er die Akte für einen Entwurf zum Namensänderungsgesetz vor, spitzt nochmals den Bleistift und schreibt unter Ziffer VI eine erste Formulierung: Jede Namensänderung wird als Beeinträchtigung der Erkennbarkeit und als potentielle Verdunkelung des Personenstandes definiert und im Zweifel nicht gestattet. Bestrebungen jüdischer Personen, ihre jüdische Abkunft durch Ablegung oder Änderung ihrer jüdischen Namen zu verschleiern, können daher nicht unterstützt werden. Ebenso wenig kann die Namensänderung mit dem Hinweis auf antisemitische Strömungen oder auf das Bestreben eines besseren wirtschaftlichen Fortkommens begründet werden.
Es ist schon spät. Er hätte längst Feierabend machen sollen. Morgen wird er den Vorentwurf in aller Ruhe redaktionell überarbeiten, dem Minister vorlegen und an die Regierungspräsidenten und Landräte handschriftlich verfügen. Er muss es aber noch deutlicher zum Ausdruck bringen und entsprechend nachtragen: Der Minister ist nur eingeschränkt bereit, Entscheidungsbefugnisse zu delegieren. Und: Welche Gesichtspunkte für die Entscheidung bei weiterzuleitenden Anträgen bedeutsam sind, bleibt dem Minister ebenfalls vorbehalten. Er setzt sich nochmals an den Schreibtisch, damit er die Formulierung nicht vergisst: Ich bemerke ausdrücklich, dass diese Richtlinie lediglich die Vorbereitung der Entscheidung erleichtern soll. Auch bei der Erfüllung der in der Richtlinie aufgestellten Voraussetzungen besteht kein Anspruch auf Genehmigung der beantragten Namensänderung. Von einer Veröffentlichung ist Abstand zu nehmen.
Während er formuliert, glaubt er, für den jüdischen Teil der Bevölkerung nicht zu weit gegangen zu sein. Zwar gibt es lächerlich klingende jüdische Namen. Wer will schon Mondschein, Freudenhaus oder Kotz, Itzig oder Nachtschweiß heißen. So schreibt er, dass derartige anstößige Namen deutschen Ursprungs geändert werden können, indessen in der Regel nur durch Gewährung eines anklingenden Namens, des Namens eines nahen Familienangehörigen oder eines Phantasienamens, nicht aber durch Gewährung eines sonst vorkommenden Namens.
Mit dieser Abfassung, dessen ist er sich bewusst, entspricht er dem Zeitgeist. Einige Protagonisten in staatstragenden Schichten des Kaiserreichs, insbesondere in Kreisen von völkisch konservativen Deutschnationalen, hatten zunehmend Fragen des Namensrechts, insbesondere die Namensänderungen der Juden in ihr Agitationsprogramm mit einbezogen. Das Namensrecht wurde ihr antisemitisch rassistisches Propagandaobjekt: Namensänderungen, so in der Staatsbürgerzeitung vom 1. Juni 1900, sind darauf angelegt, die jüdische Abstammung nach außen hin zu verschleiern. Der Schutz des Namens entspringt germanischer Rechtsanschauung, die der jüdischen natürlich fremd ist.
„Ist der Familienname im Deutschen Reiche vogelfrei?“, fragte der Deutsche Herold 1913. Es könne doch nicht angehen, dass jemand, der nicht zu unserem Geschlechte gehöre und mit uns absolut nichts zu tun habe, unbefugt unsere Namen führe.
Globke legt den Bleistift zur Seite, schiebt die Brille auf die Stirn und reibt sich die Augen. Er liest die Niederschrift nochmals durch. So, das muss genügen. Schluss für heute. Er steht auf, nimmt Mantel, Homburger und Stock, zieht den Schal fest um den Hals und verlässt mit einem „N’abend“-Gruß für den Pförtner Ewald Globlowski das Haus. Ich sollte weiterführend erwähnen, denkt er, dass Neugeborene von christlich verheirateten Eltern keinen jüdischen Vornamen erhalten dürfen. Der Grundgedanke sei durchaus gesund. Antisemitisch zwar nicht neutral, aber im Sinne der Kirche. Was die Nationalsozialisten wohl dazu sagen würden, wenn sie denn an die Macht kämen? Es entspräche ihrer Denkungsart. Sie werden es nicht schaffen, und wenn doch, dann müsste er sich ...
Ein heftiger Wolkenbruch mit Gewitter und Hagelschlag überrascht ihn. In der Früh noch schien die Sonne vom heiteren Himmel. Pitschnass erreicht er seine Wohnung, legt in der Garderobe die durchnässten Sachen ab und genehmigt sich, bevor er Wasser für ein heißes Bad in die Wanne einlässt, einen doppelten Armagnac. Eine unangenehme Kälte überkommt ihn. Es ist nicht nur der Preußenschlag, der ihn Böses ahnen lässt.