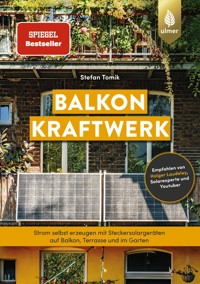
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sie wollen Öko-Strom zuhause selbst erzeugen? Kein Problem mit Stecker-Solargeräten für Balkon, Terrasse und (Schreber-)Garten. Mit diesen „Balkonkraftwerken“ kann wirklich jede*r zum Stromproduzenten werden. Stefan Tomik beantwortet in diesem ersten Ratgeber zum Thema die dringendsten Fragen zu Stecker-Solargeräten wie: Wie viel Prozent der Stromrechnung können eingespart werden? Welche Geräte können wie lange mit Balkonstrom betrieben werden? Außerdem erklärt er das Wichtigste zu den Ertragschancen, Rechtlichem und der Registrierung bei der Bundesnetzagentur, der Sicherheit sowie der Montage und Technik der Anlagen. Empfohlen vom Solar-Pionier und Youtube-Star Holger Laudeley!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefan Tomik
Strom selbst erzeugen mit Steckersolargeräten auf Balkon, Terrasse und im Garten
INHALT
WARUM DIESES BUCH?
Oder: Wie ich mal eben schnell ein Balkonkraftwerk aufhängen wollte – und fast daran verzweifelt wäre
SCHRITT FÜR SCHRITT
BALKONKRAFTWERKerklärt in 15 Minuten
ERSPARNIS
SICHERHEIT
RECHT
KAUF
MONTAGE
ENDLICH AM ZIEL
SERVICE
AUF EINEN BLICK:Die wichtigsten Fragen und Knackpunkte für angehende Stromproduzenten
EINE KLEINE GESCHICHTE DER BALKONKRAFT
Anmerkungen
Quellen und Literaturhinweise
Über den Autor
Dank
WARUM DIESES BUCH?
Oder: Wie ich mal eben schnell ein Balkonkraftwerk aufhängen wollte – und fast daran verzweifelt wäre
Alle meine Bekannten wollen jetzt ein Balkonkraftwerk, ein Mini-Solargerät für die Steckdose. Die Medien berichten darüber, im Fernsehen läuft Werbung dafür, und die Strompreise steigen wer weiß wie hoch noch. Deshalb wollen viele nun ihren eigenen Strom erzeugen, mit einem Stecker direkt ins Haushaltsnetz einspeisen – und Geld sparen. Dann läuft der Stromzähler nämlich langsamer oder steht sogar still. Gut fürs Klima ist es obendrein. Und weil das fantastisch klingt, will ich es auch und mache mich auf die Suche.
Ein Prospekt des örtlichen Baumarkts verspricht ein Rundum-Sorglos-Paket: „Mit der Komplett-Solaranlage produzieren und nutzen Sie Ihren eigenen Ökostrom – sparen Sie sich damit einen großen Teil Ihrer Stromrechnung und werden Sie Teil der Energiewende! Einfache Montage im Garten, am Balkon oder auf einem Flachdach.“ Und das zu einem Knallerpreis von unter 500 Euro, einschließlich Befestigungssystem für Balkongeländer oder Wandmontage.
Ich fahre gleich in die nächste Filiale – und komme gerade einmal bis zum Informationsschalter, bevor mein Traum zerplatzt. „Balkonkraftwerke? Nee, die haben wir gar nicht bekommen“, höre ich. „Da gab es wohl Lieferschwierigkeiten.“ Lieferschwierigkeiten gibt es auch bei vielen Onlineshops, die solche Geräte anbieten. Das Internet ist voll von Angeboten, aber oft heißt es: „Derzeit nicht lieferbar“.
Vor allem tauchen im Internet die ersten Probleme auf. Man muss die Geräte zwar nicht genehmigen lassen, aber anmelden, heißt es dort, und das scheint nicht ganz ohne zu sein. Anmelden muss man sie nicht nur bei der Bundesnetzagentur, sondern auch beim örtlichen Stromnetzbetreiber. Und der errichtet hohe Hürden. Er wirft mit VDE-Normen um sich, dass einem schwindlig wird, und verlangt eine spezielle Einspeisesteckdose, die nur ein Elektriker anschließen darf. Der würde auch gleich noch die Leitungen messen und die Sicherung tauschen. Das wird teuer, und Elektriker sind auch schwer zu bekommen. Außerdem soll womöglich der Stromzähler getauscht und ein Zweirichtungszähler installiert werden. Ganz so einfach, wie es im Prospekt angepriesen wird, scheint das ganze Unterfangen also nicht zu werden.
Andererseits gibt es Leute, die schon seit vielen Jahren Balkonkraftwerke betreiben und ihren Strom ebenso lange mit einem normalen Haushaltsstecker einspeisen, obwohl der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) behauptet, genau das sei gefährlich und unzulässig. Manche von ihnen melden ihre Geräte überhaupt nicht an und nennen das „Guerilla-Photovoltaik“. Sie sehen sich als Stromrebellen und begehren auf gegen die Macht der Stromkonzerne und Netzbetreiber.
Ab jetzt wird gespart: Balkonkraftwerk am sonnigen Südbalkon.
Ein Balkonkraftwerk hätte ich schon gerne, aber ich will auch nicht im Knast oder Krankenhaus landen. Und sicher montiert werden soll es auch. Da offenbart sich gleich die nächste Schwierigkeit: Wie befestigt man das schwere Solarmodul am Balkongeländer, und ist das überhaupt zulässig? Je länger ich recherchiere, desto mehr Probleme tauchen auf. Das Baurecht stellt sich mir in den Weg. Von Überkopfzulassung ist die Rede, von Schnee- und Windlasten und von einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, die aber nur ganz wenige Solarmodule besitzen. Und was wird überhaupt mein Vermieter zu meinen Plänen sagen? Darf er sie verbieten?
Ich brauche Rat. Im Internet und auf Youtube stolpere ich immer wieder über einen Namen: Holger Laudeley. Der Unternehmer und Solarpionier hat Balkonkraftwerke in Deutschland bekannt gemacht in hunderten von Videos. Laudeley, ein Ingenieur für Betriebs- und Versorgungstechnik, ist ein aufmüpfiger Typ, der sich nicht so schnell von irgendetwas abbringen lässt. Als ich ihn in Ritterhude besuche, wo er sich im Gewerbegebiet ein regelrechtes Solarimperium aufgebaut hat mit riesigen Photovoltaikanlagen, erzählt er mir, wie er mit einem Kumpel vor zwölf Jahren seine ersten Balkonkraftwerke entwickelte, wie ihre Firma verklagt wurde und Insolvenz anmelden musste. Laudeley sieht eine mächtige Lobby am Werk, die gut verdient an dreckigem Kohlestrom und kein Interesse daran hat, dass Leute wie Sie und ich jetzt anfangen, zu Hause ihren eigenen Ökostrom zu produzieren.
Diese Sichtweise wird mir später immer wieder begegnen. Quer durch die Solarbranche sind Unternehmer frustriert, weil Deutschland bei der Photovoltaik einst zur Weltspitze gehörte, heute aber kaum noch eine Rolle spielt. Schlechte politische Entscheidungen zugunsten weniger Strom-Monopolisten haben demnach die heimische Photovoltaikindustrie kaputtgemacht und die Energiewende ausgebremst. Wir könnten 15 Jahre weiter sein, sagen sie.
Auch könnte es schon viel mehr Balkonkraftwerke geben; stattdessen wurde eine eher akademische Diskussion über die richtige Einspeisesteckdose angezettelt. Mini-Solargeräte, selbst wenn sie nur aus einem Solarmodul bestehen, müssen in Deutschland genauso penibel bei der Bundesnetzagentur registriert werden wie große Dachanlagen. Die Bürokratie und der Widerstand von einigen Netzbetreibern schrecken viele Interessierte ab, die sparen und etwas für den Klimaschutz tun wollen. Diesen Frust kann ich mittlerweile gut verstehen.
Als ich Holger Laudeley vorschlage, ein Buch zu schreiben als Hilfe für alle, die die Energiewende jetzt selbst in die Hand nehmen wollen, warnt er mich: „Weißt du eigentlich, was du da tust? Du begibst dich in eine Schlangengrube. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, ich würde das alles nicht noch einmal machen.“
Ich recherchiere trotzdem weiter – mit der Hilfe vieler Fachleute. Denn ich will die Energiewende in Bürgerhand vorantreiben. Den ersten Ratgeber speziell zum Thema Balkonkraft haben Sie nun vor sich. Er soll Ihnen helfen, sich im Dschungel von Gesetzen und Normen zurechtzufinden und sich von steigenden Strompreisen weniger abhängig zu machen.
Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich mein Balkonkraftwerk viel schneller aufhängen können.
Wie es der Zufall will, ereignet sich kurz vor Druck dieses Ratgebers Erstaunliches: Plötzlich ist auch der VDE für einfachere Regeln. In einem Positionspapier fordert der Verband eine Bagatellgrenze für Kleinstanlagen. Und die soll sogar bei 800 Watt liegen. Plötzlich soll Balkonkraft auch ohne Zweirichtungszähler gehen. Und nicht nur das: Stromzähler sollen zumindest für eine Übergangszeit sogar rückwärts drehen dürfen – was bis vor Kurzem als undenkbar galt. Die Anmeldung beim Netzbetreiber soll entfallen und die Einspeisung mit Schukostecker unter Voraussetzungen geduldet werden.
Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Jahrelang wurde all das, was engagierte Aktivisten fordern, als gefährlich und absurd abgetan. Und jetzt besteht wirklich die Chance, dass es bald einfache, klare und einladende Regeln für Balkonkraftwerke gibt. Allerdings müssten dafür Gesetze, Verordnungen, technische Normen und Anschlussregeln geändert werden. Dass das alles so durchkommt, ist noch nicht ausgemacht, lag aber auch noch nie näher als heute.
SCHRITT FÜR SCHRITT
BALKONKRAFTWERK
erklärt in 15 Minuten
Das Neue und Besondere an der Balkonkraft versteht man am besten, wenn man mal ganz kurz zurückblickt auf die vergangenen Jahrzehnte der Photovoltaik in Deutschland. Die war früher nur etwas für Leute mit eigener Dachfläche und viel Geld. Mit dem haben sie eine Firma damit beauftragt, eine Anlage zu konzipieren. Ein Montagetrupp hat das Dach mit Solarmodulen gepflastert und ein Elektriker alles angeschlossen. Erst dann konnte die Anlage in Betrieb gehen und jeden Tag Strom ins öffentliche Netz einspeisen.
Dafür erhielt ihr Besitzer eine üppige Vergütung, die das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festlegt. Allerdings hatte er auch üppige Kosten. Solartechnik wurde in kleinen Stückzahlen hergestellt und war teuer. Die Einspeisevergütung musste also hoch sein, damit Privatleute überhaupt in Photovoltaik investierten. Das ist heute anders. Die Preise für Solartechnik sind stark gesunken und private Solaranlagen seit Januar 2023 sogar ganz von der Mehrwertsteuer befreit.
Auch die EEG-Vergütung wurde deshalb zurückgefahren. Gleichzeitig stiegen die Strompreise in den vergangenen Jahren enorm. Damit haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen komplett geändert: Früher war man scharf auf die hohe Einspeisevergütung, die mit einer Solaranlage zu erzielen war; heute geht es vor allem darum, den eigenen Stromverbrauch zu reduzieren. Was man günstig selbst herstellen kann, muss man ja nicht teuer einkaufen.
Strom für Millionen Mieter
Das ist genau das Prinzip der Balkonkraftwerke: Sie produzieren Strom für den sofortigen Eigenbedarf. Einen Speicher, um den Strom später zu verbrauchen, haben sie nicht und unterscheiden sich damit von vielen großen Solaranlagen.
Und vor allem: Endlich können auch Mieter von den Vorteilen der Photovoltaik profitieren. Fast die Hälfte der Deutschen wohnen zur Miete; das ist ein größerer Anteil als in jedem anderen Land der Europäischen Union. Doch nur weniger als 1 Prozent der etwa 3 Millionen Mehrfamilienhäuser in Deutschland sind mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Dabei würden die meisten Mieter sehr gerne von sauberem – und günstigem – Strom vom eigenen Dach profitieren, etwa im Rahmen von Mieterstrommodellen.
Etwa die Hälfte der Deutschen war also von der Nutzung der Solarenergie bislang ausgeschlossen, und ich bin einer von ihnen. Aber meine Mietwohnung hat einen schönen Südbalkon mit Blick auf Hofheim am Taunus. An diesem Balkon soll mein Steckersolargerät hängen. Das ist der Plan.
Ein Phänomen mit vielen Namen
Heute kommt es mir merkwürdig vor, dass ich nicht schon viel früher von Balkonkraftwerken erfahren habe. Erst der Krieg in der Ukraine und die Debatte über Energieautarkie haben das Thema so richtig in die Öffentlichkeit katapultiert.
Manchmal ist da auch von Mini-PV-Anlagen die Rede, wobei PV für Photovoltaik steht, oder von Steckersolaranlagen oder -geräten, weil es sich ja um steckerfertige Haushaltsgeräte handelt. Oft liest man auch von Plug-in-Solaranlagen, weil sie sich so einfach in Betrieb nehmen lassen („Plug and Play“). Jedenfalls wenn sie einen Schukostecker haben, der in jede normale Haushaltssteckdose passt.
Da die ersten Anlagen dieser Art gegen heftigen Widerstand von Netzbetreibern, VDE und Behörden betrieben wurden, hat sich auch der Begriff „Guerilla-PV“ etabliert. Das passt ebenfalls, wenn man bedenkt, dass viele Besitzer wohl „vergessen“ haben, ihrer Meldepflicht gegenüber der Bundesnetzagentur und dem Stromnetzbetreiber nachzukommen. Wahrscheinlich wollten sie sich Ärger vom Hals halten. Manche freuen sich heute noch diebisch, wenn sie Strom einspeisen und ihr alter Zähler rückwärts läuft – was jedoch nicht erlaubt ist.
So funktioniert’s technisch
Wie man Balkonkraftwerke auch bezeichnet – es geht immer um dasselbe Prinzip. Die Technik ist ausgereift und simpel. Mini-Solaranlagen bestehen aus ein oder zwei Photovoltaikmodulen, die mit einem Wechselrichter verbunden werden. Die Module messen etwa 1 mal 1,70 Meter und wiegen an die 20 Kilogramm. Sie erzeugen aus Sonnenlicht Gleichstrom. Doch damit kann man im Haushalt praktisch nichts anfangen. Deshalb verwandelt der Wechselrichter diesen Gleichstrom in Wechselstrom, und diesen kann ich über ein Kabel mit Stecker direkt ins Hausnetz einspeisen. Dort wird er sogleich verbraucht, und zwar von allen Geräten, die zu diesem Zeitpunkt Strom benötigen.
Aber woher „weiß“ der Strom, wohin er fließen soll? Die Antwort ist Physik pur. Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands. Der Weg von meinem Balkonkraftwerk zum Kühlschrank, zum Laptop oder zum WLAN-Router ist ja wesentlich kürzer und bietet damit deutlich weniger Widerstand als der Weg vom nächstgelegenen Kraftwerk in meine Wohnung. Das bedeutet: Meine Haushaltsgeräte nutzen zuerst den Strom meines Balkonkraftwerks, und nur wenn ihr Bedarf größer ist, schließen sie diese Lücke mit Netzstrom.
Sollte an einem sonnigen Tag trotzdem mehr Strom produziert werden, als gerade in meinem Haushalt benötigt wird, weil ich zum Beispiel im Urlaub bin, fließt dieser überschüssige Strom ins öffentliche Netz. Wahrscheinlich wird ihn dann meine Nachbarin verbrauchen. Das macht ja nichts. Im Gegenteil: Denn nun ersetzt der Ökostrom von meinem Balkon woanders konventionell erzeugten Kohlestrom. Dem Klima nützt das also trotzdem.
Der Aufbau eines Steckersolargeräts
Aufstellorte für Steckersolargeräte (Quelle: HTW-Studie)
Allerdings bekomme ich für meinen Balkonstrom dann kein Geld. Theoretisch könnte ich selbst mit einer winzigen Solaranlage und nur einem Modul eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beanspruchen. Aber das lohnt sich finanziell kaum, und für die paar Kröten nehme ich den Aufwand nicht in Kauf.
Strom erzeugen, wo er gebraucht wird
Die lokale Stromerzeugung nahe an den Verbrauchern hat einen großen Vorteil: Transportverluste werden vermieden. Bevor ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war mir überhaupt nicht klar, wie viel Energie auf dem langen Weg des konventionellen Stroms bis zu mir in die Wohnung verloren geht. Schon der Abbau von Kohle ist sehr energieintensiv. Für den Braunkohletagebau werden ganze Landschaften umgegraben, Dörfer weggebaggert und Autobahnen verlegt. Die Steinkohle für unsere deutschen Kraftwerke wird mittlerweile komplett importiert, und zwar nur zu einem mickrigen Anteil aus der EU, vor allem aus Polen. Große Anteile kommen aus Russland, Australien, den USA und Kolumbien. Erst wegen des Kriegs in der Ukraine wurde russische Kohle zuletzt durch noch mehr kolumbianische ersetzt. Die importierte Kohle wird also um die halbe Erde geschippert, bevor sie in Deutschland verfeuert wird. Ist das nicht verrückt?
Der gewonnene Strom muss von den Kraftwerken zu mir noch hunderte Kilometer durch Leitungen transportiert und auf dem Weg mehrmals in Umspannungswerken transformiert werden, von Höchstspannung in Hochspannung in Mittelspannung in Niederspannung. Jede Wandlung ist mit Verlusten verbunden. Das ist in etwa so, wie wenn man aus einer teuren Flasche Wein drei Viertel wegschütten muss, bevor man den Rest genießen kann. Erst jetzt, wo ich mich intensiv mit Balkonkraft beschäftige, dämmert mir, was für ein aufwendiges System wir hier unterhalten – und bezahlen. Da liegt die Frage doch auf der Hand: Warum produzieren wir unseren Strom nicht einfach dort, wo er gebraucht wird – bei uns zu Hause?
Jedes Solarmodul, das im Jahr 250 Kilowattstunden Strom erzeugt, ersetzt nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) die Verbrennung von 250 Kilogramm Kohle. Das Potenzial der Balkonkraft in Deutschland ist zwar nicht riesig, aber doch beachtlich. Eine überschlägige Schätzung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ergab allein für dieses Bundesland potenzielle Einsatzorte in rund einer Million Haushalte. Das entspricht einer möglichen Energieproduktion von jährlich 290 Gigawattstunden, also der Leistung von etwa 29 modernen Windkraftanlagen. Diese Energie würde, weil sie lokal erzeugt wird, ein Vielfaches an Kohlestrom ersetzen. Und wir brauchten auch weniger neue Überlandleitungen.
Der Import von Steinkohle nach Deutschland (Quelle: destatis)
Vorteile von Balkonkraftwerken
Einfach: Eine Anlage besteht nur aus ein oder zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter und Kabeln. Die kann man ganz leicht zusammenstecken (die Montage am Balkongeländer kann jedoch knifflig werden).
Schnell: Wir müssen nicht auf eine Genehmigung warten. Wir müssen die Anlage lediglich dem Stromnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur anzeigen.
Günstig: Die Investition von ein paar Hundert Euro hat sich innerhalb einiger Jahre amortisiert. Danach produzieren wir eigenen Ökostrom kostenlos.
Sicher: Das Gerät funktioniert nur, wenn es das Stromnetz mit der richtigen Spannung und Frequenz erkennt. Es schaltet automatisch ab, sobald der Stecker gezogen wird.
Flexibel: Auch Mieter können im Rahmen des Mietrechts Strom erzeugen. Bei einem Umzug nehmen sie ihr Steckersolargerät einfach mit.
Selbermachen: Kleine Anlagen bis 600 Watt können Laien in der Regel selbst und ohne Elektriker in Betrieb nehmen. Allerdings braucht man handwerkliches Geschick für die Montage.
Sichtbar: Balkonkraftwerke machen die Energiewende konkret sichtbar. Jede Anlage birgt Gesprächsstoff für die Nachbarschaft – und trägt die Idee weiter.
Unabhängig: Große Stromkonzerne dominieren den Markt, ihre Aktionäre wollen Rendite sehen. Mit einem Balkonkraftwerk lösen wir uns ein kleines Stück aus der Abhängigkeit. Vollends unabhängig werden wir leider nicht.
Warum Balkonkraft ansteckend ist
Holger Laudeley nennt Balkonkraftwerke eine „Einstiegsdroge“. Menschen, die sich bislang nie mit Photovoltaik beschäftigt haben, fangen plötzlich an zu rechnen, wie viel sie damit sparen könnten. Die steigenden Strompreise erleichtern diese Gedankengänge erheblich. Man könnte auch sagen: Es ist die blanke Panik ausgebrochen. Jeder schaut jetzt, wie er seine Stromrechnung reduzieren kann.
Besitzer von Balkonkraftwerken erfassen gerne laufend ihren Ertrag und optimieren ihren Stromverbrauch, sodass sie einen größeren Anteil ihres Bedarfs mit dem Eigenstrom decken können. Nach Angaben von Händlern fragen Kunden inzwischen nach Geräten mit immer mehr Leistung. Erstaunlicherweise sind unter den Kunden auch Leute, die bereits eine große Anlage auf ihrem Einfamilienhaus besitzen.
Jedes Solarmodul macht die Energiewende sichtbar und verbreitet die Idee weiter. Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) haben herausgefunden, dass Solaranlagen „ansteckend“ seien, und zwar „auf gute Weise“. Menschen mit einer Solaranlage in ihrer Umgebung würden mit höherer Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine kaufen. Der Faktor Nähe sei bedeutender als Einkommen, Bildung oder Mund-zu-Mund-Propaganda, fanden sie heraus.1
Energiewende in Bürgerhand
Wenn ich bald einen Teil meines Stroms selbst produziere, bin ich nicht länger ein reiner Konsument, sondern ein Prosument. So heißt das deutsche Pendant zum englischen Prosumer. Das ist Energiewende zum Selbermachen. Ich trete also ein kleines Stück weit in Konkurrenz zu den großen Energiekonzernen. Die haben seit der Liberalisierung des Strommarktes in den Neunzigerjahren eine erhebliche Macht aufgebaut. An dem von ihnen gelieferten Strom verdienen auch die vier großen Übertragungsnetzbetreiber und mehr als 900 Verteilnetzbetreiber kräftig mit. Die unterhalten und warten das Stromnetz und wachen als natürliche Monopolisten in ihrer Region über eine gewaltige Infrastruktur aus Überlandleitungen, Erdkabeln, Schalt- und Umspannwerken.
Die Energiewende ist im Mehrfamilienhaus angekommen.
Für den Transport des Stroms zum Endkunden erhalten sie ein sogenanntes Netznutzungsentgelt, dessen Höhe die Bundesnetzagentur festlegt. Dieses Entgelt macht etwa ein Viertel des Strompreises aus. Je mehr Strom ich also kaufe, desto mehr verdienen auch die Netzbetreiber. Und jetzt komme ich und will auf meinem Balkon eigenen Strom produzieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei denen nicht gut ankommt.
Tatsächlich gehörten viele Netzbetreiber zu den Bremsern der Balkonkraft. Dass ein Stromerzeugungsgerät einfach so in einen Verbrauchsstromkreis einspeist, galt lange als undenkbar. Der Druck von Balkonkraft-Enthusiasten hat dazu geführt, dass der VDE das 2019 ausdrücklich in seinem Regelwerk erlaubte – ein Durchbruch, der die Nachfrage nach Steckersolargeräten spürbar steigen ließ. Zusammen mit den explodierenden Energiepreisen und der Debatte über Energieautarkie nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine führte das zu einem regelrechten Boom der Balkonkraft.
Streit über die Steckdose
Doch es wurden andere Hürden errichtet. Der gewöhnliche Schukostecker, der in jede vorhandene Haushaltssteckdose passt, wird verteufelt, ein spezieller Einspeisestecker gefordert. Die dazu passende Spezialsteckdose darf nur eine Elektrofachkraft installieren. Die soll auch gleich noch die Leitungen prüfen und die Sicherung tauschen. Das würde jedoch einige Vorteile der Balkonkraft – schnell, günstig, flexibel – zunichte machen. Ich sehe mein Budget schon dahinschmelzen.
Brauche ich wirklich einen Elektriker zur Installation? Über diese Frage werde ich gründlich nachdenken müssen. Denn der VDE vertritt diese Meinung, als wäre sie eines der Zehn Gebote. Andererseits werden schon seit vielen Jahren Balkonkraftwerke mit Schukostecker angeschlossen, es sind bereits hunderttausende Geräte. Und es ist nicht ein Unfall dadurch bekannt geworden.
Verwirrung und Halbwahrheiten
Dennoch stiften einige Netzbetreiber eher Verwirrung, indem sie Halbwahrheiten über Steckersolargeräte verbreiten. Da werden Gefahren aufgebauscht und Endkunden zum Beispiel mit der Behauptung verunsichert, der Netzbetreiber könne den Betrieb eines Steckersolargeräts nicht genehmigen – obwohl eine solche Genehmigung weder vorgesehen noch erforderlich ist. Der auf Energierecht spezialisierte Berliner Rechtsanwalt Jörn Bringewat sieht darin einen Versuch, Balkonkraftwerker „einzuschüchtern“ mit ihrer „administrativen Übermacht“.
Nachteile der Balkonkraft
Bürokratisch: Die Bürokratie ist reduziert im Vergleich zu großen Photovoltaikanlagen, aber immer noch schlimmer, als sie sein müsste. Viele Netzbetreiber errichten Hürden bei der Anmeldung, lehnen den Anschluss mit Schukostecker ab oder bestehen auf einen eigentlich unnötigen Zweirichtungszähler.
Unübersichtlich: Die Rechtslage ist kompliziert. Balkonkraft ist in Gesetzen und Verordnungen einfach noch nicht vorgesehen. Es gibt keine Bagatellgrenze, dafür viele Grauzonen, und es fehlt an Gerichtsurteilen, die den Weg weisen würden.
Nervig: Viele Vermieter sehen Balkonkraftwerke kritisch. Auch in Eigentümergemeinschaften stößt man oft auf Unverständnis. Gerichte entscheiden mal für, mal gegen Balkonkraftwerke. Es gibt auch im Mietrecht keine gesicherte Rechtslage.
Etliche Kommunen und Landkreise haben Förderprogramme für Mini-Solaranlagen aufgelegt, knüpfen diese aber daran, dass die teils sehr strengen Regeln der örtlichen Netzbetreiber eingehalten werden. Das kann dazu führen, dass die gesamte Fördersumme und mehr in den Kassen eines Elektrofachbetriebs landet, der das Balkonkraftwerk installieren soll.
Eines wird mir bei meiner Recherche ziemlich schnell klar: Ausgerechnet die Netzbetreiber sind bestimmt nicht die besten Ratgeber, wenn es um einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Holger Laudeley bringt es auf den Punkt: „Wer sich beim Netzbetreiber über eigenen Strom informiert, lässt sich auch vom Fleischer zu Veganismus beraten.“
Die verworrene Rechtslage und die strenge Interpretation der Anwendungsregeln durch den VDE erzeugen viel Frust und schrecken Menschen ab, die der Balkonkraft grundsätzlich positiv gegenüberstehen. „Der Kampf um die Freigabe von Steckersolargeräten ist noch längst nicht abgeschlossen“, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), die fast täglich Beschwerden über die Praxis der Netzbetreiber erhält. Die Anwendungsregeln des VDE stellten „für unerfahrene Bürger eine Quelle der Unsicherheit dar“. Den Stromkonzernen gehe es „allein um ihre Marktanteile an der Stromversorgung“, mutmaßt der Verein und mahnt an, „dass die Konzerne und ihre Helfer die Blockadepolitik gegen Steckersolargeräte im VDE aufgeben und ihre Unwahrheiten und Angstkampagnen einstellen“. Puh, da hat sich wohl einiger Ärger angestaut. Allerdings besteht nun die Hoffnung, dass die Regeln doch gelockert werden, seit der VDE im Januar 2023 einen solchen Vorstoß gemacht hat. Nach vielen Jahren könnte sich die Vernunft doch noch durchsetzen.
ERSPARNIS
Ich will etwas fürs Klima tun, aber ich bin auch Sohn eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters, und da kann ich nicht raus aus meiner Haut. Also rechne ich erst einmal nach: Wann würde sich meine Anschaffung überhaupt amortisieren? Wann ist also der Zeitpunkt erreicht, wo Investition und Ersparnis sich die Waage halten? Diesen Punkt zu bestimmen ist komplizierter, als ich es mir vorgestellt habe.
Schon der Stromertrag hängt von vielen Faktoren ab, wie dem Standort, der Ausrichtung und Neigung der Solarmodule. Daran schließt sich die Frage an, welchen Anteil dieses Ertrags ich im Haushalt sofort verwenden kann; einen Speicher habe ich ja nicht. Nur dieser Eigenverbrauchsanteil verringert meine Stromrechnung. Was das Balkonkraftwerk darüber hinaus erzeugt, verschenke ich. Dieser überschüssige Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist – und in der Regel nicht vergütet.
Am Markt haben sich zwei Leistungsklassen für Steckersolargeräte etabliert: Kleine Anlagen mit einem Solarmodul und um die 300 Watt Ausgangsleistung und große mit zwei Modulen und meist 600 Watt. Ich muss herausfinden, welche am besten zu mir passt. Dazu möchte ich meinen Stromverbrauch besser kennenlernen, und ihn bei der Gelegenheit auch gleich noch verringern. Denn das ist die beste aller Sparmaßnahmen. Außerdem muss ich über Ausrichtung und Neigung der Module nachdenken, um den Strom möglichst genau dann einzufangen, wenn ich ihn brauche.
Wie viel Energie kann ich erzeugen?
Zuerst möchte ich wissen, was aus so einem Steckersolargerät überhaupt an Strom herauskommt. Einer der wichtigsten Faktoren ist: der Standort.
Standort und Einstrahlung





























