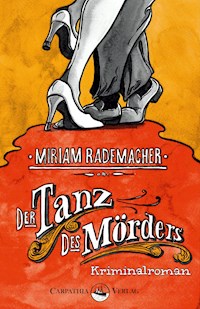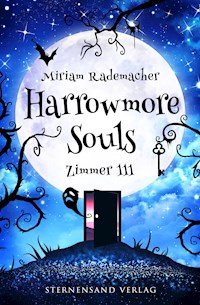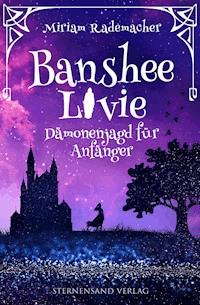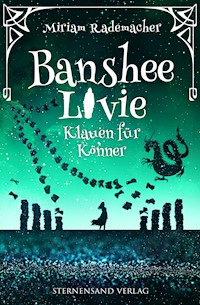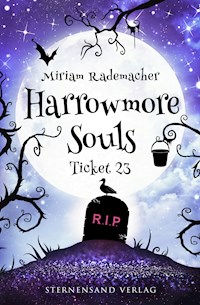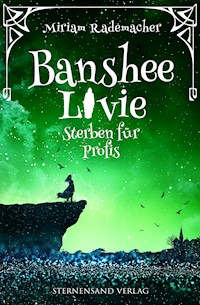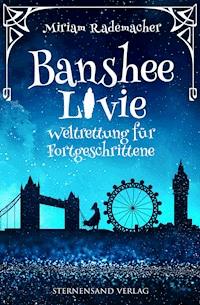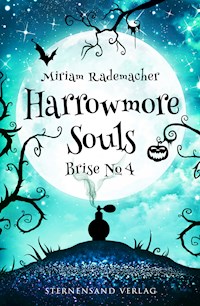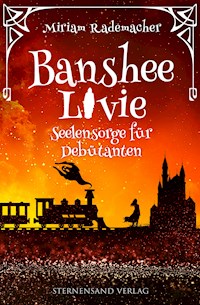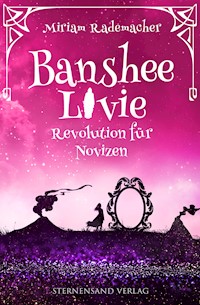Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Banshee Livie
- Sprache: Deutsch
Seit über eintausend Jahren werden die Harrowmores und ihr Schloss von Banshees beschützt. Doch eine von ihnen bringt den Fluch mit sich, der die gesamte Familie auslöschen könnte. Sollte dieser Tag schon nah und ausgerechnet Livie diejenige sein, die eine Schlüsselrolle in dem Drama spielen wird? Irrtum. Denn unbemerkt von fast allen Beteiligten hat das Unheil längst seinen Lauf genommen. Zukunft war gestern, heute ist alles anders …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Dank
Miriam Rademacher
Banshee Livie
Band 6: Realitätsreisen für Einsteiger
Fantasy
Banshee Livie (Band 6): Realitätsreisen für Einsteiger
Seit über eintausend Jahren werden die Harrowmores und ihr Schloss von Banshees beschützt. Doch eine von ihnen bringt den Fluch mit sich, der die gesamte Familie auslöschen könnte. Sollte dieser Tag schon nah und ausgerechnet Livie diejenige sein, die eine Schlüsselrolle in dem Drama spielen wird? Irrtum. Denn unbemerkt von fast allen Beteiligten hat das Unheil längst seinen Lauf genommen. Zukunft war gestern, heute ist alles anders …
Die Autorin
Miriam Rademacher, Jahrgang 1973, wuchs auf einem kleinen Barockschloss im Emsland auf und begann früh mit dem Schreiben. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Osnabrück, wo sie an ihren Büchern arbeitet und Tanz unterrichtet. Sie mag Regen, wenn es nach Herbst riecht, es früh dunkel wird und die Printen beim Lesen wieder schmecken. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Kurzgeschichten, Fantasyromane, Krimis, Jugendbücher und ein Bilderbuch für Kinder veröffentlicht.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, April 2021
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2021
Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König
Korrektorat 2: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-189-5
ISBN (epub): 978-3-03896-190-1
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieses Buch ist allen Livie-Fans gewidmet.
Livie und ich danken euch für eure Treue und Begeisterung,
die uns zu immer neuen Geschichten anspornt.
Prolog
Ein Nachmittag in England vor mehr als eintausend Jahren
»Hier ist er«, verkündete Helena Harrowmore ihrem Gatten und stellte das mit Leckereien gefüllte Körbchen am Fuß der prächtigen Eiche ab. »Dies ist der perfekte Platz für den heutigen Tag, den wir beide ganz allein feiern werden.«
Badria, der weise Druide, schenkte seiner jungen Ehefrau keine Aufmerksamkeit. Sein Blick ruhte auf den armseligen Überresten einer Holzhütte, die einmal sein Zuhause gewesen war. Er hatte sie vor langer Zeit in Sichtweite der stolzen Eiche erbaut, einem erhabenen, einsam zwischen Feldern stehenden Baum. Jetzt lagen die zerschlagenen Bohlen seiner ehemaligen Zuflucht im Laub des letzten Herbstes und dienten Pilzen und Schwämmen als Heimat. Ein Unwetter musste seine ehemalige Zuflucht in ihre Bestandteile zerlegt haben. Sein Glück, dass er zu diesem Zeitpunkt schon Helenas Mann und der Herr von Schloss Harrowmore gewesen war.
»Badria!«
Jetzt drang ihre leicht entrüstet klingende Stimme zu ihm durch. Mit einem schuldbewussten Lächeln wandte er sich ihr zu und bemerkte ihren mitgebrachten Korb unter der Eiche.
»Ich bin mir nicht sicher, ob dies hier ein guter Ort für ein gemeinsames Mahl im Freien ist«, widersprach er seiner schönen Frau. »Es ist ein mächtiger Ort. Er war es schon, bevor ich zum ersten Mal hierherkam. Ich kann seine Macht spüren, wann immer ich mich hier aufhalte. Diese Eiche steht im Zentrum meines Lebens. Meines Schicksals.«
»Wunderbar!« Helena lachte glockenhell auf und entnahm dem Korb ein grobes Tuch, das sie nahe der Eiche auf den Erdboden legte. »Es ist bestimmt diese Macht, die dich den bösen Dämon Ghorm vertreiben ließ und mir das Leben rettete. Wir Harrowmores schulden dieser Eiche somit eine ganze Menge.« Sie deutete auf ein nahes Feld, auf dem der Wind durch den Hafer strich. Es würde eine gute Ernte geben. »All das darf ich noch sehen und erleben, weil es dich und deine Magie gegeben hat. Ohne dich hätte der Dämon mir das Leben genommen.«
»Und deswegen sitzen wir nun also an unserem ersten Hochzeitstag mit unserem Essen unter freiem Himmel und schauen dem Hafer beim Wachsen zu?« Um Badrias Mundwinkel zuckte es belustigt. »Ich verstehe die Zusammenhänge nicht, fürchte ich.«
»Warte es ab!«, rief sie und wirbelte in wildem Tanz um den Stamm der Eiche herum. »Ich habe mir nämlich etwas überlegt. Etwas Großartiges, wie ich finde. Du wirst staunen.«
Badria war sich ziemlich sicher, dass er das würde. Helena hatte sich bisher als wahre Meisterin darin erwiesen, ihn zum Staunen zu bringen. Dabei war er der deutlich Ältere in ihrer Beziehung und dazu noch ausgestattet mit dem reichen Wissensschatz der Druiden.
Auch ohne den Besitz der Harrowmores war er auf seine Weise schon ein reicher Mann gewesen. Helenas Liebe hatte der Weisheit nun noch Ländereien und ein Schloss hinzugefügt. Es gab eigentlich nichts mehr, das Badria sich noch für sich wünschte. Außer vielleicht, seine junge Frau so lange wie möglich glücklich und gesund zu sehen. Und das war sie wohl, wie sie noch immer um die Eiche herumtanzte, eine ihm fremde Melodie sang und das trockene Laub zu ihren Füßen rascheln ließ.
»Auch ich habe nicht vergessen, was für ein Tag heute ist«, flüsterte er und öffnete den ledernen Beutel, den er stets an seinem Gürtel trug. »Nicht nur der Tag, an dem ich dich vor einem Jahr ehelichte, sondern auch der Jahrestag unseres Sieges über Ghorm. Deswegen habe ich ein Geschenk für dich.«
»Ein Geschenk?« Helena hielt in der Bewegung inne. Ihre kindliche Freude erreichte eine neue Dimension. Sie rannte auf ihn zu und schlang die Arme um ihn. Ihr honigfarbenes Haar kitzelte ihn am Hals. »Du musst mir doch gar nichts mehr schenken. Du bist der Grund dafür, dass ich dem Dämon entkam und noch am Leben bin. Ich bin wieder jung, mein Haar ist nicht mehr grauer als deines, ich bin am Leben! Es gibt kein größeres Geschenk.«
»Aber vielleicht ein schöneres«, murmelte Badria, schob sie ein Stück von sich und reichte ihr das rosige Kleinod, das an einer schlichten Kette hing. »Es ist aus Rosenquarz. Nicht besonders edel, aber schön. Gefällt es dir?«
Mit einem Gefühl der Befriedigung beobachtete er, wie Helena über den glatt geschliffenen Stein strich, der die Form eines Herzens hatte.
»Es ist wunderschön.« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Ich werde es jeden Tag tragen und überhaupt nie mehr abnehmen.« Sie hielt die Kette in die Höhe und betrachtete andächtig, wie die Sonnenstrahlen das rosige Herz schimmern ließen. »Dagegen ist meine Überraschung eher eine Kleinigkeit und zudem ziemlich eigennützig. Irgendwie typisch für mich.« Sie runzelte die hohe Stirn, den Blick noch immer auf das steinerne Herz geheftet.
Badria lachte und ließ sich auf dem groben Stoff nahe dem Baumstamm nieder. Aus dem Korb stieg ihm der verführerische Geruch von Gebratenem in die Nase und erinnerte ihn daran, dass er hungrig war. »Was ist es denn, womit du mich überraschen willst? Obwohl ich mit diesem Festmahl eigentlich schon recht zufrieden bin.«
»Ach, nur so ein Ritual«, rief Helena und streifte die Kette über ihren Kopf. »Ich habe es in einer deiner Schriften gefunden.«
Badria, der gerade in den Korb hatte greifen wollen, erstarrte in der Bewegung. »Das ist kein Scherz, Helena. Rituale können gefährlich sein. Sie können Dämonen wie diesen Ghorm herbeirufen.«
»Und auch wieder vertreiben.« Helena grinste und lehnte sich an den Stamm der Eiche. »Es ist natürlich ein gutes Ritual. So eine Art ewiger Schutzzauber für uns und all unsere Nachkommen.«
»Helena.« Seine Stimme bekam einen warnenden Unterton.
»Ich habe das Pergament komplett gelesen und es ist uns erlaubt, es anzuwenden«, rief seine junge Frau eifrig. »Denn du bist ein Druide und die Familie der Harrowmores besteht schon sehr lange. Wir haben ein Anrecht auf diesen Schutzgeist.«
»Von was für einem Schutzgeist sprichst du?«
Badrias Beunruhigung wurde langsam zu einer Vorahnung. Doch statt einer Antwort schloss Helena die Augen und begann damit, seltsame Worte zu murmeln, die keinen Sinn zu ergeben schienen. Ihr schlanker Körper löste sich vom Stamm des Baumes und wiegte sich wie ein Schilfrohr hin und her. Wind kam auf, spielte mit ihren Haarflechten und ihrem langen hellen Gewand.
Badria, der wusste, dass man ein einmal begonnenes Ritual besser nicht unterbrach, solange man nicht wusste, um was für eine Art Zauber es sich handelte, hielt den Atem an. Seine Gedanken kehrten zu den Pergamenten in seiner Schreibstube auf Schloss Harrowmore zurück. Was in aller Welt mochte Helena gelesen haben? Was hatte ihre Aufmerksamkeit erregt?
Wieder begann seine Ehefrau damit, die Eiche zu umrunden. Doch dieses Mal nicht tanzend und springend, sondern gemessenen Schrittes. Der Klang ihrer Worte wurde lauter, ihre Schritte schneller und der Wind, der immer mehr auffrischte, fuhr in die Krone der Eiche und schüttelte ihre Zweige.
Und mit einem Mal wusste Badria, was seine junge Frau da tat, und Erleichterung flutete seinen angespannten Körper.
Als Helena einige Minuten später das Ritual beendete, die Augen öffnete und lächelnd unter der bebenden Eiche stand, die noch immer von einem seltsamen Wind geschüttelt wurde, lächelte auch er.
»Eine Banshee? Du schenkst mir eine Banshee? Mir und allen Harrowmores, die noch kommen werden?«
»Nicht ganz uneigennützig, ich weiß.« Sie schlug die Augen nieder. »Aber ein Schutzgeist wird unsere Nachkommen noch vor Dämonen schützen, wenn wir beide schon längst zu Staub zerfallen sind.«
»Wir werden ihr ein Zuhause geben müssen«, stellte Badria fest und bemerkte im selben Moment eine Frauenstimme, die aus der Richtung des Haferfeldes an sein Ohr drang und jemanden zu rufen schien.
»Auf Schloss Harrowmore ist Platz genug.« Helena schien unbeeindruckt. »Sie kann eine der vielen Dachkammern haben, wenn sie will. Dort oben stört sie uns nicht in unserem Alltag und kann doch ein wachsames Auge auf alles haben, was sich im Schloss und auf den Ländereien tut.«
Badria nickte zustimmend. Die Frauenstimme klang jetzt näher und rief noch immer einen Namen, wie es ihm schien. Doch ganz sicher war er sich nicht, denn die Äste der Eiche tanzten fortwährend einen wilden Tanz. Der Zauber wirkte in ihr und würde es von jetzt an für alle Zeit tun. Das Schicksal des Baumes war nun auf ewig mit dem der Harrowmores verbunden. Die Eiche war zum Ort eines mächtigen Rituals geworden.
In diesem Moment knackte es im Geäst und ein spitzer Schrei folgte. Gleich darauf fiel ein kleiner Körper aus der Krone des Baumes und schlug neben seiner Frau auf dem Erdboden auf. Helena sprang erschrocken zur Seite und schlug sich die Hände vor den Mund, um den Schrei zu unterdrücken, der ihr über die Lippen kam.
Badria wagte kaum, zu atmen. Und lauter als zuvor hörte er jetzt das Rufen einer Frau irgendwo hinter dem Hafer.
»Gilda! Gilda! Na warte, mein Liebes, wenn du heimkommst, setzt es was!«
Die Äste der Eiche hörten auf, zu tanzen, und eine seltsame Ruhe breitete sich über den Sommertag aus. Badria ahnte, dass Gilda nie mehr heimkommen und diese arme Frau ein Leben lang vergeblich nach ihr rufen würde. Denn wenn er die Dinge richtig beobachtet hatte, hatte sich das Mädchen bei seinem Sturz aus luftiger Höhe soeben das Genick gebrochen.
Helena war derweil aus ihrer Starre erwacht und ging neben dem Kind, das kaum älter als zehn Jahre sein konnte, in die Knie. »Sie muss sich im Baum versteckt haben. Vermutlich wollte sie sich vor der häuslichen Arbeit drücken. Und dann kamen wir und sie traute sich nicht mehr herab.«
»Vor der Arbeit versteckt, das halte ich für eine glaubwürdige Theorie«, stimmte Badria im Näherkommen zu. Die Kleidung des Mädchens ließ auf ein einfaches Bauernmädchen schließen. Ihre kleinen Hände waren voller Schwielen. Er ging ebenfalls neben dem leblosen Körper in die Hocke. »Es scheint so, als ob das Schicksal uns eine noch recht junge, unfertige und vermutlich faule Banshee zugedacht hat.«
Helena hob den Kopf und sah ihn an. In ihren Augenwinkeln glitzerten Tränen. »Du glaubst, dass ich das getan habe? Dass mein Ritual dieses Kind getötet hat?«
»Es hat sie zu etwas anderem gemacht«, flüsterte Badria sanft. »Das Schicksal hat entschieden, nicht du. Du konntest nicht wissen, auf wen die Wahl fällt. Hast du nicht behauptet, das Ritual zuvor bis zum Ende gelesen zu haben? War dir denn nicht klar, dass ein Mensch sterben muss, um zur Banshee zu werden?«
»Nein!«, schrie sie entsetzt und griff nach den Schultern des Kindes, um es zu schütteln. »Das habe ich nicht gewollt, ich wusste das nicht, ich …«
»Deswegen sollte man das Zaubern besser den Zauberern und ihresgleichen überlassen«, sagte Badria ohne jeden Vorwurf in der Stimme. »Doch für einen solchen Ratschlag ist es nun zu spät und wir sind für dieses Mädchen verantwortlich und es für uns.« Er erhob sich, nahm die Decke vom Boden auf und breitete sie über den Körper der Kleinen, wobei er ihr Gesicht aussparte. »Es kann eine Weile dauern, bis sie aufwacht. Ich werde bei ihr bleiben, damit sie sich nicht fürchtet, wenn ihre neue Existenz beginnt.«
»Ich werde auch bleiben.« Helena klang verschnupft. »Ich habe ihr das angetan und ich werde ihr nicht von der Seite weichen, bis sie mir verziehen hat. Wenn sie das denn jemals kann. Ich habe ihr das Leben genommen.« Sie zog die Kette mit dem Herz aus Rosenquarz von ihrem Hals und legte sie der Kleinen um. »Mein erstes Geschenk für dich«, flüsterte sie. »Das Herz der Banshee.«
»Es kann Tage, ja sogar Wochen dauern, bis sie zu sich kommt. Und der beste Ort, um als Banshee zu erwachen, ist der, mit dem sie verbunden bleibt«, klärte Badria seine Frau auf, setzte sich und lehnte den Oberkörper an die Eiche. »Es ist nicht nötig, dass wir beide bei ihr wachen. Geh heim und halte dich warm. Du musst den Schrecken verarbeiten. Doch es wäre nett, wenn du mir das Nötigste zum Leben bringen würdest. Der Inhalt des Picknickkorbs wird nicht lange vorhalten.«
»Ich gehe hier auch nicht weg. Hunger, Durst und Kälte sind mir egal, ich gehöre jetzt hierher. Soll jemand anders unser Essen heranschaffen.« Helena klang entschlossen. Dann legte sie sich auf die Erde in das trockene Laub, umfing den Körper des Kindes mit einem Arm und schloss die Augen.
Auch Badria fielen bald die Lider zu. In der Ferne rief noch immer eine verzweifelte Mutter nach ihrem Kind, das nie mehr heimkehren würde.
Gilda. Der Druide überlegte, wann und wo er diesen Namen schon einmal gehört hatte. Wenn die Familie hier in der Gegend lebte, musste ihm doch einfallen, von wem seine junge Banshee abstammte.
Gilda. Badria durchstreifte seine Erinnerungen. In welches der nahen Bauernhäuser gehörte eine Gilda?
Plötzlich fuhr er hoch und die Erkenntnis ließ sein Herz schneller schlagen. Erschrocken starrte er auf den leblosen Körper, der sich unter der Decke abzeichnete. »Sie ist kein Bauernmädchen«, flüsterte er.
Prompt öffnete Helena die Augen. »Was meinst du?«
»Kein Bauernmädchen«, wiederholte Badria und fröstelte. »Sie ist die einzige Tochter der irren Silvana.«
»Der Hexe, die in diesem kleinen Dorf lebt, das jenseits des Feldes liegt? Ich glaube, die Bewohner nennen den Ort Mag Mellis.« Jetzt sah auch Helena erschrocken aus. »Badria! Wenn ihre Mutter eine verrückte Hexe ist, was bedeutet das für uns?«
»Noch nichts«, beteuerte der Druide. »Aber es wäre wohl besser, wenn Silvana nicht so bald erfährt, was aus ihrer Tochter geworden ist. Wir sollten diesen Moment so lange es möglich ist hinauszögern. Verwünschungen und Flüche sind nicht gerade das, was ich mir für die Nachkommen unserer Familie erhofft habe. Vielleicht kann die Zeit den Zorn der Hexe etwas mildern.«
Helena, die ihn mit großen Augen angestarrt hatte, sah hinab auf den friedlich daliegenden Kinderkörper, an dessen Hals das rosige Herz schimmerte. »Was habe ich uns bloß angetan? Was?«
Kapitel 1
London, Ende November 2019
»Livie, weißt du zufällig, wo ich einen Band über Heraldik finden kann?«, hörte ich eine vertraute Stimme sagen.
Olivia Eleanor Emerson heiße ich. Ich bin neunzehn Jahre alt und lebe in London. Bis vor Kurzem habe ich in einer Futtermittelfabrik weit entfernt vom Stadtzentrum gearbeitet, doch jetzt habe ich einen Job in einer Bibliothek. Diese Arbeit liegt mir viel mehr. Ich liebe Bücher, alte wie neue, mag den Geruch und das Licht an diesem Ort.
An manchen Tagen fühlt sich alles so vertraut an, als hätte ich schon einmal zwischen langen Regalreihen voller Bücher gearbeitet. Meine Chefin, Mrs Harper, ist zwar manchmal ein richtiger Drache, aber eigentlich denke ich, dass alle Bibliotheksleiter ein bisschen was von einem Drachen an sich haben.
Nicht, dass ich an Drachen glauben würde, ich bin ja nicht wie meine Tante Ethel. Die hat mich nämlich aufgezogen, nachdem meine Mutter bei einem Tauchunfall ums Leben kam. Damals war ich erst zwölf und zog mit all meinem Hab und Gut bei meiner Tante ein, die nicht nur an Drachen, sondern an nahezu alles glaubt, was noch nie ein Mensch gesehen hat. Jedenfalls niemand, den ich kenne.
Nach dem Tod meiner Mutter war Tante Ethel das Beste, was mir passieren konnte, trotz ihrer verqueren Weltanschauung.
In der Bibliothek war an diesem Novembernachmittag nicht viel los. Millicent Harrowmore, die blassnasige Studentin mit den feuerroten Locken, mit der ich mich vor einer Weile angefreundet hatte, stand noch immer neben mir und sah mich fragend an. Sie erwartete geduldig meine Antwort auf ihre Frage über die Nachschlagewerke. Ich beneidete sie um diese wundervollen Locken. Meine Haare hingen immer wie gebügelt um mein rundes Gesicht.
Ich stellte das letzte Buch zurück ins Regal und wandte mich ihr zu. »Wirklich? Heraldik? Was studierst du denn diese Woche, Millie?«
Sie schob beleidigt die Unterlippe vor, obwohl diese ihr Gesicht neben der langen Nase sowieso schon dominierte. »Es fällt mir eben schwer, mich festzulegen. Ich muss mich erst finden. Bedenke, dass ich ursprünglich überhaupt nicht mit dem Ziel eines Abschlusses studieren wollte. Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte und es ist mir sehr wohl bewusst. Ich war nur auf der Suche nach einem klugen Mann, der es mit mir aushalten kann und der ein paar clevere Gene in den Genpool meiner Familie einfließen lässt. Aber jetzt, da die Ärzte meinen, dass es hoffnungslos ist …«
Ich seufzte mitfühlend. Millicent Harrowmore war ein ganz armer Tropf. Auf ihr ruhten alle Hoffnungen ihrer blaublütigen Familie, das Geschlecht zu erhalten. Jetzt, da ihr Bruder Cameron, für alle völlig unfassbar, seinen Glauben entdeckt hatte und in ein Kloster eintreten wollte, war es quasi ihre Pflicht, sich fortzupflanzen und damit den Fortbestand der Harrowmores auf Schloss Harrowmore nahe der schottischen Grenze zu sichern.
So war sie mit dem festen Vorsatz, sich zu verheiraten, nach London gekommen und hatte geglaubt, dass eine Universität ein guter Ort sei, um die Liebe ihres Lebens zu finden. Doch dann hatte ihr genau dieses Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der ärztliche Befund, der besagte, dass sie vermutlich niemals Kinder bekommen konnte, hatte Millies Pläne zunichtegemacht. Die Chance, Mutter zu werden, war für sie verschwindend gering. Und ohne die Aussicht auf Kinder war auch ihr Interesse an potenziellen Ehemännern gesunken.
Ein Umstand, den ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Meiner Meinung nach sollten Menschen in erster Linie aus Liebe heiraten und nicht, um ihre Blutlinie aufrechtzuerhalten. Aber was wusste ich schon von solchen Dingen?
An dem Tag, als ihr Gynäkologe ihr die bevorstehende Kinderlosigkeit prophezeit hatte, war Millicent zum ersten Mal in meine Bibliothek gekommen, um sich im Schutz der hohen Regale erst einmal so richtig auszuheulen. Dort hatte ich sie gefunden. Ich half ihr mit Taschentüchern aus und ließ dieses fremde Mädchen einfach in meinen Armen weinen, bis keine Tränen mehr übrig waren. Dann war sie von mir ins nächstbeste Café geschleppt worden. Und ein paar Tassen Tee später waren wir bereits gute Freundinnen gewesen.
Inzwischen kam sie regelmäßig und betrieb ihre Studien mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Wenn sie keine Familie gründen konnte, wollte sie zumindest das Beste aus ihrem Leben machen und ihren Kopf mit ein wenig Wissen füllen. Nur für eine Fachrichtung hatte sie sich bisher nicht so richtig entscheiden können.
Jetzt beugte sie sich mit Verschwörermiene zu mir und flüsterte: »Weißt du was? Vergiss die Heraldik. Ist dir dieser wahnsinnig gut aussehende Typ schon aufgefallen, der immer bei Anbruch der Dämmerung unter dem Fenster bei den medizinischen Ratgebern steht? Ist er nicht zum Sterben schön? Der könnte mir gefallen, obwohl ich ja jetzt beschlossen habe, ernsthaft zu studieren und mich weniger um Männer zu kümmern. Ich wüsste zu gern mehr über ihn.«
Ich starrte sie fassungslos an und schüttelte mich in einem Anflug von Abscheu. Mir war der bleiche Mann mit den schwarzen Locken, der wie aus dem Nichts auftauchte, sobald draußen vor den Fenstern die Novembersonne versank, sehr wohl aufgefallen. Und ich mochte ihn nicht. In seiner Gegenwart schien die Luft sich abzukühlen, liefen die Leser der Bibliothek plötzlich mit hochgezogenen Schultern durch die Gänge. Der Mann jagte mir Schauer über den Rücken. Nicht nur Kälteschauer, wohlgemerkt. Nie hätte ich mich für einen so finster aussehenden Typen begeistern können und es war nur schwer zu glauben, dass meine Freundin es konnte.
»Ich habe ihn vorhin angesprochen.« Millie kicherte. »Er sagt, er heißt Cube. Komischer Name, oder?«
»Ein komischer Name für einen komischen Kerl«, bestätigte ich. »Millie, der ist ganz sicher nicht die Art von Mann, den deine Familie gern neben dir vor dem Traualtar sehen will. Du solltest vielleicht nicht jeden erstbesten …«
Dies war der Moment, in dem sie mich rüde unterbrach.
»Warum nicht?«, rief sie eine Spur zu laut für eine Bibliothek. »Dass ich keine Kinder bekommen kann, heißt ja wohl nicht, dass ich keinen Sex mehr haben darf! Und jetzt ist doch genau genommen völlig egal, wen ich in mein Bett zerre, oder? Seine Intelligenz kann nicht Einzug in unsere Familie halten und seine Erbkrankheiten auch nicht. Es ist völlig bedeutungslos, mit wem ich …«
Irgendwo hüstelte jemand verlegen, aber dennoch deutlich hörbar. Doch Millie war noch nicht fertig.
»Ich kann jetzt einfach jeden haben, verstehst du? Ich muss nicht mehr darauf achten, den Richtigen nach Hause zu schleppen, den Mann, der genug Geld hat, um das Familienschloss zu erhalten, und der klug und gesund ist. Jetzt geht ja sowieso alles zum Teufel. Von Rechts wegen würde Schloss Harrowmore nun an einen anderen Zweig unserer Familie fallen, aber weißt du was? Da gibt es kaum noch jemanden! Und schon gar niemanden mit Kindern. Wir Harrowmores sterben aus, ob wir wollen oder nicht. Fast könnte man meinen, irgendjemand hätte uns verflucht.«
Das Hüsteln, das ihren Monolog nicht hatte unterbrechen können, klang jetzt deutlich näher und bekam Ähnlichkeit mit dem Fauchen eines Drachen.
»Meine Chefin, Mrs Harper, ist auf dem Kriegspfad«, zischte ich. »Wir sprechen später weiter. Ich bin offiziell zum Arbeiten hier, Millie. Wenn der alte Drachen mich beim Tratschen erwischt, kann ich meinen Job verlieren. Vielleicht aber wird sie mich vorher mit ihrem feurigen Atem rösten.«
Manchmal wusste ich selbst nicht, warum ich so eigenartige Sachen sagte. Tante Ethel begann wohl doch, auf mich abzufärben.
»Olivia Emerson?« Die Stimme von Mrs Harper mit ihrem durchdringenden Tonfall ertönte in meinem Rücken. »Würden Sie diesem Herrn hier bitte behilflich sein? Er sucht … Zeugs.«
Neugierig wandte ich mich um. Noch nie zuvor hatte Mrs Harper geschriebene Wörter als ›Zeugs‹ bezeichnet, ganz egal, wie trivial sie waren. Was suchte der Herr bloß, dass die pure Verachtung aus der Bibliothekarin sprach? Wo war der Herr überhaupt?
Mrs Harper, eine gewaltige Frau, die sich gern in wallende Seidengewänder von roter und grauer Farbe hüllte, mit einem untertänigen Lächeln bedenkend, suchte ich nach dem Kunden, konnte ihn aber nicht entdecken, sosehr ich mich auch streckte und meinen Hals in jede Richtung drehte.
Da trat er plötzlich aus ihrem Windschatten hervor und streckte seine kleine, knubbelige Hand zu mir empor. Ein Zwerg, dachte ich und schalt mich augenblicklich selbst für diese beleidigende, aber treffende Beschreibung. Der Mann reichte mir nicht einmal bis zu den Hüften, wirkte gedrungen und der Kopf mit seinem eisgrauen Haar schien übergroß auf seinen schmalen Schultern. Ich blinzelte zweimal, doch der Fremde wuchs nicht und verschwand auch nicht. Er war real, stand hier vor mir und wartete noch immer darauf, dass ich seine Hand ergriff.
Mrs Harper, die heute besonders drachenäugig auf mich wirkte, stieß keine Rauchwolke aus und machte sich davon, wobei ihre seidene Robe leise raschelte. In einiger Entfernung konnte ich die schwarze Gestalt des angsteinflößenden Lesers namens Cube erkennen. Es musste draußen also bereits dunkel geworden sein, er kam nie vor der Dämmerung zum Vorschein.
Dieser Cube hatte das Buch, in dem er gerade geblättert hatte, sinken lassen und starrte den kleinen Mann vor mir mit unergründlicher Miene an. Mehr denn je wirkte er auf mich wie ein böses Nachtgespenst. Oder bildete ich mir all das nur ein?
Der kleine Mann wartete nicht länger auf mein Händeschütteln. »Guten Tag, mein Name ist Biggs. Zacharias Biggs. Habe ich die Ehre mit …« Er blickte auf einen kleinen, zerknüllten Zettel in seiner Hand und las von ihm ab: »Olivia Eleanor Emerson?«
Ich nickte und wollte ihn gerade fragen, womit ich ihm behilflich sein konnte, als er seine kurzen Ärmchen in die Höhe streckte und mir den Zettel entgegenhielt.
»Erinnern Sie sich an diese Notiz, Miss Emerson? Sagt sie Ihnen irgendetwas?«
Ich starrte auf den Zettel, auf dem nur wenige Worte in einer mir fremden Handschrift hingekritzelt worden waren.
Olivia Eleanor Emerson. Banshee Livie. Schloss Harrowmore.
»Was zur Hölle ist eine Banshee?«, entfuhr es mir.
»Und warum steht meine Adresse unter deinem Namen?«, rief Millicent, die ganz dicht an mich herangetreten war und ebenfalls neugierig auf den Zettel geblickt hatte.
Der kleine Mann lächelte sie an. »Ich nehme an, Sie wissen, was eine Banshee ist, Miss Harrowmore?«
Millies Miene verfinsterte sich. Sie musterte den kleinen Mann von oben bis unten, was verständlicherweise nicht viel Zeit in Anspruch nahm. »Kennen wir uns?«
Er wog bedächtig den Kopf. Irgendwie kam mir diese Geste vertraut vor. Ja, der ganze Mann hatte etwas an sich, das in mir ein angenehmes Gefühl der Freundschaft wachrief, doch ich wusste nicht, woher es stammte. Ich verband keine bewusste Erinnerung mit ihm.
»Das ist in verwirrenden Zeiten wie diesen eine recht schwierige Frage, Miss Harrowmore«, sagte er. »Es ist gut möglich, dass wir uns kennen sollten. Mit Gewissheit kann ich das aber im Moment nicht sagen.«
»Was für verwirrende Zeiten meinen Sie denn?«, fragte ich und sah noch immer auf den Zettel in seiner Hand herab.
»Es sind genau genommen falsche Zeiten«, korrigierte sich Mister Biggs. »Fehlerhafte Zeiten, uns allen fremde Zeiten, in einer ganz und gar neuen Realität.«
Ich konnte nicht verhindern, dass meine Augenbrauen sich selbstständig machten und über meine Stirn nach oben wanderten. »Neue Realität«, wiederholte ich und er nickte bedächtig. Der Kerl musste verrückt sein. »Dann suchen Sie sicher ein Werk über Physik. Vielleicht hat Stephen Hawking etwas dazu geschrieben«, schlug ich vor.
Der Mann machte eine wegwerfende Handbewegung. »Stephen hat nichts aufgeschrieben, das ich ihm vorher nicht ganz genau erklärt habe. Nein, ich suche etwas anderes. Ich suche einen Weckruf. Es muss einfach einen geben. Alles andere wäre eine Katastrophe, und die hat meiner Meinung nach bereits stattgefunden.«
Ich gab mir keine Mühe mehr, meine Verblüffung zu verbergen. »Ein Buch über Weckrufe? Davon habe ich noch nie gehört. Ich könnte Ihnen aber schnell eines schreiben, wenn Sie möchten. Meine Tante Ethel ist in solchen Dingen ausgesprochen kreativ. Heute Morgen hat sie mich mit den Worten ›Der Hausmüll brennt‹ aus dem Bett geholt. Ich sage Ihnen: Das ist ein Weckruf, der bei jedem funktioniert, ganz egal, wie lange er oder sie in der letzten Nacht billige Schundheftchen gelesen hat.«
»Ich habe mal gehört, dass man bei heterosexuellen Männern nur ›Titten‹ sagen muss, und zack, sind sie hellwach«, mischte sich Millie ein.
»Nun, ich brauche einen Weckruf für eine Banshee«, gab Mister Biggs zu bedenken. »Da werden mir Titten nicht weiterhelfen, aber vielen Dank.«
Er lehnte sich an eines der Regale und sah fröhlich zu uns hinauf. Ich konnte mir nicht helfen, ich mochte ihn einfach.
Ich verlangte zum zweiten Mal, aufgeklärt zu werden. »Was ist denn nun eine Banshee?«
»Eine Banshee ist ein Schutzgeist«, erklärte Millie mir mit todernster Miene und schien von dem kleinen Mann viel weniger begeistert als ich. »In irischen, englischen und schottischen Sagen werden sie zumeist als Klageweiber beschrieben, die heulend den Tod eines Familienmitglieds ankündigen.«
»Ach, so eine komische Märchenfigur ist das?« Ich war ein bisschen enttäuscht. »Und die wollen Sie aufwecken, Mister Biggs? Klopfen Sie doch mal zärtlich auf den Deckel eines Märchenbuches, vielleicht hüpft sie dann heraus.«
»Meine Familie hat eine Banshee«, verkündete Millie und es klang ein wenig hochmütig. »Schon seit über einem Jahrtausend. Gut, das Personal hat gelegentlich gewechselt, aber wir Harrowmores nannten immer eine Banshee unser Eigen.«
Ich hob meinen Blick von dem Fremden und sah meine Freundin prüfend an, um herauszufinden, ob sie mich gerade veralbern wollte. Fast schockiert stellte ich fest, dass sie todernst aussah.
Millie machte keine Witze. Sie glaubte tatsächlich an den Blödsinn, den sie gerade von sich gegeben hatte. Ich erwog, sie mal mit meiner Tante Ethel zusammenzubringen.
»Okay.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Glaubt alle, was ihr wollt. Wer bin ich denn, dass ich behaupten könnte, die Weisheit gepachtet zu haben. Aber ein Buch über Weckrufe gibt es in dieser Bibliothek nicht. Jedenfalls nicht dass ich wüsste. Da müssen Sie woanders weitersuchen, Mister Biggs.«
Der kleine Mann mit den eisgrauen Locken sah auf den zerknüllten Zettel in seiner Hand herab, auf dem mein Name stand, und murmelte: »Nein, ich bin hier ganz sicher richtig. Dieser Anker hier hat mich zu Ihnen geführt. Jetzt brauche ich nur noch diesen Weckruf.«
»Ein Anker?« Mir verging langsam die Lust an diesem Gespräch. Es drehte sich zunehmend um Dinge, die ich nicht verstand und auch gar nicht verstehen wollte. »Nein, erklären Sie es mir nicht. Ich muss jetzt weiterarbeiten, Mister Biggs. Der Drache kommt sonst zurück und faucht mich zusammen … staucht mich zusammen, wollte ich sagen.«
Ich war entschlossen, sowohl Millie als auch den kleinen Mann wieder sich selbst zu überlassen, ich hatte schließlich andere Dinge zu tun. Doch als ich gehen wollte, hielt dieser Biggs mich am Hosenbein zurück.
»Sie nennen die Bibliotheksleiterin einen Drachen? Warum tun Sie das?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sie erinnert mich an einen Drachen.« Als ich sah, wie seine Augen sich weiteten, korrigierte ich meine Aussage. »Natürlich habe ich noch nie einen Drachen gesehen, denn es gibt ja gar keine Drachen. Aber wenn es welche gäbe, würden sie wohl Mrs Harper im Wesen und Erscheinungsbild ähneln.«
Der Mann sah noch immer mit weit geöffneten Augen zu mir auf und ließ das Hosenbein meiner Jeans nicht los. »Ihr Name ist Olivia Eleanor Emerson, neben Ihnen steht eine Harrowmore, Sie selbst nennen Ihre Arbeitgeberin einen Drachen und dort drüben unter dem Fenster steht ein Inkubus und spürt genau wie ich, dass dies alles nicht richtig sein kann. Spüren Sie selbst denn gar nichts?«
Doch. Ich spürte ganz deutlich, dass ich der letzte normale Mensch an diesem Ort war.
Ich sah kurz zu dem Leser namens Cube hinüber, der mit finsterer Miene zu uns herüberstarrte. Hatte es Sinn, irgendjemanden zu fragen, was genau ein Inkubus war? Vermutlich nicht. Es wurde allerhöchste Zeit, mein Umfeld zu ändern, bevor es auf mich abfärben konnte.
»Ich spüre schon den heißen Atem meiner Chefin im Nacken. Es tut mir leid, Mister Biggs, aber ich muss jetzt weiterarbeiten.«
Energisch versuchte ich, mich von ihm loszumachen, doch der kleine Kerl gab mein Hosenbein einfach nicht frei. »Todesbote?«, rief er unvermutet aus und starrte mich an.
Ich starrte wortlos zurück. Hatte das witzig sein sollen?
»Dieses Wort löst nichts bei Ihnen aus? Rein gar nichts?« Er klang enttäuscht.
Ich schüttelte den Kopf. »Also wenn das ein Weckruf sein soll, taugt er nicht viel. Allerdings bin ich ja auch keine Banshee.«
Noch einmal bemühte ich mich energisch, seinem Griff mit heiler Hose zu entkommen, und dieses Mal hatte ich Erfolg. Eilig machte ich mich daran, in einen sicheren Teil der Bibliothek zu flüchten. Irgendwohin, wo es keine Millie und keinen Mister Biggs gab. Zu den Kochbüchern vielleicht.
»Druideneiche? Walt? Dachkammer?«, rief mir der Mann aufgeregt hinterher, doch jetzt konnte er meine Flucht nicht mehr verhindern. Und seine Beine waren kurz genug, dass sogar eine lahme Ente wie ich ihm mühelos davonrennen konnte.
»Mummel!«, schrie er hinter mir und dieses Mal war es keine Frage.
Ich wollte gerade im Weglaufen genervt den Kopf schütteln, als etwas Eigenartiges mit mir geschah. Mein Herzschlag beschleunigte sich, während ich gleichzeitig eine Gänsehaut bekam, die mir über Arme, Beine und Rücken zugleich lief. Jedes einzelne meiner Körperhaare schien sich aufstellen zu wollen, gleichzeitig gaben meine Knie so ruckartig nach, dass ich lang auf dem schäbigen Teppichboden der Bibliothek aufschlug und mir Stirn und Nase prellte.
Als ich den Kopf wieder hob, spürte ich sofort das warme Blut, das mir über die Lippen lief und von meinem Kinn tropfte. Vorsichtig setzte ich mich auf und befühlte meine Nase, die bereits anzuschwellen drohte. Ich würde für mindestens eine Woche total entstellt sein.
»Was für ein beschissener Tag«, brachte ich hervor und sah meinem Blut zu, das kleine Flecken auf meine Jeans malte. »Was für ein unglaublich beschissener Tag.«
Mrs Harper gab mir den Rest des Tages frei, als sie mein blutverschmiertes Gesicht sah. Kopfschüttelnd nahm sie meine Erklärung entgegen, dass ich über meine eigenen Füße gefallen sein musste. Anders konnte ich mir meinen Sturz nicht erklären.
Da ich dem kleinen Mann, der allem Anschein nach nicht alle Tassen im Schrank hatte, nicht noch einmal begegnen wollte, verließ ich die Bibliothek durch den Personaleingang und machte mich auf den Weg zur nächsten U-Bahn-Station. Die Dämmerung war einem typischen Novemberdunkel gewichen und London setzte jede einzelne seiner Glühbirnen dagegen. Trotzdem wirkte alles auf mich finster und trüb.
Ich ignorierte die fröhlichen Weihnachtsdekorationen in den Schaufenstern, kuschelte mich in meinen überdimensionalen Schal und konnte gar nicht schnell genug nach Hause kommen. Meine Nase schmerzte und hinter meiner Stirn pochte es dumpf. Ich brauchte dringend einen Eisbeutel, ein Aspirin und ein bisschen Aufmerksamkeit.
Seit einigen Monaten lebte ich nicht mehr in meinem Kinderzimmer bei Tante Ethel, sondern war in die Wohnung meiner verstorbenen Mutter zurückgekehrt. Der Mieter war höchst ungern ausgezogen, denn es waren hübsche kleine Räume im begehrten Stadtteil Kensington, die ich geerbt hatte. Gut, das Haus war alt, es gab weder einen Fahrstuhl noch einen Balkon. Doch da das tägliche Treppensteigen bis in den dritten Stock mein einziger Sport war, störte mich das für gewöhnlich nicht.
Heute schon. Meine Nase war inzwischen so stark angeschwollen, dass ich nur noch durch den Mund atmen konnte, und das fiese Pochen hinter den Augenbrauen nahm weiter zu.
Ich erreichte mein neues Domizil, suchte eine halbe Ewigkeit in all meinen Taschen nach dem Wohnungsschlüssel und gab schließlich auf. Entnervt drückte ich auf den Klingelknopf. Danny, mein derzeitiger Freund, der kurz nach mir samt seiner Playstation und zehn Kilo Dreckwäsche hier eingezogen war, müsste eigentlich daheim sein. Schließlich war er gerade arbeitslos.
Obwohl Danny nur zwei Jahre älter war als ich, hatte er schon mehr Jobs gehabt als jeder andere Mensch, den ich kannte. Er rechtfertigte dies stets mit den Worten, es sei einfach noch nicht das Passende für ihn dabei gewesen.
Ich klingelte ein Dutzend Mal, dann hielt ich den angelaufenen Messingknopf gedrückt und spürte, wie ich immer wütender wurde. Jede Wette, dass Danny mal wieder irgendein blödes Computerspiel zockte und einfach nur zu faul war, um seinen Hintern aus meinem Sofa zu erheben.
Nach fast drei Minuten erhielt ich die Bestätigung für meine Vermutung. Die Tür vor meiner Nase wurde geöffnet und der Mann meiner Träume, die ausgeleierte Jogginghose unter den Bauchspeck geklemmt, öffnete mir. Sein blondes Haar sah aus, als wäre es heute noch nicht mit einem Kamm in Berührung gekommen, und sein Chipskonsum hatte in seinem runden Gesicht eine ganze Reihe neuer Pickel erblühen lassen.
»Verdammt, ich hätte fast den Highscore geknackt«, rief er zur Begrüßung. Dann musterte er mein Gesicht. »Bist du gegen eine Faust gelaufen? Oder war es ein Laternenpfahl? Livie, wenn man geht, sollte man sich auf seine Umwelt konzentrieren und nicht auf ein Buch oder ein Display. Sonst kann das schlimme Folgen haben.«
»Was du nicht sagst.« Ich versuchte, meinen Ärger in Ironie zu hüllen. »Blöderweise warst du kluger Mann nicht an meiner Seite, als der Fußboden der Bibliothek auf mich einschlug. Wenn man eine Freundin hat, sollte man immer ihr Prinz in schimmernder Rüstung sein und sie im Notfall auffangen, sonst kann das schlimme Folgen haben.«
Ich schob mich an ihm vorbei in den winzigen Flur und bereute es augenblicklich. Ein unbeschreiblicher Gestank hing in der Luft, so stark, dass ich glaubte, einen grünlichen Nebel aus der offenen Küchentür wabern zu sehen. Dabei hatte ich angenommen, durch meine verschwollene Nase gar nichts mehr riechen zu können.
»Was ist das denn?«, fragte ich und wollte es eigentlich gar nicht wissen. »Hat ein Antarktisforscher dir seine drei Monate lang nicht gewaschenen Socken vermacht?«
»Das ist Esrom-Auflauf.« Mein Herzbube grinste und strich sich über den Dreizehntagebart. »Megalecker und quasi fettarm, da das meiste beim Backen herausgelaufen ist. Willst du was abhaben?«
»Danke, mir ist schon schlecht.«
Ich floh ins Wohnzimmer und stellte fest, dass Danny zum Nachtisch eine Tüte Chips und all meine geliebten Oreo-Kekse verdrückt hatte. Verpackungen und Krümel hatte er mir netterweise dagelassen, damit ich auch wusste, dass gestaubsaugt und eingekauft werden musste.
In diesem Moment fiel es mir schwer, Danny nicht zu hassen, und ich fragte mich, ob es nicht an der Zeit war, ihn rauszuwerfen und endlich wieder selbst meine Wohnung zuzumüllen. Dafür brauchte ich doch eigentlich niemanden. Und unsere Liebe war sowieso schon so abgekühlt wie der Novemberabend dort draußen.
Ich befühlte vorsichtig meine Nase. »Haben wir Eis im Gefrierfach? Vanilleeis für die Seele und Eiswürfel für den Rest?«
»Nicht mehr.«
Danny ließ sich aufs Sofa fallen und suchte nach einer der vielen Fernbedienungen. Vielleicht aber auch nach einem Controller, Joystick oder was auch immer. Einen Wimpernschlag später war er in seiner eigenen Welt versunken und ich war wieder abgemeldet.
War ich eigentlich blöd, mir so einen Typen aufzuhalsen?
»Heute war ein Mann in der Bibliothek. Ein winzig kleiner Mann etwa so hoch wie unsere Sofalehne«, begann ich eine Konversation, in der Hoffnung, seine Aufmerksamkeit zurückerlangen zu können.
»Hm«, machte Danny. Es klang zustimmend, was nicht viel Sinn ergab, aber zum Weitersprechen animierte.
»Er hielt mir einen Zettel unter die zu dem Zeitpunkt noch heile Nase, auf dem mein Name stand. Aber nicht meine Adresse, sondern die von meiner Freundin Millie. Du weißt schon, die rothaarige Studentin, die seit Tagen ihre prophezeite Kinderlosigkeit beweint.«
»Rothaarig«, wiederholte Danny, um mir zu beweisen, dass er mir zuhörte. Er war wirklich ein verdammter Idiot.
»Tja, er war eben ein Zwerg, den mir der Drache geschickt hat, weil er ein seltsames Buch suchte. Und die ganze Zeit über war da der gruselige Nacht-Cube und starrte uns an, als ob wir einen terroristischen Anschlag planen würden. Und plötzlich hat mich Mutter Erde am Kopf getroffen. Was sagst du dazu?« Ich verschränkte die Arme vor der Brust und sah mit finsterer Miene auf meinen Freund hinab.
»Klingt schlimm, Babe. Willste ein Bier?«
Ich atmete tief durch den Mund ein und schloss für einen Moment die Augen. Dann ging ich um den zugemüllten Couchtisch herum und schaltete den Flachbildschirm aus. »Das war’s, Danny. Pack deine Klamotten und mach dich vom Acker. Und nimm den Müll mit raus, wenn du mein Leben verlässt, okay?«
Er hob den Kopf und schenkte mir einen dieser gefährlich bettelnden Bassettblicke, bei denen ich immer schwach wurde. »Echt jetzt? Lief doch ganz gut mit uns. Dachte ich zumindest.«
»Tja, ich denke das nicht.« Ich stapfte in den Flur zurück und wickelte mich in meinen meterlangen Schal ein. »Jetzt, wo ich diese ungemein schmückende rote Gummel anstelle einer Nase im Gesicht trage, kann ich einfach jeden Kerl haben. Alle Männer dieser Welt werden sich um mich reißen, vermutlich beginne ich sogar eine Modelkarriere. Was meinst du dazu, Danny?«
»Okayyy …« Er hatte sich aus dem Sofa erhoben und sah mir mit traurigen Augen beim Anziehen zu.
Für einen Moment überkam mich Mitleid, aber es hielt gerade einmal lange genug vor, um ihm einen letzten Ratschlag zu geben. »Du bist ein netter Kerl, Danny. Aber auch träge, langweilig und dreckig. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo dort draußen auf den Straßen Londons ein Mädchen gibt, das ganz großartig zu dir passt, aber ich bin es nicht.«
»O…«
Ich fiel ihm ins Wort. »Nein, das ist nicht okay. Eigentlich nicht. Es ist traurig. Du solltest etwas daran ändern. Aber mach das bitte nicht hier, mein Helfersyndrom ist nicht besonders ausgeprägt. Ich habe selbst genug Probleme. Ich sehe aus wie Rudolf, das rotnasige Rentier, und ich weiß nicht, was ein Mummel ist.«
»Ein Mummel?« Danny kratzte sich am Ohr. »Nie gehört. Kenn ich gar nicht.«
»Ich auch nicht, aber genau das hat dieser kleine Mann zu mir gesagt, bevor ich umgefallen bin. Ich fürchte fast, es war sein Weckruf, und über den bin ich irgendwie gestolpert. Und dieses Papier mit meinem Namen drauf, das nannte er einen Anker. Ich vermute mal, dass das nichts mit Schiffen zu tun hat.«
»Livie, du bist echt hart auf den Kopf geknallt, oder?« Zum ersten Mal seit meiner Heimkehr klang Danny überzeugend mitleidig.
»Mag sein.« Ich riss einen meiner vielen Ersatzwohnungsschlüssel vom Schlüsselbord und stopfte ihn in eine meiner Jackentaschen, wo er vermutlich auf seinen Zwilling treffen würde. »Aber das ändert nichts daran, dass es aus ist, Danny. Verpfeif dich, ich gehe jetzt erst einmal zu Tante Ethel. Vielleicht weiß die ja, was ein Mummel ist. Und wenn ich wiederkomme, bist du bitte nicht mehr da.«
Kapitel 2
Kaum war ich wieder auf der Straße, setzte auch schon passenderweise ein fieser kalter Nieselregen ein. Dieser Tag tat wirklich alles dafür, um von mir zum schlechtesten des ganzen Jahres gewählt zu werden.
Glücklicherweise hatte ich es bis zu meiner Tante Ethel nicht weit, die im selben Stadtteil Londons nur wenige Straßen entfernt von mir wohnte. Als Teenager hatte ich einmal gewagt, zu fragen, wie zwei absolute Durchschnittsfrauen wie meine Mutter und meine Patentante an so hippe Wohnungen in einer teuren Wohngegend gekommen waren. Statt einer Antwort ließ Tante Ethel mich meine Schultasche auf dem Küchentisch ausleeren und für jedes vergammelte Pausenbrot, das sie zwischen den Heften fand, bekam ich einen Tag Fernsehverbot. Ich fragte nie wieder.
Nass und schlecht gelaunt schleppte ich mich die Stufen zu meiner Patentante hinauf. Wenigstens meiner Nase hatte der kalte Regen gutgetan.
Ich fühlte mich schon viel weniger wie ein Zombie, als mir geöffnet wurde und die Begrüßung lautete: »Sternschnuppen, Livie! Im Radio haben sie gerade erzählt, dass heute Sternschnuppen niedergehen! Und das im November. Komm, wir gehen gleich raus auf den Balkon, ja? Du lieber Himmel, was ist denn mit deiner Nase passiert?«
»Die hab ich versucht, als Airbag zu benutzen, als ich unvermutet auf den Boden geknallt bin. Doch so eine Nase bläst sich mit ziemlicher Verspätung auf. Du willst wirklich draußen Sternschnuppen anschauen?« Für gewöhnlich beneidete ich sie um ihren Balkon, aber nicht heute. »Tante Ethel, es regnet. Der ganze Himmel hängt voller Wolken.«
Sie sah enttäuscht auf meine tropfnasse Gestalt. Aber nur einen Augenblick später hellte sich ihre Miene wieder auf. »Und wenn doch eine zu uns durchkommt?«
»Dann wäre das nicht so gut, denn niemand will eine Sternschnuppe auf den Kopf bekommen«, argumentierte ich weiter, aber es war sinnlos.
Einige Minuten später standen wir zwei einträchtig unter freiem Himmel und ließen den Londoner Regen in unsere Teetassen tropfen. Meine Tante musste man einfach so nehmen, wie sie war, Argumente halfen da wenig.
»Sag mal, hast du eine Ahnung, was ein Mummel ist?«, fragte ich und versuchte, einen möglichst harmlosen Ton anzuschlagen. Dabei war mir schon im Gespräch mit Danny aufgefallen, dass dieses Wort wie Brause auf meiner Zunge prickelte.
»Mummel?« Meine Tante überlegte und sah gleichzeitig in den Nachthimmel hinauf, aus dem es ihr ins Gesicht tropfte. Ihr dünnes rotes Haar klebte bereits wie eine Zellophanfolie an ihrem Kopf. Ihr war das egal. »Das ist ein schönes Wort. Mummel. Man macht automatisch einen Kussmund, wenn man es ausspricht. Mummel.«
»Ja, aber hast du eine Ahnung, was es bedeutet?«, hakte ich nach.
»Es sind Wasserwesen, glaube ich.« Sie neigte den Kopf und warf mir einen neugierigen Blick zu. »Warum willst du das wissen? Du glaubst doch an nichts, das du nicht auch in einem Katalog bestellen kannst. Oder hast du etwa einen Mummel kennengelernt und bist endlich von der Existenz des Unbekannten überzeugt worden?«
Ich dachte an den kleinen eisgrauen Mann aus der Bibliothek und versuchte, ihn mir mit einem Fischschwanz vorzustellen. Es klappte nicht, also schüttelte ich den Kopf. »Und was ist ein Anker?«
Jetzt bekam der Blick meiner Tante etwas Mitfühlendes. »Livie-Maus, dein Sturz heute war wohl doch etwas heftiger, was? Ein Anker ist so ein schweres Ding, das Seeleute ins Meer werfen, damit ihr Schiff am selben Fleck bleibt.«
Ich rollte genervt die Augen. »Das ist mir klar, Tante Ethel, aber was ist ein Anker außerdem noch? Was wäre ein Anker für einen Menschen, der beispielsweise an die Existenz von Mummeln glaubt? Oder Drachen? Oder Banshees?«
»Ach, du meinst vielleicht einen Zeitanker? Das ist eine tolle Sache, hast du etwa einen gefunden? Davon musst du mir unbedingt erzählen.«
Tante Ethel vergaß die Sternschnuppen und schleifte mich zu ihrem grellbunten Sofa. Wenigstens war ich auf diese Weise dem schlechten Wetter entkommen. Und außerdem hatte ich jetzt ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Schnell, zeig ihn mir. Wo ist der Anker? Hast du ihn bei dir?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ein kleiner Mann in der Bibliothek hat heute davon gesprochen. Er meinte, ein Anker hätte ihn zu mir geführt und er würde einen Weckruf für eine Banshee suchen. Kurz darauf hörte ich zum ersten Mal das Wort ›Mummel‹ und bin auf die Fresse geflogen.«
Meine Tante hielt es nicht auf der Sofakante. Wie ein aufgescheuchtes Huhn flatterte sie um mich herum und konnte sich gar nicht wieder beruhigen. Ich sah ihr eine Weile schweigend zu und wartete, bis sie kurz innehielt, dann erinnerte ich sie an meine ursprüngliche Frage: »Anker?«
Tante Ethel flatterte erneut mit den Armen und glich jetzt mehr einem startenden Albatros als einem Huhn. »Ein Zeitanker kann alles Mögliche sein, beispielsweise ein Tonband, ein geliebter Gegenstand oder einfach eine geschriebene Nachricht. Ich habe gehört, dass man sogar Lebewesen als Zeitanker benutzen kann, aber das finde ich irgendwie gruselig.«
Meine Geduld war am Ende. »Was macht denn nun dieser blöde Zeitanker? Was für einen Zweck hat er und warum sollte überhaupt jemand irgendwo auf der Welt mit einem Tonband oder einer Notiz vor Anker gehen?«
»Um sich nicht in der Zeit zu verlieren.« Meine Tante hatte ihre Stimme gesenkt und sah mich mit ihrem Gruselgeschichten-nach-Mitternacht-Blick an. »Wenn man in eine Art Parallelwelt zu stürzen glaubt, wenn die Dinge um einen herum sich falsch anfühlen, wenn man denkt, das einzig Richtige in einer falschen Realität zu sein, dann kann einem nur der Anker Gewissheit geben.«
Ich verstand nur Bahnhof und brachte dies mit einem einzigen Wort zum Ausdruck: »Hä?«