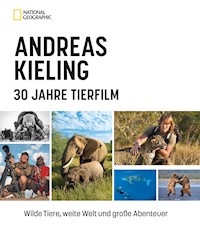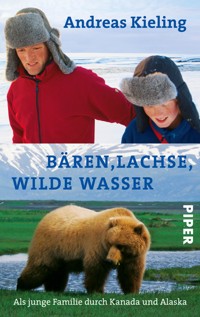
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abenteuer Wildnis: 3200 Kilometer lang ist der Yukon, die Lebensader Alaskas und Kanadas. Für Andreas Kieling, Deutschlands bekanntesten Tierfilmer und Bärenexperten, und seine Familie wird die aufregende Reise von den Quellen bis zur Beringsee zur existenziellen Erfahrung. Grizzlys und Elche kreuzen ihren Weg, und sie erleben die Urgewalt des Yukon. Das spannend erzählte Dokument einer einzigartigen Reise – Thema von Kielings großem ARD-Dreiteiler »Abenteuer Yukon«. Andreas Kieling auf Deutschlandtour: http://www.kieling-tour.de/
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Cita, Großvater im Wald und Kim in den ewigen Jagdgründen
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
6. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-96696-2
© Piper Verlag GmbH, München 2007 © Piper Verlag GmbH, München 2009 Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, www.kohlhaas-buchgestaltung.de Covermotiv: Andreas Kieling Fotos: Andreas Kieling und Frank Gutsche Karte: Eckehard Radehose, Schliersee Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Prolog
Kein Dock, keine Rampe, nichts, was die Arbeit an dem kaputten Kiel erleichtern würde. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich schon aufgetaucht bin, um Luft zu holen. Die Kälte des Yukon setzt mir trotz Trockentauchanzug zu. Gesicht und Finger sind eiskalt. Der zugleich skeptische und ängstliche Blick, mit dem mich Birgit bei jedem Auftauchen mustert, zerrt an meinen Nerven. Ich spüre, wie meine Kräfte und die Konzentration nachlassen. In welche Situation habe ich meine Familie da nur manövriert? Weitab jeglicher Zivilisation sitzen meine Frau, unsere zwei Kinder und ich auf einem kaputten Segelboot in der Wildnis Kanadas fest.
Und da passiert es. Von meinen Gedanken abgelenkt, tauche ich auf der falschen Seite des Schiffs auf. Sofort reißt mich die Strömung mit. Die zwölf Kilo Blei, die ich trage, damit mich der Auftrieb des Trockentauchanzugs nicht wie eine Luftblase an die Wasseroberfläche steigen läßt, ziehen mich nach unten. Ich rudere mit den Armen, strample mit den Beinen, um nach oben zu kommen. Keine Chance. Will den Bleigurt lösen, doch der Sicherheitsverschluß klemmt. Verdammt, ich habe keine Luft mehr! Ich greife nach meinem Tauchmesser, säble wie verrückt an dem Gurt, begehe in der Panik fast Harakiri, schlucke Wasser.
Doch dann, von einer Sekunde auf die andere, werde ich ganz ruhig, denke, das war’s dann wohl. Kämpfe nicht mehr gegen das Ertrinken an. Wenn es denn so sein soll, ist es gut. Habe ein spannendes, erfülltes Leben gehabt, meine Träume gelebt. Also, was soll’s? Im nächsten Moment spuckt mich der Yukon 200Meter weiter wieder aus und spült mich ans Ufer. Während ich mir fast die Seele aus dem Leib kotze, wird mir klar, daß dies das Ende unserer Reise ist. Einer Reise, auf der mein Unfall von soeben sozusagen nur das Highlight in einer Reihe von Katastrophen – kleineren, aber auch größeren – war.
Dabei hat alles so schön begonnen …
Wieder in Alaska
März 2005. Zum zweiten Mal bin ich mit meinem elfjährigen Sohn Erik in Alaska unterwegs. Zwei Jahre zuvor waren wir mit unserem Segelboot Tardis durch die Shelikofstraße entlang der Südseite der Aleuten gesegelt, eine der gefährlichsten Routen weltweit. Gewaltige Stürme, plötzliche Wetterumschwünge und ein sehr hoher Tidenhub – zehn Meter liegen zwischen Ebbe und Flut – sind charakteristisch für dieses Gebiet, in dem das milde Nordpazifikklima auf die eisige Luft der Beringsee stößt. In geschützten Buchten waren wir an Land gegangen, und Erik hatte erstmals die Grizzlys, von denen ich ihm schon so viel erzählt hatte und die er aus meinen Filmen kannte, live und aus nächster Nähe gesehen.
Seit Erik fünf Jahre alt war, hatte er mir nach jeder Rückkehr aus Alaska – wo ich oft mehr als die Hälfte des Jahres verbringe – ein Loch in den Bauch gefragt. Und jedes Verhör hatte mit der Frage geendet: »Papa, wann nimmst du mich mal mit nach Alaska?« Natürlich freute ich mich über das Interesse meines Sohnes an der faszinierenden Welt, die mich vor 15Jahren in ihren Bann geschlagen hat und seither nicht mehr losläßt. Für Erik war der Törn auf unserem Tardis (wir sagen immer »der Tardis«, obwohl uns klar ist, daß Schiffe eigentlich weiblich sind) entlang der Aleuten ein Abenteuer gewesen, das ihn tief beeindruckt hat.*[* Nachzulesen in Kieling, Andreas: Der Bärenmann. Vater und Sohn unter Grizzlys in Alaska, Hamburg 2004.] Und er hatte Feuer gefangen: Alaska hat ihn ebenso infiziert wie mich, denn von da an hatte er mich ständig mit der Frage gelöchert: »Papa, wann nimmst du mich wieder mit nach Alaska?«
Der wilde Norden ist für Erik das ideale »Spielfeld«, denn er ist wie ich ein Wassermensch, kein Bergtyp, und will als erstes immer wissen: »Kann ich da angeln?« und »Gibt’s da große Fische?«
Ich war als Kind genauso. Magisch zog es mich zum Wasser. Wann immer ich einen Kanal, einen Fluß oder Strom sah, war ich nicht mehr zu halten. Mein erstes Boot war der auseinandergesägte Benzintank eines russischen Lkws der Marke Ural. Mit diesem unförmigen, rechteckigen Ungetüm und einer Dachlatte als Paddel dümpelte ich schon als Sieben-, Achtjähriger auf einem kleinen Waldsee herum, und damit es mir niemand wegnehmen konnte, befestigte ich eine Schnur daran und versenkte es jedesmal. Nur mit Mühe konnte ich das schwere Teil dann zu meiner nächsten Exkursion aus dem Schlick ziehen. Doch irgendwann wurde ich zu groß und zu schwer für das Gefährt und mußte es aufgeben.
Nach dem Umzug an die Saale machte ich mich mit meinem neuen Kumpel Michael auf die Suche nach einem Ersatz für den Benzintank. Ein Wassertrog auf einer Kuhweide kam uns da wie gerufen. Der ausgehöhlte, zylinderförmige Holzstamm hatte natürlich weder Bug noch Heck, aber praktischerweise zwei Griffe. Wir hatten gerade das Wasser ausgekippt und wollten unser neues Boot zur Saale schleppen, da kam der Bauer angerannt. Es gab mächtig Hiebe. Zum Glück bekomme ich sehr schnell Nasenbluten, und als mir das Blut übers Gesicht bis auf mein Hemd lief, bekam es der Bauer mit der Angst und ließ uns laufen. Zwei Tage später hatten wir mehr Erfolg, und kurz darauf fuhren wir in dem Wassertrog von Jena bis an die Einmündung in die Elbe bei Halle.
Irgendwann war uns der Trog nicht mehr gut genug, war ja auch kaum steuerbar. Da entdeckten wir eines Tages Masten, aus denen eine Telegraphenleitung errichtet werden sollte. Für uns Jungs ein Geschenk der Götter, war das doch das beste Material, um ein Floß zu bauen. Pfeil und Bogen und auch eine Angel gehörten zu unserer Standardausrüstung, dazu ein Feuerzeug, um ein Lagerfeuer machen zu können, über dem wir Kartoffeln und mit etwas Glück einen selbstgefangenen Fisch grillten. Wir waren wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und wenn unser Floß am Wehr zerbrach, setzten wir es anschließend wieder zusammen – unermüdlich.
Wie gesagt, Erik ist genauso ein Wassermensch wie ich und genauso von Alaska begeistert. Als ich ihn fragte, ob er wieder mit mir nach Alaska reisen wolle, diesmal, um auf dem Chilkoot Trail in das Quellgebiet des Yukon zu ziehen, schaute er mich aus großen Augen an. Er glaubte seinen Ohren nicht trauen zu können – und hatte vermutlich sowieso nur die zweite Hälfte von dem, was ich gesagt hatte, mitbekommen. Die Aussicht, mit dem Kanu auf dem Yukon zu paddeln …
»Erik, hast du mir richtig zugehört? Zuerst müssen wir über den Chilkoot-Paß. Das wird alles andere als ein Spaziergang. Der Weg ist extrem anstrengend und schwierig – vor allem im Frühjahr, denn da ist es in Alaska noch eiskalt.«
»Was meinst du, Papa, schaffe ich das?«
»Da bin ich mir sicher.«
»Dann will ich mit!«
Erik weiß, daß ich ihn zu nichts überreden würde, was ich nicht verantworten könnte, und wenn ich ihm sage, daß ihm dies oder das gefallen wird oder er einer Aufgabe gewachsen ist, dann vertraut er mir – im Unterschied zu Thore, unserem jüngeren Sohn, der sehr stark von Birgit beeinflußt ist, die trotz meiner langjährigen Erfahrung in der Wildnis immer noch mit Ängsten zu kämpfen hat.
Die Tour mit Erik wäre nur der Anfang einer groß angelegten Unternehmung, die mich von Skagway beziehungsweise Dyea an die Quellen des Yukon und von dort bis zu seiner Einmündung in die Beringsee führen würde – knapp 3200Kilometer durch die Wildnis. Im Fokus stand neben der atemberaubenden Landschaft mit ihrem sagenhaften Wild- und Pflanzenreichtum auch die Geschichte dieses Gebiets. Vor über 100Jahren hatte der Goldrausch Tausende wagemutiger Männer – und einige Frauen – an den Klondike River, einen Nebenfluß des Yukon, gelockt. In der Erwartung unermeßlichen Reichtums hatten die Menschen härteste Strapazen auf sich genommen, und viele hatten ihre Hoffnungen mit dem Tod bezahlt. Nur wenige waren wohlhabend geworden. Auch Jack London war ohne ein Klümpchen Gold zurückgekehrt, dafür aber mit Geschichten, die die Welt begeisterten. Dieser Vergangenheit wollte ich nachspüren. Da ich diesmal weit länger als sonst von zu Hause fort sein würde, hatten Birgit und ich vereinbart, daß Erik mich in den Osterferien begleiten und in den Sommerferien dann die ganze Familie zu mir stoßen würde.
Birgit und ich waren schon einmal, 1991, den Yukon runtergepaddelt. Daß sie damals den Mut zu einem solchen Abenteuer aufgebracht hatte, rechne ich ihr noch heute hoch an, denn sie ist kein Wassermensch, hat zu Wasser eher ein zwiespältiges Verhältnis. Schwimmen und Baden, ja, aber große Flüsse sind ihr suspekt. Trotzdem ließ sie sich auf das Wagnis ein, mehrere Monate auf und an einem Fluß in der Wildnis zu leben. Die Reise wurde eine Bewährungsprobe für mich und meine Pläne, als Abenteurer und Filmer meinen Unterhalt zu verdienen, und für unsere Beziehung: Die ersten Wochen war unser Freund Michael mit von der Partie, was so manche Situation entspannte, doch dann lebten Birgit und ich mehrere Monate auf engstem Raum zusammen – untertags in einem Kanu, nachts in einem kleinen Zelt. Nur selten kamen wir an Siedlungen vorbei und konnten mal mit anderen Menschen reden. Wir waren zudem mit vielen Träumen und null Ahnung aufgebrochen, denn auch ich war damals noch ein absolutes Greenhorn. Tagelang wurden wir oft von heftigen Regenfällen regelrecht durchweicht, dann wieder stürzten sich dicke, schwarze Moskitowolken auf uns. Als Birgit schließlich nach Deutschland zurückkehrte, während ich den Yukon noch bis zur Beringsee weiterpaddelte, stand unsere Beziehung auf der Kippe. Dabei hatten wir ursprünglich geplant, in irgendeiner der Indianersiedlungen am Yukon zu heiraten … Na ja, aber wir sind noch immer zusammen, haben irgendwann mal auch geheiratet und mittlerweile zwei Söhne. Und ich habe mir als Tierfilmer einen Namen gemacht.
Und wie das halt so ist, mit der Zeit fängt man an, alte Erlebnisse zu romantisieren. Das ging dann so nach dem Motto: »Erinnerst du dich noch an die lustigen Indianer?« Die waren nicht lustig, sondern einfach nur betrunken. Oder: »Weißt du noch, wie schön das war, als der Elch damals in der Abendsonne durch den Fluß geschwommen ist?« Und allmählich reifte der Plan, noch einmal, wenn unsere Jungs dafür groß genug wären, gemeinsam den Yukon zu bereisen – zumindest ein Teilstück. Diese zweite Reise war also als »Familienurlaub« von langer Hand geplant, in erster Linie unternahmen wir sie aber für das Fernsehen.
Über die »goldene Treppe«
Ende März 2005 landen Erik und ich auf dem kleinen Flughafen in Skagway und fahren nach Dyea. Dyea, in einem Fjord gelegen, ist der Ausgangspunkt des Chilkoot Trails, auf dem die alten stampeders oder Argonauten – benannt nach den Argonauten Iasons auf der Suche nach dem Goldenen Vlies – vor über 100Jahren nach Dawson City in Kanada zogen, um am Klondike Gold zu schürfen. Wir decken uns mit Vorräten ein, und ein letztes Mal für die nächsten Wochen schlafen wir in einem richtigen Bett und gönnen uns ein Essen in einem Restaurant.
Am nächsten Morgen geht es dann los. Der Winter ist nicht gerade die optimale Zeit für so ein Unternehmen. Um uns her ist alles weiß. Wobei gerade die weiße wilde Landschaft Erik fasziniert. Sooooo viel Schnee! Es hat um die minus 20Grad, dazu starke Winde, das potenziert sich schnell zu gefühlten minus 40.
»Mensch, Papa, wann sehe ich denn endlich mal ein Tier?« beschwert sich Erik nach einiger Zeit, und ich merke, daß er sich unser Unternehmen doch ein klein bißchen anders vorgestellt hatte. Zwar kommt er mit der Kälte gut zurecht, wir sind ja auch in adäquate Kleidung verpackt, doch Bergsteigen ist halt nicht das seine. Er will an den Yukon, er will paddeln, und vor allem will er angeln und Tiere sehen! Die Bären sind zu dieser Jahreszeit aber noch im Winterschlaf; nur einer lugt mal zaghaft aus seiner Höhle, und die anderen Tiere – wie Elche, Dallschafe, Schneeziegen und Karibus – versuchen Energie zu sparen, das heißt, sie stehen fast bewegungslos herum und sind daher nur mit viel Glück auszumachen.
Doch Erik ist ein genauso zäher Knochen wie ich. Als ich ihm daher sage: »Hör mal, die nächsten zwei, drei Tage müssen wir uns richtig quälen, aber danach werden wir tolle Sachen erleben«, beißt er die Zähne zusammen. Und obwohl der Aufstieg auf 1100Meter Meereshöhe zum Chilkoot-Paß auf Skiern und mit einem dicken Rucksack auf dem Rücken Eriks ganze Kraft erfordert, kommt nie ein Kommentar wie »Ich mag nicht mehr«. Ich bin unheimlich stolz auf meinen Sohn und bewundere seine Durchhaltekraft und seine Zähigkeit. Immerhin ist er erst elf Jahre alt.
Vier Tage nach unserem Aufbruch in Dyea bauen wir ein Stück unterhalb des Passes an einer einigermaßen windgeschützten Stelle unser Zelt auf. Es ist bitterkalt, minus 30Grad. Auch Cita, unser Hannoverscher Schweißhund, friert erbärmlich, und wir ziehen ihr einen Anzug und Schühchen aus Fleece an, die wir noch in Deutschland extra für sie haben anfertigen lassen.
»Papa, wann gehen wir endlich auf Schneehuhnjagd? Seit Tagen versprichst du’s mir!«
»Wir haben doch bislang keine gesehen, wie sollen wir da welche jagen?« entgegne ich. Im nächsten Moment entdecke ich ein paar Federknäuel. »Mensch, schau mal, Erik, da drüben sind welche.«
Im Nu hat Erik sämtliche Strapazen vergessen: das Schleppen, das Frieren, das Schwitzen, die Nasenlöcher zugefroren, die Wimpern vom Eis verklebt … Schon läuft er zu der Stelle hinüber, dreht sich unterwegs kurz um, um mir zu bedeuten, daß ich nur ja den Jagdbogen mitbringen solle. Wir jagen beide gern mit Pfeil und Bogen. Zum einen haben die Tiere dadurch eine faire Chance zu entkommen, zum anderen werden nicht sämtliche Lebewesen im Umkreis durch den Knall einer Schußwaffe aufgeschreckt.
Der erste Pfeil geht dann prompt daneben, doch mit dem zweiten erbeuten wir unser Abendessen, und für Erik ist die Welt wieder in Ordnung, er ist rundum zufrieden und glücklich.
Als wir wenig später in unseren High-Tech-Schlafsäcken in einem High-Tech-Zelt liegen, frage ich Erik: »Kannst du dir vorstellen, wie das für die Menschen war, die hier über den Paß zogen, um am Klondike Gold zu schürfen? Die hatten noch keine Fleece-Sachen zum Anziehen und haben erbärmlich gefroren.«
»Wann war das denn?« will er wissen.
»Im August 1896 wurde im Bonanza Creek …«
»… wie die Fernsehserie?« unterbricht mich Erik.
»Ja, genau. Damals wurde im Bonanza Creek …«
»… wo ist der?«
»Da, wo der Klondike in den Yukon mündet. Also, 1896 wurde im Bonanza Creek ein großer Goldfund gemacht. Die Gegend ist aber so abgelegen, daß die Außenwelt erst ein Jahr später davon erfuhr, als nämlich im Juli 1897 ein Schiff mit einer Tonne Gold vom Yukon in Seattle anlegte. In wenigen Stunden verbreitete sich die Neuigkeit über die ganze Stadt und innerhalb einer Woche entlang der Westküste. Man kann sich kaum vorstellen, was dann hier abging. Als erstes kamen die Goldsucher aus San Francisco und andere Amerikaner, bald aber auch Deutsche, Italiener, Norweger und so weiter, sogar Chinesen und Japaner. Schon die Fahrt nach Alaska war ein Abenteuer für sich. Die Dampfer waren meist hoffnungslos überladen: statt 30 waren über 100Passagiere an Bord, dazu Pferde und andere Tiere, tonnenweise Goldgräberausrüstung … Kein Wunder, daß allein 1898 40 dieser Seelenverkäufer sanken. Die Mannschaft war oft völlig unerfahren, bestand zum Teil gar aus Goldgräbern, die sich ihre Überfahrt durch die Arbeit an Bord verdienten. Schlafen war aufgrund der heillosen Überbelegung nur im Turnus möglich, auf Essen mußte man nicht selten stundenlang warten, obwohl rund um die Uhr gekocht wurde. Reichlich Alkohol führte zu Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten – auch mal mit tödlichem Ausgang. Nach der Ankunft entschieden sich die wenigsten für den einfacheren, aber längeren Weg über den White-Paß, die meisten wählten die ›goldene Treppe‹ über den Chilkoot.«
»Da gab’s ’ne goldene Treppe?« fragt Erik mit vor Staunen weit aufgerissenen Augen.
»Eine Treppe ja, aber nicht golden. Stell dir vor, ein paar gewiefte Geschäftsmänner haben tatsächlich 1200 Stufen in das Eis des Berghangs geschlagen, um den Aufstieg zu erleichtern. Aber wer die benutzen wollte, mußte eine Gebühr zahlen. Das kam die Goldsucher ganz schön teuer, denn um oben am Paß die Grenze zwischen Alaska und Kanada überqueren zu dürfen, mußten sie nachweisen, daß sie 500Kilogramm Nahrungsmittel dabeihatten, und zwar jeder! Außerdem brauchten sie ja jede Menge Ausrüstung zum Goldschürfen, Hacke, Spaten, Schaufel und so weiter. Da kam schnell eine Tonne zusammen.«
»Eine Tonne? Wow!«
»Und die konnten sie natürlich nicht in einem Rutsch tragen, also mußten sie ihre Sachen in mehreren Etappen transportieren. Das hieß, 30, 40 oder 50Kilo, je nachdem, wie kräftig der einzelne war, ein Stück weit bringen, dann zurückmarschieren, den nächsten Schwung holen und so weiter; das Ganze bis zu dreißigmal. Viele sind schon da ausgestiegen. Das hat den Betreibern der goldenen Treppe natürlich nicht gefallen, da sie ja jedesmal ihre Gebühr kassierten. Deshalb haben sie für ein paar Annehmlichkeiten gesorgt, etwa ein Handlaufseil und kleine Ausweichstellen zum Verschnaufen. Denn damals kam nicht ab und zu mal einer hier entlang, sondern stiegen Hunderte von Menschen in einer langen Reihe die Stufen hoch – zumindest bis die Eisenbahn über den White-Paß fertig war, denn mit der schaffte man es dann in einem Tag mitsamt dem ganzen Gepäck von Skagway nach Whitehorse. Übrigens: Die, die an dieser Eistreppe vorzeitig aufgegeben haben, nannte man ›Kaltfüßer‹. Daher kommt der Ausdruck ›kalte Füße bekommen‹, wenn sich jemand davonmacht.«
»Und wie ging’s von Whitehorse aus weiter?«
»Auf Schaufelraddampfern, zum Teil sogar in sehr luxuriöser Weise – für die, die es sich leisten konnten. Die Raddampfer fuhren flußabwärts bis nach Dawson City am Klondike. Und natürlich wieder zurück. Das war ein regelrechter Linienverkehr. Mit allen Tücken natürlich. Die Leute, die kein oder wenig Geld hatten, haben sich am Lake Tagish ein Boot oder ein Floß gebaut und sind auf eigene Faust den Yukon hinuntergefahren. Dabei sind viele ertrunken.«
»Was hatten die denn zum Essen dabei, damals gab’s doch mit Sicherheit noch keine Fertiggerichte, oder?«
»Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Goldsucher an Nahrungsmitteln mitschleppten, aber Fertiggerichte gab’s noch nicht, da hast du recht. Vor allem wußte man noch nicht, welche Nahrungsmittel sich am besten für das kalte Wetter und die Strapazen eignen, also zum Beispiel Schokolade als Energielieferant oder Fett, damit man nicht so leicht friert. Daß man bei so extremen Niedrigtemperaturen wie hier viel Fett braucht, unterschätzen auch heute noch die meisten Menschen. Die mitgebrachten Lebensmittel waren außerdem schnell aufgebraucht. Die Greenhorns aus Kalifornien, Oregon oder Portland dachten, ach, wenn es kalt wird, ziehe ich meine drei Paar Unterhosen übereinander an, und verhungern werde ich schon nicht; da steht doch bestimmt an jeder Ecke ein Elch oder ein Biber, den ich fangen oder schießen kann. Na ja, so kam es, daß während des Goldrauschs am Yukon die Menschen zu Tausenden verhungerten.«
Am nächsten Vormittag entdecke ich in einiger Entfernung zwei Elche.
»Hey, Erik, schau mal, da drüben, siehst du die beiden Elche?«
»Wo?«
»Ein Stückchen links von den Fichten. Hast du sie?«
»Ja!«
In Sekunden haben wir unsere Skier abgeschnallt und rennen los. Immer wieder brechen wir dabei durch den verharschten Schnee, kommen völlig außer Atem. Erik ist das egal, er will weiter, will die Elche aus der Nähe sehen. Doch die beiden Tiere, eine starke Kuh und ein junger Bulle, verhalten sich sehr scheu, und als sie dann noch Cita entdecken, ergreifen sie die Flucht.
Die folgende Nacht verbringen wir in einer Schneehöhle, die wir zufällig entdeckt haben. Sie ist gerade groß genug, daß Erik, Cita und ich darin Platz haben.
»Das ist fast ein bißchen unheimlich hier drin«, meint Erik, als wir in unseren Schlafsäcken liegen und die Stirnlampen ausgeknipst haben.
»Ja, es ist total ruhig. Draußen oder wenn man im Zelt liegt, hört man immer irgend etwas, und wenn es nur der Wind ist.«
»Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.«
»Was ist dir dann unheimlich, wenn nicht die Stille?«
Erik zögert mit der Antwort. Als ich schon glaube, daß er eingeschlafen ist, sagt er: »Na ja, so rundherum nur Schnee und Eis. Was ist, wenn die Decke in der Nacht einfach einstürzt?«
»Das wäre in dem Fall nicht weiter schlimm«, beruhige ich ihn, »weil sie nicht sehr dick ist. Wir würden nur furchtbar erschrecken, aber passieren könnte nichts. Willst du lieber doch im Zelt schlafen?«
»Nö!« kommt es wie aus der Pistole geschossen. »Jetzt nicht mehr.«
Die Abfahrt vom Chilkoot-Paß ist noch einmal richtig anstrengend. Zum einen sind wir keine besonders guten Skifahrer, zum anderen habe ich einen Packschlitten im Schlepptau. Häufig überschlagen wir uns auf den steilen Hängen, brechen durch harschige Stellen, geraten auf Eisplatten und gewinnen mehr Tempo, als uns lieb ist – bis uns die nächste Tiefschneewehe abrupt abbremst.
Nach anstrengenden Stunden, viel Schimpfen und Fluchen haben wir es endlich geschafft, und Erik wird für all die Mühe entlohnt. In einem kleinen Tal mit zaghafter Vegetation, ein paar Weidenbüschen, vereinzelten Erlen, Espen und Birken, sehen wir gleich mehrere Elche. Erik packt das Jagdfieber. Jagen heißt bei ihm in erster Linie: sich anpirschen, gute Fotos oder Filmaufnahmen machen.
»Ganz vorsichtig, Erik, Elche können ganz schön gefährlich werden«, mahne ich meinen Sohn leise.
Erik wirft mir einen skeptischen Blick zu. »Die sehen aber nicht so aus, Papa.«
Tatsächlich verleitet das Äußere der Elche, ihre großen braunen Kulleraugen, umrahmt von dichten langen Wimpern, die weiche krumme Nase, die meist gemächliche Gangart oder etwa das bedächtige Schaukeln des schweren Kopfes während der Rangkämpfe dazu, diese Tiere, die zur Familie der Hirsche zählen, als harmlos einzustufen.
»Ja, ich weiß, deshalb werden sie ja auch unterschätzt. Dabei werden in Alaska Jahr für Jahr mehr Menschen von Elchen verletzt als von jedem anderen Tier, Grizzly eingeschlossen. Gegen einen rasenden Elch hilft nur die rechtzeitige Flucht.«
»Und was machen sie, wenn sie einen angreifen?«
»In der Regel verpassen sie dir Huftritte. Dazu stellen sie sich auf die Hinterbeine und schlagen mit den Vorderläufen zu. Oder sie setzen ihr Geweih ein. So ein Geweih – nur Bullen haben übrigens eines – kann bis zu 35Kilogramm wiegen.«
»Wow, fast soviel wie ich! Wieviel wiegt denn dann der ganze Bulle?«
»Die Alaska-Elchbullen können bis zu 750Kilogramm auf die Waage bringen, Kühe immerhin noch bis zu 600Kilo. Damit sind die Alaska-Elche die größten ihrer Art. Stell dir vor, die werden fast doppelt so schwer wie Moschusochsen.«
»Echt? Die Moschusochsen sehen aber doch viel wuchtiger aus!« Erik schüttelt ungläubig den Kopf.
»Das liegt an ihren zotteligen langen Haaren. Darunter sind sie eher schmächtig«, erkläre ich flüsternd, denn mittlerweile sind wir fast in Hörweite der Elche.
Wir suchen uns einen jungen Bullen aus und schleichen uns weiter an. Mehr zum Spaß werfe ich Cita ein »Cita, faß!« zu, und die reagiert sofort, schießt auf den Elch zu, gibt Standlaut.
Der taffe Elch – Elche scheinen genau zu wissen, wann Jagdzeit ist, dann verziehen sie sich in den Wald; ansonsten zeigen sie sich überraschend selbstbewußt – mustert sie mit großen Augen, legt die Ohren an … und attackiert den Hund!
Cita bekommt es mit der Angst, dreht sozusagen auf dem Absatz um und sucht Schutz bei ihrem Herrchen. Der Elch hinterher. Ach, du Scheiße!
»Erik, paß auf, stell dich hinter den Baum da!« schreie ich.
Im nächsten Moment spurte ich ebenfalls los, finde keine Deckung, laufe weiter – und falle, gefolgt von Cita, in ein riesiges Schneeloch. Auch der Elch bricht ein, landet aber glücklicherweise nicht wie Cita auf, sondern neben mir. Zu dritt liegen wir nun in dieser Falle. Der Elch strampelt wie verrückt. Fast gerate ich in Panik, denn ich weiß: Ein Schlag gegen den Kopf von so einem gewaltigen Huf, und ich kann tot sein. Zu allem Überfluß vermeldet der Hund ununterbrochen, wau, wau, ich bin ein Schweißhund, was den Elch noch wilder um sich treten läßt.
»Papa, Paaaapa, komm da raus!«
Kurz sehe ich Eriks erschrockenen Blick, während ich darum kämpfe, nicht unter den Elch zu geraten – der würde mich glatt plattdrücken – und mich vor den Hufen zu schützen. Mit einem Satz befreit sich der Elch schließlich aus dem Loch und sucht das Weite.
Erik schaut mich mit großen Augen an, dann bricht er in Gelächter aus, und nach einigen Sekunden falle ich in sein Lachen ein.
»Mensch, Papa«, japst er, »schade, daß das nicht auf Film ist. Das sah richtig komisch aus!«
Behutsam erkläre ich Erik, daß und warum diese Situation, obwohl mich das Tier ja nicht attackiert hat, nicht ganz ungefährlich war. Ein schwieriger Balanceakt, denn ich muß Erik für Gefahren sensibilisieren, will aber nicht, daß er vor lauter Angst, was alles passieren könnte, die Lust an unserem Abenteuer verliert. Generell habe ich mich dazu für »Learning by doing« entschieden, die Art, wie auch ich groß wurde. Mit einer Ausnahme: Noch in Deutschland brachte ich Erik den Umgang mit dem Satellitentelefon bei, mit dem wir nicht nur Kontakt mit zu Hause halten, sondern notfalls auch Hilfe anfordern könnten.
Dieses »Lernen durch Erfahrung« führt allerdings dazu, daß Erik in manchen Situationen überfordert ist oder daß ich ihm zuviel zumute – was ich erst in dem Moment oder gar hinterher merke. Dann mache ich mir natürlich Vorwürfe. Erik sieht das jedoch ganz gelassen. Wenn man ihn auf eine gefährliche Situation anspricht, die wir heil überstanden haben, reagiert er ganz cool. Nicht mit der Coolness, die die Gefahr leugnet, sondern eher mit der Haltung »Shit happens«, also muß man schauen, wie man am besten wieder rauskommt, und wenn man sich nicht ganz dumm anstellt – und einen Papa dabei hat, der seit vielen Jahren in der Wildnis unterwegs ist und entsprechend Erfahrung hat –, gelingt das auch.
Ski ade
Endlich kommen wir in das Yukon-Quellgebiet. Der Yukon hat keine eigentliche Quelle, vielmehr sammelt sich in einem Gebiet, das in etwa 100Quadratkilometer umfaßt, ein verzweigtes Wassersystem zu Flüßchen und schmalen, langgezogenen Seen, wie dem Tagish, Bennett und Marsh, die schließlich den Anfang des Yukon bilden. Der Einfachheit halber bezeichne ich dieses Quellgebiet bereits ab hier als Yukon.
Überraschenderweise sehen wir sehr viele Weißkopfseeadler. Weißkopfseeadler sind nicht ganz so groß wie unsere einheimischen Seeadler, aber größer als die Steinadler, die in den Alpen leben. Eigentlich ziehen sie den Winter über nach Oregon und nach British Columbia an die Küste. Aber in den vielen kleinen Flüssen hier mit warmen Quellen spackeln ein paar Lachse herum – und die sind ein gefundenes Fressen für die Adler.
Es gibt fünf verschiedene Lachsarten in Alaska. Der größte ist der Königslachs, der zweitgrößte der Silberlachs. Außerdem gibt es den sehr kleinen Buckellachs und den Rotlachs, schließlich noch den Hundslachs, der wieder sehr groß werden kann. Hundslachs heißt er deswegen, weil er früher meist nur an Hunde verfüttert wurde. Inuits essen ihn, Indianer hingegen grundsätzlich nicht, für sie gilt er als minderwertig. Dabei schmeckt der Hundslachs wunderbar. Der größte Königslachs, den ich je fing, wog um die 27Kilo. Lachse haben aufgrund des hohen Ölgehalts im Fleisch im Vergleich zu einem Hecht oder einem Karpfen ein sehr hohes spezifisches Gewicht.
Im Yukon River findet, soviel ich weiß, der längste Lachs-Run der Welt statt, zumindest der längste Nordamerikas. Die Lachse ziehen von der Beringsee zum Teil den ganzen Yukon hoch, dann noch durch die Seen Bennett oder Tagish und Marsh, bis sie irgendwo im Quellgebiet ablaichen. Dort kommen sie an wie Zombies. Das muß man sich mal vorstellen: 3000Kilometer gegen den Strom schwimmen. Das ist eine irre Leistung. Außerdem nehmen die Lachse hier keine Nahrung mehr zu sich, sobald sie im Süßwasser sind. Anders als die Atlantiklachse, die wir in Europa haben, im Rhein, in der Sieg oder in der Elbe: Die laichen in einem Fluß ab, dann kehren sie zurück ins Meer, kommen im Jahr darauf wieder, laichen wieder ab und so weiter. Die fünf Pazifiklachsarten können nur einmal laichen und sterben danach. Das ist so eine Art Generationenvertrag. Keiner weiß genau, wie es funktioniert, aber man geht davon aus, daß es über Gerüche läuft, daß die Lachse zum Ablaichen exakt, wirklich exakt an die Stelle zurückkehren, wo sie selbst aus dem Ei geschlüpft sind. Und wenn ihnen 50Meter vorher die Kraft ausgeht, wird halt nicht abgelaicht. Ein Lachs könnte ja auch sagen, ich bin jetzt 2000Kilometer diesen Fluß hochgeschwommen, mir reicht’s, ich gehe jetzt in irgendeinen Nebenfluß rein, lege meine Eier ab, such mir ein Männchen, das seine Milch drübergibt und fertig. Doch ein Lachs gibt nicht eher Ruhe, als bis er an seiner Geburtsstätte angekommen ist.
Im Quellgebiet dümpeln also immer noch ein paar Lachse im Wasser herum, zum Teil fallen ihnen schon die Augen aus, ganze Seiten mit Haut und Fleisch lösen sich ab, aber sie leben noch. Sie haben sich bereits gepaart, und eigentlich sterben sie danach. Das Fleisch, das sich dann im Wasser auflöst, ist die Nahrung für die Fingerlinge, also für die Brut vom Vorjahr. Und daran laben sich die großen Weißkopfseeadler. Einfach spektakulär: Es ist kalt, und zum Teil sind die Adler voller Rauhreif. Wir können ziemlich nah an die Vögel heran, denn sie haben überhaupt keine Scheu. Ebenso erstaunlich ist, daß sie sich wie Geier verhalten. Dazu muß man wissen, daß Adler normalerweise in Paaren leben, und bitte mit ganz viel Distanz zum Nachbarn. Sie beanspruchen ein großes Revier. Und hier sitzen sie einer neben dem anderen oder laufen sogar durch den Schnee, stürzen sich auf die letzten halbfauligen Lachse und streiten sich darum. Das hat so gar nichts Majestätisches mehr.
Doch dann hält es Erik nicht mehr: Er will nun endlich runter von den blöden Skiern, rein ins Kanu, rauf aufs Wasser und paddeln – und hoffentlich ein paar Fische fangen. Cita hingegen würde lieber an Land bleiben, das schmale Schlauchkanu ist ihr nicht geheuer.
Cita kann natürlich nicht wissen, daß sie in einem supertollen Boot sitzt, wohl das beste, was es an aufblasbaren Kanus auf dem Markt gibt. Es stammt von der österreichischen Firma Grabner, die ursprünglich Luftboote für das Militär baute. Die waren so robust und begehrt, daß Grabner bald auch eine zivile Version ins Programm nahm. So ein Boot hat den großen Vorteil, daß man es überallhin mitnehmen kann. Für den Transport gibt es einen Rucksack. Alles in allem, mit Paddel und Sitzbrettern, wiegt das Ganze so um die 30Kilogramm. Das ist nicht viel. Das Problem sind nur die Bären. Sie lieben den Geruch von Gummi. Und Bären gibt es praktisch überall in Nordkanada und Alaska. Ich verlor schon ein Boot wegen eines Bären. Und einmal traf ich in Nordalaska Jäger, die einen Bären nicht rechtzeitig von ihrem Zodiac-Boot vertreiben hatten können; der eine paddelte, der andere pumpte wie verrückt, weil der Gummi total zerbissen war und sie nicht genug Reparaturflicken dabei hatten. Die hatten so ihre liebe Not, trotzdem mußte ich lachen, weil es wirklich lustig aussah.
Es folgen zwei wunderbare Tage. Wir kommen gut voran, finden abends geeignete Plätze für unser Zelt. Am dritten Morgen jedoch sehe ich, daß sich immer mehr Schelfeis auf dem Wasser bildet. Wenn der Yukon nun zufriert, sind wir aufgeschmissen! Große Eisblöcke lösen sich vom Ufer, driften mit uns den Fluß hinunter, und plötzlich stehen wir vor einer großen Eisbarriere.
»Papa?« Erik dreht sich zu mir um und schaut mich fragend an.
»Wir müssen hier raus.«
»Ooooch.«
»Erik, es geht nicht anders. Wir müssen an Land. Und ganz vorsichtig sein, denn die Eisschollen gehen zum Teil drei Meter ins Wasser rein, und du siehst, wie das Wasser hier wallt. Wenn es uns unter das Eis spült, kommen wir nicht mehr raus.«
Ich steuere das Ufer an, und wir klettern aus dem Kanu. Als wir beide und Cita sicheren Boden unter den Füßen haben, überlegen wir, wie es weitergehen soll. Das Ganze abbrechen? Den Hubschrauber rufen, damit er uns rausholt?
»Och, nö, Papa, ich hab doch noch keinen einzigen Fisch gefangen!«
Erik muß mich nicht lange überreden. Der Yukon ist auf diesem Abschnitt von Seen unterbrochen, die noch komplett zugefroren sind, doch es würde, wie ich weiß, immer wieder mal Stellen geben, die aufgrund stärkerer Strömung oder warmer Quellen bereits offen sind. Und irgendwann würde der Fluß dann durchgehend befahrbar sein. So ziehen wir am Ufer den Yukon entlang, nutzen freie Passagen zum Angeln und dazu, das Ein- und Aussteigen auf Eis zu üben. Beim Einsteigen klettert Erik noch auf festem Untergrund ins Kanu. Dann schiebe ich das Boot die letzten Meter über Schnee und Eis, verpasse ihm kurz vor dem offenen Wasser einen kräftigen Schups und springe im letzten Moment hinein. Das gerät nicht selten zu einer Wackelpartie, da sich an vielen Stellen, dummerweise gerade an den vom Ufer aus leicht zugänglichen, durch das Ineinanderschieben von Eisplatten regelrechte Verwerfungen gebildet haben. Beim Aussteigen steht einer von uns – in der Regel der leichtere, also Erik – vorsichtig auf, während der andere das Kanu ausbalanciert. Er stellt ein Bein vorsichtig auf das Eis, belastet es nur ein ganz kleines bißchen, stochert mit dem Paddel und prüft, ob das Eis fest ist. Dann legt er sein ganzes Gewicht auf dieses Bein, um zu sehen, ob das Eis wirklich trägt. Erst dann steigt er aus.
Für Erik ist das alles eine neue Welt. Vor allem ist er kein großer Läufer, und stundenlang auf Skiern durch die Tundra zu spuren oder über gefrorenes Wasser zu laufen, statt darin zu paddeln, ist absolut nicht sein Ding. Aber ich brauche nur zu sagen: Hör mal, wir sind hier auf einem See, ich glaub, hier unten sind dicke Forellen, hack mal ein Loch ins Eis, laß uns mal angeln. Man glaubt gar nicht, wie schnell er die Axt aus dem Kanu zieht und ein Loch kloppt. Angel fertig gemacht und rein – da kann das mieseste Wetter, die mieseste Stimmung sein. Er ist wieder glücklich, selbst wenn er nichts fängt.
»Hey, Erik, sollen wir mal schwimmen gehen?« ulke ich an einer der freien Stellen.
»Was?« Entsetzt schaut er mich an.
»Na ja, ist vielleicht doch ein bißchen zu kalt. Aber wie wäre es mal mit Zähneputzen und Haarewaschen?« ziehe ich ihn weiter auf.
»Meine Haare sind noch sauber!« behauptet er da prompt.
»Das glaubst du doch wohl selbst nicht?«
»Dooooch.«
Da will ich meinem Sohn mal zeigen, was ein Mann ist, und tauche meinen Kopf in das eisige Wasser.
»Ach, du Sch…, ist das kalt!« pruste ich los, als ich wieder Luft bekomme, denn für einen Moment hat mir die Kälte schier den Atem verschlagen.
Erik kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Tja, da muß ich jetzt durch. Ich drücke ein bißchen Shampoo aus der Tube und verteile es auf dem Kopf. Doch noch während ich rubble, bilden sich in meinen Haaren Eisklumpen. Und ich schaue wohl ziemlich belemmert drein. Denn mein Sohn wirft sich neben mir in den Schnee und kann sich nicht mehr halten vor Lachen.
Unsere Körperpflege kommt generell zu kurz und beschränkt sich in der Regel aufs Zähneputzen – sofern wir daran denken, die Zahnpasta mit in den Schlafsack zu nehmen, denn ansonsten ist sie am nächsten Morgen bretthart gefroren. Wer jetzt glaubt, wir würden eine Dunstglocke um uns her tragen, irrt. Zum einen riecht man durch das sehr trockene Klima generell nicht so leicht, zum anderen stinke ich komischerweise selbst dann nicht, wenn ich stark schwitze, und Erik ist noch zu jung zum Müffeln (die Duftstoffe der Schweißdrüsen – Schweiß an sich ist ja geruchsfrei – bilden sich nämlich erst in der Pubertät).
Das Extremste, was ich in der Hinsicht erlebte, war bei der Besteigung des Mount McKinley, des kältesten Berges der Erde. Die Gruppe startete an einem 16.Mai im Basislager und kam am 5.Juni dorthin zurück. In der ganzen Zeit konnte man sich nicht waschen, ganz klar. Und selbst nachdem wir vom Basislager aus nach Talkeetna geflogen worden waren, rannten wir nicht gleich unter die Dusche.
Als ich mit Erik im Golf von Alaska und in der Beringsee unterwegs war, wählten wir oft die harte Tour: Heute scheint die Sonne, Wassertemperatur ist zwar nur fünf Grad, aber wir legen uns jetzt irgendwo in eine Bucht, wärmen uns richtig auf wie Eidechsen in der Sonne, dann beißen wir die Zähne zusammen und springen ins kalte Wasser. Gesagt, getan. Aber jedesmal blieb uns für einen Moment das Herz stehen. Für die »kleine Wäsche zwischendurch« hatten wir Feuchttücher dabei, wie man sie zur Babypflege verwendet. Auch keine schlechte Lösung, doch die Dinger sind halt sehr schwer. Auf dem Tardis war das ja kein Problem.
Dann kommt der Moment, wo wir endlich wieder offenes Wasser vor uns haben. Das Abendlicht ist wunderschön, der Himmel leuchtet und bietet uns ein dramatisches Farbenspiel in Violettönen. Es ist nicht mehr ganz so kalt, und der Fluß fließt relativ schnell, aber nicht als Wildwasser dahin.
»Schau mal, Papa«, deutet Erik auf den Yukon, »da können wir doch morgen wieder paddeln, oder?«
»Ja, sieht ganz danach aus.«
»Puh, wird auch Zeit!«
Die Aussicht, am nächsten Tag endlich wieder »richtig« auf dem Wasser sein zu können und zu genießen, wie die Landschaft an einem vorbeizieht, statt mühsam mit all dem Gepäck durch Schnee zu stapfen, spornt meinen Sohn – und ehrlich gesagt nicht nur ihn – an, und in Nullkommanichts haben wir unser kleines Lager errichtet und sitzen vor gigantischer Kulisse an einem wärmenden, knisternden Lagerfeuer. Und als Belohnung für die Plackerei der letzten Tage gibt es für jeden von uns eine Extraportion Schokolade zum Nachtisch. Herrlich!
Am nächsten Morgen sind wir schon in aller Frühe auf den Beinen. Die Vorfreude auf das Paddeln macht uns ganz kibbelig, und Cita, die unsere Aufregung natürlich spürt, springt hierhin und dorthin, läuft uns ständig zwischen die Beine und bringt einmal vor lauter Übermut Erik zu Fall.
»Mensch, Cita, jetzt mach mal Platz, los, sitz!« ruft Erik und verpaßt ihr einen Klaps. So gern er sonst mit unserem Hund spielt, heute hat er keine Geduld dafür.
Der schlimmste Tag
Schließlich haben wir trotz Citas Sperrfeuer das Lager abgebrochen und unsere Sachen verstaut. Das Ufer, überschneit und zugeweht, ist auch hier noch zugefroren. Da wir nicht wissen, wie dick das Eis ist, schieben wir das Kanu vorsichtig Richtung offenes Wasser, Erik vorn am Bug, ich hinten, so, wie wir es geübt haben. Cita haben wir schon ins Boot gesetzt, weil sie beim Einsteigen nach wie vor Probleme macht – das Kanu ist ihr wahrscheinlich suspekt (kalter Boden, wackelig), sie ist halt kein Wasserhund, ist es auch auf der ganzen Reise nicht geworden.
»Erik, paß auf, nicht daß hier drunter was lose ist.«
Ich sichere gerade das Boot, damit Erik reinklettern kann, da bricht direkt unter uns eine riesige Scholle Eis ab, kippt und wird sofort in die Strömung gezogen. Erik fällt in das eisige Wasser, reagiert zum Glück blitzschnell und klammert sich am Rand des Bootes fest, das langsam hinter ihm herrutscht.
»Papaaaa!«
Mein Sohn hat Angst. Er hängt bis zur Brust in eiskaltem Wasser, die Luft hat minus 20Grad, er wird abgetrieben, und sein Vater ist nicht im Boot!
»Erik, halt dich fest!« schreie ich und schaffe es im letzten Moment, in das Kanu hineinzuspringen. »Halt dich fest, halt dich fest!«
»Papa, Papa!«
Das Boot ist verdammt lang und auch noch vollgeladen. Erik hängt vorn am Bug, und ich bin hinten. Mir bleiben nur wenige Sekunden, bis seine nassen Handschuhe gefrieren und er den Halt verliert – und das Boot hat außen keine Fangleinen, an denen man sich leichter festhalten könnte!
Die Gedanken rasen durch meinen Kopf. Mein Junge säuft ab – ich muß zu ihm – Erik geht unter – verdammter Yukon – Erik!
Zum Glück gerät Cita nicht in Panik. Sie liegt einfach im Boot – an ihrem Stammplatz an der äußersten Spitze im Bug – und hält sich ganz ruhig.
»Brav, Cita, schön Platz«, rufe ich ihr sicherheitshalber zu, denn wenn sie jetzt aufspringt und zu toben anfängt, ist alles verloren.
Während wir mit wahnsinnig hoher Geschwindigkeit den Fluß hinuntertreiben, immer mehr zur Flußmitte hin, krieche ich auf allen vieren in dem Kanu, das wild auf den Wellen tanzt, über all das Gepäck zu Erik vor.
»Nicht loslassen, Erik, halt durch! Ich komme zu dir!« rufe ich ihm immer wieder zu.
Da sehe ich die nächste Packeisbarriere – nur 500Meter vor uns. Ich denke, Scheiße! Wie konnte ich nur so blauäugig sein? Wir werden jämmerlich ersaufen!
Endlich bin ich bei Erik, reiße meine Handschuhe herunter, damit ich ihn besser greifen kann, bekomme ihn mit einer Hand zu fassen, strecke ihm die andere hin.
»Nimm meine Hand.«
Erik ist total schwer. Zum einen ist er ein großer Junge, und zum anderen hat sich seine ganze Kleidung voll Wasser gesogen. Wegen der eisigen Temperaturen hat er natürlich lauter dicke Sachen an, eine Daunenjacke, feste, gefütterte Schuhe, eine dicke Hose und so weiter. Einerseits gut, da in der Kleidung viel Luft ist, die isoliert, so daß die Körpertemperatur erst einmal einigermaßen stabil bleibt, andererseits wiegt das Zeug nun etliche Kilo mehr als normalerweise.
Jetzt bin ich froh, daß das Boot vollbeladen ist – die schweren Sachen unten am Boden, die leichten oben drauf –, dadurch liegt es relativ stabil im Wasser. Trotzdem besteht das Risiko zu kentern, weil ich mein ganzes Gewicht auf die Seite legen muß, an der Erik hängt, um ihn ins Kanu ziehen zu können.
»Pass auf, Erik, wir müssen dich jetzt herausholen.«
Ich versuche mich und das Boot so gut wie möglich auszubalancieren, muß mein Gewicht mehrmals verlagern. Erik sieht die Panik in meinem Gesicht, ich kann nichts dagegen tun, sieht, daß ich plötzlich nicht mehr so cool bin wie sonst immer. In den Augen meines Jungen steht Todesangst. Ich werde dieses Gesicht von Erik nie vergessen.
Ich denke, wenn das Boot jetzt kentert, ist es mit uns beiden aus. Dann schaffen wir es nicht mehr, ans Ufer zu kommen. Und selbst wenn, dann erfrieren wir halt dort. Bei diesen Temperaturen pitschnaß, bleibt dir vielleicht noch eine halbe Stunde, um über dein Leben nachdenken, und das war’s. Da hört der Spaß, das Abenteuer auf.
Erik klebt mir fast an der Bordwand fest, als ich versuche, ihn aus dem Wasser zu ziehen, weil seine nasse Kleidung augenblicklich gefriert.
Und dann habe ich es auf einmal geschafft.
»Erik, bleib einfach nur liegen! Ich suche sofort eine Stelle, an der wir anlanden können«, sage ich zu ihm und streiche ihm über den Kopf. Erik weint, er bibbert vor Kälte. Doch ich kann nicht bei ihm bleiben, muß wieder nach hinten krabbeln und meinen Platz einnehmen. Dabei merke ich, wie auch mir Tränen übers Gesicht laufen.
Wir sind mittlerweile fast direkt vor der Packeisbarriere. Ich kann nicht riskieren, das Kanu vom Heck aus allein da durchzusteuern, dazu fehlt mir ein zweiter Paddler, der uns vorn von Hindernissen abstößt. Statt dessen liegt ein halberfrorenes Kind im Kanu.
»Erik, ich komme da allein nicht durch«, rufe ich nach vorn, »ich beache.« Ein Boot, das in Ufernähe havariert ist und zu sinken droht, »beacht« man, das heißt, man fährt es mit voller Geschwindigkeit auf den Strand – in diesem Fall halt auf das Eis. Ich paddle wie ein Geisteskranker und schramme uns mit Hilfe der Strömung Bug voraus auf festen Grund, springe hinaus und ziehe das Kanu weiter an Land. Erik ist bereits stark unterkühlt, ist nur noch Eis. Feuer, ist mein erster Gedanke, ich finde aber nur ein paar mickrige Weiden und Erlen. Also hole ich Erik erst einmal aus seinen bretthart gefrorenen Klamotten und ziehe ihm trockene Sachen an. Dann grabe ich unterm Schnee nach Treibholz, und sobald ich ein kleines Feuer in Gang habe, das aber nur qualmt und nicht wärmt, rubble und massiere ich meinen Jungen.
»Du mußt dich bewegen, Erik!«
»Ich kann nicht, Papa«, weint er.
Also reibe und knete ich weiter, versuche immer wieder, Erik dazu zu bringen, sich zu bewegen. Doch er hat einfach keine Kraft dazu. Irgendwann, ich weiß nicht, wieviel Zeit vergangen ist – eine Viertel-, eine halbe Stunde? –, hört Erik zu zittern auf. Ich baue das Zelt auf und stecke Erik in seinen Schlafsack. Das beste wäre, ich könnte mit hineinkriechen, um Erik von meiner Körperwärme abgeben zu können, doch dazu sind unsere beiden Schlafsäcke zu klein, und dummerweise sind sie nicht koppelbar. Das ist etwas, so schwöre ich mir, worauf ich in Zukunft unbedingt achten würde. Ich habe fast keine Kraft mehr in Händen und Armen, dennoch massiere ich Erik weiter, rubble und reibe wie von Sinnen. In meinem Kopf hämmert es: Du mußt deinen Sohn retten! Du mußt deinen Sohn retten! Du mußt …
Nie könnte ich es über mich bringen, zu Hause anzurufen! Eher würde ich in den Fluß springen. Mir fallen die Geschichten ein, die ich über Väter und Mütter gehört habe, die ihr totes Kind Tage oder Wochen mit sich herumschleppten, nicht in der Lage, in die nächste Siedlung zu gehen oder Verwandten Bescheid zu geben. Oftmals wurden sie wahnsinnig und brachten sich selbst um.
»Ist genug, Papa, du schrubbst mir ja noch die Haut herunter.« Eriks Stimme reißt mich aus meinen trüben Gedanken. Mechanisch habe ich ihn immer weiter massiert. Nun erscheint ein zaghaftes Grinsen auf seinem Gesicht.
Im nachhinein ist man immer schlauer, sagt sich, hättest du doch eine Aludecke und Wärmepads eingepackt, hättest du doch ein Gewehr mitgenommen und eine Leuchtkugel oder … Das ist ja alles schön und gut und im Ernstfall durchaus hilfreich, bloß, wohin mit all dem Zeug? In einem so kleinen Boot wie dem unsrigen ist der Stauraum limitiert. Natürlich haben wir wasserdicht verpackte Streichhölzer dabei und ein Stück Feueranzünder für den Fall, daß es mal schnell gehen muß. In Survival-Büchern heißt es ja immer, ein Feuer zu machen sei kein Problem. In den meisten Fällen ist es das auch nicht. Aber sei mal in einer Situation, wo es darauf ankommt, in fünf Minuten ein wärmendes Feuer zu haben, und alles, was du findest, ist ein bißchen halbfeuchtes, fast gefrorenes Weidenholz, oder um dich her heult ein Sturm, und es regnet. Versuch dann mal, ein Feuer zu machen, das nicht nur qualmt, sondern wärmt! Keine Chance.
Außerdem bin ich ein Mensch, der sich sagt, wir leben in Deutschland wie in einem Full-size-Airbag, aber in der freien Natur will ich das nicht. Und kann es auch nicht. In der Wildnis kann man sich schlichtweg nicht gegen alles präparieren. Eine ganz große Gefahr ist, daß man sich auf der einen Seite zwar der Tatsache bewußt ist, hier draußen ein ganz kleines Licht zu sein, sich auf der anderen Seite trotzdem nicht ständig sagt, oh, das könnte jetzt aber gefährlich werden, jetzt paß ich lieber mal ein bißchen auf, sondern halt einfach was riskiert. Das ist nun mal so. In 99Prozent der Fälle geht es ja auch gut.
Erik und ich reden noch heute – über ein Jahr später – ganz oft darüber, wenn wir zu Hause im Warmen und Trockenen sitzen: Weißt du noch damals mit dem Kanu? Man, war das kalt und kein Feuer. Was für ein Abenteuer! Bis ich dieses Buch schrieb, war dieser Vorfall ein Geheimnis zwischen uns beiden – nicht einmal Birgit wußte davon.
Obwohl dieses Erlebnis für Erik im ersten Moment ein richtiger Schock war, erholt er sich schnell davon.
»Hör mal, Erik, sollen wir abbrechen und uns ausfliegen lassen?«
»Nö, wieso denn?« Entgeistert schaut er mich an. »Es ist doch alles in Ordnung, mir geht es wieder gut!«
Das ist typisch Erik. Als ich mit ihm in der Beringsee unterwegs war, wurde er gleich zu Beginn seekrank. Er übergab sich ständig, war regelrecht apathisch. Es war so schlimm, daß ich die nächstmögliche Bucht ansteuerte und dort vor Anker ging. Erik hatte nur einen Gedanken: Nichts wie runter vom Boot. Erst Stunden später hatte er sich einigermaßen erholt. Da hätte man meinen mögen, er ginge nie wieder auf ein Segelboot. Doch weit gefehlt. Als ich zu ihm sagte, daß die ersten Lachse reinkämen, war alles vergessen. Sofort rauf auf den Kahn, raus in die Wellen und Lachse geangelt. Thore ist da ganz anders. Ihm stecken zum Beispiel die Negativerlebnisse, deren »Höhepunkt« ich am Anfang des Buches schilderte, noch heute in den Knochen. Als im Jahr darauf die Frage aufkam, ob wir wieder einen solchen Urlaub machen sollen, schüttelte er energisch den Kopf! Er will wieder zu den schönen großen Seen, nachschauen, ob die Hütte, die er sich gebaut hat, noch steht, im Sand wieder kleine Teiche graben und darin baden. Schiffchen bauen und Spaß haben. Das schon, doch mit dem Tardis wieder auf dem Yukon fahren? Nein, davon hat er die Schnauze voll!
Erik ist da schmerzfreier. Er ist so ein Typ, dem könntest du ins Knie schießen, und ein paar Tage später würde er humpelnd da weitermachen, wo er zuvor aufgehört hat. Es muß ihn nur interessieren. Sachen, die ihn nicht interessieren, macht er gar nicht erst.
Für Erik ist das Ganze also relativ schnell überstanden. Spätestens, als wir ein paar Wölfe sehen, die im Schnee herumtappen. Ihm ist wieder warm, das Wetter bleibt stabil, und wir kommen gut voran. Dann beißen auch noch ein paar Fische an, und Erik ist glücklich.
Von Schokolade und Schlafsack, Romantik und Realität
Endlich mal wieder was anderes als Instant-Food! Viel geben die Mini-Forellen zwar nicht her – satt essen können wir uns daran also nicht –, aber wir sind schon zufrieden, mal wieder den Geschmack von was Frischem auf der Zunge zu haben.
Die meisten Menschen denken, daß Abenteurer, die wochenlang durch die Wildnis ziehen, sich nur aus der Natur ernähren. Das können vielleicht so Typen wie Rüdiger Nehberg. Doch man stelle sich vor, ich würde versuchen, Erik, der seine Nudeln gewöhnt ist, mit geraspelter Birkenrinde, vermischt mit kleingehackten Brombeerblättern, abzufüttern. Das würde er einmal vielleicht noch ganz witzig finden, danach aber sagen, hör mal, du mutest mir hier ein bißchen viel zu.
Ich wage auch zu bezweifeln, ob Rüdiger Nehberg sich auf einer Tour, wie Erik und ich sie unternehmen, aus der Natur ernähren könnte. Nicht nur, daß wir für das Paddeln Energie brauchen, unser Körper verheizt zudem jede Menge »Brennstoff«, nur um die Körperwärme aufrechtzuerhalten, schließlich haben wir Tag und Nacht Minustemperaturen. Das kann man nicht mit den spärlichen Pflanzen ausgleichen, die man unter der Schneedecke findet.
Meine Erfahrung lehrt mich, daß man im Norden eine Basis an Nahrungsmitteln dabeihaben muß. Doch was läßt sich am besten transportieren und konservieren? In der kalten Jahreszeit kann man eigentlich alles mitnehmen, was man tragen kann, theoretisch sogar Eier, da sie sowieso die ganze Zeit gefroren wären. Als Energieträger ist Schokolade ganz wichtig, sie enthält eine Menge Fett und Kohlehydrate und macht außerdem gute Laune. Kekse und Müsliriegel eignen sich ebenfalls. Dabei sollte man nicht am Geld sparen, sondern hochwertige Sachen mitnehmen, die gut schmecken und viel Energie liefern. Früher war ich diesbezüglich Purist und dachte, ich hole mir ein paar getrocknete Moosbeeren und lebe davon. Das hält man nicht lange durch. Man hat bald keine Kraft mehr, und auch die Motivation läßt nach. An zweiter Stelle stehen definitiv Nudeln und dehydrierte Fertigprodukte. Vor allem letztere nehmen wenig Platz weg, wiegen fast nichts, und man kann sich daraus ein komplettes Menü zusammenstellen. Will man auf Kaffee nicht verzichten, empfiehlt es sich, Nescafé in dünne Plastikbeutel einzuschweißen. Ich selbst kann zur Not vier Wochen von Zwieback und Vitamintabletten leben und sag hinterher, das war eine super Diät. Mit Erik würde ich das nie machen.
Erik und ich haben folglich jede Menge Schokolade dabei (nicht, daß der halbe Packschlitten mit Snickers, Mars und Bounty bepackt wäre – aber fast) und ganz viele Nudeln, Teebeutel und Instanteistee. Tee ist ideal, weil man ihn heiß und kalt trinken kann. Und Instanteistee mögen halt besonders Kinder gern. Natürlich könnten wir uns wie Rüdiger Nehberg einen Fichtennadeltee brauen, doch wir wollen ja nicht einfach nur überleben, sondern auch Spaß und gute Laune haben.
Ganz wichtig, wenn man im Winter in solchen Gegenden »outdoor« unterwegs ist, ist Fett – egal in welcher Form, ob als Margarine, Butter oder Käse. Nimmt man zuwenig Fett zu sich, fängt man an zu frieren und stirbt möglicherweise an Unterkühlung.
Nicht zu unterschätzen sind die Vorteile eines kleinen Spezialkochers, der Diesel, Benzin, Brennspiritus, Mischungen aus all dem oder white gas (gereinigtes Benzin), also fast alles schluckt. Natürlich ist es schön, abends an einem Lagerfeuer zu sitzen, aber wenn man nach einem anstrengenden Tag so richtig k.o. ist, will man nicht erst noch in den Wald marschieren und Feuerholz sammeln. Solche Situationen haben Erik und ich oft. Da wollen wir nur noch ganz schnell heißes Wasser haben, ein paar Nudeln reinschütten – möglichst amerikanische, die nur warm werden müssen und schon quellen –, ein bißchen was Warmes in den Bauch und dann ab in den Schlafsack. Wenn wir die Muße dazu haben, machen wir uns natürlich ein Lagerfeuer. Wie jedes Kind kokelt Erik gern. Also bin ich fürs Holzsammeln zuständig und Erik fürs Feuermachen.
Ebenfalls wichtig in der Wildnis sind ein warmer Schlafsack und eine gute Isomatte. Unsere Schlafsäcke haben einen Komfortbereich bis minus 30, einen Überlebensbereich bis minus 38Grad – laut Hersteller. Also den möchte ich mal sehen, der in dem Ding bei minus 38 überlebt. Denn in dem Moment, wo sich unter dir die Daunen zusammendrücken, entsteht sofort eine Kältebrücke. Wer schon mal bei minus 30 draußen geschlafen hat, weiß, was ich meine. Man muß sich selbst im besten Schlafsack alle zehn Minuten drehen – zum Glück macht man das irgendwann automatisch, im wahrsten Sinn des Wortes »im Schlaf« –, um von allen Seiten warm zu bleiben, weil erst der Hintern kalt ist, dann wieder der Bauch und so weiter.
Erik hat gleich zwei Isomatten dabei, eine aus Schaumstoff und eine richtig gute Thermarest. Das hilft. Außerdem haben wir ein ultramodernes Zelt, in dem, wenn man es einigermaßen windgeschützt aufstellt, die Temperatur deutlich höher ist als draußen.
Ende der Leseprobe