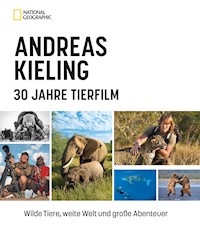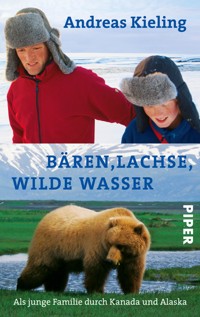12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Andreas Kieling bereiste die ganze Welt und kam exotischen Tieren so nahe wie sonst niemand. Die überraschendste Entdeckungstour aber wurde für ihn seine Deutschlandwanderung: mit seiner treuen Hündin Cleo entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Vom Dreiländereck bis an die Ostsee, 1400 Kilometer, acht Bundesländer in sieben Wochen. Er fand die Wildnis mitten in Deutschland und entdeckte unsere Heimat ganz neu: Flussperlmuscheln in der bayrischen Regnitz, Mufflons im Thüringer Wald, Luchse im Harz. Urwald und wilde Orchideen im Hainich, Wanderfalken im Eichsfeld und vom Aussterben bedrohte Birkhähne in Hessen. Nandus in Mecklenburg und seltene Seeadler auf dem Schaalsee …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Cleo, meine treue Begleiterin,
meinen Mentor Karl Lapacek und Christoph Keller
Mit 64 Fotos und mit einer Karte
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
8. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95284-2
© Piper Verlag GmbH, München 2011
Text: Andreas Kieling mit Sabine Wünsch
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Umschlagmotiv: Ralf Blasius
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Vor dem ersten Schritt
Das Dreiländereck von Böhmen (Tschechien), Bayern und Sachsen hatte ich mir ganz anders vorgestellt, irgendwie exotischer. Das lag vermutlich daran, dass ich gerade erst von einem Dreh aus dem Yellowstone-Nationalpark zurückgekehrt war, einer Region, die einen staunen lässt.
Der Nationalpark inmitten der gewaltigen Rocky Mountains liegt zum größten Teil in der Caldera des Yellowstone-Vulkans, des größten Supervulkans auf dem amerikanischen Kontinent. Es zischt und brodelt und dampft aus unzähligen Geysiren – darunter »Steamboat«, der größte aktive Geysir der Erde –, Schlammtöpfen und heißen Quellen; mittendrin riesige Herden von Steppenbisons, dazu Wölfe, Bären, Wapitis – ein wahres Naturwunder, vor allem im Winter, wenn der Kontrast zwischen Kälte, Eis und Schnee einerseits und den heißen Auswürfen unseres Planeten andererseits dem Ganzen einen ganz eigenwilligen Reiz verleiht.
Als damals der Anruf vom ZDF kam und der Redakteur fragte, ob ich nicht Lust hätte, was über die deutsch-deutsche Grenze zu machen, da Deutschland wegen des 20. Jahrestags des Mauerfalls im Trend liege, habe ich ganz spontan zugesagt, weil mir die Idee sehr gefiel. Obwohl ich genug Arbeit hatte: Die »Expeditionen zu den Letzten ihrer Art« – eine ZDF-/National-Geographic-Reihe über bedrohte Tierarten – gingen weiter, und parallel war ein Buch [1] zur ersten Staffel in Arbeit.
»Tja, also, was ich noch nicht gesagt habe: Du sollst die 1400 Kilometer dieser Grenze wandern«, schob der Redakteur nach.
Wo soll ich denn da anfangen?, schoss es mir in den Kopf. Etwa irgendwo im tiefsten Polen oder Tschechien? Mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht klar gewesen, dass die innerdeutsche Grenze so lang gewesen war, immerhin die Entfernung von Nürnberg nach Barcelona oder von Bremen nach Florenz. Das hat mich erstaunt, denn wir sind ja ein recht kleines Land.
Aufhänger war also das Jubiläum der Wiedervereinigung; doch die Wanderung führte zudem durch das größte Naturschutzgebiet Deutschlands. Deutschlands größtes Naturschutzgebiet?, staunte ich. Das hatte ich bis dahin in den Nationalparks Bayerischer Wald oder Wattenmeer vermutet, doch nicht an der deutsch-deutschen Grenze. In der Tat ist das sogenannte Grüne Band mit nur ein- bis zweihundert Metern Breite, dafür aber fast eineinhalbtausend Kilometern Länge unser größtes Naturschutzgebiet. Das Erstaunliche ist jedoch nicht so sehr seine Größe beziehungsweise Länge, sondern dass es mitten durch »wildestes Deutschland« geht, wie man es sonst nur vom Bayerischen Wald und einigen Hochgebirgsregionen kennt. Vierzig Jahre »Zonenrandgebiet«, wie es im Westen hieß, beziehungsweise »Sperrgebiet« – der DDR-Ausdruck – hatten diesem Landstrich sozusagen einen politischen Umweltschutz beschert. Es gab nur wenige große Städte mit noch weniger Schwerindustrie, und die Forst- und Landwirtschaft wurde in der Regel sehr extensiv betrieben, also mit hohem Verbrauch an Fläche, aber geringem Eingriff in die Natur. Das heißt wenig Herbizide, Fungizide, Insektizide, kaum Düngemittel. Dadurch blieb eine Tier- und Pflanzenwelt erhalten, die in anderen Gebieten Deutschlands durch die Jahrzehnte, in denen wir in unserem Land Raubbau betrieben haben, komplett verschwunden ist.
Klare Vorstellungen, wie das Ganze aussehen sollte, hatte der Sender nicht, nur, dass es eine bunte Mischung werden solle aus Natur, Kultur, Historie und Politik, wobei die Natur ganz klar im Fokus stehen solle, und dass man die Zuschauer ein bisschen verblüffen wolle, indem man zeige, wie »wild« Deutschland noch sein könne. Nun lag mein Schwerpunkt als Tierfilmer in den letzten Jahren zwar nicht gerade in Deutschland, aber ich habe hier lange als Förster gearbeitet und auch einige Tiergeschichten gedreht, sodass mir klar war, wie schwierig es werden würde, in einem der letzten Rückzugsgebiete inmitten dieses ansonsten dicht besiedelten Landes seltene, scheue Tierarten vor die Kamera zu bekommen – oder auch einfach nur vors Fernglas, um sie beobachten zu können.
Der Knackpunkt, der das Ganze fast platzen ließ, war jedoch ein ganz anderer, nämlich Cleo, die ich unbedingt dabeihaben wollte.
»Was? Ein Hund?«, fragte meine Chefin beim ZDF irritiert, fast schon entsetzt. »Der sorgt doch nur für Verwirrung. Der bellt die ganze Zeit, stört die Tonaufnahmen und verscheucht die Tiere!«
»Ich mach’s aber nur, wenn Cleo mit darf«, beharrte ich.
Nach einigem Hin und Her meinte sie dann: »Gut, aber sie bekommt keine Gage – und das Futter müssen Sie selbst bezahlen.«
Als ich mir die Wegstrecke dann auf der Karte ansah, dachte ich, hoppla, das sollst du wandern, mit Rucksack samt Zelt und Schlafsack (für die Nächte weitab jeglicher Pension) auf dem Rücken und der Kamera auf der Schulter? Ganz schön weit. Und dann noch das enge Zeitfenster. Für jede der fünf Folgen waren nur neun bis zehn Drehtage geplant. Und das, obwohl die Teile auch im sehr anspruchsvollen Abendprogramm von ARTE gezeigt werden sollten, das hochwertige Unterhaltung und Information bietet. Es ging ja nicht nur darum, die 1400 Kilometer zurückzulegen, das Ganze musste ja auch irgendwie filmisch umgesetzt werden. Da hieß es ordentlich Gas geben.
Um den Bogen zu schließen: Kurz nach meiner Rückkehr aus dem Yellowstone-Nationalpark standen Cleo und ich nun im deutschen nasskalten Frühjahr in einem kleinen Sumpfloch in der Nähe von Hof vor einem Schild mit der Aufschrift »Staatsgrenze«. Hier sollte also der Startpunkt für das »Abenteuer Deutschland« sein.
»Wie machen wir das bloß groß auf?«, fragte ich mich immer wieder, während ich mit der Kamera etwas hilflos herumlief.
Neben uns plätscherte ein piefiges Bächlein dahin, es regnete, und es war verdammt kalt. Cleo neben mir zitterte, nicht nur vor Aufregung. Wir waren gar nicht begeistert. Und in dem Moment nicht sehr motiviert.
Schließlich sprach ich einen Aufmachertext in die Kamera: »Es geht in die wildesten Gebiete Deutschlands. Ich lade Sie ein! Kommen Sie mit, Sie werden wunderbare Dinge erleben, Sie werden berührt sein! Cleo wird meine ständige Begleiterin sein, ich bin selbst gespannt, wann wir an der Ostsee ankommen und was uns erwartet …« Da stand ich also und redete von irgendetwas Großem, aber das Große war nicht erkennbar.
Ich habe diese Wanderung für mich selbst ein bisschen als Abenteuer verstanden. Das mag kitschig klingen, aber dieses »Dein treuer Hund, dein Wanderstock (den ich nicht hatte), dein Hut und du auf der Wanderung durch die Heimat« hatte für mich etwas Romantisches. Apropos Hut. Als wir dem ZDF die ersten Aufnahmen zukommen ließen, hieß es, dass sie mich lieber nicht mit Hut wandern hätten, das sehe zu sehr nach Landstreicher aus und passe nicht zum ZDF.
Erst einmal musste ich furchtbar lachen, als ich das hörte, dann sagte ich: »Hört mal Leute, es regnet. Es regnet kleine Hunde und Katzen. Cleo und ich sind tropfnass. Ich lasse diesen Hut auf.«
Ich fand überhaupt nicht, dass ich damit aussah wie ein Penner, ich fand sogar, es sah ganz gut aus. Immerhin lief ich nicht mit irgendeinem, sondern mit dem klassischen Indiana-Jones-Hut herum – und wenn der nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Außerdem hatte es mich dank Hutgröße 62 – nur weil ich breite Schultern habe, sieht es nicht aus, als hätte ich einen Wasserkopf – einige Mühen und Geld gekostet, ein passendes Exemplar zu finden. Und das wollte ich nun auch tragen! Das Ende vom Lied war, dass auf einmal alle mit Hut gut fanden und ich sogar in dem Opener (aus einigen Filmszenen zusammengesetzter Clip), der für die fünf Teile geschnitten wurde und als sogenannter Appetizer die Zuschauer zum Weitersehen verlocken soll, mit Hut zu sehen bin.
Endlich wanderten Cleo und ich los. Die Marschrichtung war ja vorgegeben: entlang dem Grünen Band, im Prinzip auf dem alten Kolonnenweg, der für die Patrouillen- und Versorgungsfahrzeuge der Grenzposten angelegt worden war. Die Betonplatten des Kolonnenwegs mit ihren Aussparungen, aus denen Gras wächst, sind nicht gerade der ideale Wanderweg. Wie ich es schon von anderen Wanderern gehört und gelesen habe, fällt es auch mir schwer, den richtigen Tritt zu finden.
»Du hast es gut«, sagte ich nach den ersten Kilometern zu Cleo, doch die schaute mich nur verständnislos an. Ihr machte der Kolonnenweg verständlicherweise keine Schwierigkeiten, denn sie lief rechts oder links davon in den angrenzenden Feldern oder Wiesen, die für sie ja auch viel interessanter waren, schnüffelte mal ein bisschen an einem Bachlauf herum, in dem ein paar Wasserspitzmäuse und kleine Forellen schwammen.
Die Gewässer in diesem Gebiet sind kristallklar und naturbelassen, so wie, ich habe es bereits erwähnt, aufgrund der jüngeren Geschichte die ganze Natur da für mitteleuropäische Verhältnisse sehr unverfälscht ist. Es passierte nicht viel, aber das wenige nahm ich dankbar wahr und an. Oft fragen mich Leute, wie ich es eigentlich in Deutschland aushalte, da ich doch die große weite Welt kenne, exotische Länder, die Traumziele vieler Menschen. Ich sage dann immer, dass ich das sehr genau differenzieren und mich an der Beobachtung eines Feldhasen, am Jagdflug eines Turmfalken oder der Entdeckung eines Feuersalamanders in Deutschland genauso erfreuen kann.
Der Flussperlmuschelsucher
Ein paar Kilometer bachabwärts, an einer sumpfigen Wiese, sahen wir in einiger Entfernung einen älteren Mann mit Wattstiefeln im Bach knien und vornübergebeugt in eine kleine blaue Plastikwanne gucken. Mein erster Gedanke war: Goldwäscher. Mein zweiter: Der sammelt Unrat. Nein, das konnte es nicht sein, denn er hielt das Ding mit beiden Händen fest. Cleo knurrte erst einmal, als sie ihn sah, denn das sah schon etwas seltsam aus. Warum starrt der die ganze Zeit in diese Spülschüssel?, fragte ich mich. Was gibt es da so Spannendes zu sehen? Schließlich trieb mich meine Neugier zu dem Mann. Um ihn nicht zu erschrecken, rief ich aus einigem Abstand »Hallo«, aber er war so vertieft in sein Tun, dass er mich nicht hörte. Später sollte ich feststellen, dass der Mann sich seiner Sache derart verschrieben hat, dass er stundenlang in gebückter Haltung in eiskaltem Wasser stehen oder knien kann und die Welt um ihn herum völlig ausblendet. Nach zwei weiteren »Hallo!« schaute er endlich auf, ganz entspannt, als ob hier ständig Wanderer vorbeikämen.
»Was machen Sie denn da mit Ihrer Schüssel im Bach?«, fragte ich.
»Ich bin staatlicher Flussperlmuschelsucher vom Wasserwirtschaftsamt Hof«, antwortete der Mann mit der silberumrahmten Brille ernst.
Ich staunte nicht schlecht. In Indonesien hatte ich mal Perlenfischer kennengelernt, aber dass es Flussperlmuschelsucher in Deutschland gibt, war mir neu. Das Arbeitsgerät entpuppte sich als Eigenbau: In den Boden einer herkömmlichen Spülschüssel, wie es sie in jedem Haushaltswarengeschäft oder Kaufhaus zu kaufen gibt, war eine Glasplatte eingesetzt, die es dem Mann erlaubte, den Grund des Flusses abzusuchen, ohne seinen Kopf in das kalte Wasser stecken zu müssen. Wenn er die Schüssel nämlich auf die Wasseroberfläche drückte, brach das die Oberflächenspannung und man hatte ein klares, sauberes Bild vom Gewässerboden.
»Und, haben Sie schon mal eine Perle gefunden?«
»Eine einzige in dreißig Jahren«, schmunzelte Stephan Schmidt, wie er sich mittlerweile vorgestellt hatte, und fuhr dann fort: »Früher war Flussperlmuschelsucher in Bayern ein sehr ehrenwerter Beruf, der von Generation zu Generation vererbt wurde. Eine Vertrauenssache, denn die Flussperlmuschelsammler hätten sich die Perlen ja auch in die eigene Tasche stecken können. Damals gab es ein spezielles Gerät, ein Flussperlmuschelmesser, mit dem man die Muschel ganz vorsichtig öffnete. War eine Perle drin, wurde die Muschel getötet. Ansonsten wurde sie in den Fluss zurückgesetzt, in der Hoffnung, dass sie irgendwann einmal eine Perle bildet.«
Das Wassereinzugsgebiet der Regnitz beherbergt eines der größten – und auch eines der letzten – Flussperlmuschelvorkommen Mitteleuropas.
»Abwässer, Düngemittel und sonstige Schadstoffe haben den Bestand stark gefährdet«, erklärte mir Herr Schmidt, »denn die Flussperlmuschel braucht kalk- und nährstoffarmes Wasser. Sie ist daher ein sogenannter Kulturflüchter. Doch wohin soll man schon fliehen, wenn man weder Flossen noch Beine hat? Wo es früher in einem einzigen Flüsschen mehrere Millionen dieser sehr sensiblen Tiere gab, sind es heute in ganz Bayern nur noch geschätzte 100000 bis 130000.«
Und um deren Schutz, nicht um Perlen, geht es dem Biologen und Naturschützer. Er katalogisiert die Flussperlmuscheln und beobachtet, wie viele sterben.
»Hier liegen aber erstaunlich viele Muschelschalen«, wunderte ich mich und deutete auf den Bachgrund.
»Die sind aber sehr alt«, winkte Schmidt ab.
»Wie alt kann denn eine Flussperlmuschel werden?«
Flussperlmuscheln, so erfuhr ich, können nach neuesten Erkenntnissen bis zu 280 Jahre alt werden, zum Beispiel in Schweden. Interessant ist nämlich, dass Größe und Alter nach Norden hin zunehmen. In Spanien etwa wird die Muschel meist nur acht bis zehn Zentimeter groß und lediglich sechzig bis siebzig Jahre alt.
Als ob die hohen Ansprüche an die Wasserqualität und die, nennen wir sie mal, begrenzten Fluchtmöglichkeiten das Überleben dieser selten gewordenen Tierart nicht schon genug gefährden würden, ist ihre Fortpflanzung beziehungsweise Vermehrung ein sehr komplexer und störanfälliger Prozess: Zunächst schlüpfen winzige Frühformen der Muschel, die die nächsten zehn Monate parasitisch im Kiemenbereich der Bachforelle leben und dort zu einen halben Millimeter großen Jungmuscheln heranwachsen. Das heißt: ohne Bachforelle keine Flussperlmuschel, egal wie gut die sonstigen Lebensbedingungen sind. Wenn die Temperatur und das Bachbett stimmig sind, lassen sich die Muscheln auf den Gewässergrund fallen und graben sich dort ein. Erst nach etwa sieben Jahren, wenn sie ausgewachsen sind und eine harte Schale ausgebildet haben, kommen sie an die Oberfläche des Gewässergrunds.
Vorsichtig löste Stephan Schmidt eines der Tiere aus dem Boden und zog es aus dem Wasser. Sofort schloss es seine Schale und spritzte dabei in kleinem Bogen das überschüssige Wasser heraus. Die dunklen, fast schwarzen Muscheln sind in Deutschland etwa acht bis elf Zentimeter groß, sehen nicht sehr spektakulär aus, wie eine große Teichmuschel. Als ich Cleo die Muschel zum Schnuppern hinhielt, schnappte sie gleich danach. Für sie roch das lecker fischig, und da Cleo ein Hund ist, der alles probieren mag und sogar Grapefruit frisst, war die Verlockung natürlich groß. Herr Schmidt riss entsetzt die Augen auf, doch zum Glück war ich schneller als Cleo. Behutsam setzte der Flussperlmuschelsucher das wertvolle Exemplar in den Bach zurück, wo es sich von ganz allein wieder in den Sand einbuddelte.
Gebirgsbäche, egal ob im Mittel- oder Hochgebirge, sind kleine, in sich geschlossene, höchst sensible Ökosysteme mit einer ebenso empfindlichen Fauna und Flora, die sich über Jahrhunderte entwickelt und auf ihre Umgebung abgestimmt haben, auf das Klima, den pH-Wert des Wassers, sei es nun, bedingt durch die Böden in der Umgebung, eisen- oder kalkhaltig, sauer oder basisch. Während ein Dorfteich oder ein großer Fluss einiges an Verschmutzung vertragen kann, stößt ein Gebirgsbach schnell an die Grenzen seiner Regenerationsfähigkeit. Das Düngen der umliegenden Wiesen, das unachtsame Verschütten einer Flasche Spülmittel oder Altöl kann bereits das Ende des Ökosystems bedeuten, denn Bachneunauge (ein Süßwasseraal), bestimmte Arten von Mühlkoppen oder der europäische Flusskrebs, um nur einige Beispiele zu nennen, brauchen sehr, sehr sauberes Wasser. Andere Tierarten sind da weniger wählerisch. Das Wasser stinkt, ist von Abwässern aus Häusern und Gehöften verseucht, und trotzdem findet man darin Blutegel, Bachflohkrebse oder verschiedene kleine Muscheln.
Entsprechend unterteilt man Flüsse in verschiedene Abschnitte. Am Oberlauf eines Fließgewässers ist die artenarme sogenannte Forellenregion mit starker Strömung und kaltem Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt. Dann folgt die Äschenregion mit ebenfalls klarem, kühlen Wasser mit viel Sauerstoff, aber mit mehr Pflanzen. Wird der Fluss breiter und die Strömung schwächer, tummeln sich Barben, Brachsen und Döbel. Die Kaulbarsch-Flunder-Region schließlich findet man in den Unterläufen großer Ströme; sie zählt bereits zum Brackwasserbereich.
Das Phantom der Wälder
Auf der Wanderung lief Cleo meist frei bei Fuß, weil sie sehr gut folgt. Wenn sie eine Fährte entdeckte oder eine Witterung wahrnahm, merkte ich das an ihrem Verhalten und konnte entsprechend reagieren. »Halt! Lass zeigen!«, rief ich dann, ein Kommando, bei dem sie stehen blieb, oft einen Lauf ein bisschen anhob und ihre Nase in die Richtung streckte, in der sie etwas gerochen hatte. Meistens hatte sie dann die Spur eines Marders, eines Fuchses oder eines Wildschweins ausgemacht. Und erst wenn ich sagte: »Such voran!«, verfolgte sie die Fährte.
An einem Tag jedoch zischte Cleo ohne Vorwarnung los, und bevor ich noch den Mund aufbrachte, steckte Cleo ihre Schnauze bereits in einen großen Haufen toten Holzes. Mir war klar, dass sich darunter der Bau eines Raubtiers befinden musste. Ich sah Teile einer Fährte auf Felsplatten, konnte sie aber zunächst nicht genau deuten. Dafür fand ich daneben, im Matsch – es regnete ja seit Tagen – Katzenspuren. Von einer Wildkatze? Ich wollte es zunächst gar nicht glauben.
Die Europäische Wildkatze – einer der großen Beutegreifer Deutschlands, obwohl von der Größe her natürlich nicht mit dem Wolf und dem Luchs gleichzusetzen – ist nicht nur selten, sondern auch derart scheu und hat einen so extrem ausgeprägten Gehör- und Sehsinn, dass sie die Flucht ergreift, lange bevor man nur den Hauch einer Chance hat, sie wahrzunehmen. In der Eifel, einem der wenigen Gebiete, in denen es Wildkatzen gibt – der Nationalpark Eifel ist sogar ein Wildkatzenschutzgebiet –, habe ich in all den Jahren, die ich nun schon dort lebe, kaum je eine gesehen. Um mir in meinen ersten Jahren als Förster und Jäger dort einen zumindest annähernden Überblick über den Bestand der Wildkatze in meinem Revier zu verschaffen, konnte ich nur eines tun: Nachts mit dem Geländewagen durch die Bergtäler fahren, mit einem starken Suchscheinwerfer die Hänge und Felskanten ableuchten und hoffen, dass ich die Reflexion von Katzenaugen sah. Eine zugegebenermaßen recht unzuverlässige und fehleranfällige Methode. Fotofallen, eine andere Möglichkeit, standen mir damals nicht zur Verfügung.
Wenn also ein Wanderer oder Spaziergänger glaubt, auf einer Wiese oder einer Waldlichtung eine Wildkatze zu sehen, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine streunende oder verwilderte Hauskatze, die nur eine ähnliche Färbung hat: eine kontrastarme graubraune Tigerung und drei bis vier dunkle Kringel am schwarz und stumpf endenden Schwanz. Ein äußerlich erkennbares Unterscheidungsmerkmal ist – zumindest in der Theorie – der bei Wildkatzen buschigere Schwanz. In der Theorie deshalb, da bei kampfbereiten Hauskatzen durch das Aufstellen der Schwanzhaare der Schwanz optisch leicht drei- bis vierfach so dick wirken kann, wie er eigentlich ist. Die beiden anderen körperlichen Unterschiede – ein kürzerer Darm und ein größeres Hirnvolumen – lassen sich nur am toten Tier feststellen. Die Hauskatze stammt im Übrigen nicht von der Europäischen Wildkatze ab, sondern von der Falb- beziehungsweise Afrikanischen Wildkatze.
Verantwortlich für das seltene Vorkommen von Wildkatzen – es besteht ganzjährige Schonzeit in Deutschland – ist wie in so vielen Fällen der Mensch. Noch 1931 hieß es in einem Jagdbuch: »Es wird keinen Jäger geben, der … ruhen und rasten würde, bevor es ihm gelungen ist, sein Revier und sein Wild von diesem unheilvollen Gaste befreit zu haben.« Wildkatzen wurden bis in die 1950er-Jahre als vermeintliche Schädlinge geschossen oder gerieten in für Pelztiere aufgestellte Schlagfallen. Ein anderer Grund ist der Verlust von Lebensraum. Die Wildkatze ist, wie etwa der Luchs, der Schwarzstorch oder der Baummarder, ein klassischer Kulturflüchter, der sich in dem Versuch, den Menschen zu meiden, in entlegene Regionen zurückzieht; im Unterschied zum Kulturfolger, der aus verschiedenen Gründen – viel Nahrung, kein Feinddruck, generalistische Lebensweise – die Nachbarschaft zum Menschen attraktiv findet und sogar sucht.
Menschenleere oder zumindest menschenarme Gebiete sind in Deutschland allerdings höchst selten. Hinzu kommt ein weiterer entscheidender Faktor: In den 60er- und 70er-Jahren, als man nicht gerade zimperlich mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Pestiziden umging, potenzierten sich diese Gifte in den Tieren, die am Ende einer Nahrungskette stehen. Da wurde zum Beispiel Gift in den Wald gespritzt, um einer Borkenkäferplage Herr zu werden. Daraufhin fielen die Borkenkäfer und außerdem alle Maikäfer, Hirschkäfer oder Junikäfer von den Bäumen, Falter verendeten. Insektenfressende Vögel wie etwa Spechte, die sich über dieses Festmahl hermachten, wurden irgendwann von kleinen Beutegreifern gefressen, und diese wiederum landeten in den Mägen von Fuchs, Dachs, Wildkatze, Marder, Falke, Habicht oder Uhu. Und von Glied zu Glied dieser Nahrungskette sammelte sich mehr Gift im Fettgewebe, in den Nieren, in der Leber an. Einigen Tieren, wie beispielsweise dem Fuchs und dem Dachs, konnten diese Gifte verhältnismäßig wenig anhaben, anderen hingegen setzten sie massiv zu. Sie legten Eier ohne Schalen oder sterile Eier, brachten verkrüppelte oder schwache Junge zur Welt. Dies in Verbindung mit der Verschmutzung der Gewässer brachte viele Tiere an den Rand des Aussterbens. Damals spielte sich in Deutschland ab, was heute in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern wie etwa Indonesien oder China zu beobachten ist: In ihrem Bestreben nach Wohlstand betrieben die Menschen einen gnadenlosen und unüberlegten Umgang mit und einen brachialen Raubbau an der Natur. Das klassische Beispiel ist die Abholzung von Urwäldern, um Platz für Plantagen oder Wirtschaftswald zu schaffen. Ökonomisch betrachtet sehr einträglich, ökologisch gesehen eine Katastrophe.
Die größten Vorkommen von Wildkatzen in Deutschland gibt es in den Mittelgebirgen, etwa wie schon erwähnt in der Eifel, darüber hinaus im Hunsrück, dem Thüringer und Bayerischen Wald oder dem Hainich. Kleinere Bestände finden sich in Gegenden, in denen der Mensch durch Forst- und Landwirtschaft eigentlich recht präsent ist. Aus dem einfachen Grund, dass es da viele kleine Nagetiere gibt und die Hauptnahrung der Wildkatze Mäuse sind – nicht Rehkitze und Hirschkälber, wie man früher glaubte.
Hier aber, im tschechisch-deutschen Grenzgebiet, ist die Welt noch in Ordnung. Hier, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, ist auch Platz für die Europäische Wildkatze.
Ich schaute mich genauer um. Überall kleine Fußabdrücke, geknickte Zweige, platt gedrücktes Gras. Der Bau war also »bespielt«. Tierbaue sind meistens so angelegt, dass der Ausgang – bei Bauen mit mehreren Ausgängen zumindest einer – im Sonnenbereich liegt. Ab Ende April, Anfang, Mitte Mai zieht es den Nachwuchs, ob nun Katze, Fuchs oder Wolf, hinaus, dann wollen die Kleinen nicht mehr nur im Dunklen sitzen, wo es feucht ist und kühl, sondern in der Sonne spielen und die nähere Umgebung erkunden. Na ja, feucht und kühl war es dieser Tage auch draußen, aber zumindest heller. In der Jägersprache heißt es dann, der Bau ist »bespielt«. Das Muttertier bringt ab diesem Zeitpunkt lebende Beutetiere, die sie vor dem Bau freilässt, damit die Kleinen sich in der Jagd üben können. Eine Phase, die für die Jungen extrem prägend ist.
Die Kätzin würde sich mit Sicherheit nicht zeigen und auch ihren Nachwuchs nicht ins Freie lassen, solange Cleo und ich in der Nähe waren. Aber, so hoffte ich, vielleicht war das Muttertier ja auf der Jagd. Dann bestünde die Chance, dass die Kätzchen aus dem Bau gekrochen kamen, weil Jungtiere immer ein bisschen unbedarft sind. Sie haben natürlich einen Instinkt, ein Feindverhalten, und verschwinden – brrrp! – im Bau, sobald sich ein Mensch oder Tier nähert. Wenn man sich dann ruhig verhält – ich habe das schon ein paar Mal bei Füchsen erlebt –, denken die Kleinen: Der ist jetzt weg, und nach einer Viertelstunde streckt das erste seine Nase heraus, dann das zweite und das dritte, und nach zwanzig Minuten tollt die ganze Bande wieder draußen herum.
Da Cleo ihre Witterung am Bau hinterlassen hatte, was für Wildkatzen höchste Alarmstufe bedeutet, mussten wir uns in gebührender Entfernung auf die Lauer legen. Ich fand einen etwas erhöhten Felsen knapp hundert Meter weit weg, von wo aus ich – zumindest mit dem Fernglas – einen guten Blick auf den Wildkatzenbau hatte. An diesem Tag war mir das Glück wirklich hold, denn nach einigen Minuten spitzte die Sonne durch die Wolken und lockte ein Kätzchen nach dem anderen ins Freie. Bald übten sich vier tapsige, tollpatschige Wollknäuel in spielerischen Kämpfen, kugelten durcheinander, jagten im Kreis ihrem eigenen Schwanz nach, versuchten an Zweigen ihre ersten Kletterversuche. Die ganz Mutigen entfernten sich bis zu drei Meter vom Bau, merkten dann plötzlich: Hoppla, wo bin ich? Ich bin ja ganz weit weg!, und rannten in Windeseile zurück. Es war ein Spaß, ihnen zuzuschauen, und ich genoss jede Minute.
Cleo lag während all der Zeit brav neben mir. Sie hat ein festes Wesen und einen ruhigen Charakter und ist ja auch ein wohlerzogener und gehorsamer Hund. Wenn ich zum Beispiel »Platz!« oder »Ablegen!« und danach »Bleib!« sage, dann bleibt sie an der Stelle. Selbst wenn ich weggehe. Weil sie weiß: Herrchen kommt wieder. Der holt mich immer. Manchmal ist er schon nach fünf Minuten wieder da, manchmal muss ich ein bisschen länger warten. Um das zu erreichen, ist es wichtig, einen Hund nie zu sich heranzupfeifen, wenn man ihm »Platz« oder einen ähnlichen Befehl gegeben hat, sondern ihn immer da abzuholen, wo man ihm das Ablegen befohlen hat. Wobei er natürlich in dem Moment, wo ein paar Meter vor ihm ein Fuchs vorbeiläuft, wie ein geölter Blitz hochschießt und hinterherjagt. Das ist ganz klar. Alles andere wäre meines Erachtens unnatürlich. Doch von der guten Erziehung mal abgesehen, liebt es Cleo auch, mit mir auf der Lauer zu liegen.
Als ich gerade überlegte, ob Cleo und ich weitermarschieren sollten, tauchte eine Wildkatze mit einer Schermaus, der zweitgrößten Wühlmausart in Europa, im Maul auf. Schermäuse sehen mit ihrem sehr dunklen Fell und den großen gelben Nagezähnen fast wie Maulwürfe aus und sind aufgrund ihrer Größe eine äußerst nahrhafte Beute für Katzen, Füchse oder Mäusebussarde. Und nun folgte, was viele Menschen so irritierend an Katzen finden: Nachdem die Kätzin die noch lebende Maus fallen gelassen hatte, schlugen die Kleinen mit ihren Tatzen nach der Beute, die ziemlich angeschlagen im Kreis herumlief, bissen auch ab und zu hinein, allerdings ohne sie gleich zu töten. Erst nach für die Maus quälend langen Minuten war das »Spiel« vorbei und machten sich die Kleinen ans Fressen.
Obwohl ich schon sehr viele unterschiedlichste Tierarten auf der ganzen Welt beobachtet habe, war dies für mich etwas Einzigartiges: eine Wildkatze, deren Anblick nur ganz wenigen Menschen vergönnt ist, samt ihrem Wurf vor einem romantischen Bau aus Fels und alten Wurzeln.
Dann kam unweigerlich der Moment, da uns die Katze wahrnahm, vielleicht durch ein Aufblitzen der Frontlinse vom Fernglas in der Sonne – und im nächsten Augenblick war die Bühne leer.
Das Grüne Band führte uns weiter über feuchte Magerwiesen, ein Eldorado für Naturfreunde. Sumpfvergissmeinnicht, Breitblättriges Knabenkraut, Schlangenknöterich und Lupinen blühten um die Wette und schufen ein farbenfrohes Gemälde. In den wenigen Sonnenstunden in der Luft das vielstimmige Summen und Zirpen von Insekten, die in den Wiesen einen reich gedeckten Tisch fanden und ihrerseits zahlreiche Vögel anlockten.
Cleo
Für Cleo war diese Wanderung ihre erste große Expedition, und wir, meine Familie und ich, hatten zu Anfang deswegen Bedenken gehabt. Natürlich ist Cleo gechipt, außerdem hatte man ihr in Frankreich eine große Nummer ins Ohr tätowiert. Trotzdem bekam sie extra für diese Wanderung zwei Halsbänder, in die unsere Telefonnummer eingraviert war. Meine größte Angst war nicht, sie auf einer Hatz oder Suche zu verlieren, denn Cleo hat ein unglaublich gutes Heimfindevermögen. Das heißt nicht, dass sie aus der Rhön bis nach Hause in die Eifel gelaufen wäre, aber wenn sie einen Fuchs oder ein Wildschwein jagt, findet sie immer zum Ausgangspunkt zurück. Meine größte Angst war, dass sie wie mein allererster Hund von einem Auto überfahren wird. Minka hetzte ein Wildschwein, und die beiden liefen genau in dem Moment über eine kleine Verbindungsstraße zwischen zwei Dörfern, als eines von insgesamt vielleicht zehn Autos pro Tag daherkam. Das Wildschwein schaffte es, aber Minka prallte gegen das Auto und war tot. Die zweitgrößte Angst war, dass Cleo einen Giftköder frisst. Gift erwischte sie zum Glück nicht, dafür so einiges andere, was sie eigentlich nicht fressen sollte.
In einer Pension gab es eine griechische Landschildkröte von der Größe eines kleinen Kuchentellers, die im Garten an einem Pflock angebunden war. Dazu hatte man ihr ein kleines Loch in die abstehende Platte ihres Panzers gebohrt und einen Schlüsselring mit Schnur durchgezogen. Hatte die Schildkröte im Umkreis des Pflocks das Gras abgefressen, wurde sie samt Pflock umgesetzt. Eine witzige und effektive Methode, sich das Mähen zu ersparen.
Cleo ist – wie soll man sagen – ein Freund der Tiere. Sie beobachtet zum Beispiel für ihr Leben gern Vögel. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen auf der Wanderung war, über eine Blumenwiese zu springen und Vögel aufzuscheuchen. Es gibt Vögel, die vor Hunden überhaupt keinen Respekt haben, wie Kiebitze oder Lerchen, also Bodenbrüter, die einen Hund attackieren, wenn er über eine Wiese läuft. Cleo wusste sehr wohl, dass sie keine Chance hatte, so einen Vogel zu erwischen, aber es war für sie einfach ein schönes Spiel, diese Vögel zu jagen und nach ihnen zu schnappen, wobei der Vogel drei, vier Meter über ihr flatterte und einen Teufel tat, sich fangen zu lassen.
An manchen Tieren hat Cleo hingegen überhaupt kein Interesse, und ich war mir ziemlich sicher, dass Reptilien dazu zählen. Jedenfalls saß ich da eines Morgens in dieser sehr kleinen Pension und unterhielt mich mit den Wirtsleuten über den Osten, den Westen, das Zusammenwachsen, über Filinchen, Spreewaldgurken, Club-Cola, Nordhäuser Doppelkorn, f6 und andere Sachen, die es in der DDR nur unter dem Ladentisch gegeben hatte. Für die westdeutschen Leser: Filinchen ist ein Waffelbrot, f6 eine Zigarettenmarke. Cleo trieb sich unterdessen im Garten herum.
»Berta ist weg – hast du Berta gesehen?«, hieß es auf einmal.
Pflock, Schnur und Schlüsselring waren noch da, aber von Schildkröte Berta weit und breit keine Spur. Die Wirtsleute waren ziemlich ratlos, denn Berta konnte sich ja nicht einfach den Schlüsselring aus dem Panzer gerissen haben. Während sie sich auf die Suche nach dem Tier machten, trank ich noch eine Tasse Kaffee und studierte meine Wanderkarte. Irgendwann kam Cleo mit einem erstaunlich dicken Bauch angetrabt, wirkte ein bisschen aufgeregt und nervös. Berta weg, Cleo dicken Bauch, nee, das kann nicht sein, unmöglich. Sie muss irgendetwas anderes erwischt haben. Auch die Besitzer der Pension sahen keinen Zusammenhang. Cleo hatte am Abend davor mit der Schildkröte spielen wollen, doch die hatte sie angezischt und sich in ihren Panzer zurückgezogen. Cleo hatte sie daraufhin ein bisschen herumgekugelt, aber bald das Interesse verloren. Als mir das einfiel, bekam ich doch irgendwie Angst, dass Cleo mit der Schildkröte etwas angestellt haben könnte. Ist Cleo vielleicht zurückgekommen und hat die Schildkröte von ihrem Ring abgebissen, damit das Spielzeug, das so seltsam zischte und fremdartig roch, besser durch die Wiese zu kugeln war? Wäre ja keine schlechte Ablenkung, solange der Chef beim Frühstück sitzt. Hm, wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht hat Cleo die Schildkröte anschließend irgendwo im Garten vergraben, so wie es Hunde gern mit Knochen machen, nachdem sie eine Weile daran herumgeknabbert haben. Ich suchte den ganzen Garten nach frisch umgegrabener Erde ab, fand aber nichts. Inzwischen war es für Cleo und mich höchste Zeit, aufzubrechen, und wir verabschiedeten uns von den Wirtsleuten, die mittlerweile ebenfalls einen Verdacht gegen Cleo hegten.
Cleo hatte den ganzen Tag über einen schwerfälligen Gang, wollte nicht herumtollen und nicht richtig fressen. Am nächsten Morgen, als Cleo ihren Haufen setzte, offenbarte sich Bertas Schicksal. Denn unter anderem fielen Cleo kleine Panzerplattenteile aus dem Hintern. Ich war fassungslos.
Cleo und ich entschuldigen uns hiermit in aller Form bei Bertas Familie.
Da Cleo bis zu dieser Wanderung praktisch ein Familienhund gewesen war, war ich zu Beginn sehr gespannt, wie wir miteinander klarkommen würden, wenn nun über Wochen nur wir beide zusammen wären. Für sie steht heute noch an erster Stelle mein älterer Sohn. Erik hat sich zwar nie besonders mit Cleo beschäftigt, aber aus irgendeinem Grund findet sie ihn einfach toll. Dann komme ganz schnell ich. Das wechselt dann auch hin und wieder. Mal bin ich ihr Favorit, sozusagen der Leitwolf, und mal ist es Erik. Als Dritte in der Reihe sieht Cleo, ein bisschen widerwillig, meine Frau Birgit, weil meistens Birgit sie füttert und mit ihr Gassi im Wald geht – aber halt nie auf Wildschweinjagd, das ist das Entscheidende. Dann folgt lange Zeit nichts und schließlich irgendwann unser jüngerer Sohn Thore. Er wird von Cleo sogar manchmal angeknurrt; sie merkt: Das ist ein Welpe, der steht wahrscheinlich rangmäßig unter mir – obwohl sie selbst noch sehr jung ist.
Es gibt nur einige wenige Tierarten auf der Welt, mit denen der Mensch eine sehr enge Beziehung eingehen kann. Dazu gehört das Pferd, auch wenn es sich als Fluchttier immer einen gewissen Vorbehalt dem Menschen gegenüber bewahrt. Dazu gehört mit Sicherheit die Katze, obwohl Katzen von ihrem Wesen her eigentlich Einzelgänger sind. Und dazu gehört der Hund, der in seiner ursprünglichen Form, dem Wolf, in einem Rudel mit Rangordnung lebt, sozial organisiert. In der domestizierten Form ist der Mensch sein Rudel, weshalb der Hund sich von allen Tieren am engsten dem Menschen anschließt und die größte Treue zeigt. Selbst wenn ein Hund geschlagen wird (was ich natürlich nicht tue), bleibt er bei einem. Das heißt allerdings nicht, dass ich solchen Kadavergehorsam gut finde, im Gegenteil, aber so ist der Hund nun mal. Der Hund sieht seinen Menschen als Leitwolf, lernt von ihm und macht im Prinzip das, was man ihm beibringt. So macht es der junge Wolf, und so macht es der junge Hund. Deshalb ist es oft so, dass Hunde, die lange mit einem Menschen zusammen sind, sich dessen Marotten und Eigenheiten anpassen. Zwischen Mensch und Hund kann eine derart innige Beziehung wachsen, dass es selbst einen tiererfahrenen und, was die Natur angeht, nüchtern denkenden Menschen wie mich immer wieder verblüfft und staunen lässt. Das muss man wissen, wenn man sich auf einen Hund einlässt. Der Hund ist zu einer solch engen Beziehung bereit, ist man selbst es auch?
Cita, mein vorheriger Hund, und ich hatten eine außerordentlich intensive Beziehung. Cita hat mich abgöttisch geliebt – die Familie spielte für sie nur eine Nebenrolle –, und ich habe sie geliebt. Doch obwohl sie völlig auf mich bezogen war, hatte Cita ein enormes Selbstbewusstsein und Stärke; jeder Hund hat ja, wie wir Menschen auch, einen Charakter und seine ganz eigene individuelle Art. Manchmal hat sie sogar wie ein Rüde im Stehen gepinkelt, also nur ein Bein gehoben, statt sich hinzuhocken, wie es sich für eine Hundedame gehört. Cita hat mich auf vielen Drehs begleitet und war über Monate in Alaska oft meine einzige Ansprechpartnerin. Wir konnten uns blind aufeinander verlassen, und wir vertrauten einander bedingungslos. Ich habe immer gesagt, dass Cita der Hund meines Lebens ist. Als sie dann starb, habe ich mehr geheult als beim Tod meiner Mutter. Noch Monate später habe ich so gelitten, dass ich nicht in der Lage war, mir einen neuen Hund anzuschaffen.
Cleo und ich hatten aufgrund dieser Vorgeschichte nicht gerade einen Start, den man als unbelastet bezeichnen könnte. Ob man will oder nicht, man legt Maßstäbe an.
Als ich schließlich bereit für einen neuen Hund war, war klar, dass es wie Cita wieder ein Hannoverscher Schweißhund sein sollte. Der Hannoversche Schweißhund, wie der Name schon sagt eine urdeutsche und außerdem eine der seltensten Hunderassen der Welt, wird eigentlich nur an Berufsjäger und Forstbeamte abgegeben, da er eine Leistungszucht ist und entsprechend gefordert werden muss. Die Rasse wird seit über 2000 (!) Jahren dazu gezüchtet, Fährten zu verfolgen und Tiere aufzuspüren. Früher wurde er auch bei der herrschaftlichen Jagd eingesetzt, heute ist seine Aufgabe in erster Linie, kranke, geschossene oder, was immer häufiger vorkommt, von Autos angefahrene Tiere zu finden oder zu stellen, damit der Berufsjäger sie von ihrem Leiden erlösen kann. Der Hannoversche Schweißhund hat keine bessere Nase als beispielsweise der Schäferhund, aber von allen Hunderassen die größte Konzentrationsfähigkeit. Er kann eine Fährte sogar über mehrere Tage hinweg verfolgen. Ich bin manchmal erstaunt, was Cleo so alles an Gerüchen aus der Luft filtert. Später, im Niedersächsischen Drömling, gab es ein ganz schräges Erlebnis. Doch dazu später.
Man züchtet in Deutschland mit etwa knapp sechzig Hannoverschen Schweißhunden, das heißt, genetische Defekte sind bei so wenig Zuchtmaterial, so nenne ich es jetzt mal, sehr wahrscheinlich. Bei uns Menschen gibt es das ja auch. Warum sehen sich viele Adlige so ähnlich? Warum haben viele Adlige aus denselben Häusern dieselben Erbkrankheiten, können nicht richtig sprechen oder lesen, sind manchmal nicht sehr helle. Aber um auf Hunde zurückzukommen: Je kleiner der Genpool, desto mehr Probleme. Man hat daher beim Verein Hirschmann, dem betreuenden Verein Deutschlands, versucht, ganz offiziell Fremdblut aus Tschechien einzukreuzen, als man nach Öffnung der Grenzen dort Hannoversche Schweißhunde fand. Doch die hatten einen noch kleineren Genpool und waren nicht sehr wesensfest. Die einen wichen aus, klemmten die Rute ein, wenn man sie etwas harscher anging, die anderen hatten eine sehr niedrige Reizschwelle. Wieder andere interessierten sich nicht sonderlich für den Geruch eines Wildschweins – als Schweißhund! Als dann die ersten Welpen geboren wurden, deren einer Elternteil aus Tschechien kam, stellte man fest, dass sie sehr stark zu Epilepsie neigten.
»Es gäbe noch eine andere Möglichkeit«, hieß es dann auf einmal. »In den Pyrenäen gibt es einen Förster, der Hannoversche Schweißhunde züchtet. Die Großmutter kommt aus Deutschland, ist jetzt in der zweiten Generation Blutlinie Frankreich, der Vater des nächsten Wurfs ist Franzose, einer der ganz wenigen französischen Hannoverschen Schweißhunde. Wir wären sehr daran interessiert, dass Sie einen der Welpen bekämen, denn wenn er sich gut macht, könnten wir mit ihm unseren kleinen Genpool auffrischen. Setzen Sie sich mal mit dem französischen Verein für Schweißhunde in Verbindung.«
Gesagt, getan. Sechs Welpen waren bereits vorab vergeben, und als der Wurf dann kam, drei Hündinnen und vier Rüden, war also nur ein Welpe frei. Da diese Hunderasse so selten ist, hätte ich mir auch in Deutschland nicht einen Welpen aussuchen dürfen, etwa: »Ich hätte gern den Dicken da hinten.« Man muss froh sein, wenn man überhaupt einen bekommt.
Als die Welpen neun Wochen alt waren, packte ich den Unterlauf eines Hirschs für Cleo in den Wagen – wir hatten uns vorab einen Namen mit C für den Welpen aussuchen dürfen; üblicherweise ist es so, dass alle Welpen des ersten Wurfs einer Zuchtstätte einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben A bekommen, die des zweiten Wurfs mit dem Buchstaben B und so weiter –, und dann fuhren Birgit und ich los. Knapp 1400 Kilometer, davon etwa 1100 durch Frankreich. Obwohl wir im belgischen Grenzgebiet leben, ist keiner von uns beiden der französischen Sprache mächtig, und welcher Franzose spricht schon Deutsch oder Englisch? Selbst wenn er es kann. Wir versuchten die Strecke daher so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, zumal gemächliches Verweilen oder Sightseeing schon wegen des frischen Hirschlaufs ausfielen.
Am nächsten Vormittag erreichten wir Cleos Heimatort, ein abgelegenes Dorf im hintersten Winkel von Südfrankreich mitten in den Pyrenäen. Gleich nach dem Jäger begrüßte uns Cleos Mutter, eine relativ große, muskulöse Hündin, sehr selbstbewusst, aber nicht aggressiv. Das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Und dann kam auch gleich Cleo aus dem Haus gerannt und wollte wissen, was da los war. Als sie uns Fremde sah, bremste sie vor der Treppe, die in den Hof hinunter führte, ab und musterte uns neugierig.
»Mann, ist die süß!«, entfuhr es mir, ein Ausdruck, den ich sonst eigentlich nie verwende. Tierbabys sind ja fast alle irgendwie süß, Cleo aber haute mich fast um, so schön war sie – und ist es heute noch.
Langsam ging ich auf sie zu und legte ihr sozusagen zur Begrüßung den Hirschlauf auf die Treppe. Cleo ging hin, schnüffelte kurz daran, schaute dann zu mir hoch und knurrte, was hieß: »Das ist jetzt meiner!« Ich war völlig perplex.
»Das gibt es doch nicht! Die knurrt dich an, die Kleine! Das kann ja was geben«, meinte Birgit.
»Wieso?«, fragte ich. »Das zeigt nur, dass sie ganz schön selbstbewusst ist. Mir gefällt das.«
Zwar gab uns die Frau des Försters auf meine Bitte hin die Decke aus der Wurfkiste mit, damit Cleo wenigstens einen vertrauten Geruch in der Nase hatte, aber alles andere war natürlich völlig neu für sie. Plötzlich war sie bei fremden Leuten, die anders sprachen, anders rochen, sich anders bewegten und anders gestikulierten als die, die sie kannte. Und nach einer langen Zeit in einem großen Ding, das brummte, öffnete sich dessen Tür, und der kleine Hund stand in der kalten, rauen Eifel. Cleo kuschelte sich auf ihr kleines Stück Decke, in der noch der Duft mit all den Erinnerungen an Zuhause hing. Sie wollte nicht richtig fressen, nicht richtig trinken; sie vermisste ihre Mutter, die vertraute Umgebung, sehnte sich zurück in die warmen Pyrenäen. Cleo litt. Zum Glück ist der Hund ein domestiziertes Tier und schließt sich sehr schnell dem Menschen an, und da Cleo sehr jung war, verblassten die Erinnerungen an ihr früheres Leben im Lauf der nächsten Wochen.
Im ersten Jahr konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mit Cleo mal das erleben darf und kann, was ich mit Cita und auch deren Vorgängerin, Kim, erlebt habe. Cita und Kim waren ein bisschen draufgängerisch, manchmal sogar etwas überpassioniert in ihrer Jagdleidenschaft. Cleo ist eher die Vorsichtige, wägt mehr ab. Wenn es hart auf hart geht, bleibt sie lieber an meiner Seite. Wenn sie etwas jagt, also hetzt, kommt sie schneller zu mir zurück – was ich mittlerweile als sehr angenehm empfinde. Ich will keinen Hund mehr, der ein Wildschwein zehn Kilometer über Berg und Tal hetzt und erst nach vielen Stunden aufgibt, während ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, ob etwas passiert ist.
Um den Bogen zu schließen: Am Ende der Wanderung waren Cleo und ich so stark zusammengewachsen, dass wir uns blind verstanden; wir brauchten uns nur anzusehen, um zu wissen, was der andere gerade spürte oder dachte. Und Cleo hat auf der Wanderung unheimlich viel gelernt, ist, auch wenn das bei einem Hund vielleicht komisch klingen mag, reifer geworden. Kurz nach der Wanderung musste sie im Rahmen der jährlichen Jahreshauptversammlung des Vereins Hirschmann ihre erste sehr schwierige Prüfung, die sogenannte Vorprüfung für junge Schweißhunde, ablegen. Der »Richter Obmann«, oder Rüdemeister, war ein eher kritischer, knorriger, sehr direkter Mann. Er hatte zunächst Vorbehalte gegen Cleo und mich – wahrscheinlich hauptsächlich gegen mich, wegen meiner langen Haare, der ausgebeulten Hose und vor allem, weil ich nicht mehr als Förster und Berufsjäger im Revierdienst tätig war. Es gab ja auch welche, die sagten, dass ich deswegen gar kein Anrecht mehr auf einen Hannoverschen Schweißhund hätte.
Cleo erzielte in der zwei Tage dauernden Prüfung bei der Formwertprüfung – quasi dem Schönheitswettbewerb, bei dem der Allgemeinzustand der Gesundheit, die Zähne, das Fell, die rassetypischen Merkmale und so weiter geprüft werden – ein »Sehr gut« und schnitt, noch wichtiger, bei der Jagdprüfung ebenfalls mit einer Eins ab, als Beste von allen sechs jungen Hunden! Bei der Jagdprüfung muss der Hund eine 1000 Meter lange kalte, gesunde Fährte »arbeiten« – und ein Kilometer im Wald kann sehr lang sein. »Kalt, gesund« bedeutet, dass die Fährte so alt sein muss, dass von den Hufabdrücken des gefährteten Tieres keine warme Witterung mehr ausgeht (wozu vier Stunden vor der Prüfung ein zahmes Wildschwein durch den Wald geführt wird). Hinter dem Hundeführer und seinem Hund marschieren die gesamte Prüferkorona und meist noch etliche Zuschauer, ein sehr seltsamer Aufzug. Nach einem Kilometer im Wald, wenn der Hund die Fährte gut gearbeitet hat, sagt der Prüfer: »So, prima! Tragen Sie Ihren Hund ab!« Dann lobt man seinen Hund leise, nimmt ihn auf den Arm und trägt ihn weg – daher der Ausdruck »abtragen«. Bei Cleo mit ihren 26 Kilogramm kein Problem, doch manche andere Hundeführer haben Rüden mit fast fünfzig Kilogramm. Schönen Gruß an die Bandscheibe! Ich sagte also zu Cleo: »So, recht, mein Hund. Hast du gut gemacht!«, und trug sie ab. Und sie hat es wirklich toll gemacht, trotz erschwerter Bedingungen, denn nachdem in den frühen Morgenstunden das zahme Wildschwein seine Fährte im Wald gelegt hatte, waren eine Wildschweinrotte und Rothirsche über die Fährte gezogen und hatten ebenfalls ihre Witterung hinterlassen. Aber Cleo hat an diesen anderen Duftspuren nur ein bisschen herumgeschnüffelt und ansonsten die vorgegebene Fährte ganz zielstrebig gearbeitet.
Abends fanden sich die etwa siebenhundert Mitglieder – es gibt fast doppelt so viele Mitglieder wie Hannoversche Schweißhunde in Deutschland – in einer riesigen Halle ein. Bei der Preisverleihung sagte der Rüdemeister in der Urteilsbegründung, dass ihm insbesondere aufgefallen war und er besonders hervorheben wollte, dass der Führer, also sprich ich, und Cleo ein unglaublich gutes Team sind, dass die Zusammenarbeit zwischen Führer und Hund hervorragend ist und dass wir uns ohne Worte verstehen. Da war ich sehr, sehr stolz! Und später, bei einem Bier, meinte der Zuchtwart: »Also so ein Hund, der so toll arbeitet, einen solchen Fährtenwillen hat, so bildhübsch aussieht, so wesensfest ist« – Letzteres zählt bei der Bewertung ebenfalls –, »der sollte mindestens zwei Würfe in seinem Leben machen.«
Mödlareuth
Ende der Leseprobe