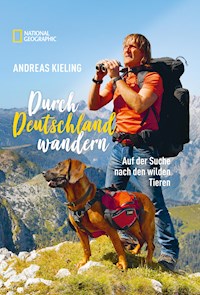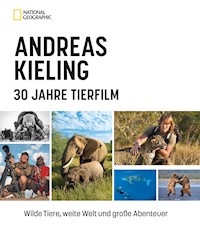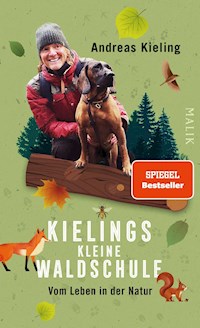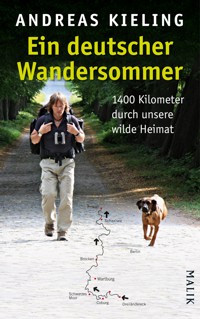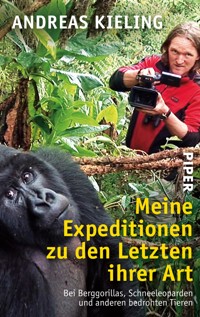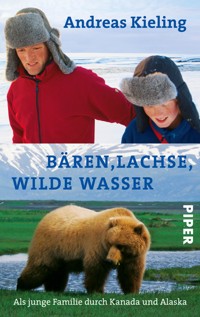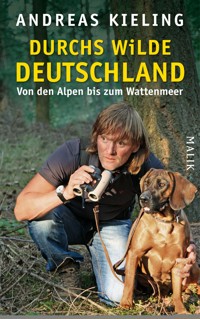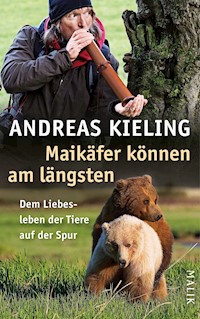
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Dokumentarfilmer verbringt Andreas Kieling monatelang mit Tieren und erlebt den Kreislauf der Natur aus nächster Nähe. Er ist bei der Hirschbrunft in der Eifel dabei; im Kongo beobachtet er, wie fürsorglich sich stattliche Berggorillamännchen um ihren Nachwuchs kümmen. Er erzählt von seinen spannendsten Reisen, die ihn zu liebestollen Löwen, zu Flussdelfinen und seltenen Wüstenelefanten führen, aber auch von heimischen Arten: vom Liebesleben der Frösche und Feldhasen, davon, wie sich Auerhähne, Bergmolche oder Igel paaren. Welche Tiere monogam leben und welche lieber einen Harem um sich scharen. Ob es im Tierreich Familienplanung oder Eifersucht gibt. Und welche Arten dem Menschen in ihrem Sexualverhalten am ähnlichsten sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
Für die sexiest Mutter und beste Frau der Welt: Birgit
Mit 62 farbigen Fotos, 12 Schwarz-Weiß-Fotos und mit einer Karte
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96345-9
© Piper Verlag GmbH, München 2013
Karte: Eckehard Radehose, Schliersee
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Composing mit Fotos von Birgit Kieling (oben) und Suzi Eszterhas/Getty Images (unten)
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Vorwort
Als ich vor vielen Jahren professionell mit der Tierfilmerei anfing, fragte ich mich: Was ist das Spektakuläre im Leben eines Tieres? Tiere sind in erster Linie Energiesparer und längst nicht so agil und aktionsversessen wie wir Menschen. Daher spielt sich bei ihnen, wenn man vom Tagtäglichen wie etwa der Futtersuche absieht, nicht viel ab. Es gibt eigentlich nur zwei besondere Ereignisse bei Tieren: die Balz- beziehungsweise Paarungszeit und die Geburt der Jungen, wobei Letztere nur die Weibchen betrifft.
Bleibt also die Paarungszeit als das absolute Highlight. Dann verwandeln sich Tiere manchmal in wundersamer Weise, wie wir Menschen ja auch. Aus Rothirschen etwa, die ansonsten das ganze Jahr über friedlich im Rudel zusammenstehen und nebeneinander Gräser, Blätter und Bäumchen knabbern, werden auf einmal für ein paar Wochen erbitterte Rivalen. Und Bären, die sich normalerweise aus dem Weg gehen und ein phlegmatisches, ruhiges Leben als Einzelgänger führen, mutieren plötzlich zu Kampfmaschinen. Somit ist die Paarungszeit für einen Tierfilmer natürlich die vielversprechendste Zeit, was aber nicht unbedingt heißt, dass man die Aufnahmen bekommt, die man haben möchte. Und naturgemäß begibt man sich, wenn der Hormonspiegel im Tierreich so hoch ist, oft auch in besonders gefährliche Situationen. Für mich sollte der Kampf zweier brunftiger Wildschweinkeiler in der Eifel eine der riskantesten Dreharbeiten überhaupt werden.
Ich habe so viel Kurioses mit Tieren – und auch mit Menschen – erlebt, dass ich wahrscheinlich ganze Bände damit füllen könnte. Vieles davon ist nur für den Naturenthusiasten oder Tierfreak interessant, anderes, so glaube ich, auch für Menschen, die die Natur und Tiere vor allem bei Waldspaziergängen oder Zoobesuchen beziehungsweise in Tiersendungen im Fernsehen oder eben in Büchern erleben. Ein Eindruck, den ich bei meinen Vorträgen und Live-Reportagen immer wieder bestätigt sehe. Die Beobachtungen zum Liebesleben der Tiere, zu Brunft und Balz, Paarungs- und Fortpflanzungsverhalten und zur Aufzucht des Nachwuchses stoßen dabei übrigens auf besonders große Resonanz, gerade auch bei Familien mit Kindern und Jugendlichen. Zu den Höhepunkten gehören dabei zweifellos die Aufnahmen von der sogenannten Hasenhochzeit – die sorgen im Saal immer für viele Lacher.
Wenn ich die Augen schließe und mich frage, welche Geschichten am erzählenswertesten sind, kommen erstaunlicherweise sehr unterschiedliche Sachen heraus; da denke ich an Eisbären und eine Paarung im Schneesturm oder an das lustige Treiben der Maikäfer, das schon Wilhelm Busch inspiriert hat. Mir fallen Geschichten mit Wüstenelefanten in Namibia ein, bei denen ich mir sagte: Das glaube ich jetzt nicht, was da gerade passiert, oder die unglaubliche Gelegenheit, Löwen bei der Paarung filmen zu können, und zwar aus einer Nähe, wie ich es nie zuvor zu hoffen gewagt hätte. Ich denke an Kindheitserlebnisse, an Tauchgänge in eiskalten Bergbächen in Deutschland, wo man wundersame Dinge unter Wasser beobachten kann, die sonst komplett im Verborgenen ablaufen. Oder an eine meiner größten Herausforderungen als Tierfilmer, nämlich eine solche Hasenhochzeit samt Paarung perfekt zu filmen.
Geschichten schreiben sich immer sehr schön, wenn man sie gerade frisch erlebt hat und einem noch die Hand zittert vor Aufregung. Da hat man oft das Gefühl: Das ist die Sensationsgeschichte. Später, wenn man zu Hause im Warmen und Trockenen am Schreibtisch sitzt, neben sich eine Tasse mit frischem, duftendem Tee, stellen sich die Erlebnisse manchmal ganz anders dar, und man denkt: Ja, das war schon hart und tough, aber im Nachhinein nicht so aufregend, wie ich es in dem Moment empfunden habe. Es gibt aber auch Episoden, die noch Monate, vielleicht sogar Jahre später genauso reizvoll, einzigartig, dramatisch, lustig oder verblüffend sind wie zu dem Zeitpunkt, als man sie erlebte. Von solchen Geschichten möchte ich in diesem Buch erzählen.
Schon als Kind war ich vom Leben in und an Bächen, Teichen und Seen fasziniert. Ein Großteil meines Wissens über Amphibien stammt von einem einzigen Teich in Gotha, den ich als Junge vom Frühjahr bis zum Herbst regelrecht belagerte. Er war einer meiner Lieblingsspielplätze, weil es dort vor Bergmolchen, Erdkröten und Grasfröschen nur so wimmelte und hin und wieder auch ein Feuersalamander zu beobachten war.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Frühjahr gegeben hätte, wo ich am Fenster nicht ein großes Gurkenglas mit Laich stehen hatte. Weil das Wasser im Laichgewässer nur wenige Grad hat, dauert es normalerweise recht lange, bis sich aus der Eizelle eine Larve entwickelt; auf der Fensterbank aber, wo es schön warm war, ging das recht schnell. Irgendwann fielen den Larven der Ruderschwanz und die außen liegenden Kiemen ab. Und siehe da, entweder sahen sie dann aus wie eine kleine Kröte oder wie ein kleiner Frosch, ein kleiner Molch oder Salamander und mussten aus dem Wasser raus. Amphibisches Leben halt und für den kleinen Jungen, der ich damals war, total faszinierend.
Amphibien unterteilt man in drei sogenannte Ordnungen. Eine Ordnung sind die kaum bekannten Schleichenlurche, die nur in den Tropen und Südtropen leben. Über diese Art weiß ich ehrlich gesagt nur, dass es sie gibt. Eine zweite sind die Schwanzlurche. Dazu gehören Molche, Salamander und die Familie der Olme, die ihr Leben im Dunklen, im Verborgenen verbringen und eigentlich bis zum Tod in einem Larvenstadium bleiben. Sie kommen in allen gemäßigten und subtropischen Zonen vor. Die dritte Ordnung bilden die außer in der Antarktis weltweit vertretenen Froschlurche. Sie haben mal ein »Frosch«, mal ein »Kröte« oder ein »Unke« im Namen, das heißt, egal ob Panama-Stummelfußfrosch, Knoblauchkröte, Lichuan-Rotbauchunke oder Schrecklicher Blattsteiger: Sie sind alle Frösche – Letzterer übrigens der giftigste Frosch der Welt. Anders formuliert: Jede Kröte und jede Unke ist im Grunde ein Frosch, aber nicht jeder Frosch ist eine Kröte oder Unke. Es gibt bei den Froschlurchen zig Unterordnungen, Gattungen und Familien mit zum Teil Tausenden Arten, weshalb ich die im Alltag üblichen Bezeichnungen und Unterscheidungen verwende: Frösche sind in der Regel schlank, haben eine glatte, feuchte Haut und sind immer in der Nähe von Wasser. Ein Frosch quakt und nervt dich damit die ganze Nacht. Kröten und Unken werden seit jeher in einen Topf geworfen. Das zeigt sich bereits an den Namen: Die Unken nannte man früher häufig »Feuerkröten«, die Feuerunke wiederum heißt auch »Kreuzkröte«. Kröten und Unken sind jedenfalls plumper als ein Frosch, haben eine trockene, ledrige Haut, häufig Warzen, leben auch weiter weg von Gewässern und »unken« – dazu gleich noch mehr. Und, ganz wichtig: Sie können nicht hüpfen.
Froschlurche haben als Kaulquappen, wie man ihre Larven üblicherweise nennt, Außenkiemen, über die sie atmen. Erst nach einiger Zeit beginnen sie, über ihre Lungen zu atmen. Dann fallen die Außenkiemen ab, und meistens auch gleich der Schwanz. Jetzt sind sie kleine fertige Frösche oder Kröten und gehen an Land. Dort beginnt ihr eigentliches Leben und erwarten sie große Gefahren. Bei Schwanzlurchen ist es ähnlich: Sie sehen zwar im Anfangsstadium schon wie ein Salamander oder Molch aus, sind fast durchsichtig, sodass man die Organe erkennen kann, haben aber ebenfalls außen liegende Kiemenbüschel. Ausnahmen sind Tiere wie zum Beispiel der Feuersalamander, wo der Nachwuchs im Mutterleib zur Larve heranwächst. Es gibt aber auch Populationen des Feuersalamanders, vorwiegend in Südeuropa, bei denen die Jungen komplett fertig entwickelt den Mutterleib verlassen, so wie es kleine Alpensalamander generell tun. In beiden Fällen hat sich die Natur etwas dabei gedacht: Kleine Tümpel und Teiche können im heißen Südeuropa schnell mal austrocknen und in den Alpen selbst im Frühling noch gefrieren. Da hat fertig entwickelter Nachwuchs, der von Anfang an an Land lebt, weit bessere Überlebenschancen als von Wasser abhängiger.
Der Alpensalamander hat im Übrigen die längste Tragzeit aller Lebewesen, je nach Höhenlage zwei bis drei Jahre. Im Bauch des Weibchens spielt sich während der Schwangerschaft Hochdramatisches ab: Die Starken fressen die Schwachen. Und das geht so: Anfangs ernähren sich die Larven vom Dotter ihres Eies. Diejenige, die ihren eigenen Vorrat als Erste aufgefressen hat, macht sich über die anderen Eier her, sodass in jedem Eierstock nur ein einziger Nachkomme übrig bleibt.
Die Paarung der Lurche hat mich schon als Kind besonders interessiert. Mein »Forschungsobjekt« erster Wahl war die Erdkröte, weil es solche Unmengen davon gab, dass ich sie ohne große Mühe beobachten konnte. Das Verrückte ist, dass an einem Gewässer entweder nur ganz wenige Erdkröten ablaichen oder dass es, wie an »meinem« Teich damals, zu einer Massenversammlung kommt. Das hat einen einfachen Grund. Außerhalb der Laichzeit leben die Erdkröten in einem weiträumigen Gebiet. Wenn dort mehrere geeignete Laichplätze sind, verteilen sich die Erdkröten schlauerweise. Gibt es aber nur einen Tümpel, Teich oder was auch immer, treffen sich natürlich alle Kröten der Umgebung an diesem einen Wasser.
Die Straße, die an unserem Dorf vorbeiging und die die Erdkröten überqueren mussten, wenn sie von ihren Winterquartieren zu ihrem Laichgewässer wanderten, war manchmal regelrecht übersät von Krötenleichen, obwohl da gar nicht viele Autos fuhren. Es gab damals noch keine Schutzzäune, wie man sie heute aufstellt, keine Schilder mit »Achtung! Krötenwanderung« und nur wenige Menschen, die sich um die Kröten sorgten. Früher war auf so mancher Straße eine richtige Schmierpampe aus überfahrenen Leibern und zerquetschtem Laich. Ich war als Junge während der Krötenwanderung tagelang damit beschäftigt, mit Eimern, Kartons und Schüsseln Kröten aufzusammeln, um sie zum Teich zu tragen.
Wenn ich ein Liebespaar aufgriff – ein Krötenweibchen, prall mit Laich gefüllt, an das sich ein, manchmal auch zwei Männchen klammerten –, dann stießen die Männchen zwar ganz erschreckt Befreiungsrufe aus, ließen aber das Weibchen um keinen Preis der Welt los. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass das Befreiungsrufe waren, sondern dachte, die Tiere hätten einfach nur Angst. Normalerweise stößt einen Befreiungsruf ein Weibchen aus, wenn sich ein Männchen zur Paarung an ihm festklammert, es aber noch nicht bereit ist, Eier abzulegen. Er signalisiert dem Männchen: Hau ab, ich will jetzt nicht! Er kann aber auch von einem Männchen kommen, das versehentlich von einem Geschlechtsgenossen umklammert wird. Der Befreiungsruf klingt wie »Ük, ük«, der Paarungsruf hingegen wie »Önk, önk«. Ich war jedenfalls fasziniert davon, dass ein Männchen in dem Moment, wo der Feind – also ich, denn sie wussten ja nicht, dass ich ihnen was Gutes tun wollte – zupackt, sich nicht trennt, sondern einfach weiter klammert.
Die Männchen ließen sich manchmal 150 Meter, was für ein Kröte relativ weit ist, weil sie ja nicht hüpfen kann und daher die ganze Strecke wandern muss, bis zum Laichgewässer tragen – etwa zehn Prozent kommen schon huckepack dort an –, weil sie darauf programmiert sind, den Moment abzupassen, in dem das Weibchen seinen Laich abgibt, damit sie ihr Sperma drübergeben können. Erdkröten sind am kälteresistentesten und wahrscheinlich deshalb die Ersten im Jahr, die sich paaren, dicht gefolgt von den Grasfröschen. Die Weibchen legen beim Ablaichen Schnüre ab, die aussehen wie Glasnudeln mit kleinen schwarzen Punkten. Die Glasnudel ist eine gallertartige Masse, die die wie auf einer Kette aufgezogenen schwarzen Punkte, die Eizellen, umschließt. Das Sperma ist keine Wolke aus weißer Milch, wie man es von Fischen kennt, sondern unsichtbar, weshalb ich es nie gesehen habe. Die Spermien durchdringen die gallertartige Masse, treffen auf die Eizelle, und das Ei ist befruchtet. Alle Froschlurche haben diese äußere Befruchtung, folglich haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch alle Männchen diesen unbändigen Trieb zu klammern. Sobald ihre Hormone wallen, ist nichts, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, vor ihnen sicher. Sie umklammern wirklich alles, was ihnen in den Weg kommt: meine Finger, ein Stück Holz, einen Tannenzapfen, einen Fisch – Hauptsache, es passt von der Größe her. Die Partnerwahl bei Erdkröten ist wie bei den meisten Lurchen also ziemlich einseitig, das Weibchen hat da nicht viel, eigentlich gar nichts mitzureden. Wer ein guter Klammerer ist und sich prima festhalten kann, der kommt zum Zug. Aus, fertig. Es macht also nicht der Größte, Schönste, Schnellste, Geilste oder Mutigste das Rennen, sondern der, der am meisten Kraft in seinen Armen hat.
Der Klammertrieb führt aber nicht nur zu – zumindest für den Außenstehenden – witzigen Irrtümern, sondern auch zu tragischen Unfällen. Mit nur einem Typen auf dem Rücken kann eine Krötenfrau immer auftauchen, da sie im Schnitt locker ein Viertel bis ein Drittel größer und schwerer ist; eigentlich kann sie mit ihm machen, was sie will. Mit mehreren aber hat sie ein ernstes Problem. Tatsächlich kommt es gar nicht so selten vor, dass mehrere Kerle ein und dieselbe Kröte zur Dame ihres Herzens küren und auf Teufel komm raus an ihr festhalten. Sich aus der Umarmung der Männchen zu befreien ist ihr aber nicht möglich. Wer schon einmal eine Kröte auf zwei nebeneinander gehaltenen Fingern hat klammern lassen, der weiß, dass dieser Klammergriff irre fest ist. Sofern sie also nicht ein besonders großes Kaliber ist und ihre Verehrer eher »dünn angerührt« sind – so bezeichnete meine schlesische Großmutter Tiermännchen und Männer, die recht mickrig oder nicht besonders helle waren; obwohl eigentlich eine recht einfache Frau, hatte sie manchmal ziemlich coole Sprüche drauf –, wird sie es mit all der Last auf dem Rücken nicht schaffen, aufzutauchen, um Luft zu holen. Und in der Folge jämmerlich ertrinken.
Als Kind hat mich das völlig entsetzt. Schuld kann man den Männchen natürlich keine geben, »… denn sie wissen nicht, was sie tun«. Was mich aber am meisten abgestoßen hat, war, dass die Männchen nicht einmal merken, wenn ein Weibchen tot ist – vorausgesetzt, das Wasser ist so flach, dass sie selbst alle halbe Stunde den Kopf rausstrecken und Luft schnappen können. Und was mich jedes Mal wieder richtig schockierte: Sie lassen selbst dann noch nicht von ihm ab, wenn nach zwei, drei Tagen seine normalerweise braune Haut zu einem gräulichen Weiß verblasst. Erst wenn kein Laich mehr aus dem – im wahrsten Sinne des Wortes »verblichenen« – Weibchen quillt, lockern sie ihren Klammergriff und lassen es frei.
Zurück zu den Lebenden. In dem Moment, wo das Weibchen sämtlichen Laich abgelegt und er seinen Samen dazugegeben hat, lockert er seinen Klammergriff, und beide verlassen sehr schnell das Gewässer. Das ist echt ein Phänomen: Man kommt Ende März an ein Krötengewässer, und es önkt und ükt überall. Alles voller Kröten, und es stoßen immer mehr dazu – das »Anwandern« dauert eine Woche bis zehn Tage –, um hier ihrem Liebesspiel nachzugehen. Kommt man ein paar Tage später wieder dahin, ist der Teich leer, heißt: Jetzt ist zwar jede Menge Laich darin, aber die Kröten sind alle weg. Und man fragt sich, wohin sie auf einmal alle verschwunden sind.
So unromantisch und unerotisch, wie Amphibiensex ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich die Tiere nach der Paarung sagen: »Nichts wie raus hier und wieder nach Hause in die warme Stube« oder »Lass uns Fliegen und Mücken jagen und den Rest des Jahres mit schöneren Dingen verbringen«. Oder so ähnlich, jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht viel Spaß am »Liebesspiel« haben. Wie sollten sie auch? In der Regel ist es kalt, und viele werden auf dem Weg zum »Liebesnest« überfahren. Sie presst die Eier raus und läuft Gefahr, dabei ertränkt zu werden, er muss im richtigen Moment seinen Samen dazugeben. Das war’s. Das kann doch gar keinen Spaß machen!
Als ich älter wurde, war es für mich die größte Freude, im Frühjahr in Gebirgsbächen oder -seen oder in irgendwelchen Teichen mitten zwischen den Lurchen zu tauchen und ihr Liebesleben aus nächster Nähe zu beobachten. Das war für mich immer ein Frühjahrsbote, mehr als das Balzen der Vögel. Es sieht ja auch total schräg aus, wenn die Tiere noch völlig unterkühlt und deshalb recht wacklig auf den Beinchen aus ihren Winterquartieren kommen und ihrer Bestimmung entgegenwatscheln. Ich dachte mir jedes Mal wieder: Wie können die nur? Die Luft war kalt, der Boden war kalt, in manchen Jahren sogar noch schneebedeckt, mir war kalt, und diese Wahnsinnigen steigen auch noch in eiskaltes Wasser.
Bei ein oder zwei Grad Wassertemperatur in einem Bach oder kleinen See zu tauchen – was selbst mit einem Trockentauchanzug Überwindung kostet – und ein relativ großes Film- oder Fotokameragehäuse vor sich herzuschieben, das ist das eine. Die Bemerkungen der Wanderer, die vorbeikamen und mich sahen, sind das andere. Wir reden ja jetzt nicht von irgendeinem tollen Gewässer oder einem abenteuerlichen Tauchgang. Das Ganze sah für einen Außenstehenden wohl eher seltsam aus. Von »Sie haben wohl was verloren?« über »Suchen Sie nach Gold?« bis zu »Liegt da eine Leiche?« bekam ich so ziemlich alles zu hören, aber kaum einer kam darauf, dass ich Lurche live beim Liebesspiel und in freier Wildbahn beobachten wollte.
In einem fließenden Gewässer ist es unter Wasser übrigens nie ruhig. Das Gurgeln und Glucksen des Wassers, das Kullern und Schaben der Kiesel und das leise Knirschen des Sandes auf dem Grund vermischen sich zu einem Grummeln, das man trotz Neoprentaucherhaube gut hören kann. Das ist eine sehr eigene Atmosphäre, die man über Wasser so nicht kennt.
Warum eigentlich paaren sich die Lurche – zumindest die meisten – so früh und warten nicht, bis Luft und Wasser wenigstens ein bisschen wärmer sind? Es gibt nur eine logische Erklärung dafür: Die Entwicklungsstadien, die sie von der Laichschnur oder dem Laichklumpen bis zum fertigen Schwanz- oder Froschlurch durchlaufen, nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Daher gibt es auch nur einen »Durchgang« im Jahr, während sich viele andere Tiere, Vögel zum Beispiel, ein zweites Mal paaren, wenn dem Nachwuchs etwas zustößt. Wenn bei Lurchen etwas schiefgeht – das Wasser in einer Pfütze komplett durchfriert oder austrocknet, was im Frühjahr ja beides möglich ist –, ist es für dieses Jahr aus und vorbei mit der Nachzucht. Tatsächlich kann man im Spätherbst, wenn es kälter wird und die Nahrung knapper, sehen, dass die kleinen Fröschlein, Krötchen oder Salamanderli so gerade mal das Minimum an Größe und Gewicht haben, das sie brauchen, um den Winter zu überstehen. Da sie das Frühjahr als Larven verbrachten, hatten sie weniger Zeit als ausgewachsene Tiere, sich Fettreserven anzufressen, und sind daher noch auf Futtersuche, während die älteren schon in ihren Winterquartieren sind: in Erdlöchern, dem Wurzelbereich von Bäumen, in Totholz, unter Steinhaufen, im Bodenschlamm von Gewässern oder ähnlichen Unterschlüpfen.
Apropos fressen: Grundsätzlich fressen Lurche alles, was da kreucht und fleucht und was in ihr Maul passt: Insekten, Spinnen, Regenwürmer und bei Bedarf Artgenossen und sogar die eigenen Jungen. Daher ist der Amerikanische Ochsenfrosch, der sich bei uns breitmacht, eine große Gefahr. Im wörtlichen Sinn, weil das Tier fast ein Kilogramm schwer werden und eine Kopf-Rumpf-Länge von zwanzig Zentimetern erreichen kann – dazu kommen noch 25 Zentimeter lange Beine. Und im übertragenen Sinn, da er wie alle Lurche nicht vor Kannibalismus zurückschreckt und aufgrund seiner Größe und seines enormen Appetits natürlich weit mehr vertilgt als zum Beispiel ein kleiner Grasfrosch, wodurch er einerseits ein gefährlicher Fressfeind und andererseits ein starker Nahrungskonkurrent ist.
Zurück zum Winter. Lurche sind wechselwarmblütige Tiere, das heißt, dass sich ihre Körpertemperatur immer der Außentemperatur anpasst. Bei einer Umgebungstemperatur von unter null Grad verfallen sie in die sogenannte Winter- oder Kältestarre, heißt: Sie werden unbeweglich, nehmen also auch keine Nahrung mehr zu sich; um Energie zu sparen, reduzieren sie ihre Körperfunktionen auf ein absolutes Minimum; selbst das Atmen stellen sie ein und decken ihren Sauerstoffbedarf stattdessen über die Haut. Letzteres ist nicht so ungewöhnlich: Auch wir Menschen atmen über die Haut, allerdings würden wir auf diese Weise nie genügend Luft bekommen, denn bei uns macht die Hautatmung nur ein Prozent unseres Sauerstoffbedarfs aus. Man fragt sich natürlich, wie die Tiere die Kälte überleben, wieso sie nicht erfrieren? Die Antwort ist: Glycerin. Die Tiere reichern ihr Blut und andere Flüssigkeiten im Körper mit Glycerin an, das wie ein Frostschutzmittel wirkt und somit verhindert, dass sich Eiskristalle bilden. Tolle Sache.
Die Paarung und alles, was dazugehört, ist bei Erdkröten zwar interessant, manchmal dramatisch, aber bei Weitem nicht so aufsehenerregend wie bei anderen Lurchen, zum Beispiel den Molchen. Man kann Molche gut in einem Kaltwasseraquarium beobachten oder sich die Mühe machen und sich im Mittelgebirge, wo sehr viele dieser Tiere leben – in Deutschland sind das Bergmolch, Fadenmolch, Teichmolch, Kamm- und Alpenkammmolch –, ganz still neben ein Kleinstgewässer, sprich eine Pfütze hocken. Im Frühjahr entwickeln die Männchen einiger Arten ein auffälliges, oft sehr hübsches Prachtkleid: Dem Kammmolch und dem Teichmolch zum Beispiel schwillt der Kamm extrem stark an, außerdem bekommt der Kamm am oberen Saum Zacken, was die Tierchen fast wie Leguane aussehen lässt, und beim Bergmolch färbt sich der Rücken blau, was einen reizvollen Kontrast zu seinem knallorangefarbenen Bauch und der schönen mosaikartigen Punktung am Rückenkamm, an den Flanken sowie im Kopf- und Halsbereich bildet. Die Hoden schwellen so gewaltig an, dass man sie von außen sehen kann, was normalerweise nicht der Fall ist, weil Lurche nämlich wie Vögel und einige andere Lebewesen eine Kloake haben – die Körperöffnung, durch die sie Harn und Kot sowie Spermien respektive Eizellen absondern –, die Hoden also im Körperinneren liegen.
Zur Paarungszeit bewerben sich mehrere Männchen um ein Weibchen. Sie schlagen mit dem Schwanz, den sie so weit es nur geht abspreizen, um Sexualduftstoffe im Wasser zu verteilen, und umkreisen das Weibchen, als würden sie tanzen, was sehr lustig aussieht. Wer am längsten die Luft anhalten kann – wer schon mal in eiskaltem Wasser apnoe getaucht ist, weiß, dass man da recht kurzatmig ist – und dabei den schönsten »Tanz« aufführt, erregt die Aufmerksamkeit des Weibchens. Schließlich setzt jedes Männchen ein Spermienpaket ab, und das Weibchen nimmt mit der Kloake eines dieser Pakete auf. Es erfolgt also anders als bei den Froschlurchen eine innere Befruchtung. Anschließend »klebt« das Weibchen, das aufgrund seiner doppelten Größe und seines passiven Verhaltens während der Paarung viel länger im Wasser bleiben kann, die Eier einzeln an Wasserpflanzen fest.
Die verrückteste Form der Geburtshilfe leisten die Geburtshelferkröten, die neben der Gelbbauchkröte wahrscheinlich seltenste Krötenart in Deutschland. Sie stoßen zur Paarungszeit das krötentypische »Önk, önk« aus, aber mit einer Lautstärke, dass es einen fast wahnsinnig machen kann. Wenn das Tier dabei in einer Felsenhöhle, einem Erdloch, einem Kellergewölbe oder einem verfallenen Gebäude sitzt (Geburtshelferkröten lieben Burgruinen), klingt es teilweise wie das Schlagen einer entfernten Kirchenglocke – obwohl die Kröte vielleicht nur zehn Meter von einem weg ist –, weshalb der Volksmund sie früher auch »Glockenfrosch« nannte.
Was ist nun so verrückt an diesen Tieren? Das Weibchen stößt die Laichschnüre aus, das Männchen gibt sein Sperma drüber. Bis hierher läuft es also wie bei Erdkröten, wenn auch mit dem Unterschied, dass Geburtshelferkröten es nicht im Wasser, sondern vorzugsweise in einem dunklen, modrigen Versteck, zum Beispiel einem muffigen, stickigen Verlies, treiben. Aber jetzt kommt’s: Das Männchen (!) wickelt sich nun mithilfe etlicher Verrenkungen die Schnüre um seine Hinterbeine, genauer: die Fersengelenke, und trägt sie mit sich herum. Dabei muss der werdende Vater aufpassen, dass es die Eier immer schön feucht haben, er muss sie also notfalls in eine Pfütze tunken und darf nie in der Sonne sitzen. In dem Moment, wo er spürt, dass es in den Laichschnüren zu zappeln beginnt, marschiert er zu einem Gewässer und legt die schlüpfenden Larven ab.
Der meines Wissens einzige weitere Lurch, der sich in irgendeiner Weise um die Nachkommen kümmert, ist der Darwin-Nasenfrosch. Das Männchen bewacht die Eier so lange, bis die Kaulquappen schlüpfen. Dann schluckt er sie. Aber nicht ganz, nur in den Kehlsack. Dort dürfen sich die Kleinen zu Fröschlein umwandeln, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden. Erstaunlicherweise kann der Frosch-Papa trotzdem weiter futtern. Der Nasenfrosch ist übrigens der einzige Nicht-Fisch unter den Maulbrütern. Unter den Maulbrütern wiederum ist er der Einzige, der seinen Nachwuchs permanent – beziehungsweise bis die Kleinen auf eigenen Beinen stehen – auf diese Weise vor Fressfeinden schützt. »Maulbrütende« Fische, die meisten davon Buntbarsche, nehmen ihre Kleinen nämlich nur dann ins Maul, wenn Gefahr droht. Der Vorteil ist, dass ein Nasenfrosch-Weibchen nur etwa dreißig, vierzig Eier ablegen muss, weil alle das Froschstadium erreichen. Ein Grasfrosch-Weibchen hingegen legt zwischen tausend und 2500 Eier und das Erdkrötenweibchen bis zu 8000, und trotzdem gibt es ein paar Wochen später nur ein paar mehr Grasfrösche und Erdkröten auf der Welt, weil die meisten Eier entweder sofort oder als Kaulquappen von Barschen oder Karpfen, Kolbenwasser- oder Gelbrandkäfern, räuberischen Libellenlarven, einem Vogel oder einem anderen Fressfeind vertilgt werden.
Der Darwin-Nasenfrosch betreibt aber nicht nur die völlig artuntypische Brutpflege, sondern hat auch ein total witziges Paarungsverhalten. Da es in seiner Heimat, einem ganz speziellen, immergrünen Ökosystem an der Pazifikküste Chiles, praktisch ständig regnet und es daher an Land fast genauso nass ist wie im Wasser, findet die Fortpflanzung der Einfachheit halber gleich an Land statt. Zuvor aber muss der Darwin-Nasenfrosch-Mann einen Bodycheck über sich ergehen lassen und dabei ganz schön was einstecken können. Das rabiate Froschweib tritt ihn nämlich kräftig in die Seite und guckt, wie weit er fliegt. Beschreibt er einen weiten Bogen, weiß sie: Der ist zu leicht und mickrig und daher nicht als Vater meiner Kinder geeignet. Kullert er nur ein Stück weit über den Boden, bedeutet das: Er ist rund und gesund, könnte also ein potenzieller Erzeuger sein. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, wiederholt sie das Spiel zwei-, dreimal. Wenn das nicht eine sehr spezielle Art der Damenwahl ist!
In der Nacht wurde zweimal auf Clarissa geschossen, mit einer abgesägten Schrotflinte. Clarissa war schwanger. Frank, mein zweiter Kameramann, und ich waren mittlerweile seit neun Tagen hinter ihr her und hatten sie in dieser Zeit nur dreimal kurz vor die Kamera bekommen.
Clarissa ist Namibierin – und einer der seltenen Wüstenelefanten, die es weltweit nur in zwei Gebieten gibt: in Mali (rund 350) und eben in Namibia (geschätzte 200).
Namibia ist eines der am dünnsten besiedelten Länder der Erde. Auf einer Fläche mehr als doppelt so groß wie Deutschland leben nur knapp über zwei Millionen Menschen, die meisten von ihnen im verhältnismäßig fruchtbaren Nordosten an der Grenze zu Angola und in den wenigen größeren Städte wie Windhoek, Otjiwarongo oder Swakopmund. Im Westen des Landes erstreckt sich von der Grenze zu Südafrika im Süden bis nach Angola im Norden die Namib, die älteste Wüste der Welt und einer der unwirtlichsten Orte der Erde, und fast die gesamte östliche Hälfte des Landes wird von der Kalahari eingenommen, einer steppenartigen Wüste, die bis weit nach Botswana hinein reicht. Auch in dem Gebiet zwischen Namib und Kalahari herrschen nicht gerade optimale klimatische Bedingungen – es ist, vom äußersten Norden abgesehen, meist heiß und trocken, die Regenfälle können von Jahr zu Jahr höchst unterschiedlich sein, in manchen Regionen auch über Jahre völlig ausbleiben.
Die Namib, der »Ort, wo nichts ist«. Jeder hat schon mal Bilder von den riesigen Dünen gesehen: in der Abendsonne orangerot leuchtende Sandberge von bis zu 400 Meter Höhe, die sich auf einer Breite von 160 Kilometern von der Atlantikküste ins Landesinnere erstrecken. So lebensfeindlich diese Wüste auch wirkt; wenn man genauer hinsieht, wird man überall Leben entdecken: den fast durchsichtigen Sandgecko, das Wüstenchamäleon, die Sandschwimmer-Eidechse, den Apotheker-Skink, die Zwergpuffotter oder Seitenwinderviper, den Mehlkäfer und, und, und. Die meisten dieser Tiere verbringen den Tag im Sand vergraben und kommen nur nachts oder in den frühen Morgenstunden an die Oberfläche. Nur dann wird der feine Nebel, der durch das Aufeinanderprallen des kalten Atlantiks und der warmen Luft über der Landmasse an der Küste entsteht, nicht sofort von der Sonne aufgelöst, sondern bringt etwas Feuchtigkeit in die Wüste. Es gibt auch große Tiere, die den heißen Temperaturen und der Trockenheit bei Tag trotzen, etwa die Oryxantilope. Der Gemsbock, wie das Wappentier Namibias ebenfalls genannt wird, kann seinen Wasserbedarf allein aus der Nahrung decken. Ein wabenartiges, stark durchblutetes System in seiner sehr langen Nase kühlt das durch die Nasenhöhle strömende Blut, das seinerseits die Arterien kühlt, die zum Gehirn führen. Ein ähnliches Prinzip, aber quasi unter umgekehrtem Vorzeichen, haben arktische Tiere, Elche zum Beispiel. Deren Knollennase ist deshalb so riesig, damit die Luft leicht vorgewärmt wird, bevor sie in die Lungen strömt.
Wüstenelefanten könnten in diesem Teil der Namib allerdings nicht überleben. Sie sind weiter im Norden zu finden, im Kaokoveld (oder Kaokoland), wo die Wüste neben Sanddünen noch ein anderes Gesicht zeigt: sehr felsig, mit bis zu 2000 Meter hohen Bergen, von tiefen Tälern und Schluchten durchzogen. Der einzige Grund, warum hier Tiere leben können, die ursprünglich nicht in der Wüste heimisch sind – neben den Wüstenelefanten etwa Wüstenlöwen oder Wüstengiraffen –, ist, dass es in Trockenflusstälern, also in Tälern, in denen nur nach ausgiebigen Regenfällen Flüsse fließen, große unterirdische Wasserreservoirs gibt, deren Wasser an einigen Stellen auch während der Trockenzeit an die Oberfläche tritt und so zum einen den Tieren als Tränke dient und zum anderen, und das ist das Entscheidende, Vegetation wachsen lässt: etwa die Schirmakazie, den Nara-Strauch und den Marula-Baum mit ihren saftigen Früchten, Dornbusch und verschiedene Gräser.
Und der einzige Grund, warum Bewohner einer Wüste, egal ob Mensch oder Tier, in der unwirtlichen Umgebung auf Dauer überleben können, ist, dass sie sehr behutsam mit den Ressourcen umgehen. Elefanten zum Beispiel fressen normalerweise alles, was pflanzlich ist. Weil pflanzliche Nahrung aber sehr minderwertig ist, müssen Elefanten extrem viel fressen, weshalb sie dreizehn, vierzehn Stunden am Tag mit nichts anderem beschäftigt sind. In der Savanne brechen sie häufig Zweige und Äste ab und legen manchmal sogar ganze Bäume um, nur um an die Blätter in der Krone zu kommen, womit sie die Savannen Afrikas mitgestalten und zum Teil sogar erst geschaffen haben. Sie gehen, um es auf den Punkt zu bringen, mit ihrer Nahrungsgrundlage nicht gerade zimperlich um, eher sehr brachial. Ganz anders die speziellen Wüstenelefanten: Sie zupfen mal hier, mal da ein paar Blätter oder Früchte von den Zweigen oder sammeln sie vom Boden auf und ziehen dann zum nächsten Baum. Sie brechen nach Möglichkeit keine Zweige oder Äste ab, als ob sie wüssten, dass sie nachhaltig mit der Nahrungsressource umgehen müssen. Das ist eines der Dinge, die mich am Wüstenelefanten am meisten beeindrucken.
Die Faszination der Namib liegt für mich nicht zuletzt darin, dass man wochenlang unterwegs sein kann – falls man genügend Nahrung und Wasser für sich und Diesel fürs Auto dabei hat und keine größeren Havarien erleidet – und keinem Menschen begegnet. Man wird immer wieder Fährten von Löwen entdecken. Ich erinnere mich an Morgen, da machten Frank und ich das Zelt auf, guckten raus, es war kalt, alles voller Raureif und trotzdem trocken, und zwei, drei Meter neben dem Zelt war eine frische Löwenspur. Wir hatten den Löwen weder gehört noch gerochen. Er ist nicht lange geblieben, ist einfach weitergezogen, aber hatte keine Scheu, an einem klassischen Safaricamp vorbeizugehen. Beeindruckend sind auch die Stürme. Im einen Moment ist schönstes Wetter, strahlend blauer Himmel, und auf einmal kommt Wind auf, aus dem Wind wird ein Sturm. Zwei-, dreimal sahen wir mitten in einem solchen Unwetter Elefanten. Wir wollten das natürlich filmen und fotografieren. Schlecht für die Kameras, ganz klar, und uns selbst knirschte der Sand zwischen den Zähnen, rieb in den Augen. In solchen Momenten hatten wir den Eindruck, in einem Lebensraum zu sein, wo eigentlich kein Leben hingehört, der den Namen Lebensraum gar nicht verdient.
Wüstenelefanten sind übrigens keine eigene Art, sondern Savannenelefanten, die sich im Lauf von Generationen an das Leben in der Wüste angepasst haben. Die korrekte Bezeichnung wäre also »wüstenbewohnende Elefanten«. Wüstenelefanten sind etwas kleiner; das erklärt sich daraus, dass sie sehr viel mehr wandern müssen und dass ihre Nahrung in Quantität und Qualität stark limitiert ist. Sie haben etwas längere Beine mit größeren Sohlen, was ihnen das Laufen auf Sand erleichtert, wenn sie kilometerweit durch Dünengebiete wandern. Sie bilden weit kleinere Herden – mit selten mehr als fünf, sechs Tieren –, und sie brauchen lediglich alle drei, vier Tage Wasser und dann auch »nur« etwa hundert Liter (wobei sie natürlich gern mehr nehmen, wenn sich die Gelegenheit bietet), während Savannenelefanten täglich je nach Größe zwischen hundert und 200 Liter trinken. Ähnlich ist es mit Wüstenlöwen und -giraffen. Sie sind ebenfalls keine eigenen Arten, sondern haben sich schlicht an das Umfeld Wüste angepasst.
Einmal kamen Frank und ich an ein sehr großes Wasserloch. »Groß« heißt im Fall der Namib: mit einem Durchmesser von zweieinhalb bis drei Meter. Da sind immer Tiere, mal ein paar Oryxantilopen und Springböcke, mal Wüstenlöwen, weil sie natürlich wissen, dass sie da Beute machen können. Es kommen vor allem hin und wieder Elefanten. Das heißt, wenn man sich dort ein paar Tage lang von morgens bis abends auf die Lauer legt, bekommt man alles vor die Kamera, was da im Umkreis von mehreren Kilometern so lebt. Irgendwann hat man aber auch selbst mal das Bedürfnis, ins Wasser zu springen und sich frisch zu machen. Frank nicht, der ist bei so etwas überaus vorsichtig, weil er glaubt – und da liegt er nicht ganz falsch –, dass in dem Wasser Keime und Bakterien ihr Unwesen treiben. Ich saß jedenfalls gerade im Wasser, nackt, denn wer denkt bei einem Dreh in der Wüste schon daran, eine Badehose einzupacken, als ein riesiger Elefantenbulle ankam. Er schaute zu mir her, und mir wurde ganz mulmig, Nichts wie raus hier, dachte ich mir, und trat den Rückzug an. Der Bulle wollte natürlich gar nichts von mir, der war einfach nur durstig. Offensichtlich war er bereits mehrere Tage ohne Wasser gewesen, denn er stapfte zielstrebig zum Wasserloch und trank. Und trank. Und trank. Vierzehn, fünfzehn Mal tauchte er seinen Rüssel in den Tümpel, saugte Wasser an – etwa acht bis zehn Liter passen in eine »Rüsselfüllung« – und spritzte es sich ins Maul. Das waren dann also schlappe 120 bis 150 Liter. Nachdem sein Durst gestillt war, nahm er eine Dusche und schließlich ein Staubbad. Und ich stand daneben, immer noch nackt, und habe ihn beobachtet. Es war ein unglaublicher Moment. Ein romantischer Mensch hätte gesagt: »Der toleriert mich, der akzeptiert mich«, und ein esoterisch angehauchter vielleicht: »Ich bin angekommen!« Ich fand es einfach nur grandios. Es war ein tolles Gefühl, in dieser Wildnis neben dem riesigen Tier zu stehen, als ein blass geratener Himba, der nicht einmal einen Lendenschurz tragen musste, weil außer Frank weit und breit kein Mensch war, der sich daran hätte stören können. Das klingt komisch, aber solche Dinge kommen in einem hoch, wenn man längere Zeit in einer weltabgeschiedenen Gegend verbringt. Dieses Gefühl, das man auch in der Tundra in Alaska entwickelt oder im Outback in Australien: in einer gewissen Weise eins zu sein mit der Natur. Und trotzdem wusste ich: Wenn dem irgendetwas nicht passt, kommt der einfach auf mich zu und tritt mich platt.
Wüstenelefanten geben eine ganze Menge Rätsel auf. Kein Mensch weiß zum Beispiel, wann und warum Elefanten ursprünglich in die Namib gezogen sind, wo die Lebensbedingungen in der Savanne doch vergleichsweise viel angenehmer sind. Und tatsächlich ziehen die Wüstenelefanten ab und an in fruchtbare Gebiete. Anhand von Sandproben, die man aus den Zahntaschen sehr alter toter Wüstenelefanten gepult hat, konnte man feststellen, dass die Tiere den Kunene, den Grenzfluss zwischen Angola und Namibia, überquert haben und weit in das jenseitige Land hinein gewandert sein müssen.
Apropos Zähne. Das ist eine gute Gelegenheit, mit einem alten Mythos aufzuräumen. Elefanten ziehen sich nicht zum Sterben auf einen Elefantenfriedhof zurück. Werden Elefanten sehr alt – die Lebenserwartung liegt bei etwa siebzig Jahren –, sind ihre sechsten und letzten Kauzähne irgendwann so abgenutzt, dass sie nur noch sehr zarte Gräser und Blätter fressen können, weshalb sie in Gebiete ziehen, in denen es ausreichend altersgerechtes Futter gibt. Dort sterben sie irgendwann, und so kommt es in bestimmten Gegenden zu einer Anhäufung toter Elefanten beziehungsweise von Skeletten und Stoßzähnen. Stoßzähne gibt es übrigens nicht in sechsfacher Ausfertigung, sondern nur einmal.
Nun weiß man ja, dass Elefanten generell große Streifgebiete haben. Das Überraschende aber ist, dass sie immer wieder in ihre, ich nenne es mal: lebensunfreundliche Heimat zurückkehren. Warum tun sie sich das an? Ob das eine genetische Programmierung ist oder andere Gründe hat, ist nicht bekannt. Vielleicht erscheint die Namib nur uns so karg, während die Elefanten sie gar nicht so empfinden. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft leben ja auch Menschen, die sich ebenfalls an dieses harte Leben angepasst haben: die Himba.
Die Himba sind Halbnomaden, unglaublich friedfertige und ausgeglichene Menschen, die alles ruhig und mit Bedacht anpacken – wahrscheinlich eine Begleiterscheinung des Lebens in der Wüste. Sie ziehen mit ihren mageren Fettschwanzschafen, Ziegen und Rindern einem jährlichen Rhythmus folgend, der sich nach dem Angebot an Weideland richtet, zwischen mehreren Dörfern hin und her. Eigentlich sind diese Dörfer eher Krals: ein paar Hütten aus Palmblättern, Lehm und Dung, so winzig, dass man sich fragt, wie darin eine ganze Familie leben kann, umgeben von einem Zaun aus getrockneten Akazienzweigen. Die Männer hüten das Vieh oder sitzen vor der Hütte und gucken den Frauen bei der Arbeit zu: wie sie Mais oder Hirse zu Mehl zerreiben, ein Essen zubereiten oder Lehm und Kuhdung vermengen, um eine Hütte auszubessern oder neu zu bauen. Der Kuhdung verbreitet wegen des heißen, trockenen Klimas übrigens allenfalls einen Hauch von Lagerfeuergeruch. Das macht, finde ich, trockene Länder so angenehm. Ist man bei gleicher Temperatur, sagen wir 35 Grad im Schatten, im Regenwald unterwegs, riecht wegen der hohen Luftfeuchtigkeit alles gammelig, modrig.
Da im Kaokoveld Wasser extrem kostbar ist, dürfen sich Himbafrauen – im Unterschied zu Männern – ab der Pubertät nicht mehr waschen. Stattdessen nehmen sie täglich ein Rauchbad, das mit Rindenstücken und Kräutern aromatisiert ist. Der Rauch öffnet die Poren, und der austretende Schweiß reinigt die Haut von Schmutz und Bakterien. Nachteil dieser Art der Körperhygiene ist, dass der Rauch mit der Zeit die Bronchien angreift, weshalb vor allem ältere Himbafrauen von einem hartnäckigen Husten geplagt sind. Bei der Babypflege verlassen sich Himba übrigens häufig auf Hunde, heißt, dass die Hunde die Babys sauber lecken. Dass Hunde für die Entsorgung von Menschenkot zuständig sind, kenne ich auch von anderen Wüstenvölkern, weshalb der Hund bei vielen von ihnen als unreines Tier gilt und entsprechend schlecht behandelt wird. Nicht so bei den Himba.
In erster Linie sind die Himba aber nicht für ihre Krals oder für ihre Rauchbäder bekannt, sondern für ihre Schönheit. Von Natur aus hochgewachsen, langbeinig und schlank, verleihen sie ihrem Äußeren eine exotische Note durch eine Paste aus Butterfett und dem aromatischen Harz des Omuzumba-Strauches – die Frauen mischen zusätzlich roten Ocker darunter –, mit der sie ihren ganzen Körper einreiben und so der Haut einen samtigen Schimmer verleihen. Ein wirklich hübscher Anblick, auch wenn dieses Ganzkörper-Make-up für die Himba in erster Linie den Zweck erfüllt, sie vor der Sonne und Ungeziefer zu schützen.
Außer einem Schurz aus Leder oder Fell tragen die Frauen nur Schmuck aus Naturmaterialien, den allerdings in Mengen. Die kunstvoll gefertigten Haarreifen, Halsketten, Armbänder, Fußgamaschen und Gürtel, die zusammen mehrere Kilogramm wiegen können, lenken in ihrer Pracht zu einem gewissen Grad von der Nacktheit ab, geben aber auch, wie die zig verschiedenen Arten, das Haar zu tragen, Auskunft über den Status einer Frau.
Die Attraktivität dieser Frauen weckt Phantasien und Begierden bei manch, ich nenn ihn mal pauschal: weißem Mann. Das Thema exotische Sexualität oder Erotik spielt dabei mit Sicherheit ebenfalls eine Rolle. Aber kann ein Mann aus unserem Kulturkreis sich wirklich auf Dauer in das Leben der Himba einfinden? Kühe hüten und mit den anderen Männern palavern? Ich glaube, dass der Reiz, den eine Himbafrau anfangs ausübt, relativ schnell verfliegt, wenn der Alltag eintritt und sich die Beziehung, wenn es denn zu einer kommt, bewähren muss. Dass solche Beziehungen letztlich meist zum Scheitern verurteilt sind, hat man nicht zuletzt bei der »Weißen Massai« gesehen. Egal wie gut sich jemand an eine völlig andere Kultur anpasst und sich integriert: Er ist und bleibt in einer gewissen Weise immer ein Fremdkörper.
Die Einzigartigkeit der Himba und ihr einfaches, der Natur angepasstes Leben abseits der Zivilisation ziehen immer mehr Öko- und Ethnotouristen an, und mit ihnen kommen die »Errungenschaften« der Zivilisation ins Kaokoveld. Immer häufiger sieht man bettelnde und betrunkene Himba, früher unvorstellbar. Bedroht ist ihre Kultur auch durch den geplanten Bau eines Staudamms an den Epupa-Wasserfällen, gegen den die Himba seit Jahren friedlichen Widerstand leisten.
Noch aber gibt es sie, und noch ist das Leben der Himba ein ständiger Kampf ums Überleben, geprägt von Wasser- und Lebensmittelknappheit. Da sie von ihren mageren Tieren allein nicht leben können, bauen sie zwischen ihren Wanderungen Mais und Hirse an, die auf dem kargen Boden allerdings wenig Ertrag bringen. Die dürren Halme wecken nichtsdestotrotz die Begehrlichkeit von Elefanten, die ständig auf der Suche nach Fressbarem sind. Konflikte sind daher unausweichlich, und die Konsequenz daraus bekamen Frank und ich zu spüren.
Wüstenelefanten ziehen auf festen Wanderwegen, die sie so gut kennen wie wir Menschen den Weg zur Arbeit oder zu unserer Stammkneipe. Aber wie das so ist in einem mehrere Tausend Quadratkilometer großen Gebiet: Man weiß zwar ungefähr, wo sich die Tiere aufhalten, sie aber tatsächlich zu finden, ist eine andere Sache. Vor allem, wenn man bestimmte Tiere sucht, so wie wir Clarissa. Zum einen bilden sie, wie schon erwähnt, sehr kleine Herden, die ohnehin schwierig auszumachen sind. Und zum anderen sind Wüstenelefanten extrem agil, weil die wenigen Stellen, wo sie Futter und Wasser finden, weit auseinander liegen. Es sieht zwar so aus, als würden sich Elefanten sehr langsam und gemächlich bewegen, doch schon bei normalem Schritttempo legen sie acht bis zehn Kilometer pro Stunde zurück. Selbst wenn man eine einigermaßen frische Spur entdeckt, hat man daher kaum eine Chance, sie einzuholen, schon gar nicht, wenn man, wie Frank und ich, zu Fuß mit Rucksack und Kameraausrüstung unterwegs ist. Selbst mit einem Geländewagen würde man ihnen in dem unwegsamen Terrain nicht besser folgen können, weshalb wir den Wagen die meiste Zeit irgendwo stehen ließen. Davon abgesehen gibt es im ganzen Kaokoveld praktisch keine Straßen, nur Sandpisten, die man sich immer wieder neu suchen muss, weil der Wüstensand sie ständig verweht.
Ende der Leseprobe