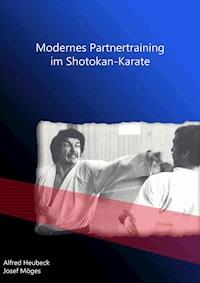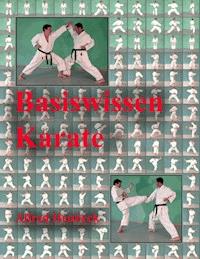
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch richtet sich an Interessierte, die sich mit dem Gedanken tragen, mit Karate anzufangen und ebenso an Anfänger, die sich nach dem Training weiter über die wesentlichen Grundlagen informieren wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Alfred Heubeck
Geb. 1947, Studiendirektor Mathematik, Physik, Informatik,
Karate seit 1962, Schwarzgurt seit 1968
7.Dan Karate 1.Dan Kyusho,
A-Trainer seit 1978, Karatelehrer seit 1999
Inhalt
Karate, was ist das?
Geschichtlicher Hintergrund
Bestandteile des Trainings
Gymnastik
Kata
Kihon
Kumite
Gürtelfarben
Karatepraxis
Grundprinzip
Grundtechniken
Stellungen und Schrittbewegungen
Abwehrtechniken
Angriffs- und Gegenangriffstechniken
Fußtechniken
Kihon-Training
Kata-Training
Taikyoku Shodan
Heian-Shodan
Kumite-Training
Nachwort
Dank
Glossar
Karate, was ist das?
Die Frage aus der Überschrift stellt für jeden ehrlichen Karatelehrer eine fast unlösbare Herausforderung dar: Eine kurze Antwort ist fast unmöglich und auch eine ausführliche wird unvollständig bleiben. Trotzdem soll hier der Versuch gewagt werden wenigstens kurz die zentralen Aspekte darzustellen.
Geschichtlicher Hintergrund
Karate kommt aus Japan und ist einmal eine Kampfsportart, bei der mit Faustschlägen und Fußstößen um Punkte gekämpft wird. Allerdings werden die Techniken unmittelbar vor dem Auftreffen gestoppt, es wird auf die Trefferwirkung verzichtet. Nur die Kampfrichter beurteilen, ob ein Angriff punktewürdig war. Karate ist aber ursprünglich und auch heute noch eine waffenlose1 Selbstverteidigung, bei der die menschlichen Gliedmaßen als natürliche Waffe eingesetzt werden.
Kampfkünstler aus China brachten seit dem Mittelalter immer wieder ihre Kenntnisse nach Okinawa. Dort vermischte sich ihre Kampfkunst mit der dort bereits existierenden Selbstverteidigung und es entstand die Schule der „China-Hand“. Diese beinhaltete Schläge und Tritte, Würfe, Hebel, Festhaltegriffe und die Kenntnis angreifbarer, empfindlicher Körperstellen.
Historische und politische Veränderungen zwangen die Kampfkunstlehrer aus Okinawa zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihr Wissen auch in Japan weiterzugeben. Um nicht in Konkurrenz zu den traditionellen japanischen Kampfkünsten zu geraten, auch um nicht die letzten Geheimnisse an den ehemaligen Besatzer zu verraten, wurde nur das Schlagen und Treten beibehalten, die anderen Elemente wurden entfernt. Aus dem Namen Kara-Te „China-Hand“ machte Funakoshi Gichin2 Karate, die „leere Hand“. Das Wort wird zwar gleich ausgesprochen, aber mit anderen Schriftzeichen geschrieben. Mit diesem genialen Schachzug entfernte er die Beziehung zum in Japan ungeliebten China und stellte eine Verbindung zum japanischen „Zen-Buddhismus“ her, bei dem die „Leere“ ein zentraler Begriff ist.
Nach dem zweiten Weltkrieg verschob sich die Bedeutung, die „Kriegstechnik“ und Selbstverteidigung, alles wurde dem Wettkampfsport untergeordnet3. Zurzeit findet aber eine Neuorientierung statt, bei der auch andere Aspekte wieder anfangen, sich neben dem Wettkampfsport zu behaupten. Gerade diese Inhalte4 machen Karate für Gruppen interessant, die sich nicht im Wettkampf messen, aber trotzdem sportlich betätigen wollen.
Bestandteile des Trainings
Das Karate-Training besteht aus 4 zentralen Elementen
Anfangs- und Schlussgymnastik
Kihon Grundschule, Training der Techniken
Kata wörtlich Form, Choreographie aus verschiedenen Techniken
Kumite
5
Training mit Partnern
Diese Teile wurden früher strikt getrennt geübt, heute werden die Bestandteile Kihon, Kata und Kumite in Training oft gemischt.
Im zweiten Teil dieser kurzen Einführung wird die praktische Seite dieser Elemente genau gezeigt, hier sollen erst die Inhalte kurz beschrieben werden.
Gymnastik
Die Aufgaben der Gymnastik im Karate unterscheiden sich kaum von denen in anderen Sportarten. Die Anfangsgymnastik soll die Muskeln aufwärmen und dehnen, den Kreislauf aktivieren und die Gelenke schmieren. Als Methoden kommen, abhängig von der Zusammensetzung der Teilnehmergruppe, statische und dynamische Übungen in Frage. Dabei können die Inhalte der Gymnastik variiert werden, das macht die Gymnastik interessant und anspruchsvoll, sie kann aber auch schematisiert werden (Ritualgymnastik), das wiederum führt im Allgemeinen zu einer vollständigen Übungsfolge und bereitet nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch sehr gut auf das Training vor.
In der Schlussgymnastik können, wieder abhängig von den Bedürfnissen der Übungsgruppe, konditionelle Übungsteile enthalten sein, vor allem aber steht hier das „cool down“, das Herunterfahren des Körpers im Vordergrund.
Kata
Eine Kata ist eine Folge von etwa 20 bis 60 Schritten und Techniken, die in einer präzisen Choreographie bis in die kleinste Bewegung festgelegt ist. In einer Kata hat ursprünglich einmal ein Lehrer die wichtigsten Inhalte seiner Schule zusammengefasst. Die Kata stellt für den Schüler einen Übungsauftrag und eine Gedächtnisstütze dar. Sie war besonders früher nötig, in einer Umgebung und Zeit, in der schriftliche Aufzeichnungen unüblich waren.
Kihon
In der Regel wird Kihon kurz mit Grundschule übersetzt, in dem Wort ist aber auch der der Hinweis auf Energie- und Techniktraining enthalten. Während die Karatebewegungen in der Kata in komplexen Schrittbewegungen und Wendungen in abwechslungsreicher Kombination geübt werden, werden in der Grundschule die grundlegenden Stellungen, Schritte, Arm- und Fußtechniken isoliert und mit einfachen Vorwärts- und Rückwärtsschritten geübt. Perfektion, Kraft und Dynamik sind dabei genauso Übungsziel wie die Verbesserung der Kondition mit Ausdauer und die Schulung des Durchhaltewillens.
Kumite
Kumite ist der Kampf. Das Kumite-Training ist das Üben mit dem Partner für den Kampf. Die verschiedenen Übungsformen beginnen mit einer Art Grundschultraining mit Partner. Spätere Übungsformen werden Schritt für Schritt immer freier und variabler in der Nutzung der Karate-Techniken. Sie enden dann für Sportler im freien Kampf nach Regeln oder im Üben praxisbezogener Beispiele für die Selbstverteidigung. Hier werden auch Anwendungen herangezogen, die ungenau als „Bunkai6“ bezeichnet werden und Interpretationen von Katabewegungen sind.
Gürtelfarben
Im Karate soll der Fortschritt, Einsatz und Lernerfolg durch die Gürtelfarben gezeigt werden. Außerdem ermöglichen diese auf einfache Weise im Partnertraining adäquate Gegenüber zu finden und beim Grundschultraining in eine Gruppe etwa gleich ausgebildeter Karateka zu üben.
Man unterscheidet zwischen jeweils 10 Kyu- und 10 Dan-Graden7, zwischen Schüler- und Meistergraden:
Die Schülergrade sind farbig und gehen von weiß (10. Kyu, vor der ersten Prüfung), weiß(-gelb), (9. Kyu), gelb (8. Kyu), orange (7. Kyu), grün (6. Kyu), blau (5. Kyu), blau (4. Kyu), braun (3. Kyu), braun (2. Kyu) zu braun (1. Kyu). 10. bis 6. Kyu gelten als Anfängergrade. Bei ihnen steht das Erlernen von Bewegungen im Vordergrund. Die Blaugurte, die Mittelstufe, sollten die wichtigsten Bewegungen kennen. Hier liegt der Schwerpunkt in der Übung der Bewegungen. Dabei sind jetzt auch komplexere Kombinationen von Techniken enthalten. Die Braungurte bilden die Gruppe der Fortgeschrittenen. Die Feinform der Bewegung soll hier trainiert und eingeschliffen werden.
Die zehn Dangrade haben einen schwarzen Gürtel. (Wie in anderen japanischen Disziplinen wären für höhere Dangrade auch rote Gürtel möglich. Diese gelten aber als die Gürtelfarbe der „älteren Herren“ und die „gibt es im Karate nicht!“) In Japan existieren noch eine Reihe von Ehrenbezeichnung. Die wichtigsten sind Sempai (1. bis 3. Dan, Vorgänger, älterer Partner), Sensei (4. und 5. Dan, Lehrer, Meister) und Shihan (ab 6. Dan, Großmeister)8.
1 Zwar ist Karate eine waffenlose Selbstverteidigung, aber es gibt ursprünglich eine enge Beziehung zum Kobudo, der Kampfkunst Okinawas mit einfachen Waffen.
2 Funakoshi Gichin brachte als erster Karate nach Japan und wurde dort einer der wichtigsten Karatelehrer. Er ist Begründer des Shotokan-Karate.
3 Das geschah nicht ganz freiwillig. Wenn nicht auf Selbstverteidigung und Kobudo (SV mit einfachen Waffen aus Okinawa) verzichtet worden wäre, hätten die amerikanischen Besatzer nach dem 2. Weltkrieg Karate verboten.
4 Ausgleichssport, Selbstverteidigung, Stärkung der Psyche, Spaß und Gemeinschaft, usw.
5 Kumite wird oft mit „Kampf“ übersetzt, besser wäre „Üben mit Partner“.
6 Bunkai ist genau genommen die Analyse einer Katabewegung, nicht das eine gewählte Beispiel.
7 Diese Einteilung entspricht der offiziellen DKV-Ordnung
8 Für höhere Dangrade ist in Japan eine weitergehende Differenzierung der Ehrenbezeichnungen möglich und üblich. In Europa wird meist darauf verzichtet.
Karatepraxis
Grundprinzip
Karate enthält zwar die notwendigen Techniken für nahezu alle denkbaren Situationen in der Selbstverteidigung, aber hier können und sollen nur die grundlegenden davon herausgegriffen werden. Diese Basis, je nach dem gedachten Bild, der Stamm oder das Fundament des Karate, kann so beschrieben werden:
Ein Angreifer will den Verteidiger entweder Schubsen, Schlagen, Stoßen oder Treten9