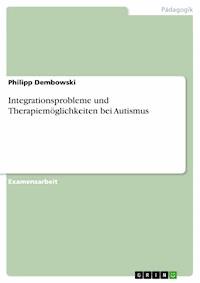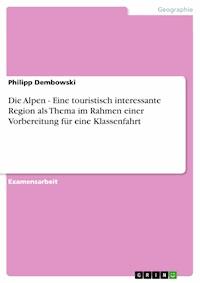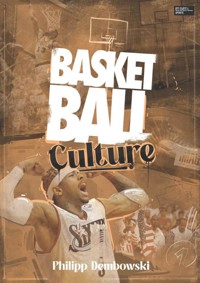
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses außergewöhnliche Buch erzählt nicht nur die Geschichte des Basketballsports von James Naismith über Dr. J bis LeBron James und Dirk Nowitzki. Vielmehr verknüpft Autor Philipp "Dembo" Dembowski die sportliche Entwicklung mit der kulturgeschichtlichen – vom Kampf der afroamerikanischen Spieler in den USA für mehr Gleichberechtigung, über die Herkunft lässiger Baller-Outfits, fette Rhymes und Hip-Hop-Beats bis hin zur Frage, welches Basketballschuhdesign das beste aller Zeiten ist. Ein Buch, das kracht wie ein Slam Dunk von Michael Jordan oder ein Alley-Oop von Shaquille O'Neal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ich widme dieses Buch meiner Frau und meinen beiden Kindern, die mich bei dieser Reise mit viel Geduld, Rückenwind und Liebe unterstützt haben.
Und natürlich der Basketball Culture, ohne die ich diesen Trip niemals angetreten hätte.
Danke an meine Familie. Danke, Basketball Culture.
Inhalt
Was bedeutet Basketball Culture?
1 Hier beginnt die Kulturgeschichte des „Basket Balls“
2 Segregation und Basketball
3 The Grandfather of Black Basketball
4 Die Ära der Black Fives
5 New York Renaissance
6 Die Harlem Globetrotters
7 Die andere Seite
8 Zwei Kulturen prallen aufeinander
9 Die Wende, Teil 1
10 Die Wende, Teil 2
11 Die Wende, Teil 3
12 Ist Detroit „The Mecca of Basketball“?
13 Die Anfänge einer Subkultur
14 Der Aufstieg eines Riesen
15 Die Gier des kleinen Mannes
16 Zurück im Land der zehntausend Seen
17 Die Aufruhr
18 Welcome, National Basketball Association!
19 Das alles verändernde Spiel
20 Basketball und der Kalte Krieg
21 Changes
22 Noch mehr Veränderungen
23 Der Beginn einer Dynastie
24 Eine jahrhundertelange Rivalität
25 Der Held von Moskau
26 Eine Rivalität, die eigentlich keine war
27 Zwei Pioniere der Basketball-Kultur
28 Der Basketball schreibt erneut Geschichte
29 Das Konzept, das keines war
30 Eine Liga für sich
31 Im Schatten der NBA
32 Ein Mord, der das Land erschütterte
33 Die wilden Siebziger
34 Die wilden Siebziger – Kool as Clyde
35 Die wilden Siebziger – First of it’s Kind
36 Die wilden Siebziger – We Need A Doctor
37 Die wilden und juristischen Siebziger
38 Die wilden Siebziger – Bad News
39 Die wilden Siebziger – Die Fusion
40 The Dark Ages
41 Der erste Eindruck
42 Der ruhige Aktivist
43 Let the Magic happen!
44 Showtime, Baby!
45 Die Dark Ages von Magic Johnson
46 Ein Spiel, das alles veränderte
47 Sneaker Wars
48 Adidas und die neue Schule des HipHop
49 Eine Geschichte von Spinnen und Ziegen
50 Barcelona 1992
51 Deine Mutter ist ein Astronaut
52 A Tale of three Cities
53 Master On Both Sides
54 Mr. Basketball Culture
55 Der Basketball-Culture-Virus
56 Der Sneakerkult
57 Und Eins!
58 Digital Nomads
59 No Justice, No Peace!
60 Träumer
Epilog
Was bedeutet Basketball Culture?
Basketball Culture. Ein großer Begriff. Ein Begriff, der bei jedem Menschen aus der Szene andere Emotionen und Erinnerungen hervorruft. Die einen schwelgen in Gedanken an die längst vergangenen Tage aus der eigenen Jugend. Andere wiederum denken an das nächste Training in der Halle. Für jeden fühlt sich Basketballkultur anders an. Kennst du das? Du stehst auf dem Freiplatz und fühlst dich wie ein NBA-Superstar, weil du einen Ball spektakulär im Korb versenkt hast. Du denkst an die neuen Schuhe, deren markanter Geruch dein Herz höherschlagen lässt. Bässe, Beats und rauer Sprechgesang bringen dein Blut in Wallung.
Wenn du sofort weißt, was ich meine, dann bist du einer von uns. Ein Baller. Für uns ist Basketball mehr als Sport. Aber woher kommt das alles eigentlich?
Als Zehnjähriger habe ich alle Klischees eines „Ballers“ erfüllt: Meine Eltern haben mich fast stündlich ermahnt, meine Hose hochzuziehen, in der Schule trug ich statt T-Shirts viel zu große Trikots, dazu weite Sneaker. Der Nachmittag wurde auf dem Freiplatz verbracht – Moves ausprobieren. Sobald einer meiner Lieblingsrapper ein Album herausbrachte, habe ich mir beim Hören vorgestellt, in New York zu leben. Sobald die neue Ausgabe eines Basketballmagazins erschien, bin ich von Kiosk zu Kiosk gelaufen, um eines der seltenen Exemplare abzugreifen. Beim Aufschlagen der ersten Seiten fühlte ich mich sofort in den Big Apple versetzt. Ich war wie im Bann, besessen von der Basketball Culture. Und bin es heute mehr denn je.
Basketball ist meine Identität. Mein Antrieb. Mein Ventil. Meine Inspiration. Doch es ist nicht der Sport allein, der mich kickt. Es ist die Kultur um den Sport herum. Eine Kultur, bei der auch ich mich immer gefragt habe, was genau sie ausmacht und woher sie eigentlich stammt.
Du weißt, was ich meine.
Für dich, mich und uns alle bin ich eine Reise angetreten, bei der ich in fast jede Ecke dieser Kultur geblickt habe. Eine Reise, die uns Antworten auf die alles entscheidende Frage geben soll: Warum lieben wir diesen Sport so sehr?
Philipp „Dembo“ Dembowski
1 | Hier beginnt die Kulturgeschichte des „Basket Balls“
Die Geschichte der Basketballkultur beginnt nicht auf einem rauen Freiplatz, wo sich eine Handvoll Spieler um ihre vermeintliche Streetballehre duellieren. Nein. Auch wenn das viele Menschen sicher vermuten, beginnt die Geschichte der „Culture“ ganz woanders …
Der Anfang unserer Geschichte wird in einem kleinen Trainerbüro in einer alten Turnhalle in Springfield, Massachusetts geschrieben. Dort teilen sich zwei Personen – die Schulsekretärin Mrs. Lyons und der Sportlehrer James Naismith – die wenigen, mit zwei Schreibtischen zugestellten Quadratmeter. Am Rand des einen Tisches stapeln sich Papierberge, dazwischen Stifte, Locher, Tacker und andere Bürogegenstände, wie man sie 1891 in einem Büro der YMCA International Training School erwarten darf. Auf dem anderen Schreibtisch herrscht penible Ordnung. Als würden sich Dr. Jekyll und Mr. Hyde gegenübersitzen. Genie und Wahnsinn.
Eines Tages, es ist der 7. Dezember 1891, stürmt der Direktor für Leibeserziehung in das Büro seiner beiden Mitarbeiter. Er ist genervt, weil er den Eltern eines seiner Schüler einen Sportunfall beichten muss, wie so häufig im Winter. Da wird es in Massachusetts richtig kalt, die Footballfelder sind meist unbespielbar, und die Jugendlichen müssen sich in der Halle austoben.
Wer Football kennt und weiß, wie brutal die Sportart sein kann, braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, für wie viele Verletzungen die Hallenversion sorgt. Deshalb beauftragt der Direktor den Sportlehrer James Naismith in klaren Worten damit, einen neuen, ungefährlichen Winter-Hallensport zu entwickeln. Naismith ist skeptisch. Der 30 Jahre alte kanadische Holzfäller, der selbst erst acht Jahre zuvor seinen Highschool-Abschluss erhalten hat, weiß, was testosterongesteuerte Jugendliche an Football besonders lieben: den harten Körperkontakt.
Auf diese Aufgabe würde man heute vermutlich ein ganzes Team von Erziehern, Sportpsychologen, Lehrkräften und Raketenwissenschaftlern ansetzen. James Naismith benötigte dazu lediglich seine Kollegin, eine Schreibmaschine und ein Blatt Papier – vom ordentlichen Ende des Schreibtischs.
Während die beiden also die Köpfe rauchen ließen und ihr Büro in eine Denkfabrik verwandelten, kam Naismith eine Idee. Er erinnerte sich an das „Duck-on-a-rock“-Spiel aus seiner Kindheit. Das Ziel war hier, eine auf einem Felsen stehende Ente (keine echte) mit einem Stein herunterzuschießen. Dieses Kinderspiel war seine Inspirationsquelle. Nur 60 Minuten später hatte er die 13 Regeln eines neuen Hallensports niedergeschrieben. Sie machen bis heute den Kern einer der beliebtesten Sportarten der Welt aus. Über seine 13 Regeln setzte James Naismith zwei Wörter: Basket Ball. Naismith und Lyons erfanden innerhalb von nur einer Stunde die Sportart, und bereits in der nächsten Sportstunde probierte der Sportlehrer seine Erfindung aus. Er besorgte dafür einen Paneel-Ball, eine Art Volleyball, und bat den Hausmeister, zwei Pfirsichkörbe zu organisieren. Die Körbe ließ er in einer Höhe von 3,05 Meter aufhängen, was bis heute den internationalen Standard setzt. Zunächst aber schien ihm der Bewegungsdrang seiner Schüler einen Strich durch die Rechnung zu machen. Naismith hatte tatsächlich geplant, „Basket Ball“ zu einer Sportart zu machen, bei der nicht gerannt werden darf – reines Davonstürmen war verboten. Man sollte den Ball passen, anstatt sich gegenseitig umzuhauen. Er wollte, dass die Jugendlichen gemeinsam an Lösungen arbeiten, um zu Korberfolgen zu erlangen. Den Kontakt mit der Schulter, Schubsen, Beinstellen, also alles, was in Sportarten wie Rugby oder Football die Regel war, untersagte Naismith. Stattdessen sollte der Paneel-Ball schlicht in die Pfirsichkörbe geworfen werden …
Wie man sich vorstellen kann, waren die Jugendlichen von diesem neuartigen und völlig körperkontaktlosen Spiel wenig begeistert. Sie wollten ihre Energie rauslassen, Testosteron will Vollkontakt! Und nun sollten sie nicht rennen, sich nicht berühren, dafür einen Ball in irgendwelche Körbe werfen? Naismiths Schüler, die Tacklings gewohnt waren, ließen sich zunächst nicht davon abbringen, weiterhin zu schlagen, zu rangeln, zu schubsen und sich zu prügeln. Der Platz war einfach zu eng für 18 Spieler. Daher reduzierte Naismith die Anzahl von neun Spielern pro Team auf fünf. Aber das erste Basketballspiel in der Sportgeschichte wurde am 21. Dezember 1891 mit 18 Spielern ausgetragen.
Bei all dem, was wir über den Basketball wissen, ist es kein Wunder, dass ein Spiel mit so vielen Akteuren nur wenig Punkte ergab. Das Resultat ist dennoch überraschend. Nach zweimal 15 Minuten Spielzeit stand es lediglich 1:0 – wahrlich kein klassisches Basketball-Ergebnis. Den einzigen Korberfolg hatte ein Student namens William R. Chase erzielt, der keine Ahnung hatte, dass er damit in die Geschichtsbücher einziehen würde – als erster „Baller“ sozusagen.
Was hat nun die verrückte Entstehungsgeschichte der Sportart Basketball mit der Basketball Culture und der Idee zu diesem Buch zu tun? Sehen wir uns William Chase genauer an, ist der Typ eigentlich weit entfernt davon, ein echter „Baller“ zu sein.
Zugegeben, der Anzug, den Chase auf dem einzigen Bild trägt, das man von ihm findet, hätte auch heute noch Stil. In Kombination mit seinem Moustache wäre er auch in einem der Hipster-Kieze in Berlin sicher gut angekommen. Aber wie ein typischer Baller nach heutigen Maßstäben sieht er nicht aus. William Chase hatte keinen Swag. Er trug kein Trikot und auch freshe Sneaker gab es damals nicht. HipHop war noch nicht erfunden. Hoodie, Sammelkarten oder Baggy Pants? Fehlanzeige.
Heute wäre ein Bild eines Ballers anders. Heute sind Basketballspieler Mode-Ikonen. In den Katakomben der NBA-Arenen sehen wir Spieler mit ihren „Tunnel Fits“ das Swag-Level auf eine neue Ebene heben. Wir sehen Spieler, die jedes Outfit nur einmal anziehen, und die so aussehen, als kämen sie gerade von einer Pariser Fashionshow, und würden in ihrem Streetstyle die Laufstege der Welt statt ihre Gegner aufmischen. Bei all dem ist uns auch heute eines klar: Das sind Baller.
Woher kommt dieses Bewusstsein, und warum ist es heute selbstverständlich, Basketball mit Mode, Musik und zahlreichen Subkulturen zu assoziieren? Nicht grundlos haben wir im Porträt von William R. Chase vergeblich nach typischen Basketball-Accessoires gesucht, nach dem, was wir für charakteristisch für die Basketball Culture erachten.
Der Basketball musste sich zunächst einmal selbst finden. Erst später fingen die Baller an, sich Kapuzen an ihre Pullover zu nähen und sich zu Bässen und Reimen zu bewegen. William Chase ist noch weit weg von Trashtalk auf Streetballplätzen und Abhängen an der Spielkonsole mit Freunden nach einer Runde NBA.
Für die Baller der 1890er-Jahre war es die größte Innovation des Sports, Löcher in die Pfirsichkörbe zu sägen, sodass sie den Ball nach einem Korberfolg nicht immer mit einem Stock herausstochern mussten. Das war die vielleicht grandioseste Idee nach der Erfindung des Sports. Einige Jahre später hatte auch der Paneelball ausgedient. 1894 erhielt die acht Jahre zuvor gegründete Firma Spalding den Auftrag von Naismith, einen speziellen Ball zu entwickeln.
Während Ball und Korb sich veränderten, wuchs die Beliebtheit des Sports rasant. Andere Schulen wurden aufmerksam auf das Wurfspiel mit Pfirsichkörben. Bereits 1893 spielte Naismiths YMCA ihr erstes College-Basketballspiel gegen die Vanderbilt University. Der Score mit 9:6 für Vanderbilt war dabei schon deutlich höher als beim ersten Spiel, wenngleich die Punkteausbeute immer noch meilenweit entfernt von heutigen Scores war.
Nachdem Schulen, Colleges und andere Institutionen auf den „Hype-Train“ namens „Basket Ball“ aufgesprungen waren, ließen die ersten Profiteams nicht lange auf sich warten. Nur acht Jahre, nachdem der Erfinder des Basketballs die 13 Regeln des Spiels auf einem Stück Papier notiert hatte, wurde die erste Profiliga gegründet: 1898.
Man nannte diese Liga zwar „National Basketball League“, doch mit „National“ hatte die Spielklasse damals nicht viel zu tun. Es nahmen lediglich sechs Teams teil, bei 19.495 Städten in den USA eine verschwindend geringe Zahl. Was den Namen noch absurder erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass drei der sechs Teams in Philadelphia ansässig waren und die anderen drei Franchises aus New Jersey kamen. Dennoch: Die Clover Wheelmen, die Germantown Nationals und die Hancock Athletic Association aus Philadelphia bildeten mit den Millville Glass Blowers, den Camden Electrics und den Trenton Nationals aus New Jersey die erste Basketball-Profiliga der Welt: die National Basketball League.
Der neue Hallensport entwickelte sich raketenhaft, der Sport wurde immer beliebter. Die sportlichen Strukturen kamen allerdings nicht ganz hinterher. Die Profiteams wurden chaotisch geführt, es gab keine Verträge, keine festen Spieler und auch sonst nichts, was einer heutigen NBA-Organisation gleichen würde. Zwei der in Philly ansässigen Teams meldeten sich noch in der ersten Saisonhälfte wieder vom Spielbetrieb ab. Ihre Premierensaison brachte die NBL mit nur vier Teams zu Ende. Die Trenton Nationals dürfte das wenig gestört haben, als sie die Trophäe der ersten Meisterschaft im Profibasketball in die Luft hievten. Ein Erfolg, der offenbar niemanden im Bundesstaat inspirierte. Die meisten Spieler aus New Jersey wollten in die neugegründete Philadelphia League wechseln. Basketball war hier voll im Trend, die NBL hingegen war es nicht. Nach nur fünf Spielzeiten war Schluss.
Ab jetzt wird’s etwas kompliziert. Neben der Philadelphia League gründeten sich auch die Eastern League und die Central League. Das wiederrum inspirierte die New Yorker, die Hudson River League zu gründen, die kurze Zeit später in New York State League umbenannt und alsbald vergrößert wurde.
So unterschiedlich die Ligen waren, hatten sie allerdings eines gemein: chaotische Zustände. Die meisten Spieler hatten keine Verträge und spielten deshalb für denjenigen, der mehr Geld bezahlte. Dieser kleine, aber feine Umstand führte zu einem unfassbaren Durcheinander in den Aufstellungen der Teams. So konnte es passieren, dass selbst mitten in einem Spiel einzelne Akteure das Team wechselten. Am Ende eines Spiels wussten die Coaches manchmal nicht, welche Spieler ihnen fürs nächste Match blieben. Die Basketball-Version von purem Chaos.
Wenngleich sowas nicht auf eine attraktive Sportart hindeutet, bilden diese ersten turbulenten Jahre einen Meilenstein in der Geschichte des Basketballs. Der Sport professionalisierte sich rasch. Obwohl die Spieler nach heutigem Geschmack alles andere als cool aussahen, gab es schon wenige Jahre nach der Erfindung des neuen Hallensports erste Fans. Zwar existierten noch keine lebensgroßen Poster fürs Kinderzimmer, doch die Menschen fingen an, sich mit dem Sport und den Spielern zu identifizieren. Und wo Fans sind, entsteht (Fan-)Kultur.
Natürlich spielten weder in der Philadelphia- noch in der Hudson-River-League Superstars, bei denen sich Anhänger vor Hotels versammelten, nur um ein Autogramm zu erhaschen. Doch der Basketball entwickelte sich zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die etablierten Sportarten.
Und auch die Spielgeräte entwickelten sich weiter. Nach sieben Profisaisons wurden 1906 die Pfirsichkörbe durch Metallringe mit Netzen ersetzt. Wir sind zwar noch etliche Jahre von dem Begriff Streetball entfernt, doch lässt sich erahnen, wie einflussreich diese Entwicklung auf das Spiel und damit die gesamte Kultur des Sports gewesen ist. Die neuen Körbe ermöglichten es den Community-Projekten urbaner Ballungszentren, öffentlich zugängliche Basketballplätze im Freien zu errichten. Plätze, auf denen jeder spielen und sein Talent unter Beweis stellen konnte. Plätze, auf denen man auf Asphalt, statt auf Hallenboden spielte. Plätze, auf denen es zur Sache ging und der Ton etwas rauer wurde. Wenn man so will, also doch Streetball.
2 | Segregation und Basketball
Bei all dem, was wir über Basketball und die Anfänge einer möglichen Basketballkultur erfahren haben, blieb ein zu Recht verpöntes Wort bislang außen vor: Rasse. In der amerikanischen Geschichte spielt die „Rassenthematik“ allerdings eine fundamentale – und auch grausame – Rolle.
Während sich die Sportart, die wir alle so sehr lieben, entwickelte, setzte sich anfang des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten die sogenannte Segregation, die Rassentrennung, durch. Sie bezog sich nicht nur auf Wohnen, Gesundheitsversorgung, Bildung, Beschäftigung und Transport, sondern auch auf das Verbot der Ehe zwischen verschiedenen „Rassen“. Segregation war die gesetzlich oder gesellschaftlich erzwungene Trennung zwischen Afroamerikanern und Weißen sowie die Trennung anderer ethnischer Minderheiten von Mehrheits- und Mainstream-Gemeinschaften.
Das liest sich schrecklich, doch die Realität war sogar noch schlimmer.
Die Abschaffung der Sklaverei war zwar bereits seit fast einem halben Jahrhundert gesetzlich fixiert, doch de facto waren die Afroamerikaner nur auf dem Papier frei. In den Südstaaten wurden Schwarze weiterhin offen unterdrückt. Man erließ Gesetze, die jeden Kontakt zwischen Schwarzen und Weißen zu unterbinden suchten. „Separate but equal“ – „getrennt, aber gleich“ – wurde zum rechtlichen Grundsatz der Rassentrennung, wobei von Gleichheit nicht die Rede sein konnte. Die afroamerikanische US-Bevölkerung war von Wahlen faktisch ausgeschlossen, auch wenn die Verfassung es verbot, Wähler wegen ihrer Hautfarbe zu diskriminieren. Eine Wahlsteuer, ein Lesetest und viele weitere Schikanen und „Gesetze“ wurden eingeführt, um Afroamerikaner von der Wahl abzuhalten. Diese „Jim-Crow-Gesetze“, benannt nach einem dunkelhäutigen Charakter in rassistischen Musikshows, bestimmten das Leben der Schwarzen auch fast 100 Jahre nach dem Ende der Sklaverei. Schwarze Kinder durften nur in Krankenhäusern für Schwarze geboren werden, nur in Schulen für Schwarze gehen, schaukelten nur auf Spielplätzen für Schwarze. Die Nachfahren der Sklaven durften im Süden der USA nicht einmal dieselben Toiletten wie ihre weißen Mitmenschen benutzen.
Nicht mal mit dem Tod endete die Segregation: Afroamerikaner wurden in anderen Bestattungsinstituten aufgebahrt als Weiße, auf anderen Friedhöfen begraben, und ihr Tod wurde in einem anderen Teil der Zeitung bekannt gegeben.
Schwarze wurden verachtet, auf offener Straße beleidigt und sogar verschleppt. Schlimmer noch: Zwischen 1890 und 1920 wurden über 3000 schwarze Männer, nicht selten wegen des frei erfundenen Vorwurfs der Vergewaltigung, rituell gelyncht. In aller Öffentlichkeit wurden sie gefoltert, getötet, zerstückelt, verbrannt, ihre Körperteile wurden verkauft. Man nahm sogar Eintrittspreise zu diesen widerwärtigen Aufführungen. Die Justiz des amerikanischen Südens akzeptierte diese Form der Volksgewalt vorbehaltlos und schritt nicht ein. Im Gegenteil: Sie trennte weiter: Verkehrssysteme, Restaurants, Schwimmbäder, Kirchen – alles war strikt nach Rassen unterteilt. Schwarze durften ihren Wohnort nicht frei wählen und waren mehr oder weniger gezwungen, für dieselben „Herren“ zu arbeiten wie zu Zeiten der Sklaverei. Die liberalen Republikaner waren nicht ansatzweise bereit, die Eigentumsverhältnisse zu verändern. Sie bezahlten ihre nominell freien Arbeiter schlecht und hielten sie in permanenter wirtschaftlicher Abhängigkeit. So waren die Arbeiter etwa verpflichtet, Güter des alltäglichen Bedarfs in den Warenhäusern der Grundbesitzer zu überteuerten Preisen einzukaufen und mussten dafür oft Kredite aufnehmen. Ihre verzweifelte Lage trieb viele dazu, in den Norden und Westen der USA zu fliehen, wo sie sich bessere Lebensbedingungen erhofften. Die damit verbundene Great Migration sollte mehr als 60 Jahre anhalten.
Obwohl diese Menschen nur Zuflucht suchten, wurden sie von den Einwohnern der Städte im Norden als Bedrohung empfunden. Und so stieg auch in diesen, vermeintlich sichereren Regionen die Zahl von rassistisch motivierter Gewalt rasant an.
Und das nicht nur seitens der weißen Bevölkerung. Die Migranten aus den Südstaaten sahen sich auch mit der Ablehnung durch das schwarze Establishment im Norden konfrontiert, das dazu neigte, auf die ungebildeten Flüchtlinge herabzuschauen. Bei der Vergabe von Wohnraum wurden europäische Einwanderer zumeist vorgezogen. Das hatte zu Folge, dass ein Großteil der Afroamerikaner in Ghettos lebte und eigene Communitys entstanden. Schon auf den Großplantagen hatten sich die Sklaven organisiert, um religiöse und kulturelle Happenings mit afrikanischer Musik, Gesängen und Zeremonien abzuhalten. In Städten wie New York, Chicago, Detroit, Philadelphia und Washington D.C. bildeten sich nun afroamerikanische Großgemeinden, die das Stadtbild wie auch die Kultur in den Metropolen beeinflussen und prägen würden. Sie tun das bis heute.
Waren den Schwarzen im Süden sportliche Aktivitäten verwehrt worden, so änderte sich dies in den nördlichen Städten. Football und Baseball kannten viele, von Basketball aber hatten die meisten Schwarzen kaum etwas gehört, geschweige denn jemals einen Spalding in der Hand gehalten. Doch schon bald erkannte ein Vorreiter, wie wichtig dieser Sport für die afroamerikanische Gemeinschaft war und wie wichtig Afroamerikaner für die Zukunft des Sports und dessen Kultur sein würden. Schon bald sollte es eine neue Form des Basketballs geben: den Black Basketball.
3 | The Grandfather of Black Basketball
Als Basketball Anfang der 1900er-Jahre populärer wurde und sich ein breites Publikum der weißen Gesellschaftsschicht dafür zu interessieren begann, wurde schnell ein Trendsport daraus. Einer ausschließlich für Weiße. In den Colleges füllten sich die ersten kleinen Hallen mit Fans, und der ein oder andere Spieler wuchs zu so etwas wie einem Star heran. Es war ein bisschen wie im Film „Highschool Musical“. Allerdings ohne die afroamerikanischen Darsteller. Diese wollten zwar auch in die Hallen und Schulen, doch ihnen wurde der Zugang zu allen professionellen Strukturen des Sports verwehrt. Der afroamerikanischen Community blieb also nichts anderes übrig, als sich selbst zu organisieren. Doch es fehlte an allem: an fundierten Kenntnissen, einer Dachorganisation und Orten jenseits chaotischer Freiplätze. So drohte die Euphorie im Keim zu vertrocknen.
Doch ein Mann sollte das verhindern. Ein Mann sorgte dafür, dass Basketball zu einem Aushängeschild der afroamerikanischen Kultur wurde. Ein Mann, der seine Vision der Gleichberechtigung nutzte und den Sport als Werkzeug dafür ansah. Ein Mann, dessen Vermächtnis und dessen Spitzname in die Geschichte der Basketballkultur eingehen sollte. The Grandfather of Black Basketball: Edwin Bancroft Henderson.
Henderson wurde 1883 in einem kleinen Haus in Washington D.C. geboren. Er besuchte als Heranwachsender die M Street School in seiner Heimatstadt und galt als herausragender Schüler seiner separierten öffentlichen Schule. Edwin war so wissbegierig und fleißig, dass er 1902 einen Abschluss mit Auszeichnung erhielt.
Edwin hatte Großes vor. Er wollte Lehrer werden und seiner Community Bildung ermöglichen, damit sie sich aus der Armut befreien konnte. Er wollte den Afroamerikanern in seiner Region eine neue Chance bieten.
Edwin schloss nach zwei Jahren als Erster seiner Klasse an der Hochschule Minor Normal School die Ausbildung zum Lehrer ab. Es lief also alles nach Plan. Fast alles. Eigentlich hatte Henderson nach seinem Abschluss geplant, an einer Grundschule zu unterrichten. Die Begegnung mit einer befreundeten Sportlehrerin durchkreuzte dieses Vorhaben allerdings.
Anita Turner unterrichtete bereits seit einigen Jahren Sport an einer öffentlichen schwarzen Schule in Washington, an der sich die beiden kennenlernten. Edwin bemerkte sofort, dass auch Turner sehr gebildet war und hörte daher genau zu, als sie ihm von der „Summer School of Physical Education” erzählte. Das Programm war eine spezielle Ausbildung für Sportlehrer der Harvard University und wurde von Dudley Allen Sargent geleitet. Beim Assistenzprofessor für Körpertraining und Direktor des Hemenway Gymnasiums hatte Turner zuvor als eine der ersten schwarzen Frauen ihren Abschluss gemacht. Sie schlug vor, ein gutes Wort für ihren Bekannten bei Allen einzulegen.
Eine Chance, die sich der sportbegeisterte Edwin B. Henderson nicht entgehen ließ. Seit frühester Kindheit spielte er Baseball und Football. Er war überzeugt davon, dass körperliche Aktivitäten vielen Krankheiten vorbeugen würden. Heute eine Binsenwahrheit, damals noch nicht empirisch nachgewiesen.
Henderson wollte keine Zeit verlieren und lieh sich Geld für die Fahrt nach Cambridge. In Harvard studierte er in der Folge innovative Ansätze für den Sportunterricht und freundete sich mit später legendären Professoren wie dem Psychologen William James und dem Philosophen Josiah Royce an. Es fühlte sich für ihn wie ein wahr gewordener Traum an, zumal er eine Ausnahme von der Regel darstellte. Er war einer von lediglich zwei Afroamerikanern in seiner 114-köpfigen Klasse und hatte Schwierigkeiten, im weiß dominierten Massachusetts Anschluss zu finden. In einem Interview erinnerte er sich, wie er einmal einen örtlichen Friseursalon besucht hatte und einen klassischen Schnitt wünschte. Der weiße Friseur rasierte ihm stattdessen einen Streifen vom Hinterkopf bis nach vorne ab und lachte den jungen Afroamerikaner aus. Henderson war so traumatisiert, dass er jahrzehntelang keinen von Weißen betriebenen Friseursalon mehr besuchte.
So schmerzhaft diese Erfahrung auch gewesen sein mag, sie motivierte ihn umso mehr. Henderson wälzte noch mehr Bücher, besuchte noch mehr Vorlesungen, konsultierte noch mehr Experten. Während eines Kurses zum Thema Körpertraining wurde ihm das neue Spiel namens Basket Ball vorgestellt. Ein Spiel, von dem er gehört, es aber noch nie erlebt hatte. Es zog ihn sofort in seinen Bann. Denn Basketball ist ästhetisch, setzt Gedankenschnelligkeit voraus und kann schnell erlernt werden. Und das Beste: Im Gegensatz zum Football und Baseball gab es damals noch keine professionellen Strukturen.
Henderson erkannte sofort die Chance. Für ihn wurde Basketball fortan zum Instrument der Bürgerrechtsbewegung und zu einem Weg, um Afroamerikanern den Zugang zu den besten Schulen des Landes zu ebnen. Seine Vision war es, herausragende afroamerikanische Studentensportler an weiße Universitäten zu vermitteln. Er sah Basketball also als Teil eines Integrationsvorhabens, bei dem die Leistungen von afroamerikanischen Spielern negative Stereotypen entkräften konnten.
Gerade von seinem ersten Sommer in Harvard zurückgekehrt, begann er sofort, den schwarzen Schülern in Washington den neuen Sport beizubringen. Zu seinem Lehrplan gehörten: Basketball, Basketball und: Basketball. Henderson schrieb später, dass die Schüler den Sport zunächst als ein „Spiel für Schwächlinge“ ansahen, da man im Vergleich zum Football seinem Gegenspieler keine Tacklings verpassen durfte. Dass ihr Sportlehrer selbst auf dem Platz stand und mit ihnen spielte, überzeugte sie jedoch schnell. Denn Henderson war ein herausragender Spieler, gesegnet mit einer Sprungkraft, von der auch heutige Spieler den Hut oder mittlerweile vermutlich die Cap ziehen würden. Seine taktische Beherrschung, gepaart mit außergewöhnlichen Kommunikationsfähigkeiten, machte den Sportlehrer außerdem zu einem hervorragenden Trainer, Förderer und Organisator.
Die Schulstunden von Edwin sprachen sich schnell im Bezirk herum. Die Menschen rissen sich darum, von dem beliebten schwarzen Sportlehrer unterrichtet zu werden, was Edwin dazu bewegte, 1908 die „Interscholastic Athletic Association of Middle Atlantic States“ zu gründen. Die ISAA war eine rein schwarze Amateursportliga, für die Henderson öffentliche Spiele organisierte und Basketball in den Communitys des Bundesstaates verbreitete. Es war das erste Mal, dass Afroamerikaner in großem Umfang Basketball spielten. Ein Fakt, der Henderson den Titel „Grandfather des schwarzen Basketballs“ einbrachte und den District of Columbia zum „Geburtsort des schwarzen Basketballs“ machte.
Die Spiele fanden in der Regel samstagsabends statt und wurden schnell zum Publikumsmagneten, was Edwin ermutigte, 25 Cent Eintritt zu verlangen. Die Einnahmen wurden direkt in die Community reinvestiert.
Henderson, der selbst als Ausbilder und Administrator der Liga fungierte, verbesserte örtliche Sportanlagen, organisierte Leichtathletiktreffen für afroamerikanische Highschools und Colleges und gründete Sportvereine. Er förderte so die Kultur des sportlichen Wettkampfs in der afroamerikanischen Community.
Um das Bewusstsein für talentierte afroamerikanische Sportler zu schärfen, beantragte Henderson nur ein Jahr später, dass sein Team von der berühmten Howard University als erstes Basketballteam der Universität übernommen wird.
Er blieb Trainer der Mannschaft und gewann in der Saison 1910/11, in der sein Team ungeschlagen blieb, den inoffiziellen Titel „Weltmeister im farbigen Basketball“.
All das war ihm allerdings nicht genug. Von 1910 bis 1913 fungierte Henderson als Mitherausgeber des „Spalding Official Handbook for the I.S.A.A“. Eine Serie von Büchern, die erstmals ein umfassendes Bild über die Teilnahme von Schwarzen an allen wichtigen Sportarten lieferte und bis heute eine der wichtigsten Quellen für historische Informationen über Afroamerikaner im Basketball ist.
Hendersons Vision wurde zur Realität. Seine Pionierarbeit war wegweisend dafür, dass afroamerikanische Basketballspieler weiße Elitecolleges besuchen und so Wohlstand für sich und ihre Communitys generieren konnten. Seine Arbeit war bahnbrechend für die Rassenintegration und ebnete den Weg für afroamerikanische Sportler.
Edwin B. Henderson war ein Held, der sein Leben der Entwicklung, Förderung und Verbesserung des Basketballs widmete. Ein Held, dessen beispiellosen Leistungen dazu führten, dass er 1974 in die „Black Athletes Hall of Fame“ und 2013 in die „Naismith Memorial Basketball Hall of Fame“ aufgenommen wurde.
Wie sich der Sport und die schwarze Kultur wohl ohne die Visionen des Grandfathers of Black Basketball entwickelt hätten? Er hinterließ ein beispielloses Vermächtnis und leitete mit seinem Pioniergeist die wahrscheinlich wichtigste Ära der Basketball Culture ein: die „Black Fives Era“.
4 | Die Ära der Black Fives
Dank des Einflusses von Edwin B. Henderson stieg Washington D.C. Anfang des 20. Jahrhunderts zur Basketballhochburg für Afroamerikaner auf. Im District of Columbia entstanden Dutzende rein schwarze Basketballteams, die sich aus Spielern öffentlicher Schulen, Sportvereine, Kirchen, Colleges und farbiger YMCAs zusammensetzten. Basketball erfuhr einen Hype in den afroamerikanischen Communitys und überschwemmte auch Städte wie New York. Doch nicht nur der Basketball eroberte den Big Apple: Auch eine Welle von Immigranten aus dem Süden und aus Europa rollte herbei, um sich hier ein neues Leben aufzubauen.
Sowohl die Stadt als auch der Staat New York nahmen von 1910 bis Mitte der 1970er-Jahre mehr afroamerikanische Neuankömmlinge auf als jeder andere Staat. Das Stadtbild veränderte sich rasend schnell, und New York erlebte durch eine zweite „Black Migration“ von Menschen aus Jamaika und von den Westindischen Inseln einen Kulturumschwung. Und Basketball diente als Hilfsmittel, um sich zu sozialisieren.
Ein Mensch sah im Basketball aber viel mehr als nur die Möglichkeit, Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Conrad Norman wollte durch Basketball Leben retten.
Anfang des 20. Jahrhunderts lag die Sterblichkeitsrate aufgrund von Tuberkulose und Lungenentzündungen bei Afroamerikanern in New York City bei mehr als 25 Prozent. Hauptgrund waren die prekären Wohnverhältnisse, durch die sich Erreger schnell ausbreiten konnten. Norman wollte das ändern. Er ergänzte Hendersons Ansatz vom Basketball als Schlüssel zu Akzeptanz und Gleichberechtigung und nutzte den Sport als Aufklärungsmittel für die Gesundheit. Er wollte die afroamerikanische Gemeinschaft dazu bewegen, mehr Sport zu treiben, Breitensport war damals Neuland für die meisten Menschen, speziell für Afroamerikaner.
Basketball eignete sich dafür besonders, weil es einfacher zu erlernen war als Football und weniger Ausrüstung benötigte als Baseball. Alles, was man brauchte, waren zwei Körbe und ein Ball. Dass sich dank Henderson die Basketballplätze im Norden der USA vermehrt hatten, nutzte Conrad für seine Ziele aus. 1904 gründete er den Alpha Physical Culture Club.
Dies war ein Amateurverein, bei dem jeder mitmachen konnte. Den Namen „Alpha“ wählte Conrad, weil er sich und sein Team als Pioniere auf dem Gebiet der Körperkultur ansah. Sein Motto lautete: „Ein fairer Deal für alle!“
Ein Leitsatz, den sich viele Menschen zu Herzen nahmen. In der Folge entstanden zahlreiche afroamerikanische Basketballvereine, die dem Motto des Alpha Physical Culture Club folgten.
Doch die Zeiten änderten sich schneller, als es Conrad Norman lieb war. Seine Idee, Basketball vor allem aus Gesundheitsgründen zu spielen, wurde durch einen Ansatz namens „Play-for-Pay“ bedroht. Viele „Black Business Owner“ hatten eher Interesse daran, die Vision von Henderson zu unterstützen und gut daran zu verdienen. In der Folge wurden viele Teams von Kirchen, anderen Sportvereinen, Sozialvereinen, afroamerikanischen Unternehmen, Zeitungen, YMCA-Zweigstellen und anderen Organisationen gesponsert. Amateure wurden plötzlich zu Profis, und die schwarzen Basketballteams konnten solide Strukturen aufbauen. So entstanden Mannschaften in New York City, Washington, Chicago, Pittsburgh, Philadelphia, Cleveland und vielen anderen Städten im Norden der USA. Teams, die Geld mit ihrer Kunst verdienen wollten. Teams, die eine neues Zeitalter einläuteten: das der Black Fives.
„Fives“ nannte man jene fünf Spieler, die für eine Mannschaft auf dem Spielfeld standen. Teile der weißen Bevölkerung gaben ihnen solch abwertende Namen wie „Colored Quints“ (farbige Fünflinge), „Colored Fives“ oder „Negro Fives“. Die Antwort der schwarzen Community war so einfach wie plakativ: Sie nannten ihre Teams fortan Black Fives.
Die neuen Clubs verfügten zwar über professionalisierte Strukturen, allerdings beschränkten sich die Trainingsstätten fast ausschließlich auf marode Schulhallen. Denn auch im Norden beanspruchten die weißen Teams die besseren Einrichtungen für sich. Geld lässt sich jedoch kaum damit verdienen, Zuschauer in alten Turnhallen zu versammeln. Aus diesem Grund spielten die Teams während der Black-Fives-Ära (auch „Early Black Basketball Era“) in, aufgepasst, Kirchenkellern, Waffenkammern, Versammlungsräumen und – in Tanzsälen.
Der Kulturumschwung brachte den Städten nicht nur den Sport. Die Great Migration sorgte für einen Mix aus verschiedenen Bräuchen, Festen und Gewohnheiten und damit für eine neue Art des Zusammenlebens. Ein Leben, geformt aus Freiheit und Musik.
Blues verschmolz mit lokalen Musikstilen wie Ragtime, Jazz, Country und Zydeco. Es entstanden ganz neue Genres. Vieles von dem, was wir heute Popkultur nennen, wurzelte in der Migration, erblühte später im Blues-, Gospel und R&B, in HipHop und Rap.
Afroamerikanische Migranten und ihre Kinder veränderten damit die Symphonie der Metropolen.
Hinzukamen die Erfindung des Phonographen und des Radios, die das kulturelle Geschehen für immer veränderten. Die Unterhaltungskultur wuchs rasant und schuf einen Boom von Jazz-, Ragtime- und Blues-Musik. New York schien von einem Tanzwahn befallen zu sein. Die Menschen wollten Musik hören und sich zu den neuen Rhythmen bewegen. Trotz der Prohibition, also dem öffentlichen Alkoholverbot, trafen sie sich in illegalen Clubs und Bars, um zu feiern. Ballsäle und Tanzlokale schossen auch in Philadelphia, Chicago und Washington wie Pilze aus dem Boden. Dies war die Geburtsstunde der Basketball Culture, wie wir sie heute kennen. Bevor die Abendveranstaltungen begannen, stellten die meist afroamerikanischen Besitzer der Clubs ihre Räumlichkeiten den lokalen Basketballteams zur Verfügung. Sie stellten die Tische beiseite, hängten zwei Körbe an die Wände und luden zum „Basket Ball“ ein. Das hatte den Vorteil, dass sich etablierte Clubbesucher auch Basketball anschauten und umgekehrt sportinteressierte Menschen zum Tanzen blieben.
Der Fokus lag allerdings weiterhin auf Tanz und Musik. Doch die Menschen bemerkten schnell, dass die neue Musik perfekt zu der ebenso neuen Sportart passte. So wurde aus einer Vorveranstaltung nach und nach das Mainevent. Die Tische wurden nicht mehr weggeräumt, sondern um das Basketballfeld herum aufgebaut. Die Spiele fanden nicht mehr nur vor den Shows, sondern während der Auftritte der besten Jazz- und Bluesmusiker des Landes statt.
Einer Notlösung entsprang eine der wichtigsten Facetten der Basketball Culture: die Musik. Spiele der Black-Fives-Teams glichen im Zeitalter von Ragtime, Jazz und Blues einer wilden Basketballparty, wie wir sie heute nicht einmal vom NBA-Allstar-Weekend kennen. Man muss sich bildlich vorstellen, wie die Tanzlokale wie das Manhattan Casino oder der Loendi Social & Literary Club an freien Abenden zu Basketball-Veranstaltungsorten umgebaut wurden, in denen bis weit nach Mitternacht Musik von den besten schwarzen Musikern gespielt wurde, die besten Basketballteams in einer selbstorganisierten Liga gegeneinander antraten, und anschließend die ganze Nacht durchgetanzt wurde. Wahnsinn!
Die Gerüchte um diese sagenumwobenen Basketballpartys verbreiteten sich rasend schnell. Bei den „Basket Ball and Dance Veranstaltungen“ musste man gewesen sein, um mitreden zu können. Die Events wurden zu einem Teil der neuen afroamerikanischen Kultur, zu bedeutsamen gesellschaftlichen Ereignissen und zu „Socializing Events“, bei denen sich Einwanderer mit Einheimischen verbanden.
Heute ist die Verbindung zwischen Basketball und Musik allgegenwertig. Doch in den 1910er-Jahren war diese Facette der Basketball Culture eine afroamerikanische Innovation.
Eine Innovation, die das Beste war, was dem Basketball passieren konnte. Durch die Symbiose von Sport und Musik entstand eine neue, durch Stil und rhythmische Bewegungen geprägte Version des Sports, dessen Ästhetik den Basketball auf ein neues Level hievte. Neben dem weißen Basketball, bei dem das Passspiel an erster Stelle stand und das vornehmlich in großen Hallen gespielt wurde, entstand so auch eine schwarze Version des Sports. Eine Version, die sich durch eine athletische Spielweise an unorthodoxen Orten auszeichnete, und bei der Bewegungskunst, die Liebe zum Spiel und zur Musik, Gesundheit, Sozialisierung, der Wunsch nach Gleichberechtigung und die Auflehnung gegen den weißen Unterdrücker zusammenfanden.
Abseits der aufblühenden Black-Fives-Ära musste die weiße Basketball-Community auf die immer beliebter werdenden und gleichzeitig professionellen Basketballpartys der Afroamerikaner reagieren: Im April 1905 übernahmen Vertreter von 15 führenden Colleges der USA die Kontrolle über den vornehmen weißen College-Spielbetrieb und gründeten das „Basket Ball Rule Committee“. Dieses Komitee wurde 1909 dem Vorgänger der National Collegiate Athletic Association (NCAA) eingegliedert und bildete den Ausgangspunkt für den professionell vermarktbaren College-Basketball.
Eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, so hätten schwarze Athleten an guten weißen Schulen die Barrieren der Hautfarbe aufbrechen können. Doch nicht damals, nicht am Anfang des 20. Jahrhunderts. Stattdessen rückte die Professionalisierung des „weißen Basketballs“ in unerreichbare Ferne, als der damalige Präsident der National Football League, Joseph Carr, die „American Basketball League“ (ABL) gründete. Ihm gelang dabei das Kunststück, neun der besten Mannschaften des Landes, die noch in keiner Liga organisiert waren, zu verpflichten.
Die ABL dominierte das öffentliche Interesse fortan, da die Spielklasse erstmals überregional Mannschaften der gesamten nördlichen Ostküste bis Maryland, Cleveland und Chicago sowie später Toledo aus dem mittleren Westen in einen Spielbetrieb integrierte. Gespielt wurde in Dritteln von je 15 Minuten. Außerdem teilte die ABL die Saison meist in zwei Hälften auf. Die beiden Mannschaften mit den meisten Siegen in jeder der beiden Halbserien spielten in den ersten Playoffs den Meister der Saison aus. Doch so professionell die Liga auch schien, hatte sie einen Haken. Einen großen rassistischen Haken. Denn das Privileg, Teil der ABL zu sein, war den weißen Teams vorbehalten. Die Gründer der ABL waren der Meinung, dass Mannschaften aus ausschließlich afroamerikanischen Spielern nicht gegen Teams aus weißen Topspielern mit einer elitären Ausbildung gewinnen konnten. Sie lagen gewaltig daneben. Denn unter den vielen afroamerikanischen Teams sollte sich losgelöst von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit das wohl erfolgreichste Team des Jahrhunderts verstecken: die New York Rens.
5 | New York Renaissance
Während der Great Migration flohen neben Menschen aus den südlichen Teilen der USA und vielen Europäern auch unzählige Menschen der Westindischen Inseln in die Vereinigten Staaten. In den ersten drei Dekaden des 20. Jahrhunderts wanderten allein aus der Karibik über 300.000 Menschen ein, was sie zur zweitgrößten Gruppe von „Dritte-Welt-Migranten“ machte. Sie kamen entweder über den zentralamerikanischen Isthmus, wo sie als billige Arbeitskräfte beim Bau des Panamakanals und auf Bananenplantagen für amerikanisches Kapital arbeiteten, oder direkt als landwirtschaftliche Arbeitskräfte nach Florida. Doch die meisten, mehr als 70 Prozent, ließen sich in New York City nieder. Nirgendwo sonst auf der Welt lebten mehr karibische Einwohner. Viele der westindischen Einwanderer bevorzugten ein Leben in einer der afroamerikanischen Communitys und zogen deshalb nach Bedford Stuyvesant und Harlem. Der „Big Apple“ war für sie ein Ort, an dem sie ihre Familien ernähren und sich eine Zukunft aufbauen konnten. Um sich diesen Traum zu erfüllen, war ihnen kein Job zu schlecht und keine Arbeit zu niedrig. Die Afrokariben galten als besonders ehrgeizig und schafften es zumeist innerhalb weniger Jahre, sich und ihrer Gemeinschaft ein gewisses Maß an Wohlstand zu erarbeiten.
Recht bald prägten daher westindische und haitianische Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Restaurants und Reisebüros das Stadtbild vieler Nachbarschaften in Harlem. Der New Yorker Stadtteil wurde zum Festland des karibischen Archipels. Überall war der Einfluss zu spüren und deutlich zu sehen. Westindische Barbershops und Beautysalons gab es an jeder Ecke und dienten als soziale Treffpunkte der Afrokariben. In den karibischen Nachtclubs und Schallplattenläden, samt dazugehörender Calypso-, Soca- und Reggaeklänge, bekam man das Gefühl, sich weit entfernt vom New Yorker Stadtlärm aufzuhalten. Glasklar: Männer mit Rastas oder Dominospieler, die in den Parks oder auf den Bürgersteigen spielten, veränderten die Atmosphäre von Harlem in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts maßgeblich.
Doch der Traum vieler Afrokariben wurde schnell zum Albtraum. Tatsächlich führten der Ehrgeiz und Erfolg der westindischen Geschäftsleute zu einer ganz eigenen Form der Diskriminierung. Ihre Nachbarn in Harlem hegten einen Groll gegen die Migranten. Die afroamerikanischen New Yorker weigerten sich oftmals, die Menschen aus der Karibik zu unterstützen, grenzten sie aus und machten einen großen Bogen um ihre Geschäfte. Für viele der Migranten bedeutete dieser Umstand, dass sie sowohl die Ressentiments des weißen Amerikas als auch des schwarzen Harlem überwinden mussten. Eine frustrierende Situation, denn die Mauer an Vorurteilen über die neuen Nachbarn, deren Kultur und Ethnizität den meisten weißen wie schwarzen US-Amerikanern schlicht fremd war, war hoch.
Für viele schien sie unüberwindbar. Doch es gab einen westindischen Einwanderer, der sie einzureißen versuchte. Ein Einwanderer, der den Sport nutzte und den Basketball für immer verändern sollte. Ein Einwanderer, dessen scharfsinniger Geschäftssinn die Kultur des Basketballs revolutionierte. Ein Einwanderer namens Robert L. Douglas.
Robert Douglas, offiziell bei der Einwanderung registriert als Isaac Lewis, wurde am 4. November 1882 in St. Kitts, einem Land in der Karibik, geboren. Er war der Sohn von Robert Gould Douglas, einem Angestellten, und dessen Frau Margaret, einer Hausfrau aus New Town. In den 1890er-Jahren geriet Roberts Heimatland in ernsthafte soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das Land stützte in eine Katastrophe, die in den gewalttätigen Unruhen von 1896, den sogenannten portugiesischen Unruhen, ihren Höhepunkt fanden. Für viele Kariben war zu jener Zeit die Migration in die USA die einzige Option, um Arbeit zu finden. Aus diesem Grund traten viele Kittitianer den langen Weg in die Vereinigten Staaten an. Robert Douglas war einer von ihnen.
Der später als „Bob“ Douglas bekannte Robert kam 1901 in Harlem an. Er ließ sich in der West 52nd Street nieder und fand eine unterbezahlte Arbeit als Portier eines Hauses in der Columbus Avenue und 84th Street. Wobei unterbezahlt noch untertrieben war. Er arbeitete zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, und hatte nur jeden dritten Donnerstag und Sonntag frei. Und all das für einen Lohn von vier US-Dollar pro Woche. Die Definition von Ausbeutung. Doch seine Situation sollte sich schon bald verändern.
An einem seiner freien Tage im Jahr 1905 wurde Douglas von einem seiner Portier-Kollegen zum Anschauen eines Basketballspiels in der West 59nd Street eingeladen. Ein Sport, von dem Robert noch nie gehört hatte. Wie die meisten Menschen, die in New Town aufwuchsen, war er ein guter Schwimmer. Auch Fußball spielte er leidenschaftlich.
Da Fußballspiele in den USA damals allerdings kaum stattfanden und Schwimmer im Hudson River eher Wahnsinnige als Sportler waren, entschied sich Robert, die Einladung seines Kollegen anzunehmen.
„Hauptsache Sport“, dachte er wahrscheinlich, als er sein Haus verließ und die fünf Blocks zu einem Platz fuhr, auf dem zwei Körbe statt zwei Tore standen. An der West 59nd Street angekommen, war das Spiel bereits im vollen Gange.
Wie in Trance setzte sich Robert auf einen der Plätze, während er von der Anmut und Schönheit dieses Spiels beeindruckt war. Die athletische Spielweise, die filigranen Dribblings und die beeindruckende Präzision bei den Würfen zogen ihn in den Bann. Er meinte später, dies sei „das Großartigste, was er jemals auf der Welt gesehen hatte“. Ein Gefühl, das viele von uns sicher nachvollziehen können.
Und wie uns konnte man auch Robert nach seiner ersten Begegnung nicht mehr von den Basketballplätzen fernhalten. Ein breites Grinsen wuchs auf seinem Gesicht, sobald er sich einem Spielfeld näherte und Zeuge dieser wunderschönen Sportart werden durfte. Ein Umstand, der ihm den Spitznamen „Smilin Bob“ einbrachte.
Doch „Smilin Bob“ wollte mehr als zuschauen und grinsen. Er wollte spielen. Und das tat er auch. Wenngleich nicht besonders gut. Robert spielte zwar mit einer riesigen Begeisterung, war allerdings mindestens so untalentiert wie enthusiastisch. Doch er liebte das Spiel. Er liebte Basketball. Aus diesem Grund kündigte er seinen Job als Portier und gründete den „Caribbean Athletic Club“. Ein Verein, der neben Basketball weitere Sportarten förderte. Eine der Hauptsportarten war Cricket, eine populäre Sportart auf den Westindischen Inseln. Robert war hierin deutlich talentierter und spielte fortan für den Spartans Cricket Club. Er war sogar so gut mit dem Schläger, dass er es wahrscheinlich zum Profi gebracht hätte.
Doch hier wiederholt sich unsere Geschichte. Für Schwarze im frühen 20. Jahrhundert war es nach wie vor fast unmöglich, mit Profisport den Lebensunterhalt zu verdienen. Das galt für Cricket und erst recht für Basketball. Diskriminierung und Segregation verboten Robert den Zugang zu großen Mannschaften und Profiligen. Daher folgte Robert Douglas dem Beispiel von Edwin B. Henderson und Conrad Norman: Er gründete seinen eigenen Amateurbasketballverein – die Spartan Field Club Braves.
Robert hatte eine Vision. Er wollte die Braves zu einem der besten rein schwarzen Teams der Stadt machen. Er wollte, dass sich die Menschen genau wie er in den Sport verlieben, wenn sie seine Mannschaft sehen. Und er wollte Geld verdienen. Robert glaubte fest daran, dass die Leute Eintritt zahlen würden, um sich das beste Team der Stadt anzuschauen. Doch um diese Version zu verwirklichen, brauchte Robert gute Spieler. Ein Umstand, der ihn schneller ans Ende seiner Amateurlaufbahn brachte, als es dem jungen Einwanderer lieb war. Laut den Statuten des Amateursports war es nicht gestattet, Spieler zu rekrutieren, die bereits zuvor Geld für die Ausübung einer Sportart erhalten hatten. Doch genau diese Spieler brauchte er. Deshalb gründete „Smilin Bob“ 1923 eine Profibasketballmannschaft.
Nun fehlte ihm nur noch ein Veranstaltungsort für seine Spiele. Aus diesem Grund traf er sich mit dem Geschäftsmann William Roach. Der ebenfalls afrokaribische Einwanderer war einer der Besitzer und Betreiber des „Renaissance Ballroom and Casino“ in Harlem. Die Eventlocation war für 175.000 Dollar erbaut worden und vollständig im Besitz des afroamerikanischen Unternehmens „Sarco Realty and Holdings Company, Inc.“. Das „Renny“, wie es genannt wurde, öffnete 1921 seine Türen an der Ecke 138th Street und 7th Avenue in Harlem und war der einzige Club, der ausschließlich Afroamerikanern offenstand. Im „Schwarzen Mekka“ spielten Jazzlegenden wie Louis Armstrong, Lena Horne, Billie Holiday und Ella Fitzgerald. Es fanden dort regelmäßig Theaterabende, Tänze, Preiskämpfe, Organisationsveranstaltungen und Filmvorführungen statt. Der Renaissance-Ballsaal war das Epizentrum der Harlem Renaissance der 1920er- und 30er-Jahre. Kurzum: der perfekte Ort für ein Basketballteam. Dachte sich auch Robert Douglas.
Im ersten Stock des Gebäudes befand sich ein Kino und im zweiten Stock ein Ballsaal, den Robert jeden Sonntagabend für den Rest des Jahres 1923 für Spiele und Trainingseinheiten seiner Braves mieten wollte. Doch Willie Roche schien nicht begeistert von der Idee. Er befürchtete, dass diese „Art der Aktivität“ seine polierte Tanzfläche ruinieren würde. Doch als Douglas anbot, sein Team von den „Braves“ zu den „Renaissance“ umzubenennen, sah Roach eine Chance auf fette Publicity und akzeptierte das Angebot. Robert machte daraufhin seinem Spitznamen alle Ehre und grinste über das gesamte Gesicht. Nun war er in der Lage, seinen Spielern Verträge über eine gesamte Saison anzubieten. Das machte ihn zum ersten Besitzer eines komplett professionellen Basketballteams. Es machte ihn zum „Father of Black professional Basketball“, wofür er 1972 als „Contributor“ in die Basketball Hall of Fame aufgenommen wurde.
Lange zuvor fand am 30. November 1923 das erste Spiel der Harlem Renaissance gegen die Chicago Collegians statt. Inspiriert von den Basketballpartys in Washington, sorgte Robert Douglas dafür, dass seine Mannschaft gleichzeitig mit den Tanzbands spielte. Er organisierte tragbare Körbe, die vor dem Musikpavillon aufgebaut wurden, ließ Linien auf das Parkett kleben und stellte Klappstühle an den Seitenlinien des Platzes auf. Das Spiel endete 28:22 für Roberts Team. Doch nicht nur für ihn war dieser Abend ein voller Erfolg, auch die Wahrnehmung für den Basketball sollte sich in New York fortan verändern. „Während wir spielten, hörten die Menschen auf zu tanzen“, erinnerte sich Robert Douglas an das erste Spiel seiner Mannschaft zurück. „Und während sich die Mannschaft ausruhte, tanzten sie weiter. Und nach dem Spiel tanzten sie noch mehr.“
Die Gäste waren begeistert von den „Basket Ball and Dance“-Abenden im Renaissance Ballroom. Die „New York Rens“, wie Roberts Team genannt wurde, entwickelten sich zu einer Sensation.
Infolgedessen begann Robert, Spiele gegen andere schwarze Teams aus New York, Washington, Newark, Philadelphia und Washington zu organisieren. Er inspirierte andere Teambesitzer, den Basketball für die schwarze Community zu kommerzialisieren. Robert tourte mit seinem Team die gesamte Ostküste der USA entlang und fegte einen Gegner nach dem anderen vom Platz. Niemand konnte dem Team aus Harlem das Wasser reichen.
Die Mannschaft wurde bekannt für ihre innovative Spielweise, in der sie ihr überragendes Passspiel mit extravaganten Fastbreaks kombinierte. Die New York Rens verbanden das Beste aus beiden Welten des Sports: die Gradlinigkeit des weißen Basketballs mit der Athletik des afroamerikanischen Spiels. In den ersten sechs Jahren nach ihrer Gründung kamen sie auf eine Bilanz von 465 Siegen bei nur 95 Niederlagen.
Doch die Rens wurden mehr als nur ein erfolgreiches Team, sie wurden zum inoffiziellen Aushängeschild für „schwarzen Erfolg“ und dafür von den Afroamerikanern bewundert. Robert wurde zum Botschafter der „schwarzen Sache“. Sein Team reiste manchmal 200 Meilen weit, um gegen schwarze oder weiße Gegner anzutreten. Sie wollten Geld verdienen und die Grenzen der Hautfarben einreißen. Dafür nahmen Robert Douglas und sein Team jede noch so erniedrigende Widrigkeit in Kauf.
Aufgrund der Rassengesetze mangelte es ihnen auf den Reisen oftmals an Einrichtungen zum Übernachten. So schliefen die Spieler des erfolgreichsten Teams der USA oft auf dem Boden ihres Busses und nahmen kalte Mahlzeiten zu sich. Das sorgte jedoch nur dafür, dass die New York Rens noch hungriger auf Erfolg wurden. In der Saison 1932/33 erspielte sich die Mannschaft eine Bilanz von 120 Siegen bei acht Niederlagen und gewann dabei 88 Spiele in Folge. Eine Leistung, die von keinem professionellen Sportteam jemals wieder erreicht wurde. Aber der Wahnsinn ging noch weiter: Die New York Rens sollten als das erfolgreichste Basketballteam des Jahrhunderts in die Geschichte eingehen. Von 1923 bis 1948 gewannen sie 2588 von 3117 Partien, was einer sagenhaften Gewinnquote von 83 Prozent über den Zeitraum eines Vierteljahrhunderts entspricht. Nochmal: Wahnsinn!
Doch ihr wahres Vermächtnis sind nicht die Siege, die das Team auf dem Platz einfuhr. Der wahre Erfolg waren die Siege, die von den New York Rens abseits des Platzes errungen wurden. Sie schafften es als erstes afroamerikanisches Teams, regelmäßig gegen die großen Teams der Weißen zu gewinnen und rissen dadurch die Barrieren der Hautfarben nieder. Robert Douglas kommerzialisierte den afroamerikanischen Basketball und sollte als Vorreiter im Kampf um die Gleichberechtigung in die Geschichte der Basketball Culture eingehen. Und das ist noch nicht das Ende ihrer Geschichte. Die New York Rens werden uns in diesem Buch noch ein wenig begleiten.
Doch abseits der routinierten Arbeitermannschaft aus Harlem machte eine weitere afroamerikanische Equipe auf sich aufmerksam. Eine, die in jeder Hinsicht anders war. Während die Rens als fast schon pedantisch arbeitende Perfektionisten bekannt wurden, galten die sogenannten Savoy Big Five als eine Truppe von Artisten. Das Team aus Chicago schien den organisierten Basketball nicht allzu ernst zu nehmen und zeichnete sich eher durch Einzelspieler mit Ausnahmetalenten aus. Und während die einen Zuschauer noch fasziniert von den Spielen der New York Rens waren, fingen andere bereits an, von den Basketballshows der Savoy Five zu schwärmen. Deren Spieler kombinierten artistische Kunststücke mit komödiantischen Aspekten und Showelementen. Sie schufen eine Show, die kein Mensch je zuvor gesehen hatte. Wenn das einigen von euch bekannt vorkommen sollte, dann liegt ihr richtig. Die Savoy Five wurden wenig später unter einem anderen Namen weltbekannt. Ein Name, der einen Mythos in sich trägt. Die Savoy Big Five sind das Ursprungsteam der fabulösen Harlem Globetrotters.
6 | Die Harlem Globetrotters
Eigentlich ist der Name Harlem Globetrotters irreführend, da das Team eigentlich aus Chicago stammte. Um diese Verwirrung aufzulösen, müssen wir einmal mehr die Geschichtsbücher der Basketball Culture aufschlagen und uns Abe Saperstein widmen.
Der jüdisch-polnische Teenager Abraham Michael „Abe“ Saperstein wuchs nach seiner Einwanderung aus London nach Chicago im Norden der Stadt in ortsüblicher Armut auf. In einer Gegend, in der sich vornehmlich Deutsche und Schweden niedergelassen hatten, waren Menschen jüdischen Glaubens genauso wenig willkommen wie die afroamerikanische Bevölkerung. Abe sah täglich Schilder mit der Aufschrift „No Jews allowed“. Die einzigen Schilder, die so ähnlich aussahen, waren die für Afroamerikaner mit der Aufschrift „No Blacks allowed“. Eine Ähnlichkeit, die den jungen Abe nachhaltig prägen sollte.
Seine Liebe zum Sport entdeckte der zehnjährige Abe, als er im Wilson Avenue YMCA ein Basketballspiel von schwarzen Jugendlichen beobachten konnte. An der Lake View High School probierte er die neu entdeckte Sportart sofort aus und erhöhte damit die Anzahl der Sportarten, die er ausübte, auf neun. Neben Baseball, Fußball, Boxen, Leichtathletik und anderen Sportarten widmete sich Abe jetzt voll und ganz dem Basketball. Doch der kleine und etwas dickliche Teenager erkannte früh, dass seine sportlichen Fähigkeiten und seine Körpergröße ihn nicht weit bringen würden, und er studierte deshalb parallel an der University of Illinois in Chicago. Abe war wahrscheinlich einer der ersten Basketball-Romantiker in der Geschichte der Basketballkultur, denn trotz seines fehlenden Talents brach er sein Studium ab, um eine Sportlerkarriere anzugehen.
Da es für ihn als Spieler nicht wirklich eine Zukunft gab, weil er abgesehen von seiner Körpergröße auch weder voll zu den „Weißen“ noch zu den „Schwarzen“ gehörte, saß er täglich stundenlang im Welles Park auf der North Side von Chicago und schaute Kindern beim Basketballspielen zu.
An dieser Stelle ist ein kleiner, aber wichtiger Exkurs notwendig, denn das, was sich Abe dort stundenlang anschaute, waren nichts anderes als die ersten Streetball-Spiele!
Streetball ist eines der Gerüste der Basketball Culture. Wir werden noch etliche Male im Verlauf der Geschichte auf das Phänomen „Streetball“ eingehen, doch an dieser Stelle muss Folgendes erklärt werden: In den frühen 1900er-Jahren begannen Kinder, Jugendliche, Schwarze, Juden, Weiße aus der Mittel- und Unterschicht, Hispanos und andere Menschen unterschiedlicher Kulturen und Altersgruppen das erste Mal, sich abseits der YMCAs mit Basketball zu beschäftigen. „Mit weniger mehr erreichen“ war zu Beginn des 20. Jahrhunderts daher nicht nur ein Klischee, sondern eine Lebenseinstellung. Mit kaum mehr als einem Ball und etwas Hoffnung ausgerüstet, begaben sich die talentierten und auch die untalentierten Vorfahren des Streetballs auf die Asphaltplätze von Washington, D.C., New York City und anderen Großstädten. Es war die Geburtsstunde des „Street“- oder „Black“-Basketballs. Wie schon erwähnt, ist die Erfindung der Metallringe einer der Meilensteine in der Geschichte der Basketball Culture. Aber später mehr dazu, zurück zum verträumt am Spielfeldrand sitzenden Abe.
Saperstein bekam schließlich eine Anstellung als „Playground Supervisor“ für den Chicago Park District und hatte nun auch beruflich mit dem Sport zu tun, den er so leidenschaftlich verfolgte. Nachdem er wieder einmal stundenlang Kindern beim Basketballspielen zugesehen hatte, beschloss er, sein eigenes Team zu gründen. Die Chicago Reds wurden geboren. Ein halbprofessionelles Leichtgewichts-Basketballteam, in dem Abe selbst als Point Guard spielte. Durch einen Zufall lernte Abe, der unter anderem Manager und Trainer der Chicago Reds war, Walter Thomas Ball, einen legendären Baseballspieler in der Negro-League, kennen. Ball war unter anderem Eigentümer eines schwarzes Baseballteams, mit dem er auf Tournee in Illinois und Südwisconsin gehen wollte. Er engagierte Saperstein als seinen Booking-Agent, in einer frühen Form des Vereinsmanagements, um die Tour zu planen. Abe übernahm das Erlernte und wurde später Booking Agent für mehrere Basketballteams.
Am 12. Februar 1927 machten die damalige Dancehall-Entwicklungsfirma „Associated Ballrooms“ und verschiedene Bauherren von sogenannten Mega-Einrichtungen in New York ein Ankündigung, die den Basketball verändern sollte: Sie hatten einen 30-jährigen Mietvertrag über eine Million US-Dollar für einen Stadtblock an der Südseite von Chicago am South Parkway Boulevard, dem heutigen Martin Luther King Drive, in der 47th Street unterzeichnet, wo zügig der Bau eines weiteren „Monster“-Ballsaals beginnen sollte.
Unter der Eigentümer-Gemeinschaft befand sich auch der Gründer der „Tanzstätte“ Savoy in Harlem. Der Eigentümer I. Jay Faggen erklärte vollmundig, dass das Chicago Savoy noch größer als jeder andere Ballsaal im Land werden und Platz für mehr als 7.500 Tänzerinnen und Tänzer bieten würde.
Als der unternehmungslustige afroamerikanische Nachtclub-Promoter Dick „Baby Face“ Hudson davon hörte, wandte er sich umgehend an Faggen mit einem Vorschlag. Hudson war Trainer und Eigentümer der rein schwarzen Basketballmannschaft Giles Post American Legion Five und bot seinem Verhandlungspartner an, sein Team in Savoy Big Five umzubenennen, wenn es dafür dauerhaft im neuen Chicagoer Savoy spielen dürfte.
Was hat all das mit Abraham Michael „Abe“ Saperstein zu tun? Erst einmal noch nichts. An Thanksgiving 1927 wurde der Chicago Savoy Ballroom feierlich eröffnet und erfreute sich aufgrund des neues Basketball-Teams sofort enormer Beliebtheit. Tatsächlich war fast jeder, der mit den Savoy Big Five in Verbindung stand, ein bekannter Sportler. Zum Kader des neu benannten Teams gehörten Tommy Brookins, Lester Johnson, Randolph Ramsey und Walter „Toots“ Wright (allesamt ehemalige Starspieler des Chicagoer Stadtmeisters Wendell Phillips High School), Joe Lillard, ein zukünftiger NFL-Halfback, und Inman Jackson, ein späterer Star der Harlem Globetrotters. Die Savoy Big Five spielten das erste Spiel am 3. Januar 1928 im Savoy Ballroom. Erst ein Jahr später bekommen wir endlich den metaphorischen Knopf an die Geschichte, als Abe Saperstein als Booking-Agent und Manager für die Savoy Big Five anheuerte. Sein Einfluss war sofort spürbar. Er überzeugte Baby Face Hudson davon, das Team in Harlem Globetrotters Trotters umzubenennen. Saperstein wählte den Stadtteil Harlem, weil er damals als Zentrum der schwarzen amerikanischen Kultur galt, und den Namen Globetrotter, um die internationale Ausprägung des Teams zu mythisieren. Das Verrückte war, dass weder Saperstein noch einer der Spieler aus New York stammten und trotzdem 1929 unter diesem Namen durch Illinois und Iowa tourten.
Die Rolle von Abe erschien teilweise dubios, weil niemand so richtig wusste, was er eigentlich tat und warum er so viel Einfluss auf Entscheidungen nehmen konnte. Doch sie ließen ihn gewähren, denn nicht nur die Namensänderung zeigte Wirkung: Die Harlem Globetrotters wurden landesweit dafür bekannt, die versiertesten Spieler der afroamerikanischen Community im Team zu haben. Ihr Spielstil war hoch innovativ: Die Spieler kreierten Moves, entwickelten Dribblings, zeigten die ersten Slam-Dunks und präsentierten Trickspielzüge, die niemand je zuvor gesehen hatte. Außerdem hatte ihre vom Fastbreak geprägte Spielweise wesentlichen Einfluss auf die Definition von Positionen. Point Guard und Forward wurden quasi erst durch die Harlem Globetrotters populär. Wann immer sie sich eine ausreichend hohe Führung erspielt hatten, wurde das Spiel zu einer Basketball-Show. Saperstein schlug den Spielern vor, auch Slapstick und komödiantische Aspekte zu implementierten. Er glaubte, etwas Humor könnte die Feindseligkeiten und rassistischen Vorurteile mildern. Genial! Es entstand ein Mythos, der bis heute andauert.
Jeder wollte das afroamerikanische Zauberteam sehen. Sogar die weiße Bevölkerung.
Basketball wurde nun auch finanziell lukrativ. Die Spiele wurden vor einer großen Menge an Schaulustigen ausgetragen, und die Spieler erhielten eine Prämie von 75 US-Dollar pro Spiel. Inflationsbereinigt würden wir heute von umgerechnet 1346,31 US-Dollar sprechen. Und Spiele gab es fast an jedem Abend. Die Mannschaft tourte jetzt nicht nur durch Illinois oder Iowa, sondern auch durch Wisconsin, Minnesota und andere Bundesstaaten. Dabei spielte das Team fast jeden Abend gegen alle möglichen Herausforderer. Die Harlem Globetrotters waren einfach zu gut für die Konkurrenz, und so tat es dem Team auch nicht wirklich weh, wenn sich mal ein Spieler verletzte oder ausfiel und der 1,70 Meter kleine Abe Saperstein einspringen musste, um den Point Guard zu spielen.
Basketball war damals noch nicht die spektakuläre Sportart, wie wir sie heute kennen. Keine überdimensional hochfliegenden Körper, keine Dribblings à la Allen Iverson oder Kyrie Irving und auch keine Pässe, wie sie Jason Williams oder Luka Doncic spielen würden. In den 1930er-Jahren gab es Profi-Teams, bei denen Spieler teilweise nicht einmal anständig dribbeln konnten. Einzig die Harlem Globetrotters waren echte Vorboten des modernen Basketballs. Zu einer Zeit, in der es weder Live-Übertragungen im Fernsehen noch Highlight-Clips in den sozialen Medien gab, waren die „Globies“ der einzige Zugang für die Menschen zu dieser wunderschönen und neuen Art des Spiels. Das Team entwickelte den Basketball um Lichtjahre weiter. Sie führten Touch-Passing ein, entwickelten den Dunk als Kunstform weiter, erfanden „Flash“-Bewegungen wie Dribblings zwischen den Beinen und Pässe hinter dem Rücken und waren das wahrscheinlich erste Team, das mit einem modernen Point Guard spielte. Für die weißen Konservativen bedeutete das allerdings einen unangenehmen Wandel in der Kultur. Das weiße Publikum lehnte das erfolgreiche schwarze Team vehement ab und beschimpfte dessen Spieler. Die Globetrotters reagierten darauf mit Stil, Professionalität – und Humor. Besonders das sogenannte „Clowning“ verwirrte das Publikum. Sie benahmen sich so, wie es „typisch Schwarzen“ angedichtet wurde. Minstrel-Stereotype waren damals ein beliebtes Stilmittel der Globetrotters.
Minstrel-Shows wurden ansonsten allerdings von weißen Unterhaltungsmusikern aufgeführt, die heutzutage als Rassisten bezeichnet werden würden. Die „Künstler“ färbten ihre Gesichter schwarz (Blackfacing) und karikierten das vermeintliche Leben von Afroamerikanern.
Die Globetrotters benahmen sich ähnlich selbstironisch auf dem Platz wie die Minstrel-Künstler, und die Zuschauer begannen daraufhin tatsächlich, über alle Hautfarben hinwegzusehen und stattdessen die hochklassige Basketballkunst zu genießen.
1936 schafften es die Harlem Globetrotters, sensationelle 1000 Spiele im ganzen Land auszutragen und die meisten zu gewinnen. Und das in einer Zeit, in der es selbst für die mittlerweile berühmten Globies noch immer schwierig war, Zugang zu Spielstätten und gegnerischen Teams zu finden.
Durch ihren Erfolg wuchs ihr Einfluss auf den Sport und die Kultur. Kinder fingen an, die Spieler zu idolisieren und ihre Moves zu kopieren. Erwachsene versuchten, sich den Style und die lässige Art anzueignen. Abe Saperstein und Dick Hudson vollbrachten eine der größten Heldentaten in der Geschichte der Basketball Culture, indem sie es schafften, dass es für die weiße Bevölkerung normal wurde, schwarzen Athleten beim Sport zuzuschauen.
7 | Die andere Seite
Während Teams wie die New York Rens und die Harlem Globetrotters immer bekannter und Basketball immer mehr zu einer eigenen Kultur wurde, entwickelte sich auch das organisierte Spiel der Weißen weiter. Auf der einen Seite dominierte mit den Original Celtics ein rein weißes Team aus New York die ABL, gewann 90 Prozent seiner Spiele und schaffte eine Rekordkulisse von mehr als 11.000 Zuschauern. Auf der anderen Seite suchte Alonzo Lewis „Lon oder Lonnie“ Darling nach einer sinnvollen Tätigkeit in der „Saat-Off-Season“.
Darling war 20 Jahre alt und arbeitete als Vertriebshändler in der Saat-Industrie (für alle, die sich gerade gefragt haben, was eine „Saat-Off-Season“ ist). Er hatte Schwierigkeiten, in der Nebensaison eine Arbeit zu finden. Lonnie wuchs in einer sportbegeisterten Familie auf, konnte sich aber nicht wie der Rest seiner Familie für den amerikanischen Nationalsport Football begeistern. Während sein Bruder Bernard „Boob“ Darling später bei den Green Bay Packers spielte und sogar in die Franchise Hall of Fame aufgenommen wurde, zog es den jungen Alonzo immer schon zum Spiel mit den zwei Körben. Lonnies Idee bestand darin, 1929 eine professionelle Basketballmannschaft zu gründen: die Oshkosh All-Stars. Ein rein weißes Team, weswegen es auch die „All White Oshkosh All-Stars“ genannt wurde.
Lonnie schaute sich zwar nicht das „schwarze Spiel“ der Globetrotters ab, hielt allerdings viel von der Vorteilen eines sogenannten Barnstorming-Teams. – Denn lukrativ war es auf jeden Fall, wenn Teams keiner Liga angehörten und somit durch das Land touren konnten, um für Geld gegen lokale Teams zu spielen. Das Konzept konnte ja schließlich auch für andere funktionieren. Die Oshkosh All-Stars fanden auch dank ihrer Hautfarbe immer Gegner sowie Spieler, die sich ihnen anschließen wollten. Außerdem genossen sie als rein weißes und landesweit bekanntes Team das Privileg des Zugangs zu den größten Arenen der USA.