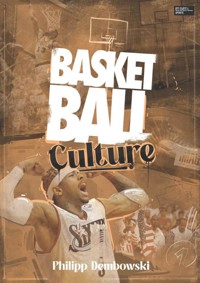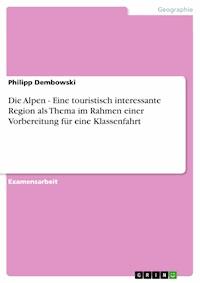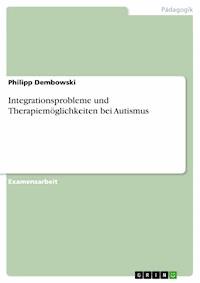
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 1, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Institut für Sonderpädagogik), Sprache: Deutsch, Abstract: In meiner Arbeit möchte ich mich gezielt mit den Therapiemöglichkeiten bei autistischen Kindern und Jugendlichen und deren Integrationsproblemen, besonders in der Schule, beschäftigen. Beginnen werde ich mit einem Fallbericht eines Jungen, der autistische Züge zeigte. Ich lernte diesen Jungen während der letzten zwei Monate meines Zivildienstes 1995 in der Kindertagesstätte 114 in Frankfurt a/M kennen. O. wurde am XX.X.1991 in Deutschland geboren. Die Mutter und der Vater sind beide türkischer Abstammung und leben seit 1980 in Deutschland. O. kam Ende 1995 in die integrative Gruppe der Kindertagesstätte. Diese Gruppe bestand insgesamt aus 12 Kindern, von denen 4 Kinder Behinderungen aufwiesen. O. schien schon als Säugling nicht auf seine Eltern oder Gegenstände zu reagieren, berichteten die Eltern. Seine ersten Wörter sprach er mit 3 ½ Jahren, aber die Sprache entwickelte sich nie richtig. Man konnte ihn häufig nur sehr schwer verstehen, denn seine Aussprache war sehr undeutlich. Oft vertauschte er einzelne Wörter oder verdrehte ganze Sätze. Auch konnte man sehr häufig bei ihm stereotype Bewegungen wie Sich- Wiegen oder Sich-um-sich-selbst-Drehen beobachten. Besonders ist mir aber die sehr geringe Schmerzempfindung aufgefallen. Selbst wenn er sich mit einem Messer geschnitten hatte, schien ihm das keine besonderen Schmerzen zu verursachen. Er hatte sehr wenig Kontakt zu den anderen Kindern und man erhielt den Eindruck, er würde diese förmlich meiden. Welche Krankheit zeigt so viele Symptome, wobei diese aber nicht alle auf einmal auftreten müssen? Im ICD-10 definiert sich Autismus als „eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die zu schwerer Mehrfachbehinderung führt“ (10. Überarbeitung der International Classification of Diseases, der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, ICD-10 Nr. F 84.0).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
Page 1
Page 2
Einleitung11
Autismus und seine Geschichte22
Klinische Gesichtspunkte und3Verbreitung des Autismus3
3.1 Symptomatik3 3.1.1 Signifikante Symptome in der Sprache 4 3.1.2 Sensorische Defizite bei autistischen Kindern 5 3.1.3 Motorisches Verhalten 6 3.1.4 Sonderleistungen autistischer Kinder 6 3.1.5 Stereotypien 7 3.1.6 Die Gefühlswelt 8 3.1.7 Aggression und selbstverletzendes Verhalten 9 3.1.8 Epileptische Anfälle 10 3.1.9 Physiognomie 10 3.1.10 Eßstörungen 11 3.1.11 Signifikante Symptome im sozialen Handeln 12
3.2 Epidemiologie12 3.2.1 Anzahl der autistischen Kinder 12 3.2.2 Geschlechtsverteilung 13
3.3 Diagnose13 3.3.1 Fachärztliche Diagnose 13 3.3.2 Diagnostische Klassifikation 15 3.3.3 Artverwandte Krankheitsbilder und Störungen 16
3.4 Ursachen für die Entstehung von Autismus17 3.4.1 Die psychogenetische Hypothese 18 3.4.2 Biochemische Indikatoren 19 3.4.3 Strukturelle Veränderung des Zentralnervensystems 20 3.4.4 Genetische Disposition 21 3.4.5 Allgemeine Störung der Wahrnehmungsverarbeitung 21 3.4.6 Hirnschädigung 22 3.4.7 Theory of Mind 23
Page 3
Therapie von Autismus244
4.1 Ziele der Therapie244.2 Ort der Therapie254.3 Therapiekonzepte26
4.3.1 Sensomotorische Therapieansätze im Hinblick auf gestörte Körperwahrnehmung4.3.1.1 Sensorische Integrationstherapie nach Ayres 4.3.1.2 Therapie nach Affolter 4.3.1.3 Therapiekonzept nach Bobath 4.3.1.4 Pattering 4.3.2 Lernpsychologischer Therapieansatz im Hinblick auf Verhaltensauffälligkeiten 30 4.3.3 Konfliktpsychologischer Therapieansatz zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit 30 4.3.4 Audio-sensorischer Therapieansatz zur Steigerung der Hörwahrnehmungsfähigkeit 31 4.3.5 Von Lautsprache unabhängige Therapieansätze zur Verbesserung der Kommunikation 32 4.3.5.1 Musiktherapie 4.3.5.2 Tiertherapie und Reittherapie4.3.5.3 Gebärdensprachentherapie 4.3.6 Physikalische Therapie 33 4.3.7 Medikamentöse Therapie 34 4.3.8 Vitamintherapie 35 4.3.9 Gestützte Kommunikation4.3.9.1 Begriffserklärung 4.3.9.2 Funktion der Stütze 4.3.9.3 Auswirkung der Gestützten Kommunikation auf die Kommunikationsmöglichkeit4.3.9.4 FC in der Schule 4.3.9.5 Kontroverse Diskussion über FC 4.3.10 Therapie einzelner gestörter Verhaltensweisen
4.3.10.1 Behandlung von Stereotypien 4.3.10.2 Sprachtherapie 4.3.10.3 Behandlung von Aggressivität und selbstverletzendem Verhalten
4.3.10.4 ToilettentrainingEntwicklung und Prognose5
46 -3-
Page 4
Pädagogische und soziale Aspekte6
47
6.1 Autismus und Schule47 6.1.2 Bestimmung des Lernortes 49 6.1.3 Verwirklichung von kindorientierten Förderformen 50 6.1.4 Integrative Förderung durch mobile therapeutische Betreuung in der wohnortnahen Schule 52
6.2 Formen außerschulischer Betreuung und Förderung54 6.2.1 Die Eltern autistischer Kinder 54 6.2.2 Konkrete Formen der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus 55 6.2.3 Notwendigkeit eines gemeinsamen Förderkonzepts 56
6.3 Praktische Hilfen für Eltern mit autistischen Kindern56 6.3.1 Kooperation mit außerschulischen Fachdiensten 56
6.4 Soziales Umfeld59
6.5 Der Übergang zum Jugendalter (Sexualität und Autonomiebedürfnis)60
6.6 Berufliche Ausbildung, Freizeitgestaltung, Wohnen und Arbeit61
Zusammenfassung763
Literaturverzeichnis865
Page 5
In meiner Arbeit möchte ich mich gezielt mit den Therapiemöglichkeiten bei autistischen Kindern und Jugendlichen und deren Integrationsproblemen, besonders in der Schule, beschäftigen. Beginnen werde ich mit einem Fallbericht eines Jungen, der autistische Züge zeigte. Ich lernte diesen Jungen während der letzten zwei Monate meines Zivildienstes 1995 in der Kindertagesstätte 114 in Frankfurt a/M kennen. O. wurde am XX.X.1991 in Deutschland geboren. Die Mutter und der Vater sind beide türkischer Abstammung und leben seit 1980 in Deutschland. O. kam Ende 1995 in die integrative Gruppe der Kindertagesstätte. Diese Gruppe bestand insgesamt aus 12 Kindern, von denen 4 Kinder Behinderungen aufwiesen. O. schien schon als Säugling nicht auf seine Eltern oder Gegenstände zu reagieren, berichteten die Eltern. Seine ersten Wörter sprach er mit 3 ½ Jahren, aber die Sprache entwickelte sich nie richtig. Man konnte ihn häufig nur sehr schwer verstehen, denn seine Aussprache war sehr undeutlich. Oft vertauschte er einzelne Wörter oder verdrehte ganze Sätze. Auch konnte man sehr häufig bei ihm stereotype Bewegungen wie Sich-Wiegen oder Sich-um-sich-selbst-Drehen beobachten. Besonders ist mir aber die sehr geringe Schmerzempfindung aufgefallen. Selbst wenn er sich mit einem Messer geschnitten hatte, schien ihm das keine besonderen Schmerzen zu verursachen. Er hatte sehr wenig Kontakt zu den anderen Kindern und man erhielt den Eindruck, er würde diese förmlich meiden.
Welche Krankheit zeigt so viele Symptome, wobei diese aber nicht alle auf einmal auftreten müssen? Im ICD-10 definiert sich Autismus als „eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die zu schwerer Mehrfachbehinderung führt“ (10. Überarbeitung der International Classification of Diseases, der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, ICD-10 Nr. F 84.0).
Page 6
Der Begriff „Autismus“ wurde von dem Schweizer Psychiater Eugen Beuler im Jahr 1914 als medizinischer Fachbegriff geprägt und dem Bereich der schizophrenen Erkrankungen zugeordnet (Hans E. Kehrer, 2000, S.9). Der eigentliche Ausdruck „Autismus“ läßt sich aus dem griechischen Wortautos,dasselbstbedeutet, ableiten. Beuler kennzeichnete autistische Verhaltensweisen durch erhöhte Kontaktabwehr bzw. Rückzugstendenzen und durch einseitig auf sich selbst bezogenes Denken.
1943 berichtete der amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner zum ersten Mal über mehrere Kinder, welche extreme
Beziehungsstörungen und außergewöhnliche Bezogenheit auf sich selbst aufwiesen. Kanner bezeichnete die beobachteten Störungen als „frühkindlichen Autismus“. Zur selben Zeit, doch völlig unabhängig voneinander, berichtete der österreichische Kinderarzt Hans Asperger über einen Jungen, der signifikante Auffälligkeiten zeigte. Er beschrieb sie als „autistische Psychopathie“ (Bruno J. Schor u. Alfons Schweiggert, 1999, S. 14). Erst nach dem zweiten Weltkrieg begann man sich in Europa für diese Verhaltensstörung zu interessieren, wenngleich das Interesse an solch einem neuen Syndrom erst Anfang der sechziger Jahre rapide zunahm. In den 70er Jahren traten mehr und mehr neurologische Aspekte in den Vordergrund der Autismusforschung. Das Interesse, sich mit dem Thema des frühkindlichen Autismus auseinanderzusetzen, erhielt seinen vorläufigen Höhepunkt Mitte der 80er Jahre. Auch in Deutschland bildete sich 1976 der VerbandHilfe für das autistische Kind e.V.,der seitdem betroffenen Eltern und Kindern vielfältige Hilfe anbietet (Bruno J. Schor u. Alfons Schweiggert, 1999, S. 15).
Zu Beginn der Erforschung des frühkindlichen Autismus ging es vorwiegend um die Diagnose und die Abklärung der Ursachen, während nach und nach die Therapiemöglichkeiten und die