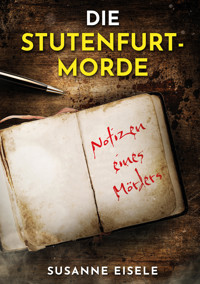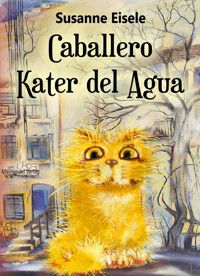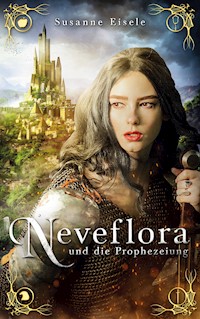4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Sklave. Eine Sklavin Eine Amazone. Ein junger Dämon Sie teilen dasselbe Schicksal. In ihrer Heimat mit dem Tod bedroht, werden sie von der Göttin Bastet gerettet und zu Auserwählten erkoren. Nun sollen sie einen Dämon von seinem Thron stoßen – mit nichts als ihrem guten Willen und einigen Musikinstrumenten. Eine Reise beginnt, bei der es nicht nur um die richtigen Töne, sondern auch die Überwindung von Gegensätzen und Vorurteilen geht. Aber hat Bastet richtig gewählt? Können vier Wesen so unterschiedlicher Herkunft als Team arbeiten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bastets Auftrag
von
Susanne Eisele
© 2025 Susanne Eisele
Cover: Dream Design - Cover and Art
www.cover-and-art.de
Lektorat: Petra Schmid
www.federundlektorat.com
Illustrationen im Innenteil: Susanne Eisele mit Bildern von Pixabay
Druck und Distribution im Auftrag von Susanne Eisele:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback 978-3-384-46613-6
e-Book 978-3-384-46614-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist Susanne Eisele verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag von Susanne Eisele.
Impressum:
Urnagold 32, 72297 Seewald
www.autorin-susanne-eisele.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Für alle, die sich gerne in
fremde Welten »entführen« lassen
und abseits des Mainstreams
lesen möchten.
Viel Freude beim Lesen
Kapitel 1
Daria wachte auf. Ein Blick durch das löchrige Dach der Hütte zeigte ihr, dass es mitten in der Nacht sein musste. Seltsam, sie konnte sich nicht erinnern, jemals während der Schlafenszeit aufgewacht zu sein. Sie lauschte auf die Atemzüge der anderen Sklaven, die gemeinsam mit ihr in der Hütte auf dem Boden lagen. Alle atmeten ruhig und gleichmäßig. Ihr kamen die Worte eines der Leibeigenen in den Sinn. Er hatte vor vielen Monden behauptet, dass die Wachen den Sklaven abends Betäubungsmittel verabreichen würden. Auf diese Art verschafften sie sich selber eine ruhige Nacht. Wenn dem so war, wieso war sie dann heute aufgewacht?
Die harte Arbeit des Tages forderte ihren Tribut. So erschöpft und müde wie sie war, schlief Daria über die Frage auch schon wieder ein.
Als die Sklaven am nächsten Morgen, rüde wie immer, geweckt wurden, fühlte sich Daria seltsam ausgeruht. Das war sonst nie der Fall. Ob das wohl daran lag, dass bei ihr das Betäubungsmittel nicht gewirkt hatte? Zum Nachdenken blieb nicht wirklich Zeit. Sie wurde, zusammen mit zwei weiteren Sklavinnen, zum Fluss getrieben. Dort mussten sie die Kleidung der Wachen und anderer Bediensteten waschen. Den ganzen Tag am oder sogar teilweise halb im Fluss zu knien war durchaus anstrengend. Dennoch war es eine der leichteren und besseren Tätigkeiten für die Sklaven.
Hier am Fluss war einer der wenigen Momente, in denen Daria froh war, so hellhäutig zu sein. Die anderen beiden Wäscherinnen waren mit braunem Teint gesegnet. Sie mussten von der Hitze ungeschützt ihre Arbeit verrichten, da es unerheblich war, ob sie noch etwas dunkler wurden. Daria selbst durfte auf keinen Fall in der Sonne sitzen, weil ihre Haut sonst dunkler werden würde und man ihrem Besitzer vorwerfen konnte, dass er sie wertvoller erscheinen lassen wollte, als sie tatsächlich war. Deshalb durfte sie unter einem schattenspendenden Baum arbeiten, der direkt am Ufer stand. Bei dem Gedanken an ihren Eigentümer wanderten ihre Überlegungen von ganz alleine zu den bevorstehenden Feiertagen »Zwischen den Jahren«. Für sie wären es ihre sechzehnten Festtage. Das bedeutete für Daria, dass man anschließend über ihre weitere Verwendung im neuen Jahr entscheiden würde.
Während ihre Hände die Wäsche wuschen, ging sie in Gedanken zurück zum letzten Neujahrsanfang. Alle hellhäutigen Sklaven über sechzehn hatte man, gruppiert nach ihren Besitzern, nacheinander auf einem Podest aufgereiht. Auch ihre Schwester. Da ihre fast weiße Hautfarbe als hässlich empfunden wurde, war ein Dienst im Haushalt eines hohen Herren ausgeschlossen. Der Anblick hätte seine Augen beleidigt. Für Leibeigene ihrer Kategorie gab es für jedes Geschlecht nur zwei Verwendungsmöglichkeiten.
Die Männer wurden als Arbeitskräfte für gefährliche oder stark kräftezehrende Tätigkeiten eingesetzt. Die Frauen wurden so oft geschwängert wie möglich, in der Hoffnung, dass der Eigentümer viele männliche Nachkommen erhielt, um genügend starke Sklaven zu haben. Besonderes hübschen Sklavinnen konnten manchmal dunkelhäutigen Männern zugeteilt werden, damit ihre Besitzer so hochwertigere Leibeigene erhielten. Diese Verwendung wurde als großes Privileg angesehen. Die meisten Sklaven mussten jedoch Kinder der gleichen, hellen Hautfarbe zur Welt bringen. Schließlich war es unverzichtbar, die wertlosesten aller Sklaven sein eigen zu nennen – wie sollten sonst die Minen betrieben und die Pyramiden erbaut werden?
Die andere Verwendungsmöglichkeit hatte ihre Schwester getroffen. Ein Schicksal, das weibliche wie männliche hellhäutige Leibeigene ereilen konnte. Sie wurden als Menschenopfer dargebracht. Während man die wenigen dunkelhäutigen Sklaven schnell ausbluten ließ, wurde der unvermeidliche Tod der ›weißen‹ Opfergaben qualvoll hinausgezögert. Je länger das Opfer die Tortur überlebte, je mehr es litt und schrie, desto angesehener war dessen Besitzer bei den Göttern.
Daria glaubte noch jetzt, die tagelangen Schreie der Ausgewählten zu hören. Trotz der Wärme überzog eine Gänsehaut ihre Arme und ein kalter Schauer lief ihren Rücken hinunter. Nach zwei Tagen voller Qualen hatte sie den blutüberströmten, noch lebenden Körper ihrer Schwester waschen müssen.
Der fast schwarzhäutige Priester hatte sie währenddessen lüstern angesehen und ihr zugeflüstert: »Im kommenden Jahr bist du dran.«
Den ganzen Tag über musste Daria an ihr bevorstehendes Schicksal denken. Sie war sich sicher, dass der Priester, der ihre Schwester geopfert hatte, sich an sie erinnern und sie einfordern würde. Nicht zum ersten Mal überlegte sie, was sie tun konnte, um dem zu entkommen. Würde sie sich selbst verstümmeln, würde ihrem Besitzer die gute Bezahlung für ein Menschenopfer entgehen. Es war gut möglich, dass er sie dann langsam zu Tode prügeln ließ. Das wäre auch nicht besser. Während Daria weiter ein Kleidungsstück nach dem anderen wusch, ihre Hände dabei im kühlen Nass aufquollen und schmerzten, reifte in ihr eine Idee.
Nach der letzten Nacht glaubte sie daran, dass die Sklaven tatsächlich betäubt wurden wahrscheinlich mit dem Getränk, das zu ihrem kargen Abendessen gereicht wurde. Wenn sie jetzt am Fluss ausreichend trank, konnte sie ihre Abendration an Wasser einem anderen Leibeigenen geben. Sie musste nur darauf achten, dass die Wachen nichts von dem Tausch ihrer Becher mitbekamen. Müde genug, dass sie erst einmal einschlief wie alle anderen, war sie nach dem langen Arbeitstag ohnehin. Sollte sie in der Nacht wach werden, so würde sie in die Wüste fliehen. Ihre Überlebenschancen dort waren nicht wirklich hoch. Aber Daria war sich sicher, dass sie auf diese Weise wenigstens einen gnädigeren und schnelleren Tod finden würde, als unter den Klauen eines Priesters.
Mit zittrigen Händen schöpfte sie sich immer wieder Wasser in den Mund. Die Wachen ließen sie gewähren, da sie gesund bleiben musste, bis die geistlichen Herren ihre Wahl getroffen hatten. Dennoch durfte es nicht auffallen, dass sie offensichtlich mehr trank als üblich.
Endlich war es Abend und Daria wurde zu den Sklavenunterkünften ihres Besitzers gebracht. Sie setzte sich neben die schwangere Kraan, in der Hoffnung, dass diese einen zusätzlichen Becher Wasser ohne viel fragen annehmen würde.
Vor Aufregung hatte Daria keinen Appetit. Sie wusste jedoch, dass sie ihre Kraft brauchen würde, wollte sie auch nur eine Stunde in der Wüste überleben. Also würgte sie ihren Getreidebrei hinunter. Gerne hätte sie einen Schluck Wasser dazu getrunken, doch dann könnte sie ihre Fluchtpläne begraben. Ob sich nochmals so eine gute Gelegenheit ergab, tagsüber so viel zu trinken, wusste sie nicht. Gespannt behielt sie die Wachen und Kraans Becher im Auge. Als die Schwangere leergetrunken hatte, vertauschte sie mit einem Augenzwinkern die Gefäße. Als Kraan ansetzte, etwas zu sagen, wisperte ihr Daria kaum hörbar zu: »Ich konnte am Fluss genug trinken. Du brauchst es nötiger als ich.«
Kurz zögerte die Schwangere, dann neigte sie fast unmerklich den Kopf. Mehr gestanden sich beide Frauen nicht zu, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Mit zitternden Beinen legte sich Daria schließlich auf den Boden, etwas weiter außen, als sonst üblich. Jeder, der ihr Zittern bemerkte, würde es hoffentlich auf ihre Müdigkeit und die Kühle der Nacht schieben. Sie zog eine fadenscheinige Wolldecke über sich und kuschelte sich an die Leiber der sie umgebenden Menschen. Die Decken der Sklaven waren so dünn, dass die Nachtkälte nur dadurch zu ertragen war, dass sich alle aneinanderschmiegten, um sich gegenseitig warm zu halten. Ein Schauder rann durch Darias Körper, als sie daran dachte, dass sie in der Wüste niemanden haben würde, an dem sie sich wärmen konnte. Kurz überlegte sie, ihre Fluchtpläne aufzugeben, erinnerte sich dann aber an den geschundenen Körper ihrer Schwester. Nein! Lieber in der Wüste erfrieren, als so zu enden.
Sollte sie wider Erwarten einige Zeit in der unwirtlichen Gegend überleben, war es wahrscheinlich besser, sich tagsüber versteckt zu halten und nachts weiterzugehen. Durch die Bewegung würde sie hoffentlich nicht den Kältetod erleiden. Aber dazu musste sie es erst einmal in die Wüste schaffen. Müde schloss sie die Augen und schlief trotz ihrer Unruhe vor Erschöpfung ein.
Als sie schläfrig die Augen öffnete, war es draußen noch dunkel. Das Licht der Sterne reichte kaum, um sich in der Hütte zurechtzufinden, zumal es nur durch die Löcher im Dach ins Innere dringen konnte. Vorsichtig setzte Daria sich auf. Um sich herum vernahm sie nur leichtes Schnarchen und die typischen Laute der nächtlichen Wüste. Die Decke fest an sich gedrückt, stand sie auf, horchte erneut, doch die Geräusche veränderten sich nicht. Zögerlich bahnte sie sich einen Weg durch die eng an eng liegenden Sklaven. Sie hatte sich ihren Schlafplatz zwar am Rand des Menschenknäuels gesucht, dennoch musste sie aufpassen, dass sie auf dem Weg zur Tür nicht über jemanden stolperte. Einmal trat sie einem Mann auf die Hand, doch betäubt wie er war, bemerkte er das nicht. Schon nach kurzer Zeit stand sie vor dem Durchgang mit dem Vorhang.
Sie wusste, dass sie noch an zwei Sklavenhütten vorbeilaufen musste, dann über eine sehr niedrige Steinmauer, die kriechende Tiere, vor allem Schlangen, weitgehend draußen halten sollte. Danach begann die Wüste. Kurz überlegte sie, ob es besser wäre in Richtung Fluss zu laufen. Dort wären ihre Überlebenschancen vermutlich größer. Allerdings wurden die Flussränder bewirtschaftet und tagsüber liefen da viele Menschen herum. Die Wahrscheinlichkeit aufgegriffen zu werden war so erheblich höher als in der Wüste. Möglicherweise würde sie dahin nicht einmal jemand verfolgen, weil niemand das Leben der Wächter für eine wertlose Sklavin aufs Spiel setzen würde – hoffte sie.
Noch einmal nahm sie allen Mut zusammen, und strich den Vorhang so weit zur Seite, dass sie hinausschauen konnte. Vor der Hütte waren das Mond- und das Sternenlicht deutlich heller, so dass sie zumindest Schemen wahrnahm. Es war niemand zu sehen. Kurz schloss sie die Augen und atmete so tief ein, wie sie es ohne ein Geräusch zu verursachen riskieren konnte. Dann lief sie geduckt aus der Hütte. Im Vorbeigehen nahm sie noch ein paar Sandalen an sich, damit sie sich tagsüber in der Wüste nicht die Fußsohlen im heißen Sand verbrannte.
Nichts regte sich. Sie huschte zur nächsten Hütte, um zu einer Seite hin verdeckt zu sein. Bevor Daria zur letzten der Behausungen schlich, horchte sie nochmals in die Nacht hinein. Weit entfernt hörte sie ein Kamel schnauben. In dieser Richtung brannten auch ein paar wenige einsame Öllampen. In den flackernden Schatten konnte sie keine Menschen entdecken.
Vorsichtig und leise wagte sie sich weiter vor. Ein lautes Schnarchen ließ sie zusammenzucken. Nachdem andere ungewöhnliche Geräusche ausblieben, setzte sie ihren Weg fort. Ein schneller Blick zurück, niemand zu sehen. Zügig kletterte sie über die Mauer und legte sich dahinter kurz auf den Boden. So konnte sie von den Hütten aus nicht gesehen werden, während sie noch einmal angestrengt in die Nacht lauschte.
Nachdem es weiter still blieb, zog Daria die Sandalen an, schlang sich die Decke um die Schultern und stand auf. Ihr war klar, dass sie vom Dorf aus zu sehen war. Gleichzeitig hoffte sie, dass für die Wachen, die sich im Bereich der Lampen aufhielten, das Sternenlicht zu gering war, um sie zu entdecken. In ihrer Furcht war sie versucht zu rennen, damit sie in kurzer Zeit den größtmöglichen Abstand zwischen sich und die Sklavenhütten bringen konnte. Ihr war jedoch bewusst, dass sie ein schnelles Tempo nicht lange würde durchhalten können. Daher schritt sie zügig aus, ohne ins Laufen zu verfallen.
Erst jetzt kam ihr in den Sinn, dass es in der Wüste Skorpione und Schlangen gab, deren Biss giftig war. Ein kurzer Schauer ließ sie frösteln, während sie weiter ausschritt. Nach allem was sie wusste, töteten diese Gifte zumindest einigermaßen schmerzfrei. Und schnell. Eine wirkliche Aussicht ihre Flucht zu überleben hatte sie ohnehin nicht. Nicht ohne Wasser und Reittier. Trotzig hob sie ihren Kopf etwas an. Sie würde nicht aufgeben. Wenn ihr die Götter und die Sandlandschaft gnädig waren, würden sie ihr wenigstens einen schnellen Tod bescheren. Das war immer noch besser als ein langsamer, qualvoller Tod als Menschenopfer.
Entweder waren die Götter ihr wohlgesonnen oder sie wollten noch etwas mit ihr spielen. Kurz vor Tagesanbruch entdeckte Daria fünf Kakteen mit insgesamt dreizehn reifen Früchten. Eine der Kaktusfeigen aß sie sofort und spürte, wie die Flüssigkeit ihrer trockenen Kehle guttat. Die restlichen Feigen legte sie in einen verknoteten Zipfel der Decke, bevor sie ihren Weg fortsetzte. In einiger Entfernung entdeckte sie auf der rechten Seite ein paar Felsen, die dort aufragten. Sie änderte ein wenig ihre Richtung, um dahin zu gelangen. In deren Schatten hoffte sie die heißesten Stunden des Tages verbringen zu können.
Wenn sie die Steinformation vor dem Höchststand der Sonne erreichen wollte, musste sie ein wenig schneller gehen. Damit sie dafür genügend Kraft hatte, aß sie noch eine Frucht. Dann beeilte sie sich, weiterzukommen.
Wenig später kündigte die Morgendämmerung den neuen Tag an. Der Weg bis zu den Steinen ließ ihren Mut sinken. Es schien, als wäre sie keinen Schritt weit gekommen. Wie sollte sie das schaffen, wenn erst einmal die Sonne aufgegangen war und gnadenlos auf sie herabbrennen würde? Zumindest hatte sie die Decke als Sonnenschutz, aber es würde dennoch heiß und anstrengend werden. Entschlossen setzte sie einen Schritt vor den anderen. Jetzt aufzugeben kam für Daria auf keinen Fall in Frage.
Ein Blick zurück ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Deutlich waren ihre Spuren im Sand zu sehen. Inzwischen dürfte ihre Flucht bemerkt worden sein. Die Wärter mussten nur den Fußabdrücken folgen.
Die Kamele der Aufseher waren trotz der gemütlichen Gangart schneller als ein Mensch. Spätestens am Abend würde man sie zurückgeschleppt haben. Oder hatte sie doch noch eine Chance, weil der beständige leichte Wind vielleicht ihre Spuren verwischte? Schließlich hatte sie schon einiges an Entfernung zurückgelegt. Aber würde das ausreichen?
Entschlossen blickte sie wieder nach vorne. Vielleicht könnte sie sich zwischen den Felsen verstecken – wenn sie es denn bis dahin schaffte. So zügig, wie sie es sich zutraute, ging sie weiter. Ihren Blick dabei starr auf die Steinansammlung gerichtet. So entging ihr der Sandsturm, der von links auf sie zukam. Erst als ihr die ersten Sandkörner unangenehm entgegenkamen, bemerkte sie die Gefahr. Daria wusste, dass sie nicht die geringste Chance hatte, ihm auszuweichen.
Kurz blieb sie mit aufgerissenen Augen stehen. Was sollte sie jetzt tun? Zurücklaufen? Es war unmöglich zu sagen, wohin sich der Sandsturm weiterbewegen würde. Möglicherweise lief sie so erst recht in das Unwetter hinein. Außerdem würde sich so ihr Abstand zur Stadt wieder verringern. Sie blickte erneut nach vorn, hin zu der Felsformation. Irgendwie hatte Daria den Eindruck, dass die etwas näher war. Sie nahm allen Mut und alle Kraft zusammen, die sie aufbringen konnte und lief, so rasch es ihr möglich war, in Richtung der Steine. Als sie nur noch wenige Meter von den Felsen entfernt war, hatte der Ausläufer des Sandsturms sie eingeholt. Schnell zog sie sich einen Teil der Decke über Mund und Nase. Beinahe trotzig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Es durfte nicht sein, dass sie bis hierher gekommen war und jetzt wegen ein paar Schritten doch noch scheiterte!
Sie kniff die Augen zusammen und hielt den Mund geschlossen, auch wenn sie so kaum genug Luft bekam. Die Felsen waren nur verschwommen zu sehen. Tränen glitzerten in ihren Augen, was ihre Sicht weiter trübte. Sie war kurz davor sich einfach hinzusetzen und den Tod zu erwarten, als sie mit dem Fuß gegen etwas Hartes stieß. Scharf sog Daria die Luft durch den Mund ein, wodurch sie trotz der Decke Sand zwischen den Zähnen spürte und anfing zu husten. Dennoch durchströmte Freude ihren Körper. Sie hatte es bis zu den Felsen geschafft! Den Schmerz in ihrem Zeh so gut es ging ignorierend, tastete Daria sich langsam vorwärts. Nach wenigen Schritten befand sie sich inmitten einiger, etwas mehr als hüfthohen, Steine wieder. Sogleich ließ sie sich auf die Knie herab, spürte wie der Sturm weitgehend über sie hinwegfegte und sie besser atmen konnte. Erleichtert schloss sie für einen Moment die Augen und gestattete sich eine kurze Pause.
Allzu lange währte die Erleichterung nicht. Das Heulen des Windes nahm zu und blies den Sand auch zwischen die Steine. Sie benötigte dringend einen Überhang, besser noch eine Höhle, in der sie Unterschlupf finden konnte. Auf den Knien versuchte sie, ihre Umgebung zu erkunden. Obgleich sie in der Lage war, ein klein wenig zu sehen, tastete sie zusätzlich mit den Händen den Boden ab. Schließlich fanden ihre Finger eine Lücke in dem Untergrund. Sie besah sich die Stelle genauer. Es machte den Eindruck, als verdecke ein flacher Stein eine Kuhle. Mühsam schob sie ihn beiseite. Tatsächlich verbarg sich darunter ein Spalt, der gerade groß genug erschien, dass sie sich dort hinkauern könnte.
Vorsichtig stieg sie mit den Füßen in die Vertiefung, dann duckte sie sich, um endlich dem wirbelnden Sand zu entkommen. Daria wollte schon erleichtert aufatmen, als plötzlich der Boden unter ihr nachgab. Mit einem Aufschrei rutschte sie mindestens drei Manneslängen nach unten. Der Abhang war zwar steil, dennoch glitt sie mehr hinunter, als dass sie fiel. Dadurch kam sie mit leichten Abschürfungen, aber ansonsten heil am Ende ihrer unfreiwilligen Rutschpartie an.
Vollkommen verwirrt blieb Daria für einen Moment liegen, bevor sie sich aufrichtete und ihre Umgebung betrachtete.
Hinter ihr erhob sich der sandige Steilhang, den sie soeben heruntergerutscht war. Zwei Schritte links von ihr sprudelte munter eine kleine Quelle aus der Felswand. Das Wasser floss als Bach neben einem breiten Weg her – zumindest so weit, wie sie sehen konnte, was nicht viel war. Das wenige Licht, das durch den Spalt fiel, reichte dafür nicht aus. Zusätzlich schienen der Wasserlauf und der Pfad nach wenigen Schritten eine Biegung zu machen.
Noch einmal schaute sie nach oben. Offensichtlich tobte dort weiterhin der Sandsturm, da das Licht nur gedämpft zu ihr herabfiel. Langsam sickerte in ihr Bewusstsein, dass sie für den Moment in Sicherheit war. Bei dem Sturm würde niemand ihr nachjagen. Dafür war das Leben der Wachen zu wertvoll, verglichen mit dem einer Sklavin. Der starke Wind hatte schon längst ihre Fußspuren verschwinden lassen, was die Suche nach ihr deutlich erschweren würde. Durch die Quelle hatte sie Wasser, außerdem war die Höhle so groß, dass ihr selbst dann nicht die Luft ausging, wenn sich der Sand über den Eingang legen würde.
Wie sie später den sandigen Steilhang wieder hochklettern sollte, war ihr ein Rätsel, dessen Lösung sie auf einen anderen Zeitpunkt verschob.
Daria stand auf, ging zu dem Bach und kniete sich nieder. Dann schnupperte sie, ob das Wasser schlecht roch. Da war jedoch nur der Duft von frischem, klarem Nass. Zögernd tauchte sie eine Hand in den kühlen Wasserlauf, schöpfte etwas von der Flüssigkeit und prüfte nochmals den Geruch, bevor sie trank. Es war tatsächlich nichts als klares, sauberes Wasser. Sauberer sogar als das des Flusses, mit dem sie sonst ihren Durst löschte. Ermutigt wiederholte sie den Vorgang, bis ihr Magen mit dem köstlichen Nass gefüllt war.
Ein weiterer Blick nach oben zeigte ihr das gleiche Bild wie zuvor. Vor der Höhlenöffnung tobte weiterhin der Sturm. Daria beschloss, die Gunst der Stunde zu nutzen und ein wenig zu ruhen. Später würde sie nochmals ausgiebig trinken und dann entscheiden, was sie weiter tun wollte. Sie legte die Kaktusfeigen sorgfältig neben sich ab, wickelte sich in ihre Decke und war kurz darauf tief und fest eingeschlafen.
Als Daria erwachte, war es stockfinster. Erschrocken blickte sie in die Richtung des Einstiegs, konnte aber nicht ausmachen, ob es einfach nur dunkle Nacht war oder der Sand den Spalt verdeckt hatte. Sie setzte sich auf und spürte einen kühlen Luftzug an ihren nackten Schultern. Fröstelnd zog sie die Decke enger um sich, atmete jedoch auf, da die Öffnung nicht ganz zugeschüttet worden sein konnte, sonst würde kein kalter Nachtwind zu ihr herunterwehen. Sie fühlte sich ausgeruht, aber auch hungrig. Tastend griff sie neben sich und war erleichtert, als sie feststellte, dass die Früchte neben ihr lagen. Sie hatte solchen Hunger, dass sie gleich drei der Feigen aß. Jetzt waren nur noch acht übrig. Sie hoffte, dass sie bei Tagesanbruch einen Ausgang aus der Höhle und in der Wüste etwas Essbares fand. Verdursten würde sie hier drinnen jedenfalls nicht. Gerade überlegte sich Daria, ob sie für einige Zeit hierbleiben konnte und nur zu Streifzügen die sichere Höhle verlassen sollte, als sie einen Lichtschimmer wahrnahm. In der Richtung war die Wegbiegung. Sie verharrte still, der Schimmer schien sich jedoch nicht zu bewegen. War sie hier wirklich in Sicherheit? Zweifel und Angst machten sich breit.
Den Blick starr auf das feine Glimmen gerichtet überschlug sie ihre Optionen. Hier sitzen bleiben und wie ein hilfloses Tier darauf warten, was da auf sie zukam? Nein. Sie war nicht geflohen, um weiterhin das Spielzeug anderer zu sein. Es blieb also nur aufzustehen und nachzusehen, was diesen Schimmer verursachte. Möglicherweise war es ganz harmlos. Eine weitere Öffnung in der Höhlendecke, bei der kein Stein oder ähnliches den Sternenhimmel verdeckte. Es könnten jedoch auch Menschen mit einer abgedeckten Lampe dort nächtigen. Dann würde sie so schnell wie es ging hierher zurückkehren, nochmals so viel trinken wie möglich und versuchen, trotz der Dunkelheit, den Weg hinauf zu finden. Denn egal, ob diese Menschen Wachen oder Mitglieder einer Karawane waren, aufgrund ihrer Hellhäutigkeit wäre jedem sofort klar, dass sie eine Sklavin war. Leibeigene mit ihrem Teint wurden nicht einmal mit Sklavenringen gekennzeichnet, da ihre Hautfarbe Kennzeichnung genug war.
Eine Gefahr die man kannte, war besser als eine unbekannte. Daher legte sie sich die Decke um die Schultern, packte ihre restlichen Kaktusfeigen in einen Zipfel und schlich leise auf den Lichtschimmer zu. Kurze Zeit später fühlte sie mit der ausgestreckten Hand, dass sie an der Wegbiegung angekommen war. Das Licht hatte sich nicht verändert, auch konnte sie keine Geräusche vernehmen. Noch einmal atmete sie tief und möglichst lautlos ein, dann blickte sie vorsichtig um die Felswand.
Die Biegung war jedoch so langgestreckt, dass sie dennoch nichts als Dunkelheit und den sanften Lichtschimmer sah. Mit einer Hand am Gestein schlich sie um die Kurve herum. Dann blieb sie stehen.
Erleichtert sanken ihre angespannten Schultern herab und sie gestattete sich, den angehaltenen Atem auszustoßen. So weit wie es die Lichtverhältnisse zuließen, konnte sie nur den Bachverlauf und den Weg erkennen. Ansonsten war sie allein. Obwohl sie keinen Luftzug spürte, musste die Höhlendecke verschiedene Öffnungen haben, durch die der Mond und die Sterne hereinleuchteten. Von ihnen kam der sanfte Schimmer, der sich durch den gesamten Gang zog.
Beim Anblick des silbern glitzernden Wassers bemerkte Daria, dass sie durstig war. Das Licht war schwach, aber hell genug, dass sie gefahrlos an den Bachlauf knien und ihren Durst stillen konnte. Dabei glitt ihr Blick immer wieder den Gang entlang. Sollte sie es wagen und ihn weitergehen? Verdursten würde sie nicht. Mit etwas Glück fand sie unterwegs auch essbare Käfer oder Wasserpflanzen. Die Aussicht, in der Wüste zu überleben und genügend Nahrung und vor allem Wasser zu finden war wesentlich geringer. Es kribbelte ihr in den Füßen aufzuspringen und loszulaufen, doch hielt sie sich selbst zurück.
Die Bedingungen der Wüste kannte sie. Es gab unter den Sklaven die Sage, dass es ein weit entferntes Land gäbe, in dem Menschen mit sehr heller Hautfarbe frei leben konnten. Wenn sie dieses Gebiet finden würde, hätten sich alle Strapazen gelohnt. Auf der anderen Seite wusste sie nicht, in welcher Richtung das Reich liegen sollte. Da konnte sie genauso gut dem Bachlauf folgen und schauen, ob und wo dieser an die Oberfläche trat.
Schließlich setzte sie sich hin und beschloss, auf die Morgendämmerung zu warten. Sollte der Lichtschimmer vom Mond- und Sternenlicht kommen, müsste sich dieser bei Tagesanbruch verändern. Wenn sie es dann immer noch für eine gute Idee hielt, dem Bachlauf zu folgen, würde sie genau das tun.
Daria musste wohl nochmals eingeschlafen sein. Als sie die Augen geöffnet und sich ausgiebig gestreckt hatte, fühlte sie sich so ausgeruht wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Sofort bemerkte sie, dass sich der sanfte Glimmer in ein goldenes Licht gewandelt hatte, das den Weg angenehm hell erleuchtete. Zügig setzte sie sich auf. Erneut dachte sie über ihre Möglichkeiten nach. Ursprünglich war sie geflohen, weil sie sich einen schnellen, gnädigen Tod in der Wüste erhoffte. Unterwegs hatte sie Kaktusfeigen gefunden, war dem Sandsturm entkommen und darüber hinaus in dieser Höhle, mit ausreichend Wasser zum Überleben, gelandet. Es schien, als seien die Götter ihr, einer minderwertigen, hellhäutigen Sklavin, wohlgesonnen. Diese Geschenke wegzuwerfen und den Tod in der Wüste zu suchen wäre einer Gotteslästerung gleichgekommen. Daher beschloss sie, den ihr aufgezeigten Weg, dem Bach entlang, zu folgen. Wenn es die Götter wirklich gut mit ihr meinten, würde sie vielleicht sogar das sagenumwobene Land finden, in dem sie frei leben konnte.
Doch zuerst wollte sie an der Quelle ein Bad nehmen, das erschien ihr bequemer, als in dem seichten Bach zu baden. Sie stand auf, nahm ihre Decke und die Feigen und ging um die Biegung herum. Ihr Blick wanderte nach oben. Das Loch in der Decke, durch das sie hereingestürzt war, war zwar vom Sand deutlich verkleinert worden, dennoch ließ es genügend Licht herein. Sie betrachtete es sich genauer. So klein wie die Öffnung jetzt war, würde sie nicht herausklettern können, vorausgesetzt, sie würde überhaupt da hinaufkommen. Sie nahm das erneut als Zeichen der Götter und begab sich zur Quelle. Dort legte sie die Decke und das große Leintuch, das ihr als Kleid diente, ab und stieg in den Bach um sich zu waschen. Auch über ihre Haare ließ sie das Quellwasser fließen, damit sie den Sand herauswaschen konnte.
Gedankenverloren betrachtete sie die hüftlangen, blonden Flechten. Eigentlich wären ihr diese am kommenden Neumond abgeschnitten worden, um – nach dem Schwarzfärben – Perücken für die Herrschenden daraus zu machen. Das wäre bereits das dritte Mal gewesen, dass ihr Schopf dafür verwendet wurde. Daria seufzte. Gerne hätte sie ihre blonde Pracht in ein geflochtenes Kunstwerk verwandelt, doch ihre Haare waren so glatt, dass sie ohne Hilfsmittel nicht in Form zu bringen waren – zumal sie nicht einmal einen Kamm hatte. Vielleicht fand sie ja unterwegs etwas, das sie zum Frisieren und als Haarklemme nutzen konnte.
Nachdem Daria sich ausgiebig gewaschen und erneut ein wenig getrunken hatte, wusch sie auch das Leinentuch und band es sich dann nass wie es war um ihren Körper. In der Höhle war es warm genug, dass sie davon nicht krank werden sollte.
Als sie aus dem Wasser gestiegen und ihre Decke ausgeschüttelt hatte, wollte sie gerade die um ihre Schultern legen, als sie plötzlich Stimmen vernahm.
Da war jemand bei den Felsen über ihr!
Wie erstarrt lauschte sie, um das Gespräch halbwegs verstehen zu können.
»Warum suchen wir hier eigentlich herum? Die Sklavin ist in den Sandsturm geraten und fertig. Das ist doch ganz klar.«
»Außerdem gibt es hier kein Wasser, mitgenommen scheint sie auch keins zu haben. Wenn sie nicht im Sturm umgekommen ist, verdurstet sie demnächst«, schaltete sich eine andere Stimme ein.
»Ruhe! Sucht weiter. Priester Nefkeron hat ausdrücklich angeordnet, dass wir ihre Leiche mitbringen sollen, wenn wir sie finden.« Die dritte Stimme gehörte offenbar zu einem Kommandanten.
Daria erschauderte und schielte zu dem Loch in der Decke. Was, wenn die Männer es fanden, nach unten schauten und sie entdeckten? Im ersten Moment geriet sie in Schockstarre und war nicht fähig sich zu rühren. Dann jedoch übernahm ihr Lebenswille die Kontrolle über ihren Körper.
Leise und zügig ging sie zu der Biegung. Dort konnten die Männer sie nicht mehr sehen. Verzweifelt betete sie zu ihrer Lieblingsgöttin Bastet, dass die Wachen die feuchten Abdrücke, die sie von ihrem Bad hinterlassen hatte, durch den kleinen Spalt nicht erkennen konnten. Die Häscher würden vom gleißend hellen Licht ins relative Dunkel blicken, das hoffentlich ihre Spuren verbarg.
Nachdem sie die Biegung umrundet hatte, blieb Daria abermals stehen und lauschte. Hinter ihr blieb es still. Es deutete auch nichts darauf hin, dass jemand das Loch in der Höhlendecke vergrößerte. Ein klein wenig beruhigter, beschloss sie weiter zu gehen.
Ihr Weg führte sie immer am Bach entlang. Dass es Abend wurde, bemerkte Daria am dunkler werdenden Licht, das den Gang beleuchtete. Sie war müde und entschloss sich, gleich an der Stelle zu rasten. Dieser Platz war so gut wie jeder andere. Nachdem sie ausgiebig getrunken hatte, aß sie ein paar der Früchte, bevor diese schlecht wurden. Als der silberne Schimmer des Mondes und der Sterne die Höhle spärlich beleuchtete sprach sie ein Dankesgebet, für diesen Tag, den sie in Freiheit erleben durfte und legte sich hin zum Schlafen.
Am nächsten Morgen aß sie die restlichen Früchte und betete darum, dass sie im Bach oder in den Gängen Nahrung finden mochte. Nachdem sie ihren Magen mit Wasser gefüllt hatte, setzte sie ihren Weg am Bachlauf entlang fort.
Die Höhle veränderte sich nicht wirklich. Mal machte der Weg eine Biegung nach links oder rechts, mal war er etwas heller erleuchtet, mal dunkler, doch stetig war linker Hand der Bach und sie lief auf dem sandigen, mehr oder weniger zwei bis drei Schritt breiten Weg. Die Höhlendecke blieb stets mindestens zwei Manneslängen hoch.
Am Nachmittag war Daria nicht nur hungrig, sie vermisste auch die Gesellschaft anderer. Wenn sie an ihr bisheriges Leben zurückdachte, stellte sie fest, dass sie tatsächlich noch nie völlig auf sich allein gestellt war. Selbst wenn nicht geredet wurde, waren doch immer andere Sklaven oder Wächter um sie herum gewesen. Die letzten zwei Tage waren für sie so einschneidend und aufregend, dass sie gar nicht dazu gekommen war, irgendetwas zu vermissen. Selbst die Nächte, die sie allein, statt eingekeilt zwischen anderen, verbracht hatte, waren eine neue Erfahrung. Doch so langsam breitete sich ein Gefühl von Einsamkeit in ihr aus. Hoffentlich nahm der Gang bald ein Ende. Was immer sie dort auch vorfinden würde.
Daria war so in Gedanken versunken, dass sie die Katze erst bemerkte, als diese an ihren Beinen vorbeistrich. Erschrocken aber auch erstaunt blieb sie stehen. Eine Katze? Hier in der Höhle? Danngab es sicher in der Nähe einen Ausgang. Erst nach diesem Gedankengang besann sie sich und kniete sich demütig nieder – schließlich waren Katzen die heiligen Geschöpfe der Göttin Bastet. Ehrerbietig blickte sie die beige Katze mit den dunklen Punkten an.
Das Tier stupste sie kurz mit der Pfote an den Arm, bevor es zwischen zwei Felsbrocken verschwand. Für einen Moment verharrte Daria, dann stand sie langsam auf und ging zu der Stelle, an der die Katze verschwunden war. Sie kniete erneut nieder und besah sich die Felsen. Bei genauem Hinsehen, konnte sie einen Spalt entdecken, der jedoch selbst für ihre schlanke Gestalt viel zu eng war, um hindurchzukriechen. Seufzend kehrte sie zu ihrem Weg zurück. Sie schalt sich selbst einen Narren. Ja, sie war alleine hier, aber dafür in Sicherheit. Warum wollte sie so unbedingt aus der Höhle heraus? Sie würde auch ohne Gesellschaft überleben – jedoch nicht ohne Nahrung. Vielleicht sollte sie den Bach und den Boden gründlich absuchen. Irgendetwas Essbares würde sie schon finden.
Sie hatte kaum zwei Schritte gemacht, als es hinter ihr raschelte. Erschrocken drehte sie sich um. Das Bild, das sich ihr bot, war so seltsam, dass sie es erst auf den zweiten Blick richtig erfasste. Die Katze war zurückgekehrt. Im Mäulchen hatte sie den Stiel des Blattes einer Fächerpalme, das sie hinter sich herzog. Auf dem Blatt lagen drei Getreidebreifladen und einige Datteln. Darias Magen fing schon bei dem bloßen Anblick an zu knurren. Zielstrebig kam die Katze mit ihrer Last auf die junge Frau zu. Daria kniete sich nieder, die Augen auf den Boden gerichtet. So musste sie wenigstens das Essen nicht mehr sehen, allerdings zog der Geruch trotzdem in ihre Nase. Warum musste dieses süße Lebewesen sie so quälen? Wahrscheinlich war das dem Geschöpf gar nicht bewusst, dennoch konnte sie diesen bitteren Gedanken nicht unterdrücken, zumal ihr Magen einmal mehr deutlich vernehmbar knurrte.
Während sie das Palmblatt direkt vor Daria platzierte, streifte die Katze deren Arm. Dann stupste sie die junge Frau erneut an. Mit Tränen in den Augen besah sich Daria das Essen. Wenn das Tier nicht heilig gewesen wäre, hätte sie zugegriffen, aber sie konnte unmöglich einer Katze etwas wegessen!
Das heilige Geschöpf war wohl anderer Meinung. Es schob ihr einen der Fladen zu, dann stupste es sie auffordernd an. Daria zögerte noch kurz, aber offensichtlich wollte das Tier, dass sie den Fladen aß. Außerdem war auch niemand sonst da, der sie dafür bestrafen konnte. Gut, die Götter waren immer anwesend. Was wäre, wenn die Katze von Bastet persönlich geschickt worden war, um ihr zu helfen? Sie verwarf den Gedanken gleich wieder. Schließlich war sie nur eine minderwertige, hellhäutige Sklavin.
Vorsichtig griff sie nach dem Fladen. Die Katze sah ruhig zu. Daria bildete sich sogar ein, so etwas wie ein leichtes Lächeln zu erkennen. Deshalb sandte sie ein kurzes Dankesgebet an die Götter, und noch extra eines an Bastet, bevor sie voller Genuss in den gebackenen Getreidebrei biss. Sie ließ sich Zeit mit dem Essen, es wartete schließlich keine Arbeit auf sie.
Kaum hatte sie den ersten Fladen verspeist, schob ihr die Katze einen weiteren und einige Datteln zu. Noch immer vorsichtig, aber doch schon mutiger als zuvor, griff sie nach den Früchten. Das heilige Tier nickte leicht, daraufhin biss sie hinein. Die Frucht war süß und saftig. So gute Datteln hatte sie in ihrem Leben noch nicht gegessen. Zufrieden schloss sie für einen Moment die Augen.
Das leichte Stupsen der Katze veranlasste Daria, das Tier anzusehen. Offensichtlich sollte sie weiteressen. Doch Daria schüttelte lächelnd den Kopf.
»Das war ganz wundervoll, eine echte Wohltat. Aber für den Moment bin ich gesättigt. Wenn du erlaubst, liebe Katze, werde ich mir den Rest für später einpacken.«
Das Tier nickte, machte einen Schritt zurück, ohne das Palmblatt mitzunehmen und setzte sich abwartend in den Sand. Mit langsamen Bewegungen schlug Daria die restlichen Fladen und Datteln in das Blatt ein, das sie in ihre Decke legte. Sie verbeugte sich nochmals ehrerbietig vor dem heiligen Tier, dann nahm sie ihre Wanderung erneut auf.
Zu ihrer Überraschung schloss sich die Katze ihr an. Hin und wieder verschwand sie kurz, vielleicht um außerhalb der Felsenhöhle eine Maus oder ähnliches zu erlegen, doch nach einiger Zeit tauchte sie erneut an Darias Seite auf.
»Du willst mich begleiten? Das freut mich sehr, dann bin ich nicht mehr so alleine. Aber dann sollte ich dir einen Namen geben. Einfach nur Katze ist einem heiligen Tier nicht angemessen.« Daria überlegte eine Weile. Es musste ein guter Name sein, keiner, den sie von anderen Sklaven kannte, das wäre dem Geschöpf nicht würdig. Nach einiger Überlegung kam ihr eine Idee. »Was hältst du von Basti? Quasi eine Kurzform des Namens der Katzengöttin Bastet?«
Sie blickte zu dem Tier, das eifrig nickte und danach an Darias Beinen entlangstrich. Daria nahm das als Zustimmung.
Bis zum Abend hatte sich der Gang noch immer nicht verändert. Daria setzte sich auf ihre Decke und packte das Geschenk der Katze aus. Bevor sie zu essen begann, hielt sie Basti einen großen Teil des Fladens hin. »Magst du auch etwas hiervon, statt immer nur Mäuse, oder was du sonst so findest?«
Das Tier schnüffelte an dem dargebotenen Stück, dann biss es davon ab. Anschließend schob es Darias Hand mit der Pfote von sich weg. Mit einem Lächeln aß die junge Frau den Rest. So teilten sie sich Fladen und Datteln. Eigentlich hatte Daria noch etwas davon für den nächsten Tag aufbewahren wollen, doch es schmeckte so gut und sie hatte nach einem durchwanderten Tag solchen Hunger, dass sie, gemeinsam mit Basti, alles verzehrte. So gestärkt würde sie auch wieder einen oder zwei Tage nur mit Wasser auskommen und das floss ja weiterhin direkt neben ihr im Bach.
Nach dem Essen legte sie sich zum Schlafen nieder. Trotz der Decke fröstelte sie leicht, vermisste die wärmenden Körper der anderen Sklaven. Sie war jedoch müde genug, um dennoch einzuschlafen. Kurz bevor sie endgültig ins Reich der Träume hinüberglitt bemerkte sie, dass sich Basti an sie schmiegte. Schon gleich wurde ihr vom Herz ausgehend viel wärmer.
Als Daria am nächsten Morgen aufwachte, lag Basti noch immer an sie geschmiegt da. Ihr war bewusst, dass sie als Sklavin so ein heiliges Tier eigentlich nicht berühren durfte, da sich jedoch die Katze an sie gekuschelt hatte, getraute sie sich, sanft über das seidige Fell zu streicheln. Schon nach kurzer Zeit hörte sie ein deutliches Schnurren, konnte es sogar über den Körperkontakt spüren. Dann konnte das ja nicht so falsch sein. Behutsam liebkoste sie das Tier weiter.
Später am Tag trank sie ausgiebig und wusch sich das Gesicht. Als sie sich wieder nach Basti umsah, hatte die Katze erneut ein Palmblatt herangeschleppt. Dieses Mal mit Brot, Ziegenkäse und Feigen. Nur ganz kurz wunderte sich Daria, doch dann genossen sie und die Katze das gute Frühstück. Anschließend machten sie sich wieder auf den Weg.
So blieb es für die nächsten drei Tag ihre Routine. Wenn Basti nicht gerade jagen war, sprach Daria mit ihr, während sie neben dem Bach hergingen. Die junge Frau hatte dabei stets den Eindruck, dass die Katze sie verstand. Die gesamte Zeit über fühlte sie sich frei und unbeschwert wie noch nie in ihrem Leben.
Kapitel 2
Der Schweiß floss Jack in Strömen vom Körper. Da, wo er in die blutverkrusteten Striemen auf seinem Rücken hinab rann, dem Zeichen seiner letzten Bestrafung durch seinen Eigentümer, brannte und juckte es wie verrückt. Dennoch getraute er sich nicht, auch nur für einen Moment in seiner Arbeit innezuhalten. Er war sich nicht sicher, ob er weitere Peitschenhiebe, die zweifelsohne auf ein »Faulenzen« folgen würden, überleben würde.
Plötzlich tauchten Stiefel in seinem Blickfeld auf. Nicht die auf Hochglanz polierten der Herren, sondern die leicht staubigen eines Vorarbeiters – Aufseher wäre das bessere Wort, den Arbeiten war für den Weißen ein Fremdwort.
»He du, sattle Sturmwind.«
Der biestigste Hengst des Stalls. Fast wäre ihm ein »Auf dem kann keiner reiten« herausgerutscht, doch er konnte es sich gerade so verkneifen und sagte stattdessen »Ja, Sir«. Dann beeilte er sich, das zu tun, was von ihm verlangt wurde. Der Hengst war meistens etwas nervös, doch bei ihm wurde er immer recht zutraulich. Er führte das prachtvolle Pferd zum Aufseher, nachdem er das Tier gesattelt hatte. Anschließend nahm Jack wortlos seine Arbeit wieder auf. Der Sandweg rund um den Stall musste ständig mit einem Rechen gerade gezogen werden, damit alles schön ordentlich aussah.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie der ebenfalls etwa sechzehnjährige Sohn seines Besitzers, in den Sattel des wilden Hengstes stieg. ›Der kann doch gar nicht mit dem Pferd umgehen‹, dachte sich Jack, als Georg auch schon unsanft auf dem Boden landete.
»Das liegt daran, dass der Sattel nicht richtig aufgelegt wurde«, plärrte der verwöhnte Kerl, während er sich mühsam aufrappelte. »Wer hat das Pferd gesattelt?«, verlangte er dann zu wissen.
Jack erstarrte in seiner Arbeit und sah, wie zwei andere Sklaven auf ihn deuteten. Obwohl er gerade eben noch geschwitzt hatte, lief es ihm nun eiskalt den Rücken hinunter. Georg kam mit erhobener Reitgerte und Mordlust in den Augen auf ihn zu. Instinktiv begriff Jack, dass der seine gesamte Wut über die soeben erlittene Schmach an ihm auslassen würde. Mit tödlichen Folgen. Wenn der Kerl ihn nicht sofort zu Tode prügelte, würde er sicher an den Wunden elendig krepieren.
Als Georg nur noch fünf Schritte von ihm entfernt war, griff Jack in den Sand zu seinen Füßen und warf diesen seinem Widersacher entgegen. Kurz sah er schockstarr zu, wie sein junger Herr anfing zu brüllen und versuchte, sich den Dreck aus dem Gesicht und vor allem aus den Augen zu wischen. Dann gewann Jacks Überlebenswille die Oberhand und er lief, so schnell ihn seine Beine trugen, in Richtung See. Das war der einzige Weg, auf dem er zumindest eine geringe Chance hatte zu entkommen. An Land hätten ihn die Bediensteten auf Pferden sofort eingeholt. Für eine Verfolgungsjagd mit Gäulen war der See zu tief. Klar waren die Tiere in der Lage zu schwimmen, aber sie waren im Wasser nicht wirklich schneller als er – hoffte er zumindest.
Direkt neben seinem Fluchtweg lag ein blecherner Waschzuber mit gut einem Schritt Durchmesser. Im Laufen griff er danach, dann war er auch schon im Wasser. Er begann mit den Füßen und einer Hand zu paddeln, während er sich mit der anderen Hand den Zuber über den Kopf hielt. Kurz darauf hörte er über den Lärm der aufgeregten Stimmen seiner Verfolger hinweg einen Schuss. Er versuchte, sein Tempo zu beschleunigen, wobei ihm der Waschzuber etwas hinderlich war. Gerade, als er überlegte, ob er sich dessen entledigen sollte, hörte er eine Kugel in das Blech einschlagen. Ihm klingelten und rauschten die Ohren von dem Geräusch. Jetzt verschwendete er keinen Gedanken mehr daran, den Behälter abzulegen.
Das Klingeln in den Ohren ließ nach, das Rauschen nahm aber deutlich zu. Hatte er sich bereits so sehr verausgabt? Vorsichtig hob er seinen Waschzuber etwas an, um zu erkennen, wie weit das gegenüberliegende Ufer noch entfernt war. Da erkannte er, dass das Tosen keineswegs vom Rauschen seines Blutes stammte, sondern von dem Wasser, das auf einen Wasserfall zuströmte. Verflucht, warum hatte er daran nicht gedacht? Er hatte doch gewusst, dass der See links in einen Wasserfall überging und nur rechts in einen wilden, aber schwimmbaren Fluss mündete. Die Sklaven durften sich schließlich hin und wieder unter Aufsicht im See waschen. Hier hatte ihm auch seine Mutter das Schwimmen beigebracht. Jack versuchte, nach rechts zu paddeln, doch die Strömung war bereits zu stark. Es gab kein Entkommen mehr aus dem Sog. Panisch schnappte er nach Luft. Was konnte er tun? Am Rande bekam er mit, dass Georg aufgehört hatte, auf ihn zu schießen. Wahrscheinlich hatte er bemerkt, dass Jack auf den Wasserfall zutrieb und ging davon aus, dass er das nicht überleben würde. Oder ein paar Bedienstete ritten gerade um den See herum, um ihn nach dem ganzen Getöse in Empfang zu nehmen.
Trotzdem wollte Jack nicht aufgeben. Er strampelte weiter mit den Beinen, um über Wasser zu bleiben. Gleichzeitig versuchte er, den Waschzuber mit beiden Händen zu greifen. Was versprach eher ein Überleben – die Wanne als Tauchglocke nehmen, in der Hoffnung, dass dort wenigstens ein klein wenig Luft verblieb, oder umdrehen und als Boot verwenden? Noch während er krampfhaft überlegte, erfasste ihn der Sog so stark, dass ihm nichts weiter blieb, als sich am Zuber festzuklammern und das Beste zu hoffen.
Jack konnte gerade noch seine Lungen mit Luft füllen, als er unter Wasser gezogen wurde. Kurzzeitig wurde der Wirbel um ihn herum schwächer und er stellte zu seinem Erstaunen fest, dass tatsächlich etwas Atemluft im Waschzuber verblieben war. Die Kugel hatte zum Glück am oberen Rand ein Loch hinterlassen, den Boden hatte sie verfehlt. Statt darüber nachzudenken, wie das sein konnte, hob er lieber sein Gesicht über den Wasserspiegel, um nochmals Luft holen zu können. Schon wurde er wieder vom nächsten Sog unter Wasser gezogen und herumgewirbelt. Er vermochte nicht zu sagen wie, aber plötzlich war der Waschzuber unter ihm. Einer Eingebung folgend setzte er sich, so gut es ging, hinein und hielt sich fest. Luft war ohnehin keine mehr darin.
Rasant wurde er weiter den Wasserfall hinuntergespült. Unbewusst hatte er die Augen zugekniffen, als würde ihm das helfen, den Sturz die Fluten hinab besser zu überstehen. Hätte er atmen können, wäre es fast wie eine wilde Bootsfahrt gewesen. Gut, der Zuber war jetzt schon aufgrund der geringen Größe nicht sonderlich bequem, aber das war das kleinste seiner Probleme. Er war es nicht gewohnt, die Luft so lange anzuhalten und langsam machte sich ein Gefühl in ihm breit, dass er dringend atmen wollte. Er fühlte sich leicht benommen und seine Lungen fingen an zu brennen. Wie lang war dieser verdammte Wasserfall eigentlich? Oder wurde er bereits den Fluss entlanggespült?
Jack konnte nichts erkennen, wusste nicht, wo oben und wo unten war. Zwischenzeitlich war er panisch und kaum noch in der Lage, weiter die Luft anzuhalten. Ob er einfach bewusst einen tiefen Atemzug nehmen sollte? Dann wäre es vorbei. Die Chancen diese irre Fahrt zu überleben war ohnehin mehr als gering. Er würde sich also nur ein paar Augenblicke voll Angst und Entsetzen ersparen.
Er sandte noch ein letztes Gebet zu seinem Gott, dann öffnete er den Mund und atmete ein. Durch Mund und Nase schoss frische Luft. Überrascht riss er die Lider auf und sah sich um. Links und rechts von sich erkannte er im Dämmerlicht Felsen, unter ihm war Wasser, das sich aber deutlich beruhigt hatte. Es strömte zwar zügig voran, er konnte jedoch in seinem Waschzuber wie in einem Boot darauf entlanggleiten. Erstaunt stellte er sich die Frage, wo er sich befand. Hinter ihm rauschte das Wasser in die Tiefe, vor ihm floss das Wasser in den Tunnel, der sich im Fels verbarg. Ob seinem Eigentümer diese Abzweigung des Wasserfalls bekannt war und er ihn am Ende des unterirdischen Gangs erwarten würde? Oder sollte er es tatsächlich geschafft haben zu entkommen? Nun, für den Moment blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in seinem Behelfsboot weitertreiben zu lassen. Die Wände erhoben sich neben ihm und boten keinen Ausweg. Zurückschwimmen zum Wasserfall war unmöglich. Er bereitete sich lieber darauf vor, aus dem Zuber zu springen und weiterzulaufen, sollten ihn am Ende des Tunnels die Männer seines Eigentümers erwarten.
Der Wasserstrom wurde beständig ruhiger und dadurch auch sein Behelfsboot langsamer. Die Strecke war recht kurvig, so dass er das Ende des Tunnels nicht sehen konnte. Von irgendwoher kam jedoch ein wenig Licht, so dass er zumindest den Weg sah – und weiterhin die Felswände links und rechts des Flusses. So gut es möglich war, besah er sich das Gestein genauer. Es war bis zu einer Höhe von gut zwei Manneslängen glatt, vermutlich vom Gewässer glattgeschliffen. Bedeutete das, dass üblicherweise deutlich mehr Wasser durch diesen Tunnel floss? War es möglich, dass er plötzlich von einer Flutwelle erfasst wurde, oder hob und senkte sich der Wasserspiegel eher gemächlich? Langsam wurde er nervös. Wo endete seine Fahrt, wenn er denn lebend hier herauskam? Vor allem, würde man ihn schon erwarten, oder konnte er wenigstens ein paar Tage in Freiheit leben? Das brachte ihn unweigerlich zur nächsten Überlegung. Egal wo er landete, durch seine dunkle Haut wurde er überall als Sklave erkannt. Sein Brandmal auf dem rechten Oberarm sagte jedem, wem er gehörte. Er hatte nur dann eine Chance auf dauerhafte Freiheit, wenn er in ein Land gelangen konnte, in dem dunkelhäutige Menschen nicht zwangsläufig Sklaven waren und welches das Brandmal nicht als Eigentumsnachweis anerkannte. Die anderen Leibeigenen hatten abends am Feuer von einem solchen Reich geflüstert. Aber gab es das wirklich, und wenn ja, wie sollte er dort hinkommen?
So viele Fragen und keine Antworten. Denn zuerst musste er aus diesem Tunnel herauskommen. Da er ohnehin nichts tun konnte, schöpfte er vorsichtig mit der Hand etwas Wasser um zu trinken. Das kühle Nass rann köstlich seine Kehle hinab, woraufhin er gleich noch mehr davon trank.