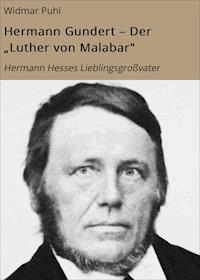Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch hat nichts wirklich Neues zu verkünden, sondern ist ein sehr persönliches Plädoyer für mehr Achtsamkeit und Nachdenklichkeit im Alltag. Was bedeuten uns heute noch einfache Dinge wie Brot, Wasser oder Luft? Was hat Armut mit Würde zu tun? Wer oder was stiehlt uns im Alltag immer mehr Zeit, seit das IKEA-Prinzip (günstig kaufen und selber aufbauen) das ganze Leben durchzieht – vom Online-Banking bis zum Eigenheim? Was kann ich persönlich für die Umwelt tun, was bedeuten heute Tugenden wie Zivilcourage und was die allgegenwärtige Schönfärberei in Politik, Werbung und Presse? Das Buch ist eine Schule des Nachdenkens und des kritischen Blicks: christlich geprägt, aber sehr eigenständig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmar Puhl
Der kritische Blick
Anstöße zum Selberdenken
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Einfache Dinge
Zwischenbilanz mit 40
Zeitdiebe
Kultur aus zweiter Hand?
Was taugt „Tugend“?
Mein Umweltschutz
Die Tücken der Technik
Kleine Typologie des Fans
Organisierter Humor und Exzess
Christen und Muslime
Biorhythmen, die Uhr der Schöpfung
Über den Tod
Impressum neobooks
Vorwort
Liebe ist der letzte Grund unseres Daseins, Liebe das höchste Ziel. Aber dass wir trotzdem sterben müssen, wirft Fragen auf. Immer wieder diese schmerzhaften Verluste und Abschiede: von glücklichen Tagen, Wünschen, geliebten Lebewesen und Dingen. Warum müssen wir so etwas ertragen und wie können wir das überhaupt? Berührt uns Schönheit nicht vor allem deshalb so sehr, weil sie vergänglich ist? Was sind denn Kunst, Poesie, Musik und Wissenschaft anderes als Versuche, das Leben zu verstehen, das Flüchtige zu halten, all das Kostbare zu bewahren und zu teilen, das uns begegnet? Doch das Leben besteht nicht nur aus Liebe. Immer wieder fallen wir dabei auf die Nase. Aber man kann daraus auch lernen.
Wer bin ich? Wo kommen wir her, wo gehen wir hin, welchen Sinn hat mein Leben? In einem hektischen, kurzatmigen Alltag gehen wichtige Fragen leicht unter. Warum bin ich eigentlich hier und wo will ich hin? Was sind meine Erwartungen ans Leben und was wollen nur andere von mir? Gut wäre daher ein Innehalten, Entschleunigen und Nachdenken, wenn wir die Lebensfreude nicht verlieren und das Wichtigste nicht versäumen wollen. Dabei soll dieses Buch helfen.
Philosophie muss nicht immer als Schwergewicht daherkommen. Der Philosoph ist ja im griechischen Sinn des Wortes ein „Freund der Weisheit“ - nicht etwa des Komplizierten. Die Fragen nach dem Warum führen aber oft in schwierige Zusammenhänge. Darum bemühe ich mich besonders um nachvollziehbare Erklärungen und allgemein verständliche Antworten. Dafür muss niemand das Rad permanent neu erfinden oder die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Neugier hilft. Es gibt viele Menschen mit guten praktischen Ideen, von denen ich auch im hohen Alter noch lernen kann.
Welche Bedeutung haben gesundes Essen, reines Wasser oder saubere Luft? Wieso ist Armut ein Problem für die Menschenwürde? Was kann ich dagegen tun, dass mir neue Medien und Technik im Alltag nicht helfen, sondern zum Stressfaktor werden? Wie und wo kann ich ganz konkret etwas für den Umwelt- und Klimaschutz tun, statt nur zu reden? Wieso haben viele Menschen zunehmend das Gefühl, Kultur nur noch aus zweiter Hand zu erleben – aus Konserven? Es geht aber nicht nur um schlaue Analysen, sondern auch darum, etwas zu verbessern. Ich möchte Mut machen, es einfach zu tun. Glücksmomente, Feiern, sogar Leidenschaft sind möglich. Selbst angesichts von Hunger, Katastrophen, Krieg und Zerstörung darf und muss es Raum für Lebenswillen und Lebensfreude geben.
Sogar das friedliche Miteinander der so gegensätzlichen Weltreligionen lässt sich aus der Geschichte lernen: Es gab immer schon gleichzeitig überzeugende Formen der Koexistenz und unvorstellbar grausame Idioten. Die biologische Uhr tickt, das Leben ist endlich – und damit selbst die menschliche Dummheit, über die Albert Einstein sagte, sie sei unendlich wie das Universum. Oft zeigen die Kleinigkeiten, aus denen das Leben besteht, dass wir alle in große Zusammenhänge gehören. Das macht vielleicht nicht immer glücklich, aber Einsicht kann durchaus Zufriedenheit erzeugen: den Frieden, den wir so gern mit uns selbst und der Welt ma- chen möchten. Dabei kann es manchmal hilfreich und notwendig sein, rebellisch zu werden, weil sich etwas ändern muss, das so nicht bleiben darf. Der Blick für das Große schärft sich gut im Kleinen. Das heißt für mich, achtsam zu sein, immer ich selbst zu bleiben, furchtlos und aufrecht durchs Leben zu gehen.
Einfache Dinge
Brot
Wenn die Frauen in dem kleinen Dorf Benningen am Neckar ihr Backofenfest feiern, bekommen wir ein ganz besonderes Brot. Wir haben Freunde dort, und die sind Mitglieder in einem Verein, der eigens gegründet wurde, um das alte Backhaus im Dorf wieder herzurichten. Gemeinsam haben sie das geschafft, und gemeinsam backen sie jetzt auch wieder – auf die gute alte Art und Weise, wie das früher auf dem Land immer üblich war.
Wenn wir einen dieser großen, dunkelbraunen Laibe mit der dicken Kruste aufschneiden, duftet es wunderbar. So ein Brot, das kann ich mit jedem Bissen schmecken, hält Leib und Seele zusammen. Was da in Benningen gepflegt wird, ist nicht bloß Nostalgie, sondern eine große sinnliche Erfahrung – und die Ehrfurcht vor dem Brot.
„Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen“ – dieser Satz aus dem Alten Testament ist die bitterste Folge der Vertreibung der Menschen aus dem Paradies. Was für eine Geschichte hat das Brot seitdem gesehen! „Sie erkannten einander am Brotbrechen“: Für die Christen ist Brot etwas Heiliges. Das Sakrament des Abendmahls, geheimnisvolles Zeichen für den unsterblichen Leib Jesu Christi, ist ein sichtbarer Ausdruck für den unsichtbaren Glauben an ein ewiges Leben. Zum Passahfest, in Erinnerung an die Flucht aus Ägypten, essen die Juden jedes Jahr Matzen, das ungesäuerte Brot, das haltbare, einfache Brot für die Reise. Das Brot ist Leben.
Brot für die Welt: Engagierte Menschen geben sich viel Mühe, um diese einfache, aus Mehl im Ofen gebackene Speise aus der alltäglichen Gleichgültigkeit herauszulösen. Wir sind ja meistens so satt, dass das Herstellen echter Aufmerksamkeit für ein drängendes Problem eine schwere Arbeit sein kann. Wir vergessen entsetzlich schnell; sogar die ausgemergelten Kindergesichter aus Äthiopien, Somalia oder dem Sudan, deren glasige Augen nicht einmal mehr um Brot bitten können. Die flehend ausgestreckten Hände verzweifelter Mütter mit vertrockneten Brüsten: Bilder, die uns fast täglich ins Wohnzimmer flimmern. Denken wir noch darüber nach? Ich ertappe mich dabei, wie ich diese Bilder beiseite dränge, wegschiebe. Es gibt ja so viel Wichtiges zu tun, was mich bedrängt und was mir viel näher ist. Gleichgültigkeit ist auch eine Schutzmauer gegen das Elend der Welt.
Dabei bin ich im christlichen Glauben erzogen worden und weiß: Das Brot brechen heißt teilen. Goethe hat geschrieben: „Wer nie sein Brot mit Tränen aß, / wer nie die kummervollen Nächte / auf seinem Bette weinend saß, / der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte“.
Zuckerbrot und Peitsche: Überfluss hier, Leid und Tod dort. Die Geschichte vom reichen Prasser und dem armen Lazarus aus dem Neuen Testament fällt mir ein, der die Krümel vom Tisch des Reichen erbat. Die Demütigung, das Leiden ums tägliche Brot. Welche Hungerhilfe füttert die Armee, die Bauern von ihren Äckern vertreibt? Hunger als Waffe, auch das ist so alt wie die Geschichte des Brotes. Hunger tut weh.
Mich schmerzen heute noch Bilder wie das Butterbrot im Papierkorb auf dem Schulhof oder das verdorbene Saatgut im Straßengraben. Und trotzdem vergesse ich oft das Kleingeld für die „Aktion Restgeld“, wenn ich eilig beim Bäcker bezahle. Dabei wäre echte Solidarität doch wohl etwas anderes als das Bekämpfen der Vergesslichkeit bei Centbeträgen.
„Unser tägliches Brot gib uns heute“: Was bedeutet mir als Christ dieser Satz aus dem Vaterunser? Was be- deutet Brot überhaupt für mich? Ich hatte auch schon Angst ums tägliche Brot; aber wir haben diesen Begriff doch sehr ausgedehnt. Inzwischen gehört das Dach überm Kopf selbstverständlich dazu, vielleicht auch das Auto, der Fernseher und der Urlaub. Es fehlt oft nicht viel, und wir machen eine Blasphemie aus dem "täglichen Brot", eine Gotteslästerung. Aus dem berechtigten Kampf ums tägliche Brot, den der Landwirt vielleicht gegen Dürre, Flut und Hagel führt, wird der erbitterte Konkurrenzkampf des modernen Egoisten in der Wohlstandsgesellschaft. Wie stehe ich dazu?
Die Dritte Welt und deren Probleme sind weniger weit weg, als der Denkverzicht vieler globalisierter Supermarktkunden nahe legt. Durch welche Art von Geschäftemacherei entsteht woanders Hunger? Wie unmoralisch ist die Existenz von Butter- oder Schweinebergen? Wer verdient wie viel an subventionierten Lebensmittelexporten, die den Bauern irgendwo in Afrika oder Lateinamerika unfaire Konkurrenz machen? Wem nehme ich das Brot weg, wenn ich ein „Schnäppchen“ mache? Wer zahlt für mein Billigangebot? Jede Arbeit ist ihren Lohn wert. Darf ich da Produkte aus Kinderarbeit in Billiglohnländern beim Discounter kaufen? Welches Brot ist blutig, weil jemand auch in meinem angeblichen Interesse Geld mit Waffen macht? Auch solche Fragen stellt mir das Brot aus dem Backhaus von Benningen.
Seit Jahren backen wir übrigens unser Brot meistens selbst. Es ist billiger als beim Bäcker, schmeckt besser und ist gesünder. Es schimmelt auch nicht, weil es weder eine Extraportion Wasser enthält, um das Brot schwerere zu machen, noch ominöse Zusatzstoffe. Wir wissen genau, was drin ist.
Wasser
Wasser hat weder Geschmack noch Farbe oder Aroma. Es ist schwer zu beschreiben, denn es schmeckt, ohne nach etwas zu schmecken. „Es ist nicht so, dass man dich zum Leben braucht“, schrieb Antoine de Saint-Exupéry in seinem Buch „Wind, Sand und Sterne“ in einem hinreißenden Lob an das Wasser: „Du selber bis das Leben.“ Viele Dichter haben den Stoff mit der chemischen Formel H2O besungen. Gottfried Keller bezieht sich auf das älteste Buch des Alten Testaments, die Schöpfungsgeschichtde, wenn er feststellt: „Der Geist schwebt eben nicht über einem Glas Wasser, er schwebt über den Wassern.“ Womit er die unbegrenzte, ungegliederte und allgemeine Fülle sämtlicher Wassermassen meint.
Beide Dichter beziehen sich aber auch auf etwas anderes: die Nähe, in der die Begriffe Wasser, Leben und Geist zueinander stehen. Sicher nicht zufällig ist die Tradition christlicher Symbolik voll davon. Das Wasser spielt bei vielen Religionen eine bedeutende Rolle. Hindus etwa oder Muslime kennen wie Juden die geistige Bedeutung des Bades, der Waschung, der Reinigung. Für die Christen geht es in der Taufe sogar um die „Wiedergeburt aus Wasser und Geist“. Etwas davon, vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein, wissen auch jene Katholiken, die ab und zu ihre Finger in Weihwasser tauchen und sich damit das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn machen.
Das Sakrament der Taufe haben alle christlichen Bekenntnisse nicht nur gemeinsam, sie erkennen es auch untereinander an. Es verbindet Orthodoxe wie Katholiken, Lutheraner wie Baptisten. Was bedeutet das? Was denke ich mir eigentlich, wenn ich mir die Zähne putze oder Wasser aus meinem Hahn in der Küche rinnt?
Man muss ja nicht immer gleich Weihwasser pinkeln, wie mir ein sehr christlicher Erzieher einmal sagte; gemeint hat er das unnötige, übertriebene und frömmelnde Herauskehren der „tiefgeistigen Zusammenhänge“ bei jeder Gelegenheit. Aber ich denke meistens gar nicht über Wasser nach, und auch das ist falsch.
Wie falsch, das wurde mir in einem Urlaub klar. Wir waren auf den Kanaren, wo es sehr selten regnet. Als der Himmel zwei Tage vor unserer Abreise plötzlich doch seine Schleusen öffnete, sagte ein Hausbesitzer: „Es regnet Peseten.“ Er meinte seine Zisterne. Ohne Regen hätte er für viel Geld einen Tankwagen kommen lassen müssen, um sie aufzufüllen. Dort gießen sie schon lange mit dem Regenwasser die Blumen im Garten, hier lernen wir das gerade erst. Viele Stadtwerke kaufen zur Zeit für gutes Geld Wasserwerke zurück, die sie vor Jahr und Tag an private Investoren verkauft oder verpachtet hatten, weil sie im Wahn einer rein ökonomischen Globalisierung glaubten, auf diese Weise sparen zu können. Es wurde ein teures Lehrstück darüber, dass alles, was dem Gemeinwohl dient, nicht auf den Markt gehört.
In einem scheußlich verregneten Sommer vergessen wir leicht die steigende Zahl und Heftigkeit der Hitzesommer, die eine Folge des Klimawandels sind. Auch in Deutschland mussten schon ganze Dörfer wochenlang von Tankwagen mit Wasser versorgt werden, weil es heiß und zu trocken war. Die Gletscher schmelzen, öfter als früher sind Talsperren leer, der Grundwasserspiegel sinkt, noch immer sind viele Flüsse verschmutzt. Ich finde, wir brauchen längst keine Fernsehbilder mehr vom Vorrücken der Sahel-Zone, um den Klimawandel ernst zu nehmen. Ein Besuch in einem großen Wasserwerk tut´s auch. Wasser ist kostbar, und zwar überall. Gut, aber ich verklappe ja keine Dünnsäure in der Nordsee. Gegen so etwas ist der Einzelne machtlos, doch durch falsche Gewohnheiten beim Essen und Einkaufen mache ich mich schnell mitschuldig. Wenn der Rhein plötzlich rot ist und die Fische sterben, bekommen wir einen Riesenschreck. Aber die meisten Schweinereien sind nicht rot und nicht groß und sogar geruchlos wie die Legionellen aus Kühltürmen vieler Kraftwerke – und trotzdem Schweinereien.
1380 Millionen Kubikkilometer Wasser gibt es auf der Welt. Aber nur knapp ein Prozent davon steht als frisches, nutzbares Süßwasser wirklich zur Verfügung. Der Kreislauf des Wassers ist empfindlich, und wir haben ihn schon stark gestört. Es ist sinnlos, „Haltet den Dieb!“ zu rufen und die eigene kleine Gedankenlosigkeit weiter zu treiben wie bisher. Ich für mein Teil achte jedenfalls darauf, dass wir so wenig Chemie wie möglich in Putz- und Waschmitteln verwenden. Wir essen viel weniger Fleisch als früher und kaufen unsere Lebensmittel aus biologischem und regionalen Anbau. Fleisch aus Massentierhaltung lehnen wir nicht nur deshalb ab, weil Tiere darunter leiden. Zuviel Nitrat aus Gülle belastet auch Boden und Wasser. Schon das Sprichwort sagt: „Aus einer bitteren Quelle fließt kein süßes Wasser.“ Wenn das alle beherzigen, schwebt der Geist vielleicht doch über jedem einzelnen Glas Wasser.
Luft
Als Mitteleuropäer muss man heutzutage in die Berge oder ans Meer, sonst ist es so eine Sache mit dem Genuss sauberer Luft. Wer Asthma oder Kinder mit Pseudokrupp hat, kann ein Lied davon singen, falls ihm nicht die Luft wegbleibt. Zwei Sprichwörter zum Thema haben mich nachdenklich gemacht: „Die Luft kann einem niemand verbieten“, und „Von Luft und Liebe kann man nicht leben“. Beide stimmen so, wie Sprichwörter halt auch nach Jahrhunderten noch stim- men; doch beide haben aber inzwischen auch eine zweite, eine neue Bedeutung. Mir kann zwar niemand die Luft verbieten, aber es kann unmöglich sein, reine, gesunde Luft zu atmen. Den Arbeitsplatz kann sich kaum jemand aussuchen, und die Wohnlage ohne Smog oder Feinstaub ist ebenfalls eine Frage des Geldbeutels. Da gibt es viel Ungerechtigkeit. Ich finde es schlimm, wenn die Luft im Normalfall schon so verschmutzt ist, dass die Leute nur noch auf Krankenschein in Luftkurorten zu sauberer Luft kommen. Zwar kann man von Luft und Liebe nicht leben. Aber dass die Menschen deshalb ohne Luft und Liebe leben könnten, will doch niemand behaupten.
Es sind Kleinigkeiten, an denen ich merke, was Luft für mich bedeutet. Seit wir umgezogen sind, kann ich ab und zu einfach eine Tür öffnen und stehe auf dem Balkon an der frischen Luft. Das ist etwas Herrliches, das mir als Städter viele Jahre lang gefehlt hat. Dass einer „nach Luft ringt“ oder es ihm „den Atem verschlägt“, dass ein Mensch seelisch an den Verhältnissen „erstickt“, in denen er lebt, das kennen wir. Aber manchmal nehme ich solche Ausdrücke auch ganz wörtlich. Kennen Sie nicht auch das Gefühl, bei einem Hustenanfall keine Luft mehr zu bekommen? Man lebt im wahrsten Sinn des Wortes auf, wenn das vorbei ist.
Wenn ich nach einer Bergwanderung auf dem Gipfel stand, fand ich es irgendwie geradezu sündhaft, in dieser wunderbaren reinen Luft zu rauchen. Ich habe früher Zigaretten geraucht und finde immer noch, dass eine Pfeife ein Genuss sein kann, aber in solchen Augenblicken passt kein Rauchen. Und wenn wir schon beim Rauchen sind: Ich finde es zwar mittelalterlich, wenn man Raucher diskriminiert und ihnen das Leben überall schwer macht; doch haben wir das nicht teilweise auch Zeiten zu verdanken, wo wir Raucher rücksichtslos und egoistisch anderen praktisch überall die Luft verpestet haben? Das Klima vergiften – das wäre ein Thema für sich.
Ich bin ein Schreibtischarbeiter; doch das sind ja ziemlich viele Zeitgenossen. Immer wenn ich besonders viel zu arbeiten habe, muss ich zuerst raus an die frische Luft. Am besten lüfte ich meinen Kopf bei einem langen Spaziergang aus. Vielleicht hilft das Gehen auch beim Verfertigen der Gedanken vor dem Sprechen oder Schreiben. Jedenfalls tut mir die frische Luft ausgesprochen gut; sie hilft, Gedanken zu finden, zu ordnen und sich setzen zu lassen, weil das Gehirn mehr Sauerstoff bekommt.
Merkwürdig genug ist das mit der Luft: Ohne dieses unsichtbare, aber allgegenwärtige Gasgemisch aus etwa 78 Prozent Stickstoff, 21 Prozent Sauerstoff, ein paar Resten anderer Gase plus Wasserdampf geht ja gar nichts. Wirklich lebenswichtig sind ja „nur“ die 21 Prozent Sauerstoff. Doch wann denken wir schon einmal darüber nach? Nichts ist selbstverständlicher als das Atmen. Aber wenn es aufhört, ist man tot. Und wenn es aus irgend einem Grund schwer wird, merken wir erst, wie wichtig es ist.
Vor einiger Zeit hatte ich mir ein Virus eingefangen und bekam eine Lungenentzündung. Ganz plötzlich, von einem Augenblick auf den anderen, konnte ich nicht mehr richtig einatmen. Bei jedem tiefen Atemzug fühlte ich einen scharfen Stich in der Brust. Da bekam ich es ganz schön mit der Angst zu tun.
Ist es nicht ein phantastisches Gefühl, zu spüren, wie sich die Lungen füllen? Ich habe beschlossen, mich öfter daran zu freuen. Deswegen ist mir auch sehr daran gelegen, dass unsere Luft nicht zu einer Müllkippe für unbekömmliche Gase wird, an denen erst die Wälder sterben und dann wir selbst.
Schlaf
Wie unentbehrlich Schlaf ist, wird einem erst klar, wenn er fehlt. Der russische Schriftsteller Alexander Solschenizyn hat eindrucksvoll die Folter durch Schlafentzug beschrieben. Erst gute Nächte erlauben gute Tage. Schlaf, dieser dem Wachen entgegengesetzte, im Allgemeinen normale Zustand, in dem das Bewusstsein eine Zeitlang ausgeschaltet ist und die Funktionen des Körpers eingeschränkt sind: Niemand weiß wirklich genau, was das ist. Von Thomas Morus wird berichtet, er sei mit zwei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht ausgekommen. Ich bewundere das, doch meine Versuche, es ihm nachzumachen, sind jämmerlich gescheitert. Wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, werde ich reizbar, unkonzentriert und vergesslich, bin unfähig, klar zu denken, und neige zu Kopfschmerzen: ein abscheulicher Zustand, in dem alles und jeder stört, in dem man anfängt, die ganze Welt zu hassen, weil alles nur von einem Wunsch beherrscht wird: dem Wunsch nach Ruhe.
Wenn ich gut geschlafen habe, bin ich frisch und ausgeruht. Ein Gefühl der Dankbarkeit stellt sich ein, weil ich es auch anders kenne. Nun kann ich es mit dem Tag aufnehmen, was auch immer er bringt. Wenn ich schlecht geschlafen habe, bin ich schon vor Beginn der ersten Runde geschwächt und in der Defensive. Stress und Überforderung sind die Folge, immer mehr Aufgaben bleiben unbewältigt, das Liegengebliebene stapelt sich schnell zu Bergen. Dann besteht die Gefahr, dass sich das einstellt, was die Ärzte etwas ratlos „psychosomatische Schlafstörung“ nennen. Es entsteht ein Teufelskreis, weil die Patienten dann aus Angst vor der gefürchteten Schlaflosigkeit nicht schlafen können.
Einmal habe ich im Urlaub eine merkwürdige Geschichte erlebt. Wir waren ans Meer gefahren, und keine zwanzig Meter vor unserem Hotelfenster schlug eine laute Brandung an die Steilküste. Erst brachen sich die Wellen mit einem dumpfen Krachen am Ufer; dann, wenn das Wasser zurückfloss, kollerten Zig-Tausende von Steinen von der Kieselküste geräuschvoll im Sog des Wassers mit. Sie wissen, was ich meine: So etwas ist wirklich laut.
Der Ort war wunderschön und einsam. Bis auf die Natur vor der Tür unterbrach nichts die erholsame Stille. Am ersten Tag bestaunten wir das Schauspiel ausgiebig, und leise Zweifel kamen, ob man dabei auch gut schlafen könne. In der ersten Nacht wachte ich ein paar Mal auf, hörte die Brandung, dachte „alles in Ordnung, das Meer ist noch da“ oder so ähnlich und schlief wieder ein. In der zweiten Nacht störte schon nichts mehr, überhaupt nichts. Die Brandung gehörte dazu. Sie war ein „Geräusch der Stille“, etwas völlig anderes als Geschrei oder laute Musik, Baumaschinen oder Verkehrslärm.
Warum erzähle ich das? – Einige Zeit vor uns war ein Kollege am gleichen Platz gewesen und hatte erzählt, er habe nur mit Wachs in den Ohren schlafen können. Ich vermute, uns war es nur besser ergangen, weil wir dieses regelmäßige Rauschen, Donnern und Poltern als Begleitmusik erholsamer Tage angenommen hatten. Ja, auch diese nicht gerade sanfte Brandung hatte schließlich einschläfernd gewirkt. Vielleicht hat das Schlafenkönnen mehr mit dem Schlafendürfen zu tun als ich bisher dachte. Vielleicht stören meinen Schlaf Geräusche, die ich auch hellwach nicht mag, nicht aber Geräusche, die ich grundsätzlich mag.
Wir hatten uns sehr auf diesen Urlaub gefreut, vom Meer geträumt und davon, wie es rauscht. Wahrscheinlich haben wir dann so gut geschlafen, weil der Unterschied zwischen Traum und Wachen plötzlich nicht mehr existierte. Es tut der Seele gut, ab und zu einen Traum zu verwirklichen. Und es muss wohl so sein, dass die Seele mit darüber entscheidet, ob ich gut schlafe oder nicht. Etwas von diesem Erlebnis hat bis heute vorgehalten, obwohl seitdem viele Jahre vergangen sind. Es war die Erfahrung: Je vollständiger ich versuche, jede Störung von meinem geheiligten Schlaf fernzuhalten, desto schwieriger wird die Sache. Mein Schlaf ist ein bisschen weniger störanfällig geworden – und damit besser.
Ernten
Eines Tages im Herbst habe ich bei einem Spaziergang Haselnuss-Sträucher entdeckt, die frei am Weg standen und voll hingen mit großen, braunen Nüssen. Ich konnte nicht widerstehen, da waren wohl Erinnerungen an meine Kinderzeit im Spiel: Erst holte ich mir eine, knackte sie mit den Zähnen (ich weiß, das ist ungesund) und zerkaute langsam und genießerisch das würzige, noch saftige Fruchtfleisch. Dann holten ich mir die nächste, und auf einmal war ich wie im Fieber. Eines Tages im Herbst habe ich bei einem Spazier- gang Haselnuss-Sträucher entdeckt, die frei am Weg standen und voll hingen mit großen, braunen Nüssen. Ich konnte nicht widerstehen, da waren wohl Erinne- rungen an meine Kinderzeit im Spiel: Erst holte ich mir eine, knackte sie mit den Zähnen (ich weiß, das ist un- gesund) und zerkaute langsam und genießerisch das würzige, noch saftige Fruchtfleisch. Dann holten ich mir die nächste, und auf einmal war ich wie im Fieber. Ich kroch in die Büsche, bog Zweige zu mir herunter, grapschte und füllte mir die Hosentaschen. Auf dem Heimweg begegneten mir andere Spaziergänger, also versuchte ich unauffällig und verschämt, meine ausgebeulten Hosentaschen mit den Händen zu tarnen. Aber stolz war ich und glücklich wie ein Schulbub.
„Schau, was ich geerntet hab“, sagte ich zu Hause und leerte meine Schätze in eine ziemlich große Schüssel. Meine Frau hat gelacht, aber nicht spöttisch.
Auf dem Heimweg begegneten mir andere Spaziergänger; ich versuchte unauffällig und verschämt, meine ausgebeulten Hosentaschen mit den Händen zu verbergen. Aber stolz war ich und glücklich wie ein Schulbub. „Schau, was ich geerntet habe“, sagte ich zu Hause und leerte meine Schätze in eine ziemlich große Schüssel, in der sie schon wieder bescheidener aussahen. Meine Frau hat gelacht, aber nicht spöttisch.
Ich glaube, was mir da passiert ist, war nicht bloß eine Kindheitserinnerung. Es war dieses Ur-Vergnügen am Ernten, das zu den einfachen, aber großen Freuden der Menschen gehört, seit sie in Höhlen schliefen und ein Leben als Jäger und Sammler führten. Wenn man so will, hat sich da der Neandertaler in mir wieder gemeldet. Längst produzieren immer weniger Bauern immer mehr Lebensmittel, und die meisten Menschen leben in großen Städten; wohin also heute mit diesem Ur-Vergnügen?
Ich möchte mir das wenigstens im Kleinen erhalten und kultivieren. In dem Wort „ernten“ steckt das englische Wort „to earn“, durch Arbeit verdienen. Das tun wir ja alle nach Möglichkeit für unseren Lebensunterhalt. Aber am Fließband, an der Ladenkasse, am Bankschalter, am Steuer oder am Schreibtisch denkt ja kein Mensch mehr an wogende Kornfelder, Ackerbau und Obstgärten. Unsere alltägliche Ernte ist sehr abstrakt und un-sinnlich geworden.
Dass diese sinnliche Freude nicht verloren geht, ist mir aber wichtig. Vielleicht hat mancher Grundstücks- oder Gartenbesitzer genau aus diesem Grund so viel Arbeit in seinen Besitz gesteckt und so viel Freude an der Plackerei, obwohl das nicht jedem bewusst ist. Die Lust am Ernten ist tief im Menschen verankert und nicht auszurotten. Für die meisten Zeitgenossen ist es nicht immer leicht, ein Ventil für diesen Trieb zu finden. Man hat selten das Glück, ernten zu können, wo man nicht gesät hat. Um die meisten Verlockungen dieser Art stehen Zäune, die man respektieren muss.
Wer im Spätsommer oder Herbst mit dem Auto oder Fahrrad in die Gegend um den Bodensee fährt, kann zahlreiche Erntefreuden haben, auch wenn er kein Stück Land mit einem Zaun drum besitzt. Überall darf man mit den Augen ernten: Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Nüsse, Quitten, Zwiebeln, Kohl – alles ist voll von Obst und Gemüse, so weit das Auge reicht. Man sieht die Leute bei der Arbeit, und am Straßenrand kann man direkt alles kaufen. Frischer und preiswerter als beim Erzeuger geht´s nicht. Ich habe auch schon auf einem Erdbeerhof mein Obst selbst geerntet. Immer mehr Bauern laden dazu ein; es wird billiger, wenn man ihnen Arbeit abnimmt. Und es kann einen großen Spaß machen.
Wenn ich überhaupt keine Zeit für solche Ausflüge habe oder nicht die rechte Jahreszeit dafür ist, gehe ich manchmal nur auf den Markt, um in Berührung mit dem Naturereignis Ernte zu kommen, um zu riechen, zu sehen und vielleicht auch zu schmecken. Vielleicht sollte ich das viel öfter tun. Man verlernt sonst so vieles. Es ist doch schön und gar nicht mehr so selbstverständlich, wenn man eine Fenchelknolle von einer Lauchstange unterscheiden kann.
Nächsten Herbst gehe ich bestimmt wieder an dem besagten Weg spazieren und schaue nach, ob „meine“ Haselnüsse noch kein anderer entdeckt hat.
Bewegung
Kinder (und Hunde) toben gern herum; die Freude an der Bewegung gehört offenbar zu den ursprünglichen Dingen im Leben. Aber dann kommt eine lange Zeit, in der wir erzogen werden, still zu sitzen. „Setz dich auf den Hosenboden“ – das war ein viel gehörter und sehr verhasster Satz in meiner Kindheit. Doch irgendwann trägt diese Erziehung Früchte. Sogar der Hund muss lernen:
„Sitz!“ Nach dem Lernen kommt das Arbeiten, und da sitzen immer mehr Menschen erst recht. Von morgens bis abends. Einen letzten Rest der alten Bewegungsfreude, im Mangel, im Nicht-Können, enthält die umgangssprachliche Formulierung, dass einer „gesessen hat“. In der Haft, das sagt die Sprache mit deutlicher Wehmut, gibt es die Freiheit der Bewegung nicht, und folglich auch kaum die Freude daran.