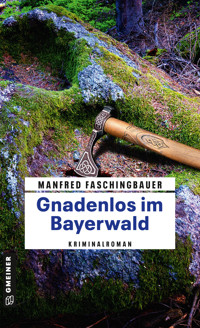Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Moritz Buchmann
- Sprache: Deutsch
Moritz Buchmann genießt gerade die Idylle im Bayerischen Wald, als seine Bekannte Julia auf der Burgruine Runding eine rätselhafte Schatulle findet. Das kleine Kästchen galt lange als verschollen und birgt ein Mysterium, das Geheimdienste ebenso wie das organisierte Verbrechen auf den Plan ruft. Dann verschwindet Julia, und für Moritz beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Bald muss er erkennen, dass es nicht nur Julias Leben ist, das es zu retten gilt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Faschingbauer
Bayerisch Tot
Kriminalroman
Zum Buch
Tödliches Burggeheimnis Kriminaloberkommissar Moritz Buchmann hat sich den Burgfreunden Runding angeschlossen. Dort lernt er Julia kennen, die eines Tages auf der Burgruine ein kleines Kästchen findet. Dieses birgt ein Geheimnis, das rechtsradikale Gruppierungen und die US-Geheimdienste auf den Plan ruft. Dann verschwindet Julia spurlos. Kurz darauf wird im Höllensteinsee das Bein eines jungen Mannes gefunden. Moritz begibt sich auf die Suche nach Julia und der Identität des Toten. Zur gleichen Zeit ermittelt seine Kollegin Melanie Güßbacher in Regensburg im Fall eines in der Donau ertrunkenen Mädchens. Während Moritz und Melanie bei ihren Ermittlungen getrennte Wege gehen, geraten auch noch Moritz’ Freunde in Gefahr. Kann er ihr Leben und das Tausender anderer Menschen retten, oder werden seine schlimmsten Albträume wahr?
Manfred Faschingbauer, 1963 in Bad Kötzting geboren, lebt mit seiner Familie in dem kleinen Bayerwalddorf Blaibach. Die mystischen, in den Wäldern des Bayerischen Waldes versteckten keltischen Opferstätten sind die Schauplätze von Moritz Buchmanns neuem Kriminalfall, der ihn und seine Lieblingskollegin Melanie wieder in den »Woid« und zu den »Waidlern« führt. Nach »Osserblut«, »Bayerisch Kalt« und »Bayerisch Tot« ist »Gnadenlos im Bayerwald« Moritz Buchmanns vierter Fall.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © escada007 / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6248-1
Widmung
Für Mama.
Danke für deine Geschichten
und für alles andere.
1945
Walter Stemmle duckte sich unter die weit ausladenden Äste des Baumes. Ein nutzloses Unterfangen, das wusste er. Entweder verbargen ihn die Blätter der Buche, unter der er das Motorradgespann abgestellt hatte, oder eben nicht. Sechs Jahre an den Fronten von Frankreich bis Moskau hatten jedoch seine Sinne geschärft und unlöschbare Reflexe in ihm verankert. Sein Körper reagierte auf bestimmte Vorgänge selbstständig. Dazu gehörte es auch, den Kopf einzuziehen, wenn ein feindliches Flugzeug am Himmel erschien.
Ja, er war dabei gewesen beim Einmarsch in die Hauptstadt des Erzfeindes Frankreich. Er hatte gleich Tausenden Kameraden am Straßenrand gestanden und dem Führer salutiert, als dieser im offenen Wagen die Champs-Élysées hinaufgefahren war in diesem Augenblick des Triumphes. Aber er war auch vor Moskau gelegen im Winter 1941/42, als die deutsche Wehrmacht halb erfroren den Rückzug antreten musste. Seither war der Krieg zu einer ständigen Flucht vor der Roten Armee geworden, die den Eindringling vor sich her nach Westen trieb. Irgendwie hatte er überlebt. Hätte ihn jemand gefragt, wie er das geschafft hatte, während seine Kameraden zerfetzt, verstümmelt und verbrannt in den Wäldern und Flüssen, den Steppen, Städten und Dörfern Russlands geblieben waren, er hätte keine Antwort gewusst.
Er hatte überlebt und er wollte weiterleben, und deshalb duckte er sich noch tiefer in das Gebüsch, während die amerikanische Thunderbolt eine letzte Schleife über den kleinen Wald zog und in Richtung Westen abdrehte. Keine Flak, kein Maschinengewehr und schon gar kein deutsches Jagdflugzeug hinderten sie daran. All das gab es nicht mehr in diesen letzten Tagen des Tausendjährigen Reiches. Vielleicht hatte der Pilot das Motorrad nicht gesehen? Vielleicht aber war er auch nur auf der Suche nach lohnenderen Zielen, die sich seinen Bordkanonen und Bomben in diesen Tagen reichlich boten.
Hauptfeldwebel Stemmle konnte es nur recht sein. Es war kein Platz in seinen Gedanken für seine Kameraden von der 11. Panzerdivision, die kurz davor standen, sich General Pattons Truppen zu ergeben, und auf die das amerikanische Flugzeug jetzt Jagd machte.
Er gehörte nicht zu ihnen. Wenn man es genau betrachtete, gehörte er zu keiner einzigen regulären Einheit der deutschen Wehrmacht. Nicht mehr, seit er die Schatulle bei sich trug.
Vielleicht, so dachte er bei sich, hatte ihn ja sein Sonderauftrag lebend durch die letzten chaotischen Tage gebracht? Nicht gebunden an taktische Vorgaben und Befehle hatten ihn das kleine Metallkästchen und der schriftliche Auftrag in seiner Brusttasche davor bewahrt, sich an den sinnlosen Verteidigungskämpfen beteiligen zu müssen. Kein Wunder, war der Befehl doch vom Kommandeur der 6. SS-Panzerarmee, Generaloberst Josef Dietrich selbst ausgestellt worden.
Walter Stemmle war die Wichtigkeit des Auftrags spätestens bewusst geworden, als er den Brief gelesen und die Unterschrift gesehen hatte. Das war vor einigen Tagen geschehen, als er das Schriftstück aus der blutgetränkten Uniformjacke Hauptmann Frenzels gezogen hatte. Er hatte keine Ahnung, was sich in der Schatulle befand, welche die beiden Männer in den langen schwarzen Mänteln seinem Hauptmann in Krakau übergeben hatten, um sie nach Berchtesgaden zu bringen. Sie bestand aus einem ihm unbekannten schwarzen Metall. Er kannte auch die Bedeutung der Schriftzeichen und Tierbilder auf dem Deckel des Kästchens. Sein Hauptmann hatte sie ihm erklärt.
An der Längsseite war ein winziges Schlüsselloch angebracht, dessen Gegenstück Frenzel an einem Lederband um den Hals getragen hatte, als ihn die Granate in Stücke riss. Das war vor drei Tagen gewesen, kurz nach Pardubice im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Zum Glück für Hauptfeldwebel Stemmle war das Motorradgespann heil geblieben. Und auch der Umschlag mit ihrem Befehl, den er dem kopflosen Torso, der einmal Jochen Frenzel gewesen war, aus der Jacke gezogen hatte. Blutverschmiert zwar, aber noch deutlich lesbar. Der Schlüssel jedoch lag zusammen mit den nicht mehr zu identifizierenden Überresten seines Vorgesetzten über ein Feld westlich von Prag verstreut und blieb unauffindbar.
Somit war er der Einzige, der von der Waffe wusste. Denn es war eine Waffe, die sich in dem Kästchen befand, das unbemerkt unter dem Sitz des Beiwagens der BMW versteckt lag.
Natürlich hatte niemand Walter Stemmle mit dieser Information vertraut gemacht. Immerhin war er nur Hauptfeldwebel. Doch sein Hauptmann wusste mehr. An dem einen Abend während ihrer langen Flucht, in einem böhmischen Gasthaus, das unversehrt von allen Kriegswirren am Wegesrand stand, hatte er es ihm anvertraut. Vielleicht war es die unwirkliche Atmosphäre der Situation gewesen, vielleicht das Bier, das sie getrunken hatten? Jedenfalls hatte Hauptmann Frenzel ihn ermahnt, nie zu versuchen, das Kästchen zu öffnen. Davor hätten ihn die beiden Männer in den langen Mänteln eindringlich gewarnt. Büchse der Pandora, hätten sie es genannt, und dass alle sterben würden, sollte der Inhalt des Kästchens bekannt werden.
»Wirklich alle!«, hatte Frenzel mit schwerer Zunge nachdenklich wiederholt, ehe ihn der Alkohol in den Schlaf getragen hatte. Seit diesem Tag war sich Walter Stemmle bewusst, dass die Schatulle auf keinen Fall dem Feind in die Hände fallen durfte.
Aber wohin damit? Berchtesgaden? München? Berlin? Alles zu spät! Russen, Engländer und Amerikaner waren schneller gewesen. Es war zu spät für diese neue Wunderwaffe, wie es auch zu spät für all die anderen gewesen war. Nicht einmal die V2 hatte den Krieg zugunsten Deutschlands entscheiden können.
Wohin damit? Seit dem Tod seines Hauptmanns zermarterte er sich das Gehirn über diese Frage und fand doch keine Antwort. Also fuhr er einfach weiter nach Westen, in der Hoffnung, das Schicksal wiese ihm den Weg. Und so war er hier gelandet, in diesem kleinen Wäldchen bei Kdyně. Inzwischen hatten die amerikanischen Flugzeuge am Himmel die russischen abgelöst. Die deutsche Grenze lag fast in Sichtweite vor ihm. Die Heimat würde jedoch keinen Schutz bieten.
Langsam kroch er aus seinem Versteck und schlich zu seiner BMW hinüber. Die Thunderbolt war verschwunden, der blaue Himmel über diesem Maitag unbefleckt. Weit entfernt störten Kanonendonner und Bombeneinschläge die Idylle. Das Brummen schwerer deutscher Kampfpanzer vom Typ Tiger drang von den Hügeln im Süden zu ihm herab. Er warf die Zweige, mit denen er das Motorrad getarnt hatte, zur Seite und setzte sich in den Sattel. Die BMW sprang sofort an. Langsam rollte er auf die Straße und weiter in Richtung Westen, wo die Hügel des Böhmerwaldes in die des Bayerischen Waldes übergingen.
*
Spätestens als er die deutsche Grenze erreichte, wusste er, dass der Krieg endgültig verloren war. Auch die apokalyptische Zerstörung, die sich in seinen Händen, oder vielmehr unter dem Sitz des Beiwagens befand, konnte dies nicht mehr verhindern. Und er wusste, dass er ab jetzt zu Fuß laufen musste. Nicht nur, weil sein Benzinvorrat zu Ende war. Nein, auch weil die Straßen vor amerikanischen Truppen wimmelten. Dazwischen immer wieder versprengte deutsche Einheiten. Ihre Fahrzeuge zerschossen, ihre Soldaten erschöpft und verwundet, in ihren Augen diese Mischung aus Entsetzen und nacktem Überlebenswillen.
Er stellte das Gespann einfach am Straßenrand ab, packte das kleine Kästchen in seinen Rucksack und marschierte quer über die Wiesen los. Die Maschinenpistole ließ er zurück. Wozu sollte er sie brauchen? Die Walther P38 musste jetzt reichen, um ihn zu schützen.
Die nächsten Stunden kam er nur langsam voran. Am Tag versteckte er sich in einer Scheune. Im Schutz der Nacht schlich er weiter, ohne zu wissen, wohin er eigentlich wollte. Gleich hinter der Grenze umging er den Ort Eschlkam, und hätte er geahnt, dass hier in diesen Stunden Generalleutnant Wend von Wietersheim die Kapitulation der 11. Panzerdivision unterzeichnete, er hätte sich vielleicht sofort dem Schicksal seiner Kameraden angeschlossen. So aber marschierte er weiter.
Am Morgen des zweiten Tages traf er eine Handvoll deutscher Soldaten unter Führung eines Unteroffiziers. Die ehemalige Besatzung eines Sturmgeschützes schlich unbewaffnet zu Fuß über einen Feldweg. Auf seine Frage »Wohin des Weges?« erfuhr er, dass sie sich zur Sammelstelle in Kötzting begeben sollten. Dort wartete die amerikanische Gefangenschaft auf sie.
Das bestätigte seine Befürchtungen. So weit war es also bereits gekommen! Wenn jetzt schon ganze Divisionen kapitulierten, dann war das Ende des Reiches nicht mehr fern. Ein letztes Mal versteckte er sich, bis die Sonne am östlichen Horizont verschwand. Eine amerikanische Patrouille fuhr im offenen Geländewagen vorbei. Er kroch tiefer in das Dunkel des Schuppens, in dem er untergekommen war, und nutzte die Zeit des Wartens. Der Bleistift in seiner Jackentasche war nur noch ein Stumpen, den er mit seinem Feldmesser anspitzte. Da er kein Papier hatte, musste sein Befehl herhalten. Walter Stemmle schrieb seine Gedanken zwischen die Schreibmaschinenzeilen, die ein Adjutant des Stabes im Hauptquartier der Division – vor einer Ewigkeit, wie es ihm schien – getippt hatte.
Er schrieb von der Schatulle und vom Untergang der Menschheit.
Er schrieb von Tod und Elend, den beiden Geschwistern, die er während seiner Jahre im Krieg zu oft gesehen hatte.
Er schrieb von seiner Frau und seiner Tochter, die er nur einmal während eines Fronturlaubs hatte besuchen dürfen.
Er schrieb von der Hoffnung, sie wiederzusehen.
Auf der Rückseite des Befehls fand sich eine kleine Stelle unbeschriebenen Papiers. Er hielt inne, dann begann er zu zeichnen. Im Licht des aufgehenden Mondes malte er ein Kreuz, einen Wolf und eine Schlange, er schrieb Zahlen und Namen.
Als er fertig und vom Bleistift fast nichts mehr übrig war, überlegte er kurz, den Befehl, der nun zugleich sein Vermächtnis war, zusammen mit der Schatulle zu begraben, doch dann steckte er ihn wieder in die Tasche seiner Wehrmachtsuniform. Sollte er aufgegriffen werden, konnte er das Blatt Papier noch immer vernichten. Notfalls würde er es einfach runterschlucken.
Noch einmal betrachtete er die Symbole auf dem Deckel des Kästchens. Mit dem Zeigefinger fuhr er die Linien entlang. Sie waren nicht nur aufgemalt, sondern in das Metall eingraviert. Sein Finger verweilte kurz auf dem Hakenkreuz, dann griff er nach seinem Hemd, riss es in Streifen und umwickelte das Kästchen. Das Ganze steckte er in seinen Rucksack. Er wusste jetzt, was er zu tun hatte. Wenn der Schrecken, der ihm anvertraut worden war, schon seinem Vaterland nicht mehr von Nutzen sein konnte, dann sollte auch niemand anderer davon erfahren. Er konnte es nicht vernichten, also musste er es verstecken. Und er wusste bereits, wo. Sollten sein Land und sein Volk dieses Geheimnis noch benötigen, konnte er ja wiederkommen und seinen Auftrag zu Ende führen. Die Nacht war endlich da. Sie würde ihn und sein Vorhaben verbergen. Vorsichtig lugte er aus der Scheune. Vor dem Mond erhoben sich dunkel ein Hügel und darauf die Reste einer Burg.
*
Im fahlen Licht der Sterne und des Mondes stolperte er durch die Ruine. Er trug keine Lampe bei sich und wenn, dann hätte er es nicht gewagt, sie zu entzünden. Von hier oben hätte man sie kilometerweit gesehen. Von der Burg war nicht mehr viel übrig. Nur die Ecke eines Turmes zeugte von ihrer einstigen Größe. Langsam tastete er sich ans Ende des Innenhofes bis zu einer brüchigen Außenwand. Dort machte er sich an die Arbeit.
*
Walter Stemmle versteckte die Schatulle so, dass sie niemand so leicht entdecken würde. Es müsste schon jemand kommen, der die alten Gemäuer untersuchte oder diese endgültig abriss. Die Stelle hatte er so gewählt, dass er sie auf jeden Fall wiederfinden konnte. Sorgfältig schob er den letzten Stein an seine ursprüngliche Position zurück. Und ebenso vorsichtig verließ er die Burg und den Berg.
*
Ein paar Minuten später befand er sich wieder unten im Tal. Er war nicht durch den Ort gegangen, sondern über eine Wiese, und erreichte auf direktem Weg einen Bauernhof. Ein kleines Anwesen, das sich in den Schatten des Berges und der Burg darauf duckte. Haus, Scheune und Stall wirkten heruntergekommen und verlassen, und doch hörte er das Muhen einer Kuh und das Gackern einiger Hühner. Aus dem Stall kämpfte das schwache Licht einer Lampe gegen eine verschmutzte Fensterscheibe und die Dunkelheit draußen an. Jemand versorgte die Tiere.
Eine Frau, erkannte er, als sich die Stalltür öffnete. Die Bäuerin wirkte müde und erschöpft. Mit schweren Schritten schlich sie auf das Haus zu. Einige Minuten später lag der Hof dunkel und leise da.
Walter Stemmle spürte den Hunger zum ersten Mal seit Stunden. Die Aufregung hatte ihn diesen ganz vergessen lassen, doch jetzt meldete er sich mit aller Kraft. Vielleicht ließ sich im Stall ja etwas Essbares finden? Ein Ei oder ein bisschen Milch? Und wenn nicht? So musste er eben bis morgen warten. Dann würde er sich den Amerikanern stellen. Das Schriftstück in seiner Jacke würde er in seinen Schuhen verstecken. Die Amis hatten sicher einen Bissen Brot für ihn. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Überleben in ihrer Gefangenschaft lag jedenfalls wesentlich höher, als bei den Russen.
Dennoch! Sein Magen drängte ihn, hineinzugehen und nachzusehen. Sechs Jahre Überleben im Krieg gemahnten ihn zur Vorsicht. Die Stalltür war gut geschmiert. Ohne Quietschen gab sie ihm den Weg frei. Die Dunkelheit nahm seinen Augen einige Sekunden des Sehens. Nichts war zu hören. Langsam trat er näher. Rechts vor ihm gewahrte er die Augen einer Kuh, die ihn neugierig ansah.
»Du schläfst ja noch gar nicht«, flüsterte er lächelnd. Es waren seine letzten Worte.
*
Hauptfeldwebel Walter Stemmle starb nicht in der Schlacht von Gembloux im Mai 1940, als er mit dem XIV. Panzerkorps Frankreich gestürmt hatte. Er erfror auch nicht ein Jahr später wie viele seiner Kameraden der 9. Armee vor Moskau. Er starb weder durch eine französische noch durch eine russische Kugel. Walter Stemmle starb in der Heimat durch den Schlag einer langstieligen Axt, die mit sauberem Schnitt seine Wirbelsäule zwischen dem vierten und fünften Halswirbel durchtrennte. Er hörte den Schlag kommen, konnte jedoch nicht mehr reagieren. Als er auf dem Boden aufschlug, war Walter Stemmle bereits tot. Und mit ihm das Geheimnis um das Versteck der Schatulle.
*
Der Junge blickte mit teilnahmslosem Gesichtsausdruck auf den Mann hinab. Er hatte erwartet, dass dieser durch die Tür kommen würde. Da er nicht sonderlich groß war, hatte er sich auf die Kartoffelkiste gestellt. Er wollte den Mann ja nicht in den Rücken schlagen! Der Junge war kräftig und er hatte gelernt, mit der Axt umzugehen. Von hier oben sollte ein waagrechter Schlag in den Hals gelingen! So war es dann auch gekommen. Irgendwie hatte die Klinge es geschafft, zwischen zwei Wirbel einzudringen und den Mann, der ein Soldat gewesen war, sofort zu töten, ohne seinen Kopf vom Rumpf zu trennen.
Der Junge hatte den Mann beobachtet, seit dieser die Ruine droben am Schlossberg verlassen hatte. Er hatte, wie fast jeden Abend, am Fenster seiner Stube unter dem Dach des Bauernhauses gesessen und hinaus in die von Mond und Sternen erhellte Dunkelheit gestarrt. An diesem Tag hatte eine greifbare Aufregung die Menschen im Dorf erfasst. Ganze Heerscharen von Soldaten waren vorbeigezogen. Amerikaner und Deutsche! Die einen sauber und wohlgenährt, die anderen zerlumpt und ausgehungert. So hatte es ihn nicht verwundert, dass es ein deutscher Landser war, der sich in dieser Nacht auf ihren Hof schlich.
Sicher ein Deserteur, dachte der Junge. In jedem Fall aber ein Plünderer, der ihn und seine Mutter um Hab und Gut bringen wollte. Großvater, der blind und lahm drüben in seiner Kammer auf den Tod wartete, hatte ihn gewarnt: »Sie werden kommen! Wenn der Krieg zu Ende geht, werden sie kommen und uns alles nehmen!«, hatte er zwischen zwei Hustenanfällen, die den alten Mann in letzter Zeit immer häufiger quälten, geröchelt. »Dann musst du den Hof und deine Mutter beschützen!«, hatte er dem Jungen aufgetragen. Und das wollte er auch! Schließlich war er für alles verantwortlich, seit Vater fortgegangen war.
Der Soldat war vornübergefallen. Sein Blut tränkte die Streu des Stallbodens. Der Junge würde sie noch beseitigen müssen. Morgen früh, dachte er. Er stieg von seiner Kiste, legte die Axt zu Seite und drehte den Toten auf den Rücken. Er wollte das Gesicht des Mannes sehen. Hatte so auch sein Vater ausgesehen, im Augenblick des Todes? Ausgemergelt, hart, verzweifelt, hoffnungslos! Waren seine Augen ebenfalls weit aufgerissen gewesen, als er den Heldentod für Deutschland gestorben war, wie es sein Kompaniechef, an dessen Namen sich der Junge nicht mehr erinnerte, geschrieben hatte? War noch Zeit gewesen, Angst zu empfinden, oder hatte ihn die Panzergranate in Stücke gerissen, ohne dass er es bemerkt hatte?
Der Junge konnte sich nicht an das Gesicht seines Vaters erinnern. Es sollte das Gesicht dieses Mannes hier sein, das ihn für den Rest seines Lebens verfolgen würde. Doch das wusste der Junge in diesem Augenblick noch nicht. Neugierig beugte er sich zu dem Mann hinab und nahm dessen Pistole an sich. Er wusste, was die Amerikaner mit Leuten machten, die eine Waffe besaßen. Die Alten im Dorf hatten es erzählt. Aber noch war der Krieg ja nicht verloren und außerdem kannte er die besten Verstecke weit und breit. Niemand würde die Pistole finden! Dann durchsuchte er die Taschen des Toten: eine Handvoll Patronen, ein Kompass, ein Messer, ein Umschlag mit einem Brief, eine Geldbörse ohne Geld, dafür mit Bildern einer Frau und eines Mädchens, ein Verwundetenabzeichen, ein Eisernes Kreuz II. Klasse, ein Bleistiftstumpen, die Erkennungsmarke.
Sorgfältig legte er alles beiseite. Später konnte er sich die Sachen noch genauer ansehen. Jetzt aber musste erst einmal der Tote verschwinden. Der Junge packte den Mann bei den Beinen. Überrascht stellte er fest, wie leicht dieser war. Er hatte offenbar schon lange nicht mehr genug zu essen bekommen. Im ersten Augenblick dachte er daran, die Leiche im ehemaligen Brunnen unter dem Stall zu verstecken. In früheren Jahren, als der Großvater des Jungen den Hof gegründet hatte, hatten sie beim Ausgraben des Kellers eine Quelle gefunden. Was lag näher, als den Brunnen dort zu errichten, wo das Wasser am dringendsten benötigt wurde? Die Quelle war versiegt, aber den Brunnen gab es noch immer. Tief und trocken lag er versteckt unter den Gewölben des Stalles. Nur ein Holzdeckel verhinderte, dass jemand in der Dunkelheit dort unten in die Tiefe fiel. Sein Vater hatte vor seiner Einberufung an die Front jedes Jahr die losen Steine des Kellers notdürftig mit Lehm verschmiert, doch seit er das Vaterland weit weg von diesem verteidigt hatte, ging niemand mehr dort hinab. Sollten aber die Amerikaner nach Waffen oder anderem suchen, würden sie den toten Landser finden.
Aber nicht dort, wohin ich ihn bringen werde, dachte der Junge. Vorsichtig band er Lisa los. Dann nahm er die ganze Kraft seines jungen Körpers zusammen und hob und schob die Leiche über ihren Rücken. Er nahm einen Strick von der Wand und band damit Arme und Beine des Mannes unter dem Bauch der Kuh zusammen.
Bevor er sich auf den Weg machte, sah er sich draußen um. Niemand war in der Nähe. Leise und langsam trieb er Lisa aus dem Stall. Es schien, als würde die Kuh, die das Überleben der drei Menschen auf dem Hof sicherte, die Anspannung des Jungen spüren. Ohne einen Laut von sich zu geben, trug sie ihre Last hinauf zur Burg. Der Kopf des Mannes pendelte bei jedem ihrer Schritte hin und her, sodass der Junge befürchtete, dieser könnte sich vom Körper lösen und wie eine Kegelkugel den Berg hinabrollen. Glücklicherweise hielten Sehnen und Hautfetzen und nichts dergleichen geschah.
Oben angekommen tätschelte er Lisas Hals. Wildes Gras und Gestrüpp bedeckten den Boden und die Reste des einst stattlichen Baus. Obwohl nur fahles Mondlicht die Szenerie erhellte, war sein Tritt sicher. Er kannte hier jeden Stein und jeden Strauch. So wusste er natürlich von dem Brunnen und der Zisterne, die einst die Bewohner der Burg mit Wasser versorgten.
Er löste den Knoten des Strickes. Schwer fiel der tote Körper zu Boden. Der Junge ging zum Brunnen hinter den Brombeerbüschen, gleich links unter dem Fels, auf dem ehemals eine Kapelle über die Burg wachte. Irgendjemand hatte ihn mit Brettern abgedeckt. Wohl, um Ziegen und Kinder, die sich hier oben herumtrieben, vor dem tödlichen Sturz in die Tiefe zu bewahren. Niemand wisse, wie tief der Brunnen sei, und noch nie sei etwas, was hineingefallen war, je wieder ans Licht der Sonne gelangt, hatte seine Mutter gesagt und ihn stets davor gewarnt, die Holzbohlen über dem Loch zu entfernen, wollte er nicht für immer von dieser Erde verschwinden. Er hatte sich an die Warnung gehalten. Jetzt jedoch musste der Mann verschwinden! Er begann, die Bretter zur Seite zu schieben. Kein leichtes Unterfangen, waren diese doch regelrecht festgewachsen. Moder und Kälte schlugen ihm entgegen. Noch einmal bedurfte es all seiner Kraft, den Mann hierherzuschleppen und über die Mauer zu heben.
Der Soldat beobachtete seine Anstrengungen aus toten Augen.
Selbst schuld, schienen sie zu sagen. Warum hast du das getan? Was hast du dir nur dabei gedacht?
Dann hatte er es endlich geschafft. Da er nicht die Kraft hatte, den Mann langsam in die Tiefe hinabzulassen, rollte er ihn über den Rand und warf ihn mit einer letzten Anstrengung hinab. Mit einem dumpfen Platscher schlug er weit unten auf das Wasser auf.
Der Junge sah noch minutenlang in die Tiefe, dann erinnerte er sich an Lisa, Mutter und Opa. Es war an der Zeit zurückzukehren. Er legte die Bretter wieder auf ihren Platz, streute Blätter und Gras darüber und ging zu Lisa. Die Kuh sah ihn aus vorwurfsvollen Augen an.
»Hab ich dich um deinen Schlaf gebracht«, sagte er. »Tut mir leid. Gleich sind wir wieder in deinem Stall.«
Er strich zärtlich über ihren Kopf. Wenn er es recht betrachtete, war das Tier in den letzten Monaten sein einziger Freund gewesen. Treu und zuverlässig, so wie in dieser Nacht. Seite an Seite, und ohne von jemandem gesehen zu werden, gingen sie hinab zu dem kleinen Hof am Fuße des Berges. Hoffentlich hat niemand im Haus etwas gehört, dachte er. Doch Mutter und Großvater waren alt an Jahren und jeder Tag ließ sie müde zurück. Er führte Lisa in den Stall und band sie fest. Ein letztes Mal für diesen Tag tätschelte er die Kuh am Hals, nahm die Habseligkeiten des Mannes und schlich ins Haus zurück. Noch einmal ging sein Blick hinauf, dorthin, wo sich die Silhouette des Turmes vor den Sternen abhob. Großvater und Mutter hatten von den Geschehnissen dieser Nacht nichts bemerkt.
Zwei Tage später kapitulierte das Großdeutsche Reich. Der Krieg war zu Ende.
Prolog
Regensburg – Donauufer beim Dultplatz
Die Kälte des Wassers stach mit tausend Nadeln in ihre Haut und riss sie aus der Bewusstlosigkeit. Sie öffnete die Augen und sah – nichts! Undurchdringliche Dunkelheit umgab sie. Ihr war furchtbar übel und es schien, als sei ihr ganzer Körper ein einziger Quell des Schmerzes, dessen Zentrum in ihren Händen lag.
Obwohl sie völlig orientierungslos war, bemerkte sie, dass sie sich unter Wasser befand. Langsam sank sie tiefer. Eine Erkenntnis, die in Panik mündete. Ihre Arme und Beine begannen zu zucken. Ihre Augen waren keine Hilfe, doch die Richtung, in der sich ihr Körper bewegte, zeigte ihr, wo oben war. Sie war eine ausgezeichnete Schwimmerin, doch beim Fall ins Wasser war sie bewusstlos gewesen. Dies bedeutete, der Luftvorrat in ihren Lungen musste bald aufgebraucht sein.
Wieso war sie bewusstlos gewesen? Warum befand sie sich überhaupt in dieser misslichen Lage? Sie war doch spazieren gegangen. Und dann? Es schien, als blockiere eine dicke Nebelwand ihre Erinnerungen.
Ihre Beine schlugen und ihre Arme ruderten, um sie nach oben zu bringen. Nach oben, dorthin, wo das Leben auf sie wartete. Sie war noch nicht tief gesunken. Es dauerte nur Sekunden und doch saugten ihre Lungen gierig nach Luft, als ihr Kopf die Oberfläche des Wassers durchbrach.
Sie drehte sich um ihre Achse, doch war da nur Dunkelheit. Ihre Hand tastete nach ihrer Brille, sie fand sie nicht. Erst jetzt bemerkte sie den Regen, der einen dichten Vorhang um sie legte. Unzählige Tropfen trommelten auf die aufgewühlte Wasseroberfläche und versperrten die Sicht. Sie versuchte sich zu beruhigen. Das wilde Zucken und Zappeln ihrer Arme und Beine ging in kontrollierte Schwimmbewegungen über. Der Regen ließ etwas nach und gab den Blick auf das nahe Ufer frei. Nur wenige Meter, dachte sie.
Sie stellte sich zwei Fragen: Was? Warum?
Schlagartig kam alles zurück. Ein Mann! Der Mann! Er hatte ihr Fragen gestellt. Was für Fragen? Julia! Irgendetwas mit Julia. Richtig! Weitere Begriffe tauchten zusammenhanglos auf: ihr Laptop! Ein Kästchen! Eine Schlange! Ein Wolf!
Dann Schmerzen! Ihre Hände, ihre Finger!
Mit langsamen Bewegungen schwamm sie los. Wasser vermischt mit Tränen verschleierte ihren Blick. Sie wollte leben, und dazu brauchte sie Hilfe. Ihre Gedanken wirbelten wild durcheinander, blieben bei ihrem Freund hängen. Wo war er nur? Sie brauchte ihn. Jetzt!
»Hilfe!«, würgte sie gurgelnd hervor. »Hilfe!« Obwohl das Ufer fast schon in Griffweite lag, spürte sie keinen Grund unter den Füßen. Plötzlich schälte sich eine Gestalt aus der Dunkelheit. Sie beugte sich herab, kniete sich hin und streckte ihr die Hand entgegen. Mit letzter Kraft griff sie zu. Sie spürte, wie sie gezogen wurde, heraus aus dem Wasser.
»Danke!«
»Komm schon! Ich hab dich.«
Sie blickte nach oben, sah ein Lächeln. Die Stimme war vertraut, klang besorgt.
Wer? In ihrem Kopf vermischten sich Gesichter und Namen.
»Hilfe! Michi, hilf mir!«
Das Lächeln verschwand. Die Hand ließ die ihre los. Verzweifelt packte sie noch einmal zu. Ihre Fingernägel krallten sich fest. Ein letztes Aufflackern ihres Willens. Dann schwanden ihre Kräfte. Sie spürte, wie ihr die rettende Hand entglitt und sich auf ihren Kopf legte. Sanft wurde sie nach unten gedrückt. Noch einmal gelang es ihr, an die Oberfläche zu kommen. Ein letzter Gedanke: Warum?
Die Hand drückte fester.
In der gleichen Nacht, nur später. Chamerau, Ortsteil Roßberg
Das Haus lag wunderbar. Nicht nur, weil es am Tag einen fantastischen Ausblick auf den Fluss drunten im Tal bieten musste. Auch die Wiese vor der Terrasse und die dunklen Bäume, hinter denen es sich verbarg, machten es einzigartig. Letztendlich aber war es die Einsamkeit des Hauses, die ihn begeisterte. Abseits der nächsten menschlichen Behausungen, nur durch einen Feldweg mit der öffentlichen Straße verbunden, bot es geradezu ideale Bedingungen für sein Vorhaben.
Er hatte es vermieden, den Wagen oben bei dem halben Dutzend Häuser und der Sternwarte, die er hier nicht erwartet hatte, abzustellen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, um vier Uhr morgens einem Spaziergänger oder einem Bewohner dieses Dorfes zu begegnen, verschwindend gering war, ging er kein Risiko ein. Jetzt stand der Audi mit der Nummer einer Leihfirma, den er unter falschem Namen und mit falschen Papieren besorgt hatte, am Rande eines Waldweges außerhalb der Ansiedlung.
Er hatte sich den Weg zu dem Haus auf Google Earth angesehen und eingeprägt. Das Licht der mondhellen Nacht sollte ein Übriges tun, doch im Dunkel der Hohlgasse, durch die er nun stolperte, sperrten Sträucher und Blätter das fahle Licht aus. Vorsichtig Fuß vor Fuß setzend arbeitete er sich hinab bis zum Rand des Waldes, hinter dem er das Haus wusste. Rechts des Weges stand in einer Einbuchtung ein Auto. Hätte das Mädchen, das sein Ziel war, ihren Wagen mitten auf der Straße geparkt, er wäre dagegengelaufen. Und hätte sie gewusst, dass er kommt, sie wäre geflohen und hätte sich wimmernd vor Angst versteckt.
Wie ein Tunnel tauchte der Weg in die Wand aus Bäumen ein. Er tastete sich voran. Die frühe Morgenstunde würde seinen Plan begünstigen. Das Türschloss sollte kein Problem für ihn darstellen. Genauso wenig wie das Mädchen. Er würde sie im Schlaf überraschen. Die Frage, ob sie ihm die Schatulle aushändigen würde, stellte sich nicht. Er wusste, er konnte sehr überzeugend sein.
Vor ihm schälten sich die Umrisse des Hauses aus dem dunklen Grau des Hintergrunds. Seine Hand tastete in seiner Tasche nach dem Dietrich, der ihm die Tür hinein öffnen sollte, als ein plötzliches Geräusch all seine Sinne in Anspruch nahm. Er verharrte in der Bewegung und hielt den Atem an. Dann trat er lautlos in den Schatten einiger Büsche am Rande des Weges. Das Haus stand auf einer Lichtung. Die Bäume wichen zurück und gewährten dem Mondlicht Einlass.
In seinem Schein rangen zwei Gestalten miteinander. Ein nur wenige stumme und lautlose Sekunden dauerndes surreales Schattenkabinett des Todes. Denn jetzt hob sich der Arm des einen und fuhr wieder hernieder, traf den anderen, trennte einen Arm von dessen Schatten. Ein dumpfes Aufstöhnen kündete den unvermeidlichen Schrei an. Noch einmal hob sich der Arm, noch einmal senkte er sich, würgte den Ruf in seiner Entstehung ab, streckte den anderen zu Boden. Der schwere Atem des Überlebenden keuchte durch die folgende Stille.
Er hielt die Luft an. Seine Gestalt verschmolz mit der Dunkelheit der Bäume, blieb unsichtbar für den Sieger dieses nächtlichen Kampfes, der kurz innehielt. Dann packte dieser den leblosen Körper, schwang ihn ächzend über seine Schulter und trug ihn den Weg hinauf. Von oben hörte er das leise Zuschlagen eines Kofferraums. Es war also das Auto des anderen und nicht das des Mädchens.
Er verharrte weiter regungslos in seinem Versteck, da der andere zurückkam. Das Licht einer Taschenlampe fraß sich in die Dunkelheit. Ziellos strich sein Schein über den Boden, um nach einer Minute wieder zu erlöschen. Dann verschwand er endgültig den Weg hinauf. Eine Autotür öffnete und schloss sich, ein Motor brummte leise auf, Fahrgeräusche der Räder auf dem steinigen Untergrund. Dann Stille.
Er fluchte leise in sich hinein. Das Mädchen war jetzt sicher wach und gewarnt. Sollte er seine Mission abbrechen? Nein, entschied er. Es musste sein. Nach den Ereignissen dieser Nacht würde sie morgen nicht mehr hier sein oder noch schlimmer, die Polizei rufen.
Also los! Mit wenigen Schritten war er an der Tür. Diese zu öffnen, dauerte nur Sekunden. Er zog seine Pistole, schraubte den Schalldämpfer auf und entsicherte die Waffe. Seine Hand tastete nach einem Lichtschalter. Für Heimlichkeiten war jetzt keine Zeit. Durch einen kurzen Flur erreichte er das Wohnzimmer, fand auch hier das Licht und machte es an. Mit einem Blick erfasste er den Raum. Eine Couch, zwei Lesestühle, ein Schreibtisch, ein Fernseher, ein kleiner Schrank. Alles älteren Datums. Fenster und eine Tür ins Freie, zwei weitere Türen. Eine in eine kleine Küche, eine andere in einen winzigen Flur. Wieder zwei Türen. Eine ins Bad, eine ins Schlafzimmer. Dort, das Bett: unbenutzt. Die Tür zur Terrasse verschlossen.
Das Mädchen war nicht hier!
Konzentriert und schnell durchsuchte er das Haus. Fünf Minuten später wusste er, dass die Schatulle nicht hier war. Außer, das Mädchen hatte sie besonders gut versteckt. Was war mit den beiden anderen? Dem Überlebenden und dem, der jetzt tot in dessen Kofferraum lag? Hatten sie die Schatulle vielleicht schon an sich genommen und waren darüber in Streit geraten?
Vorsichtig verließ er das Haus, so, wie er es betreten hatte. Er hatte keine Schubladen herausgerissen und keine Möbel umgeworfen. Nichts deutete auf seinen Besuch hin. Er schloss die Tür und ging, ohne sich noch einmal umzusehen, den Weg hinauf zu seinem Auto. Er knirschte mit den Zähnen. Wie viele wussten noch von der Sache? Wie viele wollten ihm den Fund des Mädchens streitig machen? Wie dem auch sei. Ab jetzt durfte er keine Zeit mehr verlieren. Das Rennen um die Schatulle war eröffnet.
*
Der Mann trat aus dem sicheren Dunkel des Waldes. Sollte er sich Zutritt zum Haus verschaffen? Er entschied, dass das nicht nötig war. Der andere war ihm zuvorgekommen, aber auch er war zu spät gewesen. Auch er hatte den Ausgang des Kampfes abgewartet. Dann hatte der andere das Haus durchsucht, aber das Mädchen offenbar nicht angetroffen. Und er hatte nichts in den Händen getragen, als er wieder herausgekommen war. Das bedeutete, dass sich die Schatulle noch in ihrem Besitz befand.
Das nächtliche Duell hatte seinen Auftrag erleichtert. Nur wer war der andere? Er würde sich um ihn kümmern müssen. Zuerst aber galt es, das Mädchen zu finden. Auch ihr Tod würde unvermeidlich sein. Doch zuvor musste sie ihm das Versteck des kleinen und so wertvollen Kästchens verraten. Der Mann drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit.
Erstes Buch - Was vor den Morden geschah -
Samstag, 03.06.2017 Runding, Burgruine, 13.30 Uhr
»Julia!«
Keine Reaktion.
»Julia! Guten Tag!«, starte ich einen zweiten Versuch.
»Oh! Hallo, Moritz! Ja, grüß Gott. Heute auch im Einsatz?«
»Na ja, wird Zeit, dass ich mich mal wieder hier sehen lasse. Sonst denken sich die anderen noch, ich bin nur wegen der Grillfeiern und Gartenfeste zu den Burgfreunden gegangen.«
»Sind ja auch der angenehmere Teil«, lächelt sie verträumt.
»Ist Claudia hier?«
»Nein, Hausarbeit. Außerdem meinte sie, es würde ohnehin gleich wieder regnen.«
»Gut möglich. Letzte Nacht hat’s ja wieder mächtig gekracht!«
»Kein Tag ohne Gewitter«, bestätige ich die diesjährige Wetterlage mit einem sorgenvollen Blick auf die dunklen Wolken, die über dem Haidstein heranziehen. Kein Wunder, dass Claudia da lieber zu Hause bleibt. Obwohl es ja eigentlich sie war, die mich nach zahllosen Wanderungen durch den Bayerischen Wald mit herüber nach Runding geschleppt hat. Erst wollte sie nur eine ihrer Freundinnen besuchen, doch Monika nahm uns mit hinauf auf den Schlossberg, wo die Burgfreunde ihr alljährliches Sommerfest feierten. Und während sich die staatlich geprüfte Heilpraktikerin und die Frau meines Lebens bei Kaffee und Kuchen über alternative Heilmethoden unterhielten, gelang es den ehrenamtlichen Rettern dieses historischen Platzes, mich ihren Reihen anzuschließen. Keine schwere Aufgabe, haben mich Schlösser und Burgen doch von jeher fasziniert, und warum sollte ich nicht einen winzigen Teil meines Geldes und meiner Zeit opfern, um die ehemals größte Burganlage des Bayerischen Waldes freizulegen? Und da ich schon mal dabei war und ohne sie ja nicht hier gewesen wäre, habe ich Claudia gleich mit angemeldet. Seither unterstützen wir die Arbeit dieser Leute. Claudia mit Kuchenspenden und ich mit meiner Hände Arbeit.
Nicht, dass das sonderlich hilfreich wäre. Mein handwerkliches Geschick hält sich doch arg in Grenzen. Da man mir jedoch früh erklärte, dass auch Handlangerdienste gefragt seien, hat sich das Sommerfest nicht zum letzten Aufenthalt auf dem Schlossberg in Runding entwickelt.
Ein gutes Dutzend Arbeitseinsätze später läuft meine Integration in die Welt der Einheimischen auf Hochtouren. Ich lebe nun seit mehr als einem Jahr in Kirchbach und ich glaube, behaupten zu können, dass ich in der Regentalgemeinde inzwischen wohlgelitten bin und als Kriminalbeamter ein ganz ordentliches Ansehen genieße. Dennoch beschränkt sich mein Freundeskreis im Großen und Ganzen auf ein paar alte Damen, einen Polizisten aus Bad Kötzting, dessen ukrainische Lebensgefährtin und den Bekanntenkreis Claudias. Da kann es nicht schaden, durch die Mitgliedschaft in einem Verein enger in den geschlossenen Kreis der Waidler einzudringen. Und dafür scheinen mir die Burgfreunde Runding e.V. nicht schlechter geeignet zu sein als ein Sport- oder Schützenverein.
Und so bin ich heute hier und warte zusammen mit Julia, Karl-Heinz – Kalle – Schmidgruber, dem mindestens 85-jährigen Otto Schnitzbauer, dem höchstens 15-jährigen Bernhard Vogl und Uli Meindl auf Anweisungen. Darum kümmert sich seit Jahren Friedrich Greisinger, der unumstrittene Fachmann in Organisationsfragen.
»Viel können wir heute nicht machen«, begrüßt er uns. »Der Regen letzte Nacht hat alles aufgeweicht. Ich hab mich schon umgesehen.«
Wahrscheinlich, während ich noch geschlafen habe, denke ich schuldbewusst.
»Oben beim Backofen hat das Wasser einige Steine aus der Mauer zum Burggraben gelöst«, fährt Friedrich fort. »Das könnt ihr beide machen.«
Sein Blick teilt mich und Julia ein. Ich weiß zwar nicht, was wir machen sollen, aber Otto wird uns das sicher noch erklären. Denkt zumindest Friedrich und schickt den Alten mit uns. Dann bekommen Kalle, Bernd und Uli den Auftrag, im Keller des zuletzt freigelegten Getreidestadels beim Eingang der Burg nach weiteren brauchbaren Mauersteinen für den Wiederaufbau zu suchen.
»Kommt mit«, richtet sich der gebürtige Rundinger Otto, Urgestein der Burgfreunde, an uns. Dankbar, nicht hinab in das feuchte Kellerloch steigen zu müssen, folge ich dem Berg von einem Mann und dem Mädchen. Otto ist alt, aber in der Blüte seiner Jahre strotzte er sicher vor Kraft. Noch heute packt er ohne Scheu zu und steckt Softies wie mich ohne Mühe in die Tasche. Nur gut, dass unsere Arbeit verspricht, nicht zu schwer zu werden.
»Schöner Tag heute, um zu arbeiten«, versuche ich, ein Gespräch mit dem Alten in Gang zu bringen.
»Hm«, meint dieser nur. »Wird bald regnen.«
Recht gesprächig ist er ja nicht gerade, denke ich. Ich passe mich dem schweigenden Alten an.
An der alten Wasserzisterne hält Julia an.
»Vorsicht!«, warnt Otto. »Die Steine sind locker.« Respektvoll wage ich einen Blick, der sich jedoch im Dunkel verliert. Wie auch beim Brunnen der Burg verhindert ein stabiles Eisengitter mit einer Einstiegsluke Schlimmeres. Wenigstens kann niemand dort hinabfallen, wenngleich die Gewitter dieses Sommers dem Mauerwerk um das Loch im Boden bedenklich zugesetzt haben.
Inzwischen haben wir den ehemaligen Kräutergarten hinter dem restaurierten und voll funktionsfähigen Backofen erreicht. Man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass der Sturzregen ganze Arbeit geleistet hat. Die zum Burggraben hinabführende Mauer ist hier noch in ihrem ursprünglichen Zustand oder besser gesagt, war es bis gestern. Die Fluten haben Gestrüpp und kleine Bäume mit sich gerissen. Deren Wurzeln wiederum ganze Mauersteine. Löcher in der Mauer und im Burggraben liegende Bruchsteine zeugen vom Kampf Wasser gegen mittelalterliche Baukunst. Hier, am östlichen Burgwall, hat das Wasser den Sieg davongetragen. Sicher müssen wir jetzt dort hinab.
»Da unten«, bestätigt Otto meine Befürchtungen. »Holt die Steine und macht sie sauber! Dann legt ihr sie hier hin!« Ein Kopfnicken lässt uns die Stelle vermuten.
»Wenn ihr fertig seid, könnt ihr noch die losen Bruchsteine hier beim Ofen freikratzen.« Er deutet auf die Rückwand des Backofens. Ein kurzer Blick reicht, um zu verstehen, was er meint. Die so sorgfältig von freiwilligen Händen verputzten Mauerfugen haben sich an einigen Stellen gelöst und wurden einfach fortgespült. Jetzt heißt es, die losen Reste zu entfernen, um Platz für neuen Mörtel zu schaffen.
Ohne ein weiteres Wort dreht sich Otto um und geht zurück zu den anderen.
»War ja klar! Mauern können wir ja nicht.« Ich kann Julia nur zustimmen. Ich sähe sie aber auch ungern unten an der steilen Mauer im Burggraben herumklettern.
»Lass nur! Ich steige in den Graben hinab. Kümmere du dich um den Backofen!«
»Wirklich? Du gehst allein hinunter?« Ich nicke nur und ernte einen dankbaren Blick. Es ist doch wesentlich angenehmer, die Fugen freizukratzen, als durch das nasse Gebüsch im Burggraben zu kriechen und die für den Wiederaufbau der Mauer so wichtigen Originalsteine von der Umklammerung der Wurzeln, von Schmutz und Schlamm zu befreien.
»Was machen deine Geschichten?«, lege ich bei der jungen Frau, die mit ihren 19 Jahre eigentlich noch ein Mädchen ist, einen Schalter um, während wir unsere Werkzeuge sortieren. Die anderen wissen es schon lange, ich erst seit ein paar Wochen. Das Herz des schlanken Mädchens mit den strubbeligen, schmutzig blonden, schulterlangen Haaren, den hohen Wangenknochen und den wachen, braunen Augen fiebert mit ihren Helden mit. Die Hände, die sich jetzt daranmachen, losen Mörtel von einer rauen Wand zu kratzen, tippen für gewöhnlich die Ergebnisse einer außergewöhnlichen Fantasie in ihren Laptop. Ein paar Minuten später bin ich über den aktuellen Stand ihres neuen Buchprojekts informiert. Weitere Fragen erübrigen sich. Während sie gewissenhaft den stählernen Fugenkratzer durch die Nahtstellen zwischen den Steinen zieht, erzählt Julia von Druckkosten, Layout, Covergestaltung und ihrer Freundin Sabine, die so gut zeichnen kann und die so nett ist und die in Regensburg studiert und die alle Grafiken im neuen Buch zeichnet und die kein Geld dafür verlangt und die so klug ist.
»Jetzt muss ich mich aber an die Arbeit machen!«, unterbreche ich schließlich ihren Redeschwall. Es ist höchste Zeit, in den Burggraben hinabzusteigen. Schließlich will ich nicht nach Hause gehen, ohne auch nur einen Handgriff erledigt zu haben. Zur Bekräftigung meiner Worte packe ich Pickel und Schaufel in die eine sowie eine Metallbürste in die andere Hand und stapfe auf den schmalen Steig zu, der in die Tiefe führt.
»Sei vorsichtig!«, gibt sie mir mit auf den Weg und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu.
Unten angekommen, sehe ich mich um. Der Regen hat tatsächlich ganze Arbeit geleistet. Also los! Schweigend und nach wenigen Minuten schwitzend grabe ich Steine frei, bürste nassen Lehm und Erde von ihnen und lege sie auf einen Haufen. Ich kann nicht sagen, wie lange ich so zu Werke gehe, als sich ein besonders großer Brocken meinen Bemühungen widersetzt. Ein wichtiger Stein, wie es aussieht. Ein mittelalterlicher Handwerker hat ihn vor Hunderten von Jahren zum perfekten Quader geschlagen. Jetzt ist er gefangen in einem Geflecht aus Wurzeln, die ihn nicht mehr freigeben wollen. Schnell ist mir klar, dass ich im Kampf gegen sie Hilfe brauche: eine Axt! Nur gut, dass der zum Werkzeuglager umfunktionierte Bauwagen nicht weit entfernt am Ende des Burggrabens steht, den ich nur entlangzulaufen brauche.
Ich bin keine Minute unterwegs, als mich ein gewaltiger Donnerschlag zusammenzucken lässt. Ich habe Julia ganz aus meinem Gedächtnis verbannt. Jetzt fällt mir das Mädchen oben beim Kräutergarten wieder ein. Sie hat sicher genauso wie ich über ihre Arbeit das aufziehende Gewitter vergessen! Dieses hat nun die Freundlichkeit, mich durch einen zweiten Blitz und das darauffolgende Grollen auf sich aufmerksam zu machen. Mein Blick geht zurück zu der Stelle, wo ich Julia vermute, und sieht nachtschwarze Wolken über Runding und den Schlossberg heraufziehen.
Nein, eigentlich sind sie schon da. Wie zur Bestätigung öffnet der Himmel seine Schleusen. Es regnet nicht, das Wasser fällt wie ein geschlossener Vorhang zur Erde. Ich spurte los und stürze in den Dohlenturm. Was für ein Glück, dass hier die Archäologen die Dokumentation der Geschichte der Burg untergebracht und dabei den Resten des einstigen Turmes ein neues Dach verpasst haben. Dennoch bin ich nicht gerade trocken, als mich Friedrich und die anderen empfangen. Sie haben etwas schneller auf die Situation reagiert. Ein Kasten Bier, aus dem sie mir eine Flasche anbieten, lässt mich vermuten, dass sie höchstens von innen nass sind. Der kurze Spurt hat meinen Puls nur unmerklich beschleunigt. Noch vor wenigen Jahren hätte mein Körper auf die Belastung verärgert reagiert. Alkohol und Zigaretten statt gesunder Ernährung und Sport. Zahlreiche ausgedehnte Touren über die Höhen des Bayerischen Waldes später fühle ich mich jünger als 42, obwohl ich vor vier Jahren älter als 38 zu sein schien. Zweifellos profitiert meine Konstitution auch von der Null-Promille-Grenze, die seit einem Jahr für mich gilt. Mein ehemals nicht zu verbergender Rettungsring ist einem Bauchansatz gewichen, der bei wohlwollender Betrachtung und unter Berücksichtigung meines Alters durchaus als sportlich durchgehen kann. All das hat im Zusammenspiel mit der neuen Frau an meiner Seite meinem Selbstwertgefühl auf die Sprünge geholfen. Früher versuchte ich, mein Alter hinter einem Bart zu verstecken. Heute stehe ich zu Fältchen und grauen Haaren. Solange es nicht zu viele werden.
»Wo sind Julia und Otto?« Friedrich klingt besorgt.
»Otto weiß ich nicht, aber Julia ist noch hinten beim Kräutergarten. Wir sollten sie holen, meinst du nicht?«
Kalle wirft einen Blick nach draußen. »Bis wir bei ihr sind, hört es schon wieder auf. Das ist nur ein Gewitter.«
»Ja! Außerdem ist sie ein kluges Mädchen. Sie hat sich sicher unter dem Dach des Backofens untergestellt«, bekräftigt Uli den vorherrschenden Trend, im Trockenen zu bleiben. Eine Meinung, die ich nicht unbedingt teile. Es bleibt nur die Hoffnung, dass das Mädchen in Sicherheit ist. Das umso mehr, als Blitze und Donner jetzt nahtlos ineinander übergehen. Das Gewitter schwebt langsam über die Burg hinweg. Und dann ist es auch schon wieder vorbei und bestätigt damit die anderen. Nur der Regen weigert sich beharrlich nachzulassen und hält uns weiter im Dohlenturm gefangen. Mit jeder Minute wächst meine Sorge um die junge Frau oben im Burghof.
»Ich schau mal nach ihr«, erkläre ich schließlich den anderen, die mir zuprosten, während ich meine Arbeitsjacke über den Kopf ziehe und den trockenen Unterstand verlasse. Ich orientiere mich nach rechts, als mir der dumpfe Knall einer zuschlagenden Autotür den Weg hinab zum Parkplatz weist. Rutschend laufe ich über die glatten Pflastersteine des Burgaufgangs hinab und erreiche Julias Opel Corsa in dem Augenblick, als sie den Motor startet und losfahren will. Ihre weit aufgerissenen Augen starren mich an. Ich klopfe an das Seitenfenster, das sich zögernd öffnet.
»Alles in Ordnung?«, rufe ich gegen das Trommeln des Regens auf dem Wagendach an.
»Ja! Ja, alles in Ordnung!«
Das Unwetter hat wohl außerhalb des Turmes heftiger getobt, als ich angenommen habe. Sie wirkt verwirrt. »Was ist da oben passiert? Ich hoffe, du konntest dich irgendwo unterstellen!«
Die folgende Pause ist zu lang. »Ja! Ja, es ist wirklich alles in Ordnung! Aber ich friere und bin total durchnässt. Ich möchte jetzt nach Hause!«
»Ist schon klar! Denkst du, du kannst fahren? Ich könnte dich heimbringen, wenn du willst.«
»Nein, es geht schon.«
Diesmal kommt die Antwort blitzschnell. Seltsam! Irgendetwas stimmt doch da nicht. Und was ist das?
»Hast du das gefunden?« Ich deute auf den Beifahrersitz, auf dem ein kleines Kästchen liegt.
»Was? Das …?« Hastig nimmt sie es und legt es auf den Boden. »Ach, nur ein Geschenk. Hatte ich schon dabei, als ich hergekommen bin.«
»Ach so. Ja dann, sieh zu, dass du ins Trockene kommst! Nicht, dass du noch krank wirst.«
»Ich spring sofort unter die heiße Dusche. Bis zum nächsten Mal, Moritz.«
Ich sehe ihr noch nach, bis sie um die nächste Kurve verschwindet. Erst jetzt bemerke ich, dass auch ich durch und durch nass bin. Das mit der Dusche scheint mir keine schlechte Idee zu sein. Der Arbeitseinsatz ist für heute ohnehin beendet. Ich muss nur noch mal hinauf zu den anderen und mich verabschieden. Dann fahre ich wieder hinüber nach Kirchbach.
Ich drehe mich um und zucke zurück: »Mann, Otto! Hast du mich erschreckt!«
Ich habe sein Kommen nicht bemerkt. Wie lange steht er schon hinter mir? »Julia ist nach Hause gefahren«, erkläre ich das Offensichtliche. »Wo warst du die ganze Zeit?«, schiebe ich eine Frage nach, in der Hoffnung, dass diese intelligenter klingt.
»Da hinten.« Er nickt in eine unbestimmte Richtung, dreht sich um und lässt mich verdutzt zurück. Es stimmt schon. Sehr gesprächig ist Otto wirklich nicht.
Der Regen lässt nach und ermöglicht Friedrich und den anderen die Rückkehr zum Parkplatz. Er beendet offiziell den heutigen Arbeitseinsatz. Nach und nach rollen die Autos der freiwilligen Helfer hinab nach Runding. Ich sitze halb nackt in meinem BMW und folge ihnen. Meine nassen Sachen liegen hinten im Kofferraum. Schließlich will ich den Innenraum meines treuen Vehikels nicht überfluten. Während ich durch den Ort fahre, frage ich mich, warum mich Julia belogen hat.
Chamerau, Ortsteil Roßberg, 17.30 Uhr
Julia saß auf der wackligen Holzbank vor dem Haus, das außer ihr niemand bewohnen wollte, und starrte auf die Schatulle.
Was ist Besonderes an dir?, dachte sie. War es das Hakenkreuz, das ihr, wie sie sich eingestehen musste, etwas Angst machte? Waren es die Umstände oder der Ort ihres Fundes?
Julia gehörte zu dem Teil der Menschheit, der an die Macht des Schicksals glaubte. Es war Schicksal gewesen, dass der Donnerschlag sie just in dem Augenblick erschrocken hatte, als sie ihre Hand neugierig in das Loch steckte, das sich hinter dem letzten Stein, den sie aus der Mauer gekratzt hatte, auftat. Sie war nach vorne gekippt, und als ihre Hand Boden fand, hatte sie dieses scharfkantige Teil gespürt. Das konnte kein Fels oder Stein sein. Vorsichtig hatte sie das Loch in der Wand vergrößert und als der Himmel seine Schleusen geöffnet hatte, hatte sie das Kästchen ans Licht des Tages gehoben.
Noch bevor sie die Bilder und Buchstaben darauf entziffern konnte, hatte sie das Geheimnis gespürt, das sie in Händen hielt. Ein Ergebnis ihrer überbordenden Fantasie oder Realität? Eine Frage, die der Regen beantwortet hatte, indem er den Schmutz, der das Kästchen bedeckt hatte, abwusch.
Ihre Finger tasteten über den Deckel. Die Buchstaben, das Zeichen einer vergangenen Diktatur und die beiden Tiere waren deutlich zu spüren. Gravuren, dachte sie. Grausilberne Vertiefungen auf schwarzem Hintergrund.
Was für ein Material das wohl ist? Dem Gewicht nach mindestens Eisen. Warum aber dann die schwarze Farbe? Sie hob das Kästchen, das sie an die alte, kunstvoll verzierte Schmuckschatulle ihrer Großmutter erinnerte, vor ihre Augen und drehte es in alle Richtungen. Die Buchstaben und Zeichnungen auf dem Deckel hatte sie schon drüben, auf der Burg entdeckt. Die Gravur am Boden spürte sie erst jetzt. Kleiner, dünner und doch bei genauem Hinsehen deutlich zu lesen. Ein Datum. Und ein Ort, von dem sie noch nie gehört hatte.
An einer Seite versprach ein Schlüsselloch Zugang zum Inhalt des Kästchens. Falls man den passenden Schlüssel dazu besaß. Doch wo war dieser? Noch in dem Erdloch droben auf der Burg? Eine weitere Frage. Die es später zu beantworten galt. Erst einmal wollte sie die Bedeutung der Zahlen und Namen entschlüsseln.
Und dazu brauchte sie einen Zugang zum Internet. Den sie nicht hatte. Nicht hier oben, in ihrem einsamen Domizil, das sie so sehr liebte. Hier konnte sich ihre Fantasie austoben, konnte ungestört von Facebook, Twitter und WhatsApp gute und böse Menschen, Helden und Verbrecher, ganze Welten und Zeitalter entwerfen. Ohne die Allgegenwart eines Smartphones. Julia verzichtete auf diesen für einen Teil der Menschheit inzwischen unentbehrlichen technischen Alleskönner, der ihr von jeher unheimlich gewesen war. Ein Alleinstellungsmerkmal, das sie in ihrer Altersgruppe fast schon einmalig machte.
Wenigstens hatte sie sich von Sabine ein Handy aufschwatzen lassen. »Wo du doch so einsam wohnst«, hatte ihre beste Freundin zu bedenken gegeben. »Als Frau noch dazu.« Julia hatte nachgegeben und sich ein altes Nokia der Klappgeneration schenken lassen.
Jetzt aber, das musste sie zugeben, wären Google und Wikipedia doch ganz praktisch.
Hab ich nicht, dachte sie.
Also brauchte sie Sabine. Die 21-jährige Studentin der Biologie verbrachte ihre Zeit nicht nur damit, ihre beste Freundin zu sein.
Plötzlich lief ein Schauer durch ihren Körper. Zitternd schüttelte sie sich. Kein Wunder, ihre Klamotten waren genauso klitschnass wie ihre Haare. Sie marschierte ins Haus, stellte die Schatulle auf den Tisch und ging ins Bad. Dort warf sie die nassen Sachen auf den Boden. Die nächsten Minuten genoss sie die Wärme des Wassers auf ihrer Haut, drehte den roten Knopf so weit, bis sie es kaum mehr aushielt, und schlüpfte dann in einen bequemen Trainingsanzug. Anschließend ließ sie sich auf das alte Sofa in der Ecke fallen und wählte Sabines Nummer.
Nachdenklich streichelte sie Hector. Der weiß-braun-schwarz gefleckte Kater, an dem sie mehr hing als an den meisten Menschen, schnurrte wie eine Turbine und sah sie erwartungsvoll an.
»Sabine Kulzer … Hey, Julia.« Dann redeten die beiden jungen Frauen über Dinge, über die junge Frauen eben so redeten. Julia konnte es kaum erwarten, endlich zum Punkt zu kommen. »Du, Sabine, ich hab da heute was gefunden, über das ich gerne mehr wüsste. Könntest du mal für mich nachsehen?«
»Ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass du Internet brauchst.« Die junge Frau, die dank ihrer Sommersprossen und der Brille mit der roten Fassung aus der Masse Gleichaltriger herausstach, bemühte sich, vorwurfsvoll zu klingen.
»Ja, ja! Schon gut. Kannst du oder kannst du nicht?«
»Dumme Frage. Klar mach ich das für dich, Liebstes. Um was geht’s denn?«
»Komm doch morgen vorbei. Dann kann ich’s dir zeigen.«
»Wow, hört sich ja geheimnisvoll an.«
Ist es auch, dachte Julia.
»Klar doch. Ich mach auf dem Weg nach Regensburg einen Abstecher zu dir. So um zwei?«
»Jep!«
»Ich muss jetzt. Michi kommt gerade. Wir sehen uns dann morgen.«
Michi! Was fand sie nur an dem Kerl? Julia sah Hector an und verzog das Gesicht zur Grimasse. Nur gut, dass Sabine sie nicht sehen konnte. Die Katze mit dem Namen ihres trojanischen Lieblingshelden legte den Kopf schief und kniff die Augen zusammen.
»Passt! Bis morgen dann. Wir sehen uns.« Nachdenklich starrte Julia auf ihr Handy. Sie wusste, die junge Frau mit dem untrüglichen Gespür für die falschen Kerle würde es kaum erwarten können, ihren Fund zu sehen.
Was aber, wenn das Kästchen gefährlich war? Das Wort tauchte unvermittelt auf. Mit einem unsicheren Lächeln verbannte sie es wieder und ersetzte es durch einen anderen Gedanken: Hat Moritz etwas gesehen? Sie hatte ihn nicht bemerkt, bis er an ihr Autofenster geklopft hatte. Ich habe völlig falsch reagiert, dachte sie. Spätestens, als ich das Kästchen auf den Boden vor dem Beifahrersitz geworfen habe, muss ihm das aufgefallen sein. Er ist Polizist! Da hat man doch ein Auge für so was.
Egal! Schon passiert. Jetzt will ich erst mal wissen, was die Schlange und der Wolf zu bedeuten haben.
Sonntag, 04.06.2017 Chamerau, Ortsteil Roßberg, 15.20 Uhr
»Mann, du wohnst aber abgelegen.«
Sabine trat ihrem Freund unauffällig ans Schienbein. Nicht unauffällig genug, zumal Michi das Gesicht verzog und sie wütend ansah.
Julia grinste. Die Meinung von Sabines Begleiter störte sie nicht. Er war damit nicht allein. Jeder ihrer seltenen Besucher betrat ihr selbst gewähltes Exil mit mehr oder weniger offen gezeigter Verwunderung. Dabei war es einer ihrer Glückstage gewesen, als sie oben an der Straße das »Zu vermieten«-Schild gelesen hatte.
Das Haus war klein, mehr ein Wochenendhaus. Und es lag am Ende eines Feldweges, der von Roßberg hinab in den Wald führte. Der Ort, selbst nur ein paar Häuser, befand sich auf einer Lichtung, hoch oben über dem Regental. Vor ein paar Jahren hatten ihn die Sternfreunde aus Cham als Standort für ihre Sternwarte auserkoren und ihn damit aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Seither trafen sich hier in klaren Nächten Astroenthusiasten von nah und fern, um sich das All näher zu holen.
Das Haus verlangte ihr jedes Mal die Mühen eines steilen Anstiegs ab, wenn sie von Chamerau oder Kirchbach kommend hinauf nach Roßberg fuhr, aber es entschädigte mit einem fantastischen Ausblick und eben jener Abgeschiedenheit, die sie liebte.
Deshalb nahm sie es dem schmächtigen Jungen, der mit ihr und Sabine auf der Terrasse hinter dem Haus saß, nicht übel, dass er ihre Beweggründe für ihren Wohnort nicht verstand. Vielmehr ärgerte es sie, dass ihre Freundin den Kerl überhaupt mitgebracht hatte. Und sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie damit einverstanden gewesen war. Dabei waren es nicht seine kurzen Stoppelhaare und die Pickelnarben – Überbleibsel einer unglücklichen Pubertät. Auch die schwarzen Klamotten und die von Tattoos übersäten dünnen Arme schreckten sie nicht. Schlangen, Drachen und Totenköpfe. Wirklich hässlich.