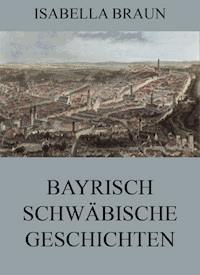
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Isabella Braun stammt aus der schwäbischen Region westlich von Augsburg und wuchs dort auch auf. Ihre Jugendgeschichten gehören nicht nur zu den Klassikern dieser Region sondern auch zu denen des deutschen 19. Jahrhunderts. Inhalt: Das Vaterhaus Nanny, die Kindsmagd. Kätherle. Die Leberspätzlein Der böse Golo Vom Schusserspiele Beim Tyrolerweine. Das Schloßgespenst Ohne Namen. Die blinde Großmutter sieht's ja nicht! Der Haussegen. Das arme Studentlein. Das Komplott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bayrisch-Schwäbische Geschichten
Isabella Braun
Inhalt:
Das Vaterhaus
Nanny, die Kindsmagd.
Kätherle.
Die Leberspätzlein
Der böse Golo
Vom Schusserspiele
I.
II.
III.
IV.
Beim Tyrolerweine.
I.
II.
III.
Das Schloßgespenst
I.
II.
Ohne Namen.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI
VII.
Die blinde Großmutter sieht's ja nicht!
I. Was Valentin der Großmutter versprechen mußte
II. Wie der Valentin zum Gespött seiner Kameraden wurde.
III. Valentin verschafft sich Ruhe und gewinnt dadurch einen Freund.
IV. Wer gewinnt die Oberhand?
V. Die Wunder des Meeres.
VI. Die blinde Großmutter hat's doch gesehen!
Der Haussegen.
I.
II.
III.
IV.
Das arme Studentlein.
I.
II.
III.
IV.
Das Komplott.
I.
II.
III.
IV.
V.
Bayrisch-Schwäbische Geschichten, I. Braun
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849623234
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Das Vaterhaus
Ob prächtig schaut mit Turm und Bogen Das Vaterhaus in's weite Land; Ob sich's von Efeu grün umzogen Gemütlich lehnt am Waldesrand; Ob in den Straßen langer Reihe, Im kleinen Dorf, im Felde draus: Ihm mangelt nie des Herzens Weihe – Es ist und bleibt das liebste Haus!
Denn holde Bilder drinnen prangen Aus einer lieben Jugendzeit: Das Mutterherz voll Lust und Bangen, Das Vateraug voll Zärtlichkeit; Das Schwesterchen in seiner Wiege Mit einem Köpfchen rund und kraus; Der Brüder laute, lust'ge Kriege – Dies alles zeigt das Vaterhaus.
Und mancher schöne Festesmorgen, Und mancher Abend lieb und traut, Und manche Hoffnung still verborgen Die sich das Kinderherz erbaut: Das Weihnachtsbäumlein voller Schöne, Der Osterhas, der Nikolaus, Und all' die hellen Freudentöne – Sie stammen aus dem Vaterhaus.
Doch auch ein Bild voll tiefer Trauer Mischt unvergeßlich sich hinein, Ein Bild voll Tränen und voll Schauer: Der enge, kalte Totenschrein – Wenn einen aus dem trauten Kreise Zur ew'gen Rast man trug hinaus Und alle weinten bang und leise Im gramerfüllten Vaterhaus.
O Vaterhaus mit deinem Frieden Sei uns gegrüßt viel tausendfach! Ob längst wir sind aus dir geschieden, Ob noch uns deckt das liebe Dach! Nimm unsern Dank für allen Segen, Der immer strömt von dir heraus. Wir denken dein auf allen Wegen, Geliebtes, teures Vaterhaus!
Wer heutigen Tages im Dampfwagen auf dem Wege von Augsburg nach Ulm fährt, gelangt an die kleine Station Jettingen. Der Ort selbst liegt etwas entfernt und nur der Kirchturm und die vier Schloßtürme treten deutlich hervor. – Das ist meine Heimat.
In der »alten Zeit«, die meine »junge Zeit« gewesen, sah es jedoch daselbst ganz anders aus.
Das Schloß glich beinahe einer Ruine; nur ein einziges Stockwerk war noch bewohnbar, das andere lag in gänzlicher Zerfallenheit und diente zur Aufbewahrung alter Fässer, die mittels eines Zuges dahin gebracht werden konnten, aber auch zum herrlichen Tummel- und Versteckplatz für uns. – Der innere Schloßhof war sonnenlos, feucht, kalt. Die Seitentüren zu den Kanzleien glichen den Eingängen zu schaurigen Burgverliesen; der Aufgang zu den Wohnungen, war nicht minder unfreundlich. Hatte man jedoch den ersten Treppenabsatz erreicht, dann strömte das Licht von zwei Seiten in einen langen, prächtigen Korridor, von dessen Wänden die lebensgroßen Bilder der römischen Kaiser herniederstarrten. Die Türen führten in eine Reihe stattlicher Zimmer, alle inein andergehend, in Ost und West vom Turm-Erker begrenzt.
Ich muß meine jungen Leser aber bitten, mich rund um das Schloß zu begleiten, um die Stellen in Augenschein zu nehmen, woselbst die Geschichten aus meiner Jugendzeit spielten.
Die Einfahrt in den vorderen Schloßhof geschah zwischen zwei Mauern, wovon die eine die Gartenmauer ist.
Wir schlüpfen durch das Tor und stehen nun vor meinem Kinderparadiese. Zwischen Blumeneinfassungen sind Obstbäume geschart; viele wohlgepflegte Wege ziehen sich hin und laufen beim Springbrunnen zusammen. Dann teilen sie sich wieder nach rechts und links, dort und hier durch eine Dirlitzenhecke begrenzt, welche die drei Abteilungen des Schloßgartens scheidet. Der mittlere Pfad führt zu einem wahren Lustplatze. Unter vielen alten Kastanienbäumen befinden sich Tische und Bänke nebst einer Kegelbahn zum allgemeinen Vergnügen, denn der Schloßgärtner hat das Recht erworben, hieselbst Bier zu schenken.
Uns verlockt aber der Seitenweg. Da glänzt im Sonnenschein der Wasserspiegel des Weihers. Hohes Schilf, dicke Binsen umfassen ihn auf einer Seite. Eine Scheu hält uns von dieser Seite ferne und allerlei Sagen von einem Kinde, welches dort hineingefallen und in einem unterirdischen Palaste gefesselt liege, knüpfen sich daran. Über dem Wasser drüben lachen grüne, saftige Wiesen und herüber ist das Ufer mit schattigen Bäumen umgeben. Ein etwas morsches Floß liegt daselbst und die kecken Knaben wagen manche Wasserfahrt, obowhl das lose Gebälke einige Gefahr damit verbindet, weshalb dieses Vergnügen uns vom Vater untersagt ist, außer wenn der Gärtner Xaver uns mit sich nimmt.
So haben wir zwei Seiten des Schlosses umfahren und landen glücklich an unserem schönsten, verborgensten Spielplatze. Auf diesen Punkt führt kein Fenster eines bewohnten Zimmers; da breitet sich der hügelichte Hopfengarten aus; im Herbste, bis zum Frühlinge sind die Stangen zeltartig aufgeschichtet. O, welche Kriegsspiele sind hier zu treiben! Daran grenzend steht auch gleich die Kaserne, ein altes, zweistöckiges Sommerhaus, und in kleiner Entfernung befindet sich ein angebautes Kartoffelland, welches zu einer Jahreszeit wenigstens die grünen Kriegskugeln liefert.
Und nun gelangen wir dicht vor das Schloß, die bewohnte Seite der Straße zugewendet, welche durch eine Mauer von dem Hofe geschieden ist. Bäume umfassen diese Mauer, nahe daran geschichtet liegt meist viel Gebälke für die Zimmerleute und ist damit eine prächtige Gelegenheit verbunden, die Schaukel zu erbauen. Auf diesem Platze läßt uns die Mutter am liebsten spielen. Dort oben am Fenster erscheint ihr liebes Gesicht, das sich oftmals von der Näharbeit zu uns wendet oder in die Stube zum Lernen und Essen ruft.
Wir folgen ihr und springen in den eigentlichen äußeren Schloßhof, am kleinen Torhause mit dem Bänkchen vorüber, und nun stehen im Halbkreise die Ökonomiegebäude: Bräuhaus, Stadel und Ställe vor unseren Augen; eine Brücke leitet endlich zum innern, bereits beschriebenen Schloßhofe.
Aber dies ist noch lange nicht alles, was ich von meiner trauten Heimat zu berichten habe.
Viele Gassen führen in den großen Marktflecken. Ein Bach fließt mitten durch denselben und bietet im Winter die herrlichste Schleif- und Schlittschuh-Gelegenheit. Das Amtshaus, das Herrschaftshaus, wo hie und da in die geheimnisvollen Gemächer mit goldgelben Samtmöbeln und goldumrahmten Spiegeln der Graf einzieht, – Kirche und Schulhaus liegen stattlich im Orte zerstreut, und der goldene Stern, das weiße Lamm lassen ihre Schilder im Sonnenschein blinken.
Wir schreiten den Bach entlang und stehen nun vor dem großen Anger, dem Sammelplatze aller Ortskinder. Zwischen zwei niederen Hecken gelangen wir wieder in den Ort und dort in der Seitengasse gewahren wir ein Haus, das sich von den andern unterscheidet; die Fenster sind nämlich bogenartig abgerundet; ein Blumengarten verleiht dem Hause noch dazu etwas apartes.
Dieses sind die engeren Grenzen unseres Tummelplatzes. Aber das liebe Schwabenland hat große, schöne Waldungen, wohlgepflegtes Ackerland, grüne, blumige Wiesen, viele Ortschaften und manches alte, halbzerfallene Schloß auf dem Berge. O, es hat des Schönen so viel, daß mir das Herz überwallt in seliger Jugenderinnerung!
Und nun, tausendmal willkommen Ihr lieben, jungen Leser, in meiner unvergeßlichen Heimat!
Nanny, die Kindsmagd.
Unter den Gestalten, welche durch meine Jugendjahre wandelten, tritt mir eine ganz besonders deutlich entgegen, denn es umgibt sie der verklärende Strahl der Liebe. Deshalb sollen auch die ersten Blätter ihr gewidmet sein.
Wir sind drei Geschwister, Anton, ich und Sophie, mit dem Zwischenraum von je drei Jahren. Unsere Kindsmagd heißt Nanny und die Mutter hat befohlen, daß wir derselben so pünktlich gehorchen müßten, wie ihr selbst. Wir hängen an unserer Wärterin mit Leib und Seele, aber sie liebt uns dafür auch so zärtlich, wie die Mutter. So lange wir denken können, ist sie bei uns und wir wissen aus ihrer Erzählung, wie sie zu uns kam, was ich nun berichten will.
Nanny war ein armes Kind, denn sie hatte den Vater schon frühzeitig verloren. Kaum notdürftig genährt, hauptsächlich mit schwarzem Brote, das dem nassen Erdboden an Farbe gleich kam, blieb sie im Wachstum zurück. Als nun einmal die Schloßfrau von Bellenberg, ihrer Heimat, Baronin von Welser, das Mädchen am schwarzen Brote kauen sah, ergriff sie das Mitleid, sie winkte die Kleine zu sich und gab Befehl, täglich das rauhe Brot gegen ein feineres umzutauschen. Auf diese Weise wurde Nanny im Schlosse heimisch, die Gespielin des kleinen Fräuleins und durfte allgemach am Nähunterricht teilnehmen.
Wie nun Nanny das sechzehnte Jahr erreicht hatte, lernte unsere Großmutter sie bei der Baronin kennen und empfahl sie der Tochter als Kindsmagd. Alle ihre Habseligkeiten in ein Tuch gebunden, mit dem Empfehlungsbriefe ausgestattet, wanderte sie an der Seite einer Landbötin ihrem Dienste nach Jettingen zu.
Sie fand eine freundliche Aufnahme; aber heimlich sagte die Gebieterin doch zur Botenfrau: »Ja, Annamie, was hat doch meine Mutter gedacht, daß sie mir eine so schwache, junge Person schickt?« Die Annamie entgegnete lächelnd: »Probiert's nur, Frau; dies Mägdle kann mehr, als sie vorstellt!«
Und so war es auch. Nanny übernahm den kleinen Tony und nähte auch noch alle seine Kleidchen. Bald erschien ein neues Pflegekindchen und das war ich.
Nanny zählte damals siebzehn Jahre. Wenn nun der mühevolle Arbeitstag vorüber war, legte sich auch der Schlaf mit Bleiesschwere auf die Augen unserer Wärterin und sie nickte schon auf dem Stuhle, bevor sie im Bette lag. Ich aber war ein kleiner Schreihals und wollte herumgetragen sein.
In einer Nacht schrie ich nun besonders jämmerlich. Die Mutter konnte es nicht mehr anhören und weckte die arme Nanny, damit sie mich in das Kissen binde und herumtrage. Eilig kam diese herbei, band mich in den Pfühl, legte den oberen Teil auf den linken Arm und drückte und wiegte den untern mit dem rechten. – Immer leiser ward das Gewimmer, immer dumpfer der Laut. Da rief die erschrockene Mutter ihr schlaftrunkenes Kindsmädchen herbei, nahm mich in den Arm, band das Kissen auf und stieß einen herzzerreißenden Schrei hervor: Nanny hatte das Kind verkehrt eingebunden, das Köpfchen befand sich, wo die Füße hingehörten. Rasch wurde ich mit Wasser bespritzt und ich hatte meine erste Lebensgefahr glücklich überstanden.
Von dieser Nacht an war Nanny nicht mehr schlaftrunken. Sie bat inbrünstig, ihr das Kind auch ferner anzuvertrauen; die Mutter gewährte die Bitte und ich genoß von nun an eine wahrhaft rührende Sorgfalt. Wenn ich vom Schlummer erwachte, waren es Nanny's Augen, in welche ich blickte. Auf ihrem Schoße spielte ich, an ihrer Hand lernte ich gehen, mein erstes Kleidchen nähte sie und an den Sonntagen kleidete sie meine Puppe; als ich die ersten Lederstiefelchen bekam, setzte sie ganz heimlich Fränslein herum. Wenn die Leute mich die »braune Bill« nannten, wurde sie sehr zornig, bis ich selbst den Namen bestätigte. Wie natürlich war es also, daß ich meinen Namen sehr lieb hatte.
Wir wohnten in der großen Eckstube neben dem Turmzimmer. Allabendlich setzten wir Kinder uns um den Tisch, wir nahmen nun bereits drei Stühle ein, Sophiechen war auch angekommen und emporgewachsen. Natürlich befand sich Nanny in unserer Mitte und die Mutter hatte den Vorsitz. Es war immer gar so vergnüglich an diesen Abenden, wir freuten uns den ganzen Tag darauf und zürnten der Uhr, weil sie so bald neun mal schlug, die Stunde, wo wir unabänderlich zu Bett mußten.
Einmal ward es plötzlich anders als sonst, es herrschte unheimliche Stille. Die Mutter stützte ihr Haupt in die Hand und mochte nicht erzählen; aus Nanny's Augen flossen Tränen auf die Näharbeit und wir blickten verstohlen von der Einen zur Anderen.
In jener Nacht kam kein Schlaf in meine Augen. Als es dämmerte, schlich ich zu Nanny's Bett, legte mich zu ihr und frug: »O Nanny, hat Dir jemand etwas getan? Warum hast Du gestern Abend geweint?«
Nanny antwortete: »Nein Bill! Niemand hat mir etwas getan; aber ich muß doch weinen.«
»Und warum mußt Du denn weinen?« forschte ich weiter.
Nanny drückte mich an sich und sagte unter Tränen: »Weil ich von Euch fort muß; der Vater befiehlt es.«
»Weil ich von Euch fort muß!« – Diese Worte erschreckten mich namenlos; sie raubten mir die Sprache und die Besinnung. Am Tage erzählte ich es Tony. Wir gingen miteinander zur Mutter und fragten sie, ob es wahr sei? und dann, warum es der Vater befohlen habe? Die Mutter sagte nur, daß der Vater jederzeit das Rechte wolle und man ihm willig gehorchen müsse.
Von diesem Tage an mochte ich nicht mehr spielen; nichts gefiel mir mehr. Ich meinte das Herz müsse mir zerspringen, so traurig war ich. Den Vater getraute ich mich gar nicht mehr anzusehen, weil mir dabei die Tränen aus den Augen gestürzt wären, und – man sollte ihm ja willig gehorchen.
Der Abschiedstag rückte heran. Nanny war beschäftigt, ihre Habseligkeiten, die sich bedeutend vermehrt hatten, in einem großen, hölzernen Koffer einzupacken. Ich stand daneben; oftmals gab sie mir etwas – ein Fleckchen, ein Band, bunte Perlen für meine Puppe, aber nichts erfreute mich. Nach einer Weile rollte das blau angestrichene Schweizerwägelchen heran, die Kiste wurde hinabgetragen gleich einer Totenbahre, ich hing mich an Nanny's Hals und schrie jämmerlich, mein Bruder schluchzte, mein Schwesterchen streckte verlangend die Arme nach ihr aus, endlich ergriff die Mutter unsere Hände und enteilte selbst weinend mit uns, während das Wägelchen von dannen rollte.
Nanny war also fort zu einem, viele Stunden entfernten Pfarrer. Der Vater kam desselben Abends von Burgau zurück und beschenkte uns mit Spielsachen, aber wir besahen sie kaum und weinten nur bei seinem Anblicke.
Da verfinsterten sich seine Blicke und er sagte: »Was ist denn mit Euch? Warum weint Ihr?« – Ich stotterte unter Schluchzen: »Unsere – Nanny – ist fort!« – Er kehrte uns den Rücken und rief beim Abgehen: »Was braucht Ihr die Nanny! – Ihr habt ja Eure Mutter!« – Später erfuhr ich, daß unsere übergroße Liebe zu der Kindsmagd der Grund ihrer Entfernung gewesen sei. Der gute Vater war besorgt, wir möchten mehr an dieser, als an der Mutter hängen.
Die Tage verstrichen unter Arbeit, aber die Abende waren traurig; wir ließen uns durch keine Geschichte erheitern und gedachten der Nanny mit beständigen Fragen. – Wenn die Zeiger unserer großen Uhr auf acht deuteten, kam jedesmal der Vater in die Wohnstube und belustigte sich an unsern fröhlichen Einfällen bis neun Uhr, zu welcher Zeit wir unser Abendgebet verrichteten, wobei er zugegen blieb.
Seit den letzten Ereignissen fand der gute Vater keine Aufheiterung in unserer Mitte. Selbst das Gebet sagten wir in traurigem Tone und fügten zum Schlusse bei: »Lieber Gott, bring uns die Nanny wieder. – Amen.« – Anfangs zürnte der Vater, aber er störte unser Gebet nicht, denn er räumte dem Vater im Himmel ein Recht des kindlichen Vertrauens vor dem irdischen ein.
Vierzehn lange Tage waren seit jenem Abschiede verflossen, als eines morgens der Vater wegfuhr, wohin? – das wußten wir nicht. Es war bereits acht Uhr; die Mutter hatte schon oft das Fenster geöffnet und gehorcht, kein Rollen des Wägelchens ließ sich vernehmen und die Zeiger der Uhr wiesen auf neun. – Wir waren schläfrig und verrichteten wie gewöhnlich unser Abendgebet. Als wir uns dem Schluße näherten, fuhr der Vater in den Hof; doch wir ließen uns nicht stören und beteten mit Herzensinbrunst: »Lieber Gott, bring uns die Nanny wieder.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Türe und die Nanny stand leibhaftig da. – Wir lachten, schrien, jubelten, stürzten in ihre Arme, Tony schlug ein großes Rad und machte einen Purzelbaum, die Mutter drückte der Nanny die Hand, der Vater aber wischte sich die feuchten Augen. Wir eilten auf ihn zu, küßten seine beiden Hände und dankten ihm recht aus kindlichem Herzen.
Nanny blieb bei uns, bis wir alle groß waren, von den Eltern geschätzt, von uns geliebt, von den Leuten als ein Musterdienstbote geachtet. Endlich zog sie von uns fort in ihr eigenes Haus und wurde eine brave, angesehene Frau. Aber immer blieb sie unsere liebe Nanny, die wir in treuer Dankbarkeit nicht vergaßen, die uns in treuer Liebe anhing.
Kätherle.
Wie voll die Apfelbäume hangen, und wie die Kinder sich darüber freuen mögen! Einstens – es ist schon lange her – war ich auch so ein Kind und habe die Äpfel auch so gerne gehabt. So oft ich nun die Zweige sich unter ihrer Last biegen sehe, ist mir's, als sei ich wieder ein achtjähriges, sonnverbranntes Mädchen. Neben mir steht mein Bruder in seinem Soldatenanzuge mit dem gemalten Bärtchen über den Lippen; auch der Vater ist wieder mit ihm aus dem Grabe erstanden; die Mutter hat aufs neue rote Wangen und eine furchenlose Stirne. Ich sehe vor mir das alte graue Schloß mit den vier Türmen und dem Storchenneste darauf; ich höre die Peitsche knallen, die Pferde wiehern und die großen Heuwagen in den Hof fahren, der rings vom Stall, Stadel und vom Bräuhause umgeben ist. Nun stehe ich am tiefen, sumpfigen, mit Schilf bewachsenen Weiher und schlüpfe von da in den Schloßgarten hin zum Baume, wo der rote Erdbeerapfel durch die Zweige lacht. Ich husche in das Gras, bücke mich und zeige triumphierend meine Beute. Aber plötzlich ist die Szene verwandelt. Beschämt blicke ich zu Boden, meine Wangen färben sich rot, mein Herz pocht!
Aber ich will in aller Ordnung Euch ein Stückchen Kinderleben erzählen. Höret also:
Es ist Sommer und das Getreide bald reif; die Wiesen stehen im höchsten Schmucke und vom Hofe herauf tönt das Dängeln der Sichel und Sense. Armes Gras! erschrickst du nicht davor? es ist dein Totenglöcklein. Darein mischt sich noch ein anderes, nicht voll und dumpf, wie bei Reichen, nur das ferne: »bim, bam!« vom Kirchhofe her, das einem Armen zum Grabe läutet.
»Mutter, wer wird denn begraben?« frage ich neugierig und schmerzlos; die Mutter versteht die Sache besser, denn sie seufzt und antwortet: »Weißt Du das nicht? Kätherle's Vater wird eingescharrt, und nun haben die armen Würmer niemand mehr auf Gottes weiter Erde!«
»Niemand mehr!« – Das kam mir recht traurig vor, denn ich war ein weichherziges Ding. Ich trat also betrübt und schmeichelnd zur Mutter und sagte: »Aber sie haben ja Dich! Du hast ihnen schon lang zu essen gegeben; wird Kätherle es denn nun nicht mehr holen?«
Die Mutter nickte mir freundlich zu, und bald war ich nicht mehr traurig, sondern stand ganz vergnügt im Herdwinkelchen bei meiner Nanny, welche die Abendsuppe kochte.
Welch ein trauliches, gemütliches Winkelchen war das nicht! Da gab es manch kleines Geschäft; ich durfte Scheitchen zulegen, in die Glut blasen, daß das Feuer hell aufloderte, und daneben gab es etwas zu versuchen und zu naschen.
Bald trat wie gewöhnlich das arme Kätherle mit dem leeren Topfe unter die Küchentüre. Hier stand sie nun, schüchterner als je in ihrem alten, dünnen Kleide; nur ein schwarzer Fetzen war zum Zeichen der Trauer um ihren Hals geschlungen. Sie weinte; mich wunderte, daß die Tränen so hell waren, und nicht schwarz die Wangen herabflossen; was denkt ein Kind nicht alles! denn ich hörte wieder die Worte meiner Mutter: »Und nun haben die armen Würmer niemand mehr!« Es duldete mich nimmer in meinem Herdwinkelchen; ich schlüpfte hervor, trat zu Kätherle, faßte sie bei der Hand und nun stand die Mutter neben uns. Da brach das arme Kind in ein lautes Schluchzen aus, denn unser Mitleiden drang in ihr Herz und löste den Tränenquell. Die Mutter nahm ein Tüchlein, wischte die Zähren ab und sprach: »Kätherle, komm Du nur alle Tage zu uns; Tony, Sophie und die Bill dort werden gewiß gerne täglich weniger essen, damit es für Euch, arme Würmer, auch noch reicht.« Da schluchzte ich mit Kätherle, Anton kam auch, und wir sagten beide: »Sei nicht so traurig, denn wir wollen Dich recht lieb haben, weil Du sonst niemand hast.«
Von diesem Abend an ging Kätherle bei uns aus und ein, als ob sie zum Hause gehöre. Wir hatten sie lieb, sie war so sanft, so nachgiebig, so untertänig, unsere kleine Magd. Gewiß wollten wir ihr keinen Schimpfnamen geben; dennoch hieß sie nicht anders, als »der Wurm«; – die Mutter hatte ihr den Namen in jener traurigen Stunde unbewußt aufgebracht, und jetzt noch, wenn ich an sie denke, muß ich mich fast auf ihren rechten Namen besinnen. Ich will sie aber in dieser Geschichte doch Kätherle heißen.
Kätherle war also unsere kleine Magd und Spielgefährtin. Beides machte sich von selbst. Die Mutter hatte ihr nicht befohlen, uns zu bedienen, im Gegenteile, wenn sie es sah, schalt sie ein wenig; aber das arme Mädchen war so dankbar, so gutherzig und so geschäftig; sie tat uns alles zu lieb, was sie uns nur an den Augen absehen konnte. Wir waren auch ein klein wenig jünger als sie; zu Hause aber hatte sie stets für die Kleinern gesorgt, und da diese sie nicht mehr brauchten, denn sie waren im Waisenhause untergebracht worden, trug sie diese Sorge auf uns über. Auf dem Lande hat man die Kinder nicht immer so im Auge, wie in der Stadt. Der Hof, der Garten, das nahe Feld, – dies sind gar weite Spiel- und Tummelplätze. Unserer Mutter war es also gerade recht, daß wir an Kätherle eine Gefährtin besaßen, welche doch ein wenig auf uns acht gab. – So lebten wir recht vergnügt und meistens auch recht friedlich miteinander.
Es ist Hochsommer, eigentlich Herbst geworden; die Sonne scheint nur gerade gar zu warm und lieblich, als daß man an den Herbst denken könnte. Das Korn ist geschnitten, im Stadel geht es lebhaft zu, denn man möchte das neue Getreide versuchen. Tick, tack, tack! – tick, tack, tack! tönt es von früh morgens bis spät abends; der Hahn schreit nochmal so laut sein: kikriki! um die Hennen zum Körner-Frühstück zu wecken; die Bäume im Garten biegen sich unter ihrer Last, und plumps! plumps! fällt manches Äpfelein besonders zur Nachtzeit in das Gras. Ich habe das oft mitten im Schlafe gehört, oder vielmehr nur davon geträumt; gewiß ist, daß ich nach dem Erwachen zuerst an die herabgefallenen Äpfel dachte und begierig war, sobald als möglich in den Garten zu kommen. Dann richtete ich mich auf und lauschte auf den Wind; die Mutter aber rief mir verweisend zu: »Braune Bill! braune Bill! Weißt Du denn nicht, daß man zuerst an den lieben Gott denken muß? Es scheint mir aber, es stecken Dir schon wieder die Äpfel im Kopfe!« – Dann rief ich: »Aber Mutter! gewiß ist Anton schon im Garten und hebt sie auf; er hat auf seinem Strohsacke eine so große »Mauket«, ich aber habe nur sechs elende Äpfel.
Dann sah ich die Mutter lächeln, obgleich sie entgegnete: »Ich will Euch die Dummheit noch vertreiben. Was tut Ihr doch mit den sauern, halbreifen Äpfeln, die Ihr nicht essen könnt! Die Sonne, und nicht der Strohsack, ist da, um sie zu reifen. Wenn es nur lieber gar keine gebe! Aber ich will es dem Vater schon sagen; er soll nur den Garten verpachten, wie er schon lange im Sinn hat; dann ist es mit dem albernen Spaß bald zu Ende.«
Endlich waren die Äpfel reif und der Herbst schüttelte uns dieselben in großer Menge in den Schoß.
Wir sind nun ein halbes Jahr älter geworden. Die lustige Martinsnacht mit ihren Küchlein, ihrem Gänsebraten und den heitern Spielen, der vermummte Nikolaus mit der Rute und dem Nußsacke, und endlich das Weihnachtsfest – haben andere Freuden gebracht. Die Schneeballen und das Schlittenfahren, die glatte Schleife auf dem Dorfbache, wo es immer so laut und lustig zuging, waren nun an der Reihe. Endlich aber kam wieder der Frühling; die goldne Sonnenkugel durchlöcherte die Eismauer des Baches, daß er lustig rauschte; die Lerche trillerte ihren Jubelgesang, die Vögel flogen von Baum zu Baum, von Busch zu Busch, von Wiese zu Wiese mit ihrer Frühlingsbotschaft; die ganze Natur freute sich mit ihr und selbst der alte Schleedorn und der verkrüppelte Weidenbaum fingen an zu blühen und zu sprossen. Nun aber stiegen auch aus unsern Kinderherzen die Frühlingshoffnungen, das heißt: die Sehnsucht nach Kirschen, Birnen und Äpfeln.
Jetzt geschah das Traurige: der Vater verpachtete den ganzen Garten, und eines Tages ließ er uns zu sich kommen, befahl uns, ihm in die Augen zu schauen und sprach: »Kinder, der Garten ist verpachtet. Von nun an gehört uns darin gar nichts mehr: keine Blume, keine Kirsche, keine Birne und kein Apfel; ja, wir haben darin nichts mehr zu tun. Merkt Euch das wohl! Alles, was Ihr daselbst nehmt, ist ein gestohlenes Gut. Der Gärtner Xaver hat das Recht Euch hinauszujagen, und ich verbiete Euch hiermit ernstlich, ohne seine Erlaubnis hinein zu gehen oder gar etwas zu nehmen.«
So sprach unser Vater. Wir hatten ihm mit tiefer Scheu zugehört, denn er redete selten so ernst, sondern hatte meist einen heitern Spaß für uns in Bereitschaft. – Wir waren aber doch recht ärgerlich und gingen in unzufriedenem Schweigen von dannen.
Solange der Frühling dauerte, wußten wir uns zu trösten und als der Wald die Erdbeeren spendete, lachten wir den Gärtner aus, der seinen Garten hütete.
Wieder war es Sommer geworden; aus den Blüten hatten sich allerliebste Äpfelchen gebildet; von Woche zu Woche wurden diese größer; die heiße Sonne färbte nicht nur unsere Wangen, sondern hauchte auch die Äpfel mit einem Rosenschimmer an und besonders das Bäumchen mit den Paradiesäpfeln und die Erdbeeräpfel, die eigentlich mir gehörten, denn sie waren immer zu meinem Namenstag reif geworden, und der Tafetapfelbaum, – sie alle winkten uns so verführerisch, wie einst jener im Paradies gelockt haben mochte; der Gärtner aber drohte immer finsterer, und gerade dieses böse Gesicht war für uns die Schlange, welche die schlimme Begierde reizte.
So stand es mit uns. Die Zeit, wo die Äpfel reifen, war gekommen. Auf dem Dorfe ist es herkömmlich, daß die Kinder die großgewordenen, herabgefallenen sammeln, auf den Strohsack legen und sie dort liegen lassen, bis sie reif und genießbar geworden sind. Das nennen sie im Schwabenlande »Mauket«. – Ob diese nun groß oder klein sei – ist eine äußerst wichtige Frage. Mancher Reiche hütet sein Geld nicht sorglicher, als die Dorfjugend ihre Mauket, und die Größe derselben ist von hoher Wichtigkeit. Zu dieser Zeit drehen sich die meisten Gespräche um jene Angelegenheit. Nun denke man sich unsere Lage. Unser Vater genoß im Orte hohes Ansehen, wir waren am besten gekleidet, saßen die Ersten in der Schulbank, – und wir allein hatten kein einziges Äpfelchen auf dem Strohsack liegen. So oft das Gespräch darauf kam, schlichen wir uns auf die Seite. Damals waren unsere Herzen nicht weniger als unschuldig; wir fühlten uns gedemütigt, der Stolz regte sich gegen die Bauernkinder, wir zürnten über den Vater, wir grollten über den Gärtner, und endlich mischte sich in unsere Räuberspiele der ernstliche Gedanke, Äpfel zu erbeuten.
Es war ein trüber Tag; während der Nacht hatte es stark geregnet und der Wind war sausend durch die Bäume gezogen. Wer sich in der Stube beschäftigen konnte, den gelüstete es nicht nach dem Freien. Das Schuljahr war bereits zu Ende, wir glaubten durch unsere Preise ein Recht auf das Nichtstun errungen zu haben. So sehr wir uns auf die Vakanz gefreut hatten, so langweilig wurde sie uns, besonders an einem Regentage wie der heutige. Sonst war der Mittag und Abend dagewesen, ehe man sich's versah, jetzt wollte es gar nicht zwölf Uhr werden. O du liebe, goldne Arbeit, wie viel Vergnügen bringst du nicht, ohne daß man es weiß! O du garstiger Müßiggang, wie viel Langweile und wie viel Schlingeleien brütest du aus!
So ging es auch Anton und mir, denn unser kleineres Schwesterchen tat etwas, sie spielte mit ihrer Puppe. Als wir beide uns in Ermangelung aller Unterhaltung gestritten und wieder versöhnt hatten, dachten wir an Kätherle, und beschlossen, diese aufzusuchen. Dieselbe war nämlich seit einiger Zeit zu allerlei Hausarbeiten angehalten worden, und wir hatten selten mehr Gelegenheit, mit ihr zu spielen. Heute befand sie sich in der Holzlege und schichtete kleines Holz und Späne auf. Es war überhaupt so ein Tag, wie sie in einer Haushaltung oft vorkommen, wo jedes in einem anderen Teile des Hauses beschäftigt und die Mutter auch überall und nirgends ist, sonst hätte sie mich zum Strickstrumpfe und Anton zu seinem Malkasten getrieben.
Wir gingen also miteinander in die Holzlege, welche sich in einem Nebengebäude, ganz in der Nähe des Gartens, befand. Dort angekommen, setzte sich mein Bruder auf einen Holzblock, ich half Kätherle bei der Arbeit und dazwischenhinein neckten wir uns und trieben allerlei Kinderpossen. Auf einmal war Tony nicht mehr zu sehen. Ich war ein höchst neugieriges Ding; es nahm mich Wunder, was er wohl treibe, und also schlüpfte ich auch hinaus, und ihm nach.
Bald hatte ich ihn entdeckt. Lauernd stand er hinter den Brettern, welche an der Gartenmauer, dicht am Seitenpförtchen lehnten und gleichsam eine Hütte bildeten. Ich ging zu ihm. Schon von weitem gab er mir ein Zeichen, flüsterte ein leises: »bst, bst!« und als wir miteinander im Verstecke waren, raunte er mir in's Ohr:
»Gerade ist der Xaver geholt worden und eilig fortgegangen; schau, er hat das Pförtchen offen gelassen, und dort am Eingange steht unser Erdbeeräpfel- Bäumchen. Wenn ich nur wüßte, ob er ausbleibt oder gleich wieder kommt!«
Ich war ein keckes Mädchen und also gleich bereit, etwas zu wagen. Darum sagte ich:
»Und was ist's auch, wenn er wiederkommt! Komm, wir gehen hinein. Die Bäume anzuschauen, das wird doch nichts so Arges sein!«
Husch! waren wir im Garten, und sieh nur, die Äpfel lagen dicht gestreut auf dem Boden, sei es, daß der Wind sie herabgeworfen, oder Xaver sie geschüttelt hatte. Doch in diesem Augenblicke hörten wir den Gärtner in der Ferne husten; wir eilten unentdeckt in unser Versteck und überschauten nun lauernd die Szene. O, wie unser Herz pochte! Es war ein böses Klopfen, das alle Mahnungen des Gewissens übertönte. Da kam Xaver daher, ging zum Baume, murmelte allerlei vor sich hin, bückte sich und trug die Äpfel auf ein Häuflein. Das mochte fast eine Viertelstunde gedauert haben, als er mit sich selber sprach: »So, nun will ich einen Korb holen! Wo nur der kleine Jörgl steckt, der könnte mir auch den Weg ersparen.«
Wir schauten uns frohlockend an. Die Hütte, wo die Gartengerätschaften lagen, war nämlich ganz am Ende des Gartens; wir kannten den Xaver wohl, der auf seiner Wanderung allerlei zu tun oder auszujäten fand. Das böse Vorhaben gibt ein rasches Einverständnis. In einem Augenblicke waren wir aus unserm Verstecke und standen in der Holzlege bei Kätherle. Mit leuchtenden Augen, mit glühenden Wangen und mit vor Hast bebenden Lippen sprachen wir zu ihr:
»Schnell, schnell komm mit uns; Du hast eine Schürze um; dort liegen eine Menge Äpfel aufgeschichtet, komm, komm!« –
Erschrocken schaute uns das brave Kätherle an; sie stammelte nur: »Nein, nein, – das ist ja verboten!«
»Was, verboten!« rief ich ärgerlich; – »was liegt denn an einigen Äpfeln!«
Tony machte wenig Umstände. Zornig riß er Kätherle fort, die sich immer sträubte und gar nicht zu Wort kommen konnte. Sie stand mit uns im Garten, ich hielt ihre Schürze auseinander, Tony warf eilig ein paar Dutzend Äpfel hinein, und noch immer stand das arme Kind da und regte sich nicht. Plötzlich hörten wir den uns so wohlbekannten Tritt des Gärtners.
»Nimm, nimm, und eil' Dich!« rief ich, indem ich Kätherle die Zipfel der Schürze in die Hände schob. Tony sprang mit mir hinaus und wir hatten gerade nur noch Zeit, in unser Bretterversteck zu schlüpfen. Kätherle aber stand auf ihrem Platze mit zusammengehaltener Schürze, als Xaver dort anlangte.
Wir sahen alles. Und nun pochte unser Herz nicht mehr freudig, sondern in namenloser Angst. »Alles ist verraten, alles ist verraten!« – so klopfte es. – Mit flehendem Blicke, uns nicht anzugeben, schauten wir auf das unschuldige Mädchen; sie aber sah uns nicht. Fast hätten wir kleinen Sünder in dieser Not zum Schutzengel gebetet, uns durchzuhelfen; aber wir fühlten doch, daß dies ein frevelhaftes Gebet wäre. Wir sahen uns fast die Augen aus dem Kopfe, wir horchten. – Plötzlich drang ein Schrei in unsere Ohren – Kätherle hatte die Zipfel losgelassen, die Äpfel rollten in's Gras, das arme Mädchen lag auf den Knieen, des Gärtners Augen flammten in Zorn – und – wie ein Rachegeist, stand unser Vater dabei.
Warum, warum sind wir nicht hervorgestürzt, um ein offenes Bekenntnis abzulegen! Aber von Furcht und Schrecken gebannt, blieben wir in unserm Versteck. »Es bleibt uns doch nicht aus!« dachten wir; – »Kätherle ist ja unschuldig, – sie wird uns angeben.«
Endlich ward es stille; der Vater führte Kätherle fort und der Gärtner hob leise brummend die Äpfel auf, legte sie in den Korb und sagte: »Habe ich euch doch noch vor dem Dieb gerettet! Morgen ist der braunen Bill ihr Namenstag und da soll sie euch doch also bekommen!« –
Ich hörte diese Worte. »Ja, morgen ist der einunddreißigste August.« Es war mir, als müsse mein Herz vor Schamesglut verbrennen! Der gute Xaver hatte die Äpfel zu meinem Namenstage bestimmt, und ich wollte sie ihm stehlen, ich wollte den Mann, der in Güte und Liebe meiner dachte, kränken! So böse war ich nicht, daß mich dies ungerührt ließ. Ich barg mich in meinem Versteck zusammen und weinte und schluchzte und wollte mich von Tony gar nicht trösten lassen. Derselbe war ebenso gerührt, versteckte es aber nach Knabenweise unter übellaunige Worte und zog mich endlich mit Gewalt fort. Die Luft kam uns ganz schwül vor. Wir begegneten keinem Menschen, hörten keinen Laut und gelangten unangefochten in die Kinderstube, wo Sophie noch heiter mit ihrer Puppe spielte.
Es war Mittag geworden; die Tischglocke ertönte und die Mutter öffnete die Tür, um uns zum Essen zu holen. Kätherle hatte bisher mit uns am Tische gegessen und zuvor mit uns gemeinsam gebetet. Heute fehlte sie. Wir wagten nicht, nach ihr zu fragen. Wohl noch nie mag beim Gebete unsere Stimme so furchtsam leise geklungen haben. Wir glaubten gar nichts anders, als die Stille bedeute ein schweres Gewitter, das mit jedem Augenblicke ausbrechen müsse. Doch der Mittag verstrich und kein Wort wurde gesprochen. Die Mutter hatte die Suppe nicht weggetragen, sondern auf ein Seitentischlein stellen lassen. Als das Essen zu Ende war, füllte sie einen Teller damit, schnitt ein Stück Brot ab, blickte meinen Vater flehend an und wollte der Nanny eben einen stillen Auftrag geben, als der Vater rasch aufstand und dazwischen rief: »Nein, und abermals nein, das Mädchen soll keinen Bissen mehr von uns bekommen! Haben wir sie so lange in unserm Hause behalten, um eine Diebin zu erziehen und unsern Kindern ein schlechtes Beispiel zu geben?«
Diese Worte waren der Donnerschlag, welcher an unsere schuldigen Herzen schallte. Kätherle hatte uns also nicht verraten! Sie hatte für uns geduldet, geweint, gelitten! Sie war für uns verjagt worden! Dort, auf dem Erdsteine saß sie weinend, das Gesicht in ihrer Schürze bergend, alles, alles für uns! – Ein einziges Wort aus ihrem Munde, und sie wäre gerechtfertigt und wir entlarvt gewesen. Aber sie duldete und sprach dies eine Wort nicht.
Dieser Augenblick hatte uns die Sache klar gemacht. Nein, nein! so böse waren wir nicht, daß wir uns auch nur eine Sekunde besannen. Beide stürzten wir zu den Füßen des Vaters, erhoben die Hände zu seinem zürnenden Angesichte, Tränen strömten aus unsern Augen, erstickten unsere Stimme und ließen nur die Worte hervorbrechen: »Vater, Vater, o verzeih! Nicht Kätherle hat es getan! Wir haben sie gezwungen!« –
Vater und Mutter erschraken heftig. Zorn und Rührung wechselten in ihren Mienen; die Mutter aber eilte hinaus, die Stiege hinab, zum Gesteine und zog das arme Mädchen herauf in's Zimmer. Und nun stand die kleine Dulderin in unserer Mitte, wir bekannten alles haarklein; die Mutter weinte; der weichherzige, gute Vater wendete sich zur Seite, wischte das umwölkte, himmelblaue Auge, dann brach aus diesem unserm Kinderhimmel die Vergebung und er küßte uns inbrünstig und der liebe Vater küßte auch unser armes, kleines Kätherle.
Laßt mich diese Geschichte enden, meine Freunde; die Erinnerung hat mich tief gerührt. Ich mag Euch keine Lehre sagen, zieht sie selbst daraus. – Es war ein schöner Namenstag, den ich darauf feierte, schön durch die Liebe, welche uns mit dem armen, verwaisten Mädchen verband, das nur aus kindlicher Dankbarkeit, dies fühlten wir sehr wohl, uns nicht verraten, sondern unschuldig geduldet hatte. Sie bekam von uns den größern Teil der Äpfel, die mir der Gärtner Xaver wirklich zum Namensfeste brachte, und auch dieser hatte von nun an gewiß nicht mehr Ursache, über uns zu klagen.
Die Leberspätzlein
Der Frühling hatte wieder die Erde holdselig angelächelt. Überall, in Garten, Wiese, Feld und Wald sproßte und blühte es, die Vögel sangen durcheinander und die ganze, weiche Luft glänzte vom Sonnenschein. Nur die Stuben behielten noch ein Frösteln, darum eilte jeder gerne hinaus in die Frühlingslandschaft.
An einem solch' schönen Tage saß ich ganz allein im Turmzimmer auf einem niederen Schemel und blickte verdrossen in mein Buch. Es war der »Weihnachtsabend« von Christioph Schmid, den ich bereits fünfmal gelesen hatte, weil die Hauptperson darin Anton heißt und ein Maler wird. Ich aber verwechselte ihn fast mit meinem Bruder Anton, der auch Maler werden wollte.
Ja, ich liebte meinen Tony über alles. Er beherrschte mich nach seiner Laune, sein Umgang war mein höchster Wunsch, seine Liebe mein Ehrgeiz und sogar ein Scheltwort von ihm war mir lieber, als wenn er mich, was nur zu häufig geschah, gar nicht beachtete.
Obwohl ich ein echtes Kind der Sonne war und diese ihr braunes Abzeichen unvertilgbar in meinem Antlitze abgedrückt hatte, saß ich also heute freiwillig in der Stube und zwar mit verdrießlichem Herzen, weil mein Bruder seit einigen Tagen mich beharrlich von seinem Umgange ausschloß.
Plötzlich fuhr ich aus meinem Lesen auf, denn Anton stürmte mit glühenden Wangen herein, warf die Mütze auf den Stuhl, stellte sich vor mich hin und sagte fast atemlos:
»Weißt Du schon, daß der Blumenthaler Verwalter Prestele in dem neuen Haus mit den Bogenfenstern zwei Buben meines Alters hat und daß sie nun auch hier sind?«
Ich blickte kaum von meinem Buche auf und murmelte: »Meinetwegen.« – Er rief entrüstet über meine Gleichgültigkeit: »Deinetwegen freilich nicht, aber meinetwegen!«
Ich sah ihn fragend an. Er richtete sich stolz empor, deutete mit dem Zeigefinger auf die Brust und sagte: »Ja, meinetwegen! Wen habe ich zum Umgange? Oberamtmanns Rudolf ist beinahe noch ein Kind, mit den andern, kurzhosigen Bauernbuben soll ich nicht spielen, Müllers Bernhard aber langweilt mich und Sternwirts Michel macht lauter dummes Zeug! Sag, mit wem soll ich spielen?« – Gerne hätte ich geschrien: »Mit mir!« aber ich schwieg beleidigt. Da näherte er sich mir schmeichelnd und sagte: »Wenn die beiden ordentliche Buben wären, das gäb' einen Hauptspaß, nicht wahr, braune Bill? – Vier Gespielen, o, da könnte man etwas Rechtes anfangen!«
Vier! Der kleine Schlingel hatte mich gefangen. Ich stellte mich, als verstünde ich ihn nicht, und sagte: »Was geht das mich an? – Es sind ja keine Mädchen.«
Nun sprudelte des Knaben Unwillen über und er rief: »Was Du doch für ein halsstarriges Ding bist! – Ja, wenn man Dich nicht brauchen kann, hängst Du Dich einem an die Ferse, und wo Du nützlich wärest, magst Du mir keinen Gefallen tun.«
Das Wort: »wo Du nützlich wärest« – hatte einen hellen Freudenschein in mir erweckt. Ich war sogleich an Tony's Seite und sagte: »Was soll ich tun?« – Er entgegnete: »Auskundschaften, wie die zwei Buben aussehen.«
»Warum tust Du es nicht selbst?« fragte ich verwundert.
Mein Bruder seufzte fast vor Ungeduld und erwiderte: »O, braune Bill, Du hast heute keinen Verstand! Wer wird Dir's übel auslegen, wenn Du neugierig bist? Alle Mädchen sind neugierig. Aber für mich schickt sich das nicht.«
»Wie soll ich das anstellen? Ich kann ihnen doch nicht nachlaufen!«
»Aber Du kannst klettern, so gut wie ich. Steig auf den Baum an der Mauer. Dort bist Du versteckt und siehst doch alles genau.«
Wir waren bei diesem Gespräche bereits nicht mehr im Turmzimmer, sondern befanden uns im Freien. Ein großer Eifer, meinem Bruder zu dienen und mir den vierten Platz im glücklichen Kleeblatt zu erwerben, trieb mich über das Gebälke zu den Bäumen. Bald saß ich zwischen den dürftig belaubten Zweigen und schaute auf die Gasse jenseits der Mauer.
»Siehst Du etwas?« – flüsterte von unten herauf mein Bruder. – Ich schüttelte den Kopf. »O, dann sind sie schon fort; vor einer Viertelstunde trieben sie sich auf der Gasse herum.«
Ich sah von neuem nach rechts und links und entdeckte die fremden Knaben. Sogleich rief ich: »Da ist einer! - Dort ist der andere! – Ein Dicker und ein Magerer! O, sie haben mich gesehen!«
Ich fühlte eine große Beschämung und kletterte eilig vom Baum herab. Aber ich blieb mit dem Kleide hängen, ich hörte den Riß und lag auch schon am Boden. Mein Bruder sprang erschrocken herbei; als er mich jedoch unverletzt fand, hatte er Lust, mich auszuschelten und sagte verdrießlich: »Jetzt wissen wir soviel wie nichts!« – Ich aber entgegnete: »Nein, nein, ich habe sie deutlich gesehen. Beide sind so groß wie Du und denke nur, sie haben schwarze Lederhosen an.«
Mein Bruder seufzte: »O weh! Lederhosen! Also wieder Bauernbuben!«
»Es sind aber keine kurzen Lederhosen, sondern lange, wie die Deinigen aus Tuch«, – entgegnete ich beschwichtigend.
Nun faßten wir uns bei den Händen und schlichen zum offenstehenden Tore in der Mauer. Dann postierten wir uns auf beiden Seiten, den Körper an die Wand gedrückt, mit dem Kopfe ausspähend. Wir stießen aber gleichzeitig einen Schrei aus, denn wir hatten mit unsern Köpfen zwei Knabenköpfe berührt. Ein schallendes Kindergelächter erfolgte; dann standen sich zwei Paare gegenüber.
Dies war unsere erste, denkwürdige Begegnung mit »Presteles Buben«, wie sie von diesem Augenblick genannt wurden. Keines hatte sich nun vor dem anderen zu schämen, da jedes in der gleichen Falle gefangen worden war. Mein Bruder gab sich als »Schloßtony« ein gravitätisches Ansehen, steckte beide Hände in die Hosentaschen und sagte: »Ich bin der Anton und das ist meine Schwester, die braune Bill. Wie heißt Ihr?«
Der Dicke entgegnete: »Ich bin der Louis und das ist der Ernst.«
Die Vorstellung war geschehen und wir befanden uns im besten Zuge, eine dicke Freundschaft zu schließen, als ich mich von rückwärts gepackt fühlte. Meine Mutter stand zürnend hinter mir. Sie hatte vom Fenster aus meinen Fall gesehen und war erschrocken in den Hof geeilt. Das erste, was sie erblickte, war mein zerrissenes Kleid. Sie hielt es einen halben Meter weit von mir weg und sagte: »Was ist das wieder, Bill?! –«
Ich wurde über und über rot, schlug die Augen nieder und blinzelte verstohlen nach den fremden Knaben. Da sah ich, wie Louis schalkhaft lächelte und Ernst mit traurigem Mitgefühl auf mich blickte. Dieses entschied für meine Vorliebe.
Die Mutter führte mich hinweg und brachte mich in's Turmzimmer, entkleidete mich und sagte vorwurfsvoll: »Wie unzählige male habe ich Dir schon gesagt, Du sollest von den Bubenstreichen lassen! – Ein Mädchen auf den Baum klettern! Schickt sich das wohl? – Warum spielst Du nicht mit Deinem Schwesterchen und der Puppe? – Warum gehst Du nicht zu Müllers Lore, wo Du nur Gutes lernen kannst? – Da ist Dein Strickzeug! Nicht aufgestanden bis zum Abendessen!«
So sprach die gute Mutter. Es war kein Wunder, daß sie ärgerlich wurde. Seit drei Tagen hatte ich drei Kleider übel zugerichtet und für morgen war die taube Näher-Katharine bestellt, um ganz allein für mich zu arbeiten.
Mehrere Stunden saß ich im Turmzimmer und wartete auf Anton; er kam nicht. Endlich holte mich unsere Nanny zum Abendessen. Sie waren alle bereits am Tische versammelt. Mein Bruder erzählte von »Presteles Buben«, welch herrliche Kameraden das seien. Er bat die Mutter, sie gleich morgen zum Samstagspaziergange nach Eberstall einzuladen. – Von mir und meiner Gesellschaft war keine Rede und auch heimlich flüsterte er mir weder Bedauern noch Trost zu.
Das schmerzte mich tief und in der Nacht weinte ich leise, warf mich von einer Seite zur andern, bis ich endlich einschlief.
###
Es war kein fröhliches Erwachen am Samstagmorgen. Mein erster Gedanke mahnte mich an ein immer wiederkehrendes Leiden, das dieser Tag mir brachte.
Es gab nämlich beim Mittagessen regelmäßig des Vaters Leibspeise – Leberspätzlein in der Suppe. Mich überkam ein Grausen und ein Schütteln, sobald ich auch nur den Namen davon hörte oder die braunrote Leber auf dem Wiegbrettt liegen sah.
Unser Vater war die Güte selbst, immer voll Scherz und Heiterkeit für seine Kinder, immer zur Nachsicht bereit, immer unser erster Anwalt bei der Mutter. Aber in einem Punkte war er unerbittlich: er bestand darauf, daß wir alles essen sollten, was uns vorgesetzt wurde. Man kann sich leicht vorstellen, daß meine Weigerung, Leberspätzlein zu essen, ihn ärgerte, um so mehr, als ich sie noch niemals versucht hatte, somit kein gültiges Urteil abgeben konnte. Nach mancher sanften Überredung war endlich seine Geduld erschöpft, er drehte die Serviette zu einem Knoten, gab mir einen tüchtigen Denkzettel und gelobte, ihn jeden Samstag zu wiederholen, bis mein Eigensinn überwunden sein und ich die Leberspätzlein wenigstens versuchen würde.
Der Vater kam heute wohl um eine halbe Stunde früher aus der Kanzlei in's Wohnzimmer und sah die Näher-Katharine bei meinen zerrissenen Kleidern. Da erzählte ihm die Mutter, wie ich zu dem letzten Riß gekommen war und schloß mit den Worten:
»Was soll aus dem Mädchen werden? Wir müssen sie am Ende doch aus dem Hause tun, damit sie in einem Institute sich an den Umgang mit ihresgleichen gewöhnt und nicht bei den Buben verwildert.«
Ich stand in einiger Entfernung und horchte. Obgleich die Eltern flüsternd sprachen, entging mir kein Wort, keine Miene. Der Vater lächelte gutmütig und meinte, es werde sich mit der Zeit schon geben. Die Mutter widersprach dem und sagte mit erhöhter Stimme:
»Nein, nein, es gibt sich nicht von selbst! Sie hat keinen mädchenhaften Sinn, Papa. Sie mag nicht stricken und nicht nähen. Je toller, desto besser, heißt es bei ihr.«
Nun seufzte der Vater doch ein wenig und entgegnete: »O Mama, das macht mir keine Sorge. Aber der Eigensinn, o, der Eigensinn, das ist schlimmer. Zum Beispiel nur die allwöchentliche Geschichte mit den Leberspätzlein! – Ist das nicht furchtbarer Eigensinn? Keine Leberspätzlein essen können! Das ist mir etwas Neues. – Weißt Du jemand, der sie nicht essen kann? - Ich weiß niemand! Es ist etwas so Gutes, Aromatisches! Nein, es ist purer Eigensinn und dieser muß gebrochen werden!«
Der Vater hatte sich in Aufregung versetzt, mir zitterte das Herz im Leibe und ich zählte an unserer Uhr die Minuten ab bis zur Tischzeit. Ich nahm mir fest vor, heute die Leberspätzlein zu versuchen.
Nun wurde die Suppenschüssel aufgetragen. Anton sprach das Tischgebet und ich flehte innerlich: »Lieber Gott, steh mir bei, damit ich die Leberspätzlein hinunter bringe.« Mein Gebet geschah jedoch nicht im rechten Geiste. Ich wollte die Speise nicht essen, um den Vater zu befriedigen; ich wollte mich nur vor der weiter drohenden Strafe sichern, vom Samstagspaziergange mit Anton und Presteles Buben ausgeschlossen zu werden.
Der Vater saß an seinem Platze, die Suppe war vorgelegt, er rief mich liebevoll zu sich. Seine klaren, großen, blauen Augen, von den schwarzen Brauen und Wimpern umrandet, blickten mir bis in die Seele hinein. Er faßte sechs kleine Spätzlein in den Löffel, hielt ihn mir hin und sagte: »Nun, braune Bill, tu Dein Meisterstück.«





























