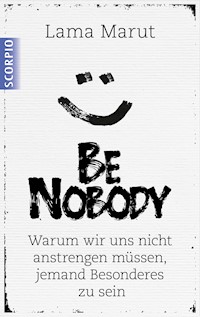
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kraftvolle Medizin: Lama Maruts Gegenmittel für die Leiden unserer wilden modernen Zeit Ist es Zufall, dass Depressionen und Narzissmus zeitgleich mit der Dominanz der sozialen Medien und einer von Stars und Sternchen geprägten Kultur immer stärker werden? Die Gier danach, jemand zu sein, hat dramatische Auswirkungen. Erfrischend radikal zeigt Lama Marut, dass unser Bestreben, uns von anderen zu unterscheiden, die wahre Ursache unserer Unzufriedenheit ist und das Gefühl weckt, isoliert und allein zu sein. Dass wir unser wahres Potenzial nur erschließen können, indem wir uns von unserer Ichzentriertheit lösen, ist eine altbekannte spirituelle Wahrheit. Be Nobody füllt sie mit konkreten Anregungen für unsere Zeit: einfache Meditationen und sofort umsetzbare Alltagsideen, die nachhaltige Veränderungen auslösen. Ein ethisches Leben zu führen ein Leben in Selbstlosigkeit statt in ungebremstem Egoismus ist der Schlüssel zu echtem Glück und der Boden, auf dem eine andere Welt entstehen kann. Ist es Zufall, dass Depressionen und Narzissmus zeitgleich mit der Dominanz der sozialen Medien und einer von Stars und Sternchen geprägten Kultur immer stärker werden? Die Gier danach, jemand zu sein, hat dramatische Auswirkungen. Erfrischend radikal zeigt Lama Marut, dass unser Bestreben, uns von anderen zu unterscheiden, die wahre Ursache unserer Unzufriedenheit ist und das Gefühl weckt, isoliert und allein zu sein. Dass wir unser wahres Potenzial nur erschließen können, indem wir uns von unserer Ichzentriertheit lösen, ist eine altbekannte spirituelle Wahrheit. Be Nobody füllt sie mit konkreten Anregungen für unsere Zeit: einfache Meditationen und sofort umsetzbare Alltagsideen, die nachhaltige Veränderungen auslösen. Ein ethisches Leben zu führen ein Leben in Selbstlosigkeit statt in ungebremstem Egoismus ist der Schlüssel zu echtem Glück und der Boden, auf dem eine andere Welt entstehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lama Marut
be Nobody
Warum wir uns nicht anstrengen müssen, jemand Besonderes zu sein
Aus dem amerikanischen Englisch von
Die amerikanische Originalausgabe ist 2014 unter dem Titel Be Nobody bei Atria Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York, NY erschienen. Dieses Buch enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte der Scorpio Verlag keinen Einfluss hat. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Haftung übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft, rechtswidrige Inhalte waren nicht erkennbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
1. eBook-Ausgabe 2015
© Copyright 2014 by Brian K. Smith Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2015 Scorpio Verlag GmbH & Co. KG, München Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich Satz: BuchHaus Robert Gigler, München ePub: 978-3-95803-014-5
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]
Sobald wir jemand sein wollen, sind wir nicht mehr frei. JIDDU KRISHNAMURTI
Dieses Buch ist Cindy Lee gewidmet, einer wahren Gefährtin, Partnerin, Muse und der besten Freundin, die man sich wünschen kann.
INHALT
Vorwort: Don’t give me that Old-Time Religion!
Einleitung: Leben im iZeitalter
Teil I:
Das verzweifelte Bemühen, jemand zu sein
1. Wir verleihen unser Gesicht einer Pappfigur
2. What goes up must come down: »Runter kommen sie alle!«
Teil II:
Wie aus einem Niemand ein besserer Jemand wird
3. Sich an Strohhalme klammern und Schatten nachjagen
4. Niemand macht einen besseren Jemand möglich
Teil III:
Das »Jemand-Sein« verlieren
5. Für andere niemand sein
6. Ein Leben im Flow
Teil IV:
Jeder ist ein Nobody
7. Ein Leben als Normalo
Danksagung
Anhang: In die eigene wahre Natur fallen
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
EINLEITUNG: LEBEN IM iZEITALTER
Demut bedeutet nicht, dass Sie sich geringer schätzen als andere Menschen, und auch nicht, dass Sie von Ihren Begabungen nicht viel halten dürfen. Es bedeutet, dass Sie ganz generell vom Denken über sich selbst frei sind. WILLIAM TEMPLE
Wir alle versuchen verzweifelt, jemand zu sein. Niemand will ein Verlierer, ein kleines Würstchen, ein Nichtskönner, eine Nullität sein. Alles deutet darauf hin, dass niemand nur ein Nobody sein möchte.
Wir existieren in großer Zahl, sind einander sehr ähnlich und bemühen uns mit allen verfügbaren Kräften um Einzigartigkeit. Dieses besessene Streben nach einer unverwechselbaren Identität treibt uns alle gleichermaßen an, denn wir alle glauben, wir würden Glück und Erfüllung erreichen, wenn wir uns von allen anderen unterscheiden, wenn wir jemand »Besonderes« wären. Unsere Kultur des allgegenwärtigen Konsums, des Materialismus und des Narzissmus sowie der Anbetung des Ruhms fördert den Glauben daran, dass wir nur glücklich sein können, wenn wir außergewöhnlich sind.
Aber vielleicht haben wir da etwas missverstanden – und zwar ziemlich gründlich missverstanden.
Vielleicht finden wir tiefstes, authentisches Glück nur dann, wenn es uns gelingt, uns von der schweren Bürde zu befreien, ein Jemand sein zu wollen, der Bürde unserer unablässigen Icherhöhung und unserer zwanghaften Ichbefangenheit. Vielleicht können wir nur in einem Zustand der Ichlosigkeit, des völligen Mangels an Ichbefangenheit, wirklich ein Niemand werden und uns so den Zugang zu etwas viel Größerem, viel Amorpherem und weniger Exklusivem erschließen.
Vielleicht müssen wir, um im Leben zu wahrer Erfüllung zu gelangen, uns leeren, statt uns weiter zu füllen.
Vom »Ich-Jahrzehnt« zum iZeitalter
Selbstsucht und Genusssucht begleiten uns Menschen seit langer Zeit. Seit Tausenden von Jahren warnen die heiligen Schriften der großen religiösen Traditionen der ganzen Welt vor den Gefahren übermäßiger Ichzentriertheit, und sie haben uns auch die wirksamsten Werkzeuge zur Überwindung dieser Tendenz an die Hand gegeben.
Doch wir haben zumindest in den sogenannten entwickelten Ländern in den letzten Jahrzehnten einen dramatischen Anstieg der allzu menschlichen und gesellschaftlich gebilligten Neigung zur Genusssucht erlebt. Wir sind heute stärker als jemals vorher mit dem »Ich« beschäftigt, sodass es kaum übertrieben ist, unsere heutige Realität als Zeitalter der Ichbesessenheit zu bezeichnen. Die exzessive Beschäftigung mit uns selbst, die mittlerweile praktisch unser gesamtes Leben charakterisiert, ist ein Beispiel – und vielleicht sogar das markanteste Beispiel – für ein echtes »Erste-Welt-Problem«.
Vor über fünfunddreißig Jahren hat der Journalist Tom Wolfe die Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts als das »Ich-Jahrzehnt« bezeichnet.1 Die sozialen und politischen Sorgen und Turbulenzen der Sechziger waren einer Kultur individueller Ichzentriertheit gewichen. Und im Jahre 1979 – am Ende dieses Jahrzehnts der Ichbesessenheit – veröffentlichte Christopher Lasch sein Buch Das Zeitalter des Narzissmus, eine vernichtende Kritik der »Kultur des vom Konkurrenzdenken geprägten Individualismus, die in ihrem Niedergang die Logik des Individualismus ins Extrem eines Krieges aller gegen alle getrieben und das Streben nach Glück in die Sackgasse einer narzisstischen Selbstbeschäftigung abgedrängt hat«. Laschs Buch ist nach wie vor eines der besten Porträts der Welt, in der wir auch heute noch leben.2
Nach Laschs Auffassung produziert jede Zeit ihre typische Persönlichkeitsstruktur, die den charakteristischen Mustern der betreffenden Gesellschaft entspricht. »Jede Gesellschaft reproduziert ihre Kultur – ihre Normen, ihre Grundvoraussetzungen, ihre Art und Weise des Ordnens und Wertens von Erfahrungen – im Individuum, im Medium der Persönlichkeit.«3 Die für unsere Zeit und Kultur maßgebende Persönlichkeit bezeichnet Lasch als »narzisstisch«:
Der Narzissmus scheint plötzlich die beste Art und Weise zu sein, sich den Spannungen und Ängsten des modernen Lebens gewachsen zu zeigen, und die herrschenden gesellschaftlichen Umstände bringen deshalb die narzisstischen Charaktereigenschaften deutlich zum Vorschein, die in unterschiedlichem Grade bei jedem Einzelnen anzutreffen sind.4
Diese Charakterzüge stehen alle in Zusammenhang mit der allumfassenden Fixierung auf die eigene Person:
Unersättliche Gier, Extravaganz, Anspruchshaltung und das Beharren auf sofortiger Wunscherfüllung, die typisch sind für eine ungezügelte Konsumsucht
Das Ende der Arbeitsethik und ihre Transformation in eine Ethik der Muße und des Hedonismus*
Die kurzsichtige Ausbeutung persönlicher und gesellschaftlicher Ressourcen, ohne Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf nachfolgende Generationen
Die vollständige Abhängigkeit von der Bestätigung anderer hinsichtlich des Selbstwertgefühls
Kultartige Verehrung von Stars und Faszination vom glamourösen »Leben der Reichen und Berühmten«
Die »Kultur des Spektakels« und der Unterhaltung, die heute so gut wie alle Menschen infiziert hat, im Bereich der Politik ebenso wie in dem des Sports und sogar dem der Religion
Diese Trends zeichneten sich schon Ende der 1970er-Jahre ab, doch seither sind sie noch stärker geworden und haben sich weiter ausgebreitet. Die Kultur des Narzissmus hat sich verwandelt und in verschiedenster Hinsicht weiterentwickelt.5 Sie hat mittlerweile jeden Aspekt der populären Kultur durchtränkt und sich auch in vielen anderen Bereichen manifestiert.
In Fernsehshows wie auch in YouTube-Videos wird das plötzliche Berühmtwerden gewöhnlicher Menschen zelebriert. Beispiele hierzulande sind Germany’s Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar und das gesamte Spektrum sogenannter Reality-Shows im Fernsehen sowie »virale« YouTube-Videos, die vorher völlig unbekannten Talenten zu plötzlichem Starstatus verhelfen (ein Beispiel hierfür ist Justin Bieber).6 Wir bewegen unseren Kopf zum Text von Popsongs, in denen es oft darum geht, wie fantastisch der betreffende Sänger ist, ganz zu schweigen von der Kleidung, die er trägt, dem Auto, das er fährt, und den Produkten, die er konsumiert. Wir lesen Zeitschriften mit so aufschlussreichen Titeln wie Self (als müsste man uns dazu überreden, noch mehr über uns selbst nachzudenken, als wir es ohnehin schon tun!).
Die narzisstische Weltsicht bewirkt, dass wir die Politik als einen Popularitätswettbewerb oder ein »Rennen« sehen. Dadurch werden Nachrichten in eine Show verwandelt, die uns unterhalten soll. Sogar im Journalismus geht es heute oft in wesentlich stärkerem Maße um die Person des Journalisten als um das Thema, über das er berichtet.
Natürlich beutet auch die Werbebranche unseren Narzissmus schamlos aus, indem sie uns den Wunsch nach »coolen« neuen Produkten einpflanzt: iPhones, iPads, iPods – all diese »i«-Geräte, die auf das »Ich« und seinen unstillbaren Hunger nach Aufmerksamkeit zielen.
Außerdem spiegelt sich in unserer gegenwärtigen Sucht nach Nonstop-Kommunikation unsere Kontaktbedürftigkeit, ohne dass wir tatsächlich ernsthaft an anderen Menschen interessiert wären. Mittlerweile gibt es weltweit etwa 3,14 Milliarden E-Mail-Konten, von denen täglich Millionen von E-Mails abgeschickt werden. Wir rufen einander ständig an; wir verschicken von den mehr als sechs Milliarden angemeldeten Mobiltelefonen weltweit pro Sekunde fast 200000 Textbotschaften; und eine halbe Milliarde Menschen verfügt weltweit über ein Twitter-Konto.7
Bei all diesen E-Mails, Anrufen, SMS und Tweets geht es weniger darum, »zu einem anderen Menschen in Kontakt zu treten und ihn zu berühren«, wie eine Telefongesellschaft es einmal formuliert hat. Vielmehr nehmen wir zu anderen Menschen auf die genannten Arten hauptsächlich Kontakt auf, damit diese uns anerkennen und bestärken.
Zudem ist ein exponenzieller Anstieg der Nutzung sozialer Netzwerke zu beobachten, wobei Facebook mit seinen mehr als einer Milliarde Teilnehmern, wenn nicht sogar 20 Prozent der Weltbevölkerung ein wahres Ungeheuer ist.8 Aber bei Facebook geht es doch nur um »gefällt mir« – um die »Likes« eben, oder nicht?
»Gefällt« dir, was ich gerade berichtet habe? »Gefällt« dir dieses Foto von meiner Katze?
Unter alldem verbirgt sich die Frage, um die es eigentlich geht:
Gefalle ich dir?
Soziale Netzwerke sind ein hochwirksames Kommunikationswerkzeug, das man für sehr positive Ziele nutzen kann (und das manchmal auch tatsächlich so genutzt wird). Leider sind die Postings meist narzisstischer Art, einige offensichtlicher als andere. Es ist traurig und typisch für unsere ichbesessene Zeit, dass wir auf unsere Bildschirme starren und unser Selbstwertgefühl von der Zahl der Facebook-»Freunde« abhängig machen, die uns eine positive Bewertung gegeben haben, wobei unsere Instagram-Herzen pochen, weil wir hoffen, noch mehr Kerben in unsere sprichwörtlichen Pfähle ritzen zu können. Wie Narziss sind wir in unser eigenes Bild im (nun digitalisierten) Spiegel verliebt. Wann werden wir merken, dass wir nie so viele »Likes« bekommen können, dass unser Ich damit zufrieden ist, ganz gleich, wie viele Fotos wir »sharen« und wie viele Geistreicheleien und Beobachtungen über das Leben wir zum »globalen Gespräch« im Netz beitragen?
Dass es bei Facebook keine »Gefällt mir nicht«-Option gibt, ist ganz sicher kein Versehen. Wir alle interessieren uns eigentlich immer nur für die »Likes«. Es wäre jedoch verfehlt zu glauben, das »Jemand-Sein« werde sich jemals in einem ihm genügenden Maße als Jemand fühlen, wenn es dies mithilfe von Methoden wie den von Facebook angebotenen versucht.9
* * *
Ja, das »Ich-Jahrzehnt« ist nahtlos in das von mir so genannte »iZeitalter« übergegangen, eine Epoche, die nicht nur von einem Übermaß an Informationen geprägt wird, sondern auch von der Ichverherrlichung, die in diesem »Kommunikationsgestöber« stattfindet. Doch obwohl wir zum unablässigen Kreisen um uns selbst ermutigt und von »iProdukten« und »iMedien« überflutet werden, kann das »iZeitalter« das »Ich«, das es ständig zu ködern versucht, niemals völlig zufriedenstellen. Wir sind heute unglücklicher und unzufriedener als jemals vorher.
Angesichts dieser völlig neuartigen Überhöhung des Ich und seines unstillbaren Hungers nach Anerkennung, Erfüllung, Verwöhnung und »Likes« sollten wir uns einmal vergegenwärtigen, dass es keine einzige authentische spirituelle Tradition gibt, die uns dazu anhält, noch ichbezogener oder noch narzisstischer zu werden, als wir es ohnehin schon sind. Wenn es um das Ziel geht, im Leben glücklich zu werden, so galt die Ichbesessenheit zu allen Zeiten als das Problem, nicht als die Lösung.
C. S. Lewis hat schon im Jahre 1952 geschrieben: »Es gab unterschiedliche Auffassungen darüber, gegen wen man sich uneigennützig zeigen solle – ob nur gegenüber der eigenen Familie, den eigenen Landsleuten oder gegenüber jedermann. Aber immer bestand darin Übereinstimmung, dass man nicht zuerst an sich selbst denken soll. Die Selbstsucht wurde nie bewundert«.10 Vielleicht nur bis heute – und vielleicht ist dies eine Veränderung, die uns allen sehr schadet.
Reichtum, Narzissmus und pandemische Depression
Ist in Anbetracht der Verbreitung von Narzissmus und Selbstbesessenheit in unserer Gesellschaft der gleichzeitige atemberaubende Anstieg der Zahl psychischer Erkrankungen reiner Zufall?
Wir werden uns dies am Beispiel der Depression anschauen, einer sehr schwächenden Krankheit. Und ich weiß, wovon ich rede! Ich wurde wegen Depression stationär behandelt, als ich Anfang dreißig war. Ich war völlig am Ende, weil eine innere Stimme mir ununterbrochen vorhielt, ich sei ganz und gar wertlos und könne daran nichts ändern. Aber selbst völlig alltägliche Probleme mit dem Selbstwertgefühl sind, wie die meisten von uns wissen, kein Sonntagsspaziergang.
Die statistischen Erhebungen über die momentane Situation sind alarmierend: Nach einer Schätzung des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums leiden zurzeit mehr als zwanzig Millionen Amerikaner unter einer Depression. Einer anderen Quelle zufolge sind 15,7 Prozent der amerikanischen Bevölkerung depressiv.11 Die Zahl der Verschreibungen von Antidepressiva ist in schwindelerregende Höhen gestiegen – im Laufe der letzten zwanzig Jahre um vierhundert Prozent, wobei mehr als einer von zehn Amerikanern im Alter von über zwölf Jahren mittlerweile solche Mittel einnimmt.12 Vielerorts ist Depression heute einer der Hauptgründe für Fehlzeiten von Arbeitnehmern.
Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass das Krankheitsbild der Depression heute pandemische Ausmaße erreicht. Einer Voraussage der World Health Organization zufolge wird Depression im Jahre 2020 die zweithäufigste tödlich verlaufende Krankheit sein, übertroffen nur von Herzerkrankungen.13 Am schockierendsten ist jedoch vielleicht, dass so viele jüngere Menschen an einer Depression erkranken. In den letzten dreißig Jahren ist die Zahl der Fälle von Depression bei Jugendlichen in den USA um tausend Prozent gestiegen.14
Es ist sicher auch kein Zufall, dass die starke Zunahme der Depressionsfälle zwei anderen modernen Trends entspricht, zwischen denen ebenfalls eine Wechselbeziehung besteht: dem dramatischen Anstieg des materiellen Wohlstands in den Industrienationen und der damit verbundenen Ichbesessenheit, die den Konsumismus fördert, verstärkt und stimuliert.
Die Zahl der Fälle von Depression – und mit ihr verwandter Leiden wie Angst und Stress oder psychischer Erkrankungen wie der Bipolaren Störung – hat genau dort stark zugenommen, wo es zu einem starken Anstieg des materiellen Reichtums gekommen ist. Vor wenig mehr als einer Generation konnte sich teure Konsumgüter nur eine kleine wohlhabende Schicht leisten, doch mittlerweile sind diese Dinge auch für die breite Masse erschwinglich: Autos (meist standardmäßig mit Kameras, Computern und GPS-gesteuerten Navis ausgestattet), Fernsehgeräte (heute mit realistischer HD- oder 3-D-Wiedergabe wie im Kino), Telefone (die unglaublich »smart« geworden sind!) und Computer (die sich früher nur Regierungen und große Forschungsinstitute leisten konnten, heute jedoch zur Normalausstattung eines jeden Arbeitsplatzes zählen und die in ständig besser, schneller und kompakter werdenden neuen Versionen verfügbar sind). Freizeitvergnügen, die vormals den Superreichen vorbehalten waren – beispielsweise exotische Ferien –, sind heute aufgrund der vielfältigen Flugverbindungen für viele von uns erschwinglich.
Man kann sich nicht leisten, depressiv zu sein, wenn man kaum das eigene Überleben zu sichern vermag. Die Depression selbst ist eine Art Luxusgut, das sich nur diejenigen leisten können, die nicht um die materiellen Grundlagen ihres Lebens bangen müssen. Es könnte aber auch sein, dass Depression nicht nur etwas ist, das nur ökonomisch Privilegierte für sich beanspruchen können (weil sie sich wirtschaftlich leisten können, depressiv zu sein), sondern dass diese Krankheit auch eine der unumgänglichen Folgen ihrer Situation ist.
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg versprach man uns, dass wir durch den Aufbau von Wohlstand und durch den Konsum glücklich werden würden. Seither (seit über sechzig Jahren) bemühen wir uns pflichtbewusst, Wohlstand aufzubauen und zu konsumieren. Wir alle haben einiges an Geld zusammengeschaufelt und uns alle möglichen Dinge angeschafft. Wir haben uns schon Backöfen und Kühlschränke gekauft, als sie sich noch nicht selbst reinigten und selbst abtauten. Bereitwillig haben wir so ziemlich alles gekauft, was die Industrie auf den Markt brachte, vom Transistorradio (erinnert sich noch jemand daran?) bis zum iPod, vom klobigen Schwarzweißfernseher bis zum schlanken 52-Zoll Plasmabildschirm, vom Taschenrechner bis zum Handheld-Supercomputer.
Vielleicht ist uns mittlerweile klar geworden, dass wir alles bekommen haben, was man uns versprochen hat, und noch viel, viel mehr. Und ist es nicht völlig offensichtlich, dass man uns ständig neue Wünsche einpflanzt, damit wir immer mehr kaufen?
Okay, Sie haben also schon den großen schwarzen iPod. Aber jetzt haben wir dieses weiße klitzekleine Modell auf den Markt gebracht! Sie haben ein Auto vom vorigen Jahr? Mag sein, dass es noch gut fährt, aber es ist doch völlig überholt!
Entweder wir haben alles und sind trotzdem nicht zufrieden, oder unsere Erwartungen sind so hoch, dass wir es für unser Recht halten, alles zu kaufen, und wenn wir dann etwas nicht bekommen, fühlen wir uns um unser Glück betrogen. Wir projizieren unsere ganze Hoffnung auf ein glückliches und erfülltes Leben auf den Konsum, und wenn dieser uns nicht das Erwartete bringt, kommt es zu einem großen Zusammenbruch. Sobald wir die Anspruchshaltung entwickelt haben, dass wir alles besitzen können müssen, bleibt uns für unseren inneren Frieden und unsere Zufriedenheit kaum noch etwas übrig.
Es ist keine Selbsthilfe, wenn es nur um Sie geht
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es vielen von uns nicht nur deshalb so schlecht geht, weil wir uns auf Schritt und Tritt ermutigt fühlen, unzufrieden zu bleiben (damit wir mehr kaufen), sondern auch, weil wir darauf beharren, ständig darüber nachzugrübeln, wie wir uns fühlen. Wir haben ständig unsere Finger am eigenen Puls:
Bin ich okay? Werden meine Bedürfnisse erfüllt? Werde ich ausreichend anerkannt und geschätzt? Bin ich schon ausreichend ein Jemand?
Diese obsessive Beschäftigung mit uns selbst basiert nicht nur auf Ichzentriertheit, sondern auch auf tiefer Unsicherheit. Die Kultur des Narzissmus hat eine dunkle Seite – und vielleicht hat sie in Wahrheit nur diese dunkle Seite. Wie wir in Kapitel 2 hören werden, ist nach den alten Schriften eine der karmischen Ursachen für Depression ein übertriebenes Interesse an der eigenen Person auf Kosten des Denkens an andere. In einer Zeit und an einem Ort, wo gilt: »Es geht nur um mich« – wo die Förderung der Belange des Pronomens der ersten Person Singular eine »Ich zuerst«-Haltung erforderlich macht –, ist es nicht weiter verwunderlich, dass so viele von uns in eine Depression verfallen.
Wie wir im Folgenden sehen werden, ist das Ich sowohl unser bester Freund als auch unser schlimmster Feind. Und nur in Gestalt unseres »besten Freundes« kann es uns vor unseren eigenen destruktiven Neigungen retten; nur wenn wir an unserer Selbstverbesserung arbeiten, werden wir uns in unserer Haut wohler fühlen.
Den Schmerz und das Leid, die durch die Geistesgifte hervorgerufen werden, wenn wir uns anstrengen, »Jemand zu sein«, zu bagatellisieren, ist weder mitfühlend noch fair. Aber es ist ebenso wenig förderlich, ein Allheilmittel anzubieten, das nicht zur Wurzel des Problems vordringt oder es sogar, was noch schlimmer wäre, noch verstärkt, indem es für die Kur ausgibt, was in Wahrheit die Ursache des Problems ist. Es gibt nun einmal wirksame und unwirksame Methoden der Arbeit an uns selbst und der Selbsthilfe. Selbsthilfe, die sich nur um Sie dreht, ist keine. Im Grunde ist es nicht förderlich für uns, wenn wir nur für unsere eigenen Interessen leben und es versäumen, anderen zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu verhelfen. Nur indem wir echte Demut und einen uneigennützigen Geist entwickeln, können wir eine gesunde und tiefreichende Selbstachtung entwickeln – nicht indem wir uns immer stärker auf uns selbst und unsere eigenen Interessen konzentrieren.
Allerdings sollten wir Demut nicht mit Selbsterniedrigung verwechseln und Depression nicht mit Selbstvergessenheit. Ein Mensch mit schwachem Selbstwertgefühl, der sich wie ein »echter Niemand« fühlt, ist im Grunde kein Niemand in dem Sinne, wie wir den Begriff in diesem Buch verwenden. Er ist ein Jemand, der als Niemand posiert – und das ist etwas völlig anderes.
Es gibt eine Art von perversem Stolz auf das »Jemand-Sein«, das sich etwas darauf einbildet und es für etwas Besonderes hält, sich schlecht zu fühlen. Und wenn wir glauben, mehr, statt weniger Ichzentriertheit würde uns weiterhelfen – das schließt Besessenheit davon, wie mies wir uns ständig fühlen, ein –, müssen unsere Bemühungen, unser Selbstbild zu verbessern, scheitern.
Wie schon im Vorwort erwähnt, besteht zwischen dem egoistischen »Jemand-Sein«, das sich als wertlos ansieht – als ein Nichts, eine perfekte Null – und Niemand-Sein ein Unterschied. Unser eingeschränktes, personalisiertes und individuelles Selbst – das sich entweder aus der Perspektive gesunder Selbstachtung oder aus der ungesunden Selbstherabsetzung sehen kann – unterscheidet sich vom uneingeschränkten, mit anderen teilenden und universellen »Niemand-Sein«. Sich mit Letzterem zu identifizieren ist etwas völlig anderes als die Identifikation mit etwas Verachtenswertem. »Niemand« bezieht sich auf unser ständig gegenwärtiges »wahres Selbst«, unsere größte Quelle der Freude und Stärke, ewiges Reservoir des Friedens und der Zufriedenheit, zu dem wir zurückkehren, um die anhaltenden Forderungen und Beschwerden des unersättlichen Ich zum Schweigen zu bringen.
Denken Sie einmal über Folgendes nach: Wir alle wissen, dass wir in Augenblicken, in denen wir uns völlig verlieren, wahrhaft glücklich sind – vertieft in ein gutes Buch oder einen Film, völlig konzentriert auf eine Aufgabe, die unsere gesamte Energie erfordert, oder auf ein Hobby oder versunken in den Blick unseres Kindes oder eines Menschen, den wir lieben. Solche Erlebnisse machen uns auf etwas ungeheuer Wichtiges aufmerksam: Unsere größte Freude erleben wir, wenn wir uns leer machen und uns etwas oder jemand anderem überantworten. In solchen Momenten, in denen es uns gelingt, »außerhalb von uns zu stehen«, erleben wir Ekstase.
Echte und zutiefst empfundene Selbstachtung entsteht nicht durch ein erschöpfendes Streben nach immer stärkerer Ichaufblähung, sondern nur, wenn das Ich und seine nie endenden Forderungen beruhigt und zum Schweigen gebracht werden, wenn das niedere Selbst geleert ist und die Fülle des höheren Selbst zutage tritt.
Erst wenn wir aufhören, unser Leben minutiös zu erzählen, und wenn wir anfangen, direkt und unmittelbar zu leben, sind wir wirklich präsent und mit unserem ganzen Sein bei der Sache. Erst wenn die leise Stimme in unserem Kopf endlich verstummt, werden wir mit dem, was tatsächlich geschieht, völlig eins und wahrhaft glücklich.
Ein gutes und gesundes Selbstwertgefühl zu haben ist wichtig, und niemand zu sein bedeutet sicher nicht, dass wir kriecherisch werden müssen, ein Fußabtreter, auf dem andere Menschen herumtrampeln können, wie sie wollen. Doch wenn wir glauben, nur dann Erfüllung finden zu können, wenn wir hervorstechen und etwas Besonderes sind, so ist eine Verstärkung, nicht eine Verringerung von Angst und Unzufriedenheit die Folge.
Dass Menschen sich wünschen, einzigartig zu sein – oder jemand zu sein, der »einzigartiger als andere« ist –, ist sehr verbreitet: Es ist keineswegs etwas Besonderes, wenn man jemand Besonderes sein will. Doch eben dieser Drang zu radikaler Individualität und Überlegenheit bewirkt, dass wir uns isoliert und allein fühlen. Letztlich ist die Bereitschaft, loszulassen und niemand zu sein, das wirklich Außergewöhnliche, und dies ist die einzige Möglichkeit, zu anderen in eine echte Verbindung zu treten und mit dem Authentischen verbunden zu sein.
Als Nachfolger von A Spiritual Renegade’s Guide to the Good Life (Beyond Words 2012), geleitet das vorliegende Buch, Be Nobody, die Suche nach wahrem Glück auf ein neues Gebiet. Wie sein Vorgänger basiert auch dieses Buch auf den universellen Wahrheiten der ehrwürdigen religiösen und philosophischen Traditionen der Menschheit und destilliert sie zu einem leicht verständlichen praktischen Handbuch für die Suche nach Glück und Erfüllung im modernen Alltagsleben. Die Prinzipien mögen aus alter Zeit stammen, aber die Darstellung ist brandaktuell.
Eine spirituelle Binsenweisheit besagt, dass wir unser wahres Potenzial nur entdecken können, wenn wir uns von unserem niederen, egoistischen Eigenwillen lösen. Be Nobody beschreibt diese Reise von Egoismus, Selbstsucht und Besessenheit von der individuellen Identität zur Weiträumigkeit und Freiheit des Verweilens in der eigenen wahren, authentischen Natur. Solch ein Ziel – vollständig und glücklich im Hier und Jetzt zu leben – ist nicht nur der spirituellen Elite oder Mystikern vorbehalten, sondern jedem möglich (»religiösen«, »spirituellen«, »säkularhumanistisch orientierten« oder »keins davon«-Menschen), der entsprechende Ideen und Praktiken in die Tat umsetzt.
Dass diese Art von Selbsttranszendenz wünschenswert ist, ist den spirituellen Traditionen der Welt seit Jahrtausenden bekannt. Alle Mystiker haben diesen gesegneten Zustand kennengelernt, und wenn es gelingt, eine permanente Verbindung und tiefe Vertrautheit mit ihm zu entwickeln, so entspricht das wohl dem, was östliche Lehren satori, samadhi, nirvana, moksha, mukti usw. nennen.
Im Christentum gibt es ein ähnliches Konzept, kenosis genannt (es leitet sich vom griechischen Wort für Leere her): die Selbstentleerung des Ich mit dem Ziel totaler Empfänglichkeit für den göttlichen Willen. Wie der große Theologe C.S. Lewis, der im vorigen Jahrhundert lebte, in seinem Buch Pardon, ich bin Christ schreibt:
Das Furchtbare, das schier Unmögliche ist, dass wir unser ganzes Selbst Christus ausliefern sollen, mit all unseren Wünschen und Vorbehalten. Und doch ist es viel leichter als das, was wir alle zu tun versuchen. Wirwollen immer nur »wir selbst« bleiben, wie wir es nennen, – wir wollen weiter nach unserem persönlichen Glück streben.15
Ein spirituelles Leben zielt darauf, dem Übenden das Erlebnis wahren Glücks zu ermöglichen. Deshalb hat jede spirituelle Entwicklung nicht zum Ziel, besser als andere, sondern besser für andere zu werden. Die religiösen Traditionen haben im Gegensatz zur heutigen allgemeinen säkularen Neigung zu Narzissmus, Konsumsucht und Gier stets anerkannt, dass es keine Lösung sein kann, die Ichbezogenheit immer weiter aufzublähen, sondern dass genau dies eher das Problem ist.
Das Buch Be Nobody ist in vier Hauptteile gegliedert:
In TEIL I, Das verzweifelte Bemühungen, jemand zu sein, beschäftigen wir uns mit einer der wichtigsten Ursachen für Stress und Angst in unserem Leben: mit der endlosen Suche nach einer verbindlichen persönlichen Identität ungeachtet der Tatsache, dass wir nur immer zeitweilige und sich ständig verändernde Rollen spielen. Wir sind unablässig auf der Suche nach einem stabilen Selbst in den Gewändern, die wir jeweils anziehen: »Ich bin ein Vater/eine Mutter/ein Sohn/eine Tochter/ein Freund/Anwalt/Arzt/Lehrer/Surfer/Blogger/Christ/Buddhist/säkularer Humanist!« und so weiter. Ganz gleich, ob wir diese Rollen selbst wählen oder ob andere sie uns auferlegen, wenn wir uns mit einer von ihnen besonders stark identifizieren, verlieren wir den Kontakt zu unserer tieferen, unveränderlichen Wesensnatur. Und wenn wir auf die eine oder andere dieser individuellen Identitäten oder Gruppenidentitäten besonders stolz sind, trennen wir uns nicht nur von den Menschen, die nicht wie wir sind, sondern wir stellen uns auch vor, wir seien ihnen überlegen – und damit sind wir auf dem besten Weg zu einem tiefen Sturz.
TEIL II, Wie aus einem Niemand ein besserer Jemand wird, beginnt mit der »Wo ist Walter?«-Suche nach dem Selbst, das zu haben wir so sicher sind – eine Suche, die uns dazu bringt, uns an Strohhalme zu klammern und Schatten nachzujagen. Wir sind nicht, wer wir zu sein glauben, aber zugleich sind wir auch niemand anderes, als wer wir zu sein glauben. Und diese Erkenntnis ist der Schlüssel zu echter Selbstverbesserung: die Entwicklung eines besseren Selbstverständnisses. Hier erfahren wir, wie Karma es tatsächlich schafft, das »Jemand-Sein« in ein glücklicheres, selbstzufriedeneres Modell umzuwandeln. Und wir lernen, dass wir die Welt um uns verändern können, indem wir unser Empfinden dessen, wer wir sind, verändern.
In TEIL III mit dem Titel Das »Jemand-Sein« verlieren erforschen wir die Freude, die wir empfinden, wenn wir uns von unseren inneren Erzählungen und unseren vor Selbstbewusstsein strotzenden Fassaden lösen und das Leben so erleben, wie es wirklich ist. Wir sind am glücklichsten, wenn wir uns verlieren – in empathischer Liebe, im Mitgefühl gegenüber anderen Menschen und indem wir wirklich »in den Flow kommen«, wenn wir uns mit achtsamer Unbefangenheit völlig einer Aktivität widmen. In solchen Augenblicken der Selbsttranszendenz finden wir das wahre Herz und die Seele des Lebendigseins.
Zum Abschluss kehren wir in TEIL IV, Jeder ist ein Nobody, zu der drängenden Frage der Selbstidentität zurück. Wer oder was ist dieses »Niemand-Sein« im Zentrum unseres Seins, das all wir Jemande miteinander gemeinsam haben? Und wie können wir mehr von unserer wahren Natur in unser Alltagsleben integrieren? Wenn wir weniger oft als »besondere Jemande« auftreten und häufiger nur als »Normalo«, wird unsere individuelle Existenz demütiger, unser Gefühl der Verbundenheit mit der Welt und den darin lebenden Menschen wird stärker, und wir erleben viel mehr echte und bleibende Zufriedenheit und Freude.
Jedes der folgenden Kapitel endet mit einem »Aktionsplan«, einer Übung, die den Lesern helfen soll, das zuvor Erläuterte in die Praxis umzusetzen und das, womit wir uns befasst haben, noch besser in den Alltag zu integrieren. Es ist eine Sache, etwas darüber zu lesen, wie man ein glücklicheres, erfüllenderes und befriedigenderes Leben führen kann, aber etwas völlig anderes, dies auch tatsächlich zu tun. Es erfordert nicht viel, eine signifikante Veränderung zu erreichen. Aber wir müssen dazu unsere alten Denk- und Handlungsmuster zumindest ein wenig verändern – alte Gewohnheiten, die, wenn wir ehrlich sind, uns nicht das gebracht haben, was wir uns davon versprochen hatten.
Am Ende des Buches finden Sie in einem Abschnitt mit dem Titel »In die eigene wahre Natur fallen« einige sehr einfache und wenig Zeit erfordernde Meditationsübungen, die Sie ausführen können, wann immer Sie im Laufe des Tages eine oder zwei Minuten Zeit haben. Es handelt sich dabei um Auszüge aus einer Sammlung von 112 solchen Meditationen, die im Vijnana Bhairava Tantra, einer ziemlich außergewöhnlichen Schrift aus dem achten oder neunten Jahrhundert v. Chr., beschrieben werden, »Methoden zur Erlangung des Bewusstseins des Göttlichen«. Das Erstaunliche an den Techniken, die in dieser Schrift beschrieben werden, ist ihre Profanität. Der alten Schrift zufolge ist es wesentlich leichter, uns in unsere wahre Natur zu versetzen und uns mit unserem Höheren Selbst zu vereinen, als wir denken mögen!
* * *
Sich vom ängstlichen Druck zu befreien, stets »jemand« sein zu müssen, ist nur durch wahre Ichlosigkeit und durch Befreiung von den Einschränkungen des Ich möglich, wo wir Trost darin finden können, uns in das Leben hineinzuentspannen, statt zu versuchen, es im Interesse unserer egoistischen Ziele zu steuern. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung zur Befreiung vom niederen Selbst, die es Ihnen erspart, sich in ein Kloster oder eine Höhle im Himalaja zurückziehen zu müssen. Das Buch soll Sie dazu anregen, die größte aller Revolutionen einzuleiten: das Überwinden der Ichzentriertheit und des um das eigene Ich kreisenden Bewusstseins, die unsere Unzufriedenheit verursachen, und das Annehmen unseres wahren Potenzials und der Quelle unseres wahren Glücks.
Glück können wir leicht finden, wenn wir die harte Arbeit nicht scheuen, uns von alten Gewohnheiten des Denkens und Handelns zu lösen und uns dem Neuen und Unerprobten anzuvertrauen.
I’m nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there’s a pair of us – don’t tell!





























