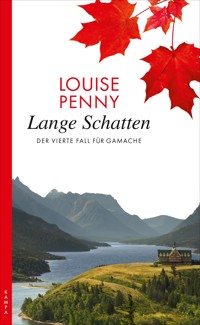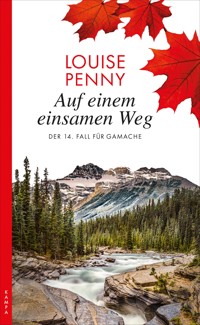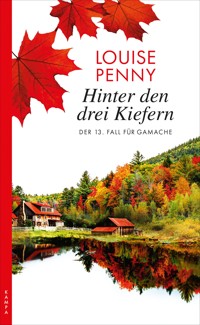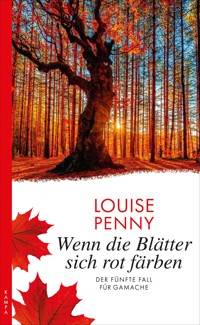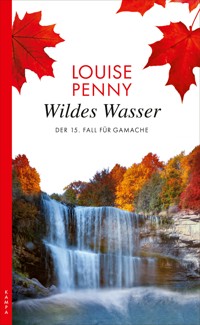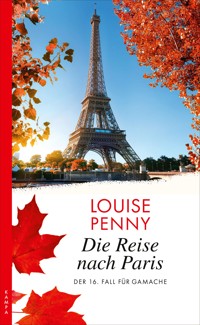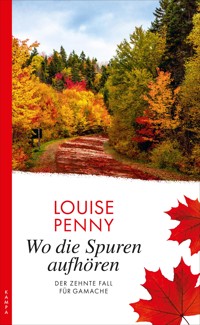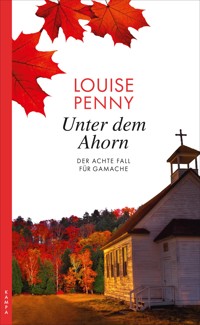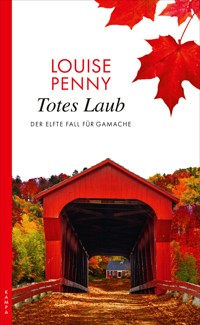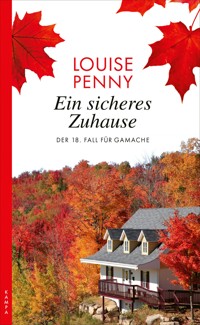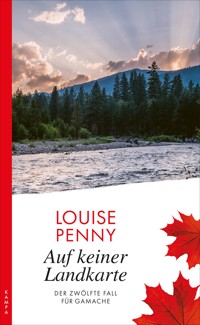Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Im beschaulichen Three Pines ist der Frühling eingekehrt, und überall duftet es nach Flieder. Neben einer frisch erblühten Pfingstrose liegt eines Morgens eine Frauenleiche in Clara Morrows Blumenbeet. Und das kurz nach Claras größtem Triumph, ihrer Einzelausstellung im berühmten Musée d'art contemporain de Montréal. Bei der Party nach der Vernissage war die Crème de la Crème der hiesigen Kunstwelt anwesend, darunter offenbar auch Lillian Dyson, eine für ihre Verrisse bekannte Kunstkritikerin und alte Freundin Claras - die nun tot in deren Garten liegt. Armand Gamache, Chief Inspector der Sûreté du Québec, stellt fest: Nicht wenige Gäste hätten ein Motiv, und auch auf einige Dorfbewohner fällt der Schatten des Verdachts. Damit nicht genug: Gamache und sein Stellvertreter Jean-Guy Beauvoir haben sich noch immer nicht von einem fatalen Einsatz erholt, bei dem beide schwer verletzt wurden und vier ihrer Kollegen erschossen. Ein traumatisches Ereignis, das die Freundschaft der zwei Männer auf eine harte Probe stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Bei Sonnenaufgang
Der siebte Fall für Gamache
Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Für Sharon, Margaret, Louise und all die wunderbaren Frauen, die mir geholfen haben, ein ruhiges Plätzchen im hellen Sonnenschein zu finden.
1
Nein, nein, nein, dachte Clara Morrow, als sie auf die geschlossenen Türen zuging.
Sie sah schemenhafte Schatten, die hinter den Milchglasscheiben wie Gespenster hin und her huschten, hin und her. Auftauchten und verschwanden. Verzerrt und dennoch menschlich.
Den Toten hörte niemand. Doch lag er noch still klagend.
Schon den ganzen Tag waren ihr diese Worte durch den Kopf gegangen, tauchten sie auf und verschwanden. Ein halb erinnertes Gedicht. Worte trieben an die Oberfläche, gingen wieder unter. Der Rest des Gedichts wollte ihr partout nicht einfallen.
Wie lautete das ganze Gedicht?
Es schien wichtig zu sein.
Nein, nein, nein.
Die verschwommenen Gestalten am anderen Ende des langen Flurs schienen aus etwas Flüssigem zu bestehen oder aus Rauch. Sie waren da und auch wieder nicht. Flüchtig. Fliehend.
Sie wäre auch gerne geflohen.
Das war’s. Das Ende der Reise. Nicht nur der Reise, die sie und ihr Mann Peter an diesem Tag unternommen hatten, als sie von ihrem kleinen Dorf in Québec nach Montréal zum Musée d’art contemporain aufgebrochen waren, das ihnen so vertraut war. Wie oft waren sie ins MAC gegangen und hatten sich mit großen Augen eine Ausstellung angesehen. Weil sie sich einem Freund, einem Künstlerkollegen, verpflichtet fühlten. Oder um sich still in das elegante Museum zu setzen, an einem Wochentag, wenn der Rest der Stadt zur Arbeit gehen musste.
Ihre Arbeit war die Kunst. Aber es war mehr als das. Sie konnten nicht anders. Warum sonst sollten sie die langen Jahre der Einsamkeit auf sich nehmen? Die Misserfolge? Das Schweigen einer irritierten oder sogar ablehnenden Kunstwelt?
Tag für Tag hatten sie und Peter in ihren kleinen Ateliers gearbeitet, in dem kleinen Dörfchen, in dem sie ihr kleines Leben führten. Zufrieden und dennoch mit dem Wunsch nach mehr.
Clara ging ein paar Schritte weiter den langen weißen Marmorflur hinunter.
Dort war das »Mehr«. Hinter diesen Türen. Endlich. Das Ziel von allem, auf das sie hingearbeitet hatte, auf das sie ihr ganzes Leben lang zugegangen war.
Am anderen Ende dieses nüchternen weißen Flurs lag ihr erster Kindheitstraum, ihr letzter Traum an diesem Morgen, beinahe fünfzig Jahre später.
Beide hatten sie erwartet, dass Peter als Erster durch diese Türen treten würde. Mit seinen exquisiten naturalistischen Studien war er der sehr viel erfolgreichere Künstler. Er ging so nah an einen Ausschnitt heran und arbeitete ihn so detailliert aus, dass die natürliche Welt verfälscht und abstrakt wirkte. Nicht wiedererkennbar. Peter nahm etwas Natürliches und ließ es unnatürlich erscheinen.
Die Leute stürzten sich darauf. Gott sei Dank. Dadurch hatten sie beide etwas zu essen auf dem Tisch, und die Wölfe, die ständig um ihr kleines Haus in Three Pines kreisten, ließen sich von der Tür fernhalten. Dank Peter und seiner Kunst.
Claras Blick fiel auf ihn. Er ging mit einem Lächeln auf dem attraktiven Gesicht einen Schritt vor ihr. Wer die beiden nicht kannte, würde kaum glauben, dass sie verheiratet waren. Vielmehr würde man eine superschlanke leitende Angestellte mit einem Weißweinglas in der eleganten Hand an seiner Seite vermuten. Ein Beispiel für natürliche Auslese. Dafür, dass sich Gleiches zu Gleichem gesellte.
Der angesehene Künstler mit dem vollen grauen Haar und den edlen Zügen konnte unmöglich diese Frau mit dem Bier in den Wurstfingern auserwählt haben. Mit pâté in dem krausen Haarschopf. Und mit dem Atelier voller Gemälde von geflügelten Kohlköpfen und Skulpturen aus alten Traktorteilen.
Nein. Peter Morrow konnte sie nicht auserwählt haben. Das wäre wider die Natur.
Und doch hatte er es getan.
Und sie hatte ihn auserwählt.
Clara hätte gelächelt, hätte sie nicht das Gefühl gehabt, sich gleich übergeben zu müssen.
Nein, nein, nein, dachte sie wieder, während sie zusah, wie Peter entschieden auf die geschlossenen Türen und die Kunstgespenster zusteuerte, die nur darauf warteten, endlich ihr Urteil zu verkünden. Über sie.
Claras Hände wurden kalt und taub, während sie langsam weiterging, angetrieben von einer unleugbaren Kraft, einer kruden Mischung aus Aufgeregtheit und Angst. Beinahe wäre sie zu den Türen gerannt, hätte sie aufgerissen und gebrüllt: »Da bin ich!«
Noch stärker aber war der Drang, sich umzudrehen und zu fliehen, sich zu verstecken.
Den langen Flur voller Licht und Kunst und Marmor zurückzustolpern. Einzugestehen, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Die falsche Antwort gegeben hatte, als man sie fragte, ob sie eine Einzelausstellung haben wolle. Im Musée. Als man sie fragte, ob sie all ihre Träume Wirklichkeit werden lassen wolle.
Sie hatte die falsche Antwort gegeben. Sie hatte Ja gesagt. Und damit hatte sie sich das hier eingebrockt.
Jemand hatte gelogen. Oder ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt. In ihrem Traum, den sie seit ihrer Kindheit immer wieder im Geist durchgespielt hatte, hatte sie eine Einzelausstellung im Musée d’art contemporain. Sie ging den Flur hinunter. Aufrecht und gelassen. Schön und schlank. Geistreich, umworben.
In die ausgestreckten Arme einer bezauberten Welt.
In dem Traum gab es keine Angst. Keine Übelkeit. Keine Gestalten, die durch Milchglasscheiben starrten und darauf warteten, ihr an die Kehle zu gehen. Sie zu zerfetzen. Sie und ihr Werk zu vernichten.
Jemand hatte gelogen. Hatte nicht gesagt, dass etwas anderes auf sie warten könnte.
Misserfolg.
Nein, nein, nein, dachte Clara. Den Toten hörte niemand. Doch lag er noch still klagend.
Wie lautete der Rest des Gedichts? Warum fiel er ihr nicht ein?
Sie war nur noch ein paar Schritte vom Ziel ihrer Reise entfernt, und alles, was sie wollte, war, nach Three Pines zu fliehen. Das Gartentürchen zu öffnen. Den Weg zwischen den blühenden Apfelbäumen entlangzulaufen. Die Haustür hinter sich zuzuwerfen. Sich dagegenzulehnen. Sie zu verriegeln. Sich mit dem Körper dagegenzustemmen und die Welt draußen zu halten.
Jetzt, wo es zu spät war, wurde ihr klar, wer sie belogen hatte.
Sie selbst.
Claras Herz klopfte heftig gegen ihre Rippen, als wäre es dahinter eingesperrt und als versuchte es verschreckt und verzweifelt zu entkommen. Sie merkte, dass sie den Atem anhielt, und fragte sich, wie lange schon. Hektisch holte sie Luft.
Peter sagte etwas, aber seine Stimme klang gedämpft, wie aus weiter Ferne. Sie wurde übertönt von dem Kreischen in ihrem Kopf und dem Hämmern in ihrer Brust.
Und den Geräuschen, die hinter den Türen immer lauter wurden. Während sie sich ihnen näherten.
»Du wirst es genießen«, sagte Peter mit einem beruhigenden Lächeln.
Claras Hand öffnete sich, und sie ließ ihre Handtasche fallen. Leise traf sie auf dem Boden auf. Außer einem Pfefferminzbonbon und dem winzigen Pinsel aus dem Malen-nach-Zahlen-Set, das ihre Großmutter ihr geschenkt hatte, war nichts darin.
Clara kniete sich hin und tat so, als würde sie unsichtbare Sachen aufsammeln und in die Handtasche stopfen. Mit gesenktem Kopf versuchte sie, ihren Atem zu beruhigen, und fragte sich, ob sie ohnmächtig werden würde.
»Tief einatmen«, hörte sie eine Stimme. »Tief ausatmen.«
Clara sah von der auf dem glänzenden Marmorboden liegenden Tasche hoch zu dem Mann, der sich über sie beugte.
Es war nicht Peter.
Es war Olivier Brulé, ihr Freund und Nachbar aus Three Pines. Er kniete sich neben sie und sah sie mit freundlichen Augen an, ein Blick wie ein Rettungsring, der einer Ertrinkenden zugeworfen wurde. Sie hielt sich daran fest.
»Tief einatmen«, flüsterte er. Seine Stimme war ruhig. Das hier war ihre gemeinsame Krise. Aus der sie sich gemeinsam retten würden.
Sie atmete tief ein.
»Ich schaff das nicht.« Clara beugte sich vor, sie fühlte sich schwach. Die Wände kamen näher, und sie starrte auf Peters blank polierte schwarze Lederschuhe vor ihr auf dem Boden. Als er endlich bemerkt hatte, dass seine Frau zurückgeblieben war und auf dem Boden kniete, war er stehen geblieben.
»Ich weiß«, flüsterte Olivier. »Aber ich kenne dich. Du wirst es durch diese Tür schaffen, ob auf Knien oder aufrecht.« Er deutete mit dem Kopf zum Ende des Flurs, ohne die Augen von ihr abzuwenden. »Warum also nicht aufrecht?«
»Aber es ist noch nicht zu spät.« Clara sah ihn erwartungsvoll an. Sah seine seidigen blonden Haare und die Falten, die man nur aus der Nähe erkannte. Mehr Falten, als ein achtunddreißigjähriger Mann haben sollte. »Noch könnte ich umdrehen und nach Hause gehen.«
Oliviers freundliches Gesicht verschwand, und wieder sah sie ihren Garten vor sich, so wie sie ihn an diesem Morgen gesehen hatte, als die Sonne den Nebel noch nicht ganz aufgelöst hatte. Unter ihren Gummistiefeln der Tau. Die frühen Rosen und späten Pfingstrosen feucht und duftend. Sie hatte sich auf die Holzbank hinter dem Haus gesetzt, in der Hand einen Becher Kaffee, und an den vor ihr liegenden Tag gedacht.
Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, dass sie vor Angst zusammenbrechen könnte. Am liebsten weglaufen würde. Zurück in ihren Garten.
Aber Olivier hatte recht. Sie würde nicht weglaufen. Noch nicht.
Nein, nein, nein. Sie musste durch diese Tür gehen. Nur durch sie kam sie jetzt noch nach Hause.
»Tief ausatmen«, flüsterte Olivier und lächelte sie an.
Clara lachte und atmete aus. »Du würdest eine gute Hebamme abgeben.«
»Was treibt ihr denn da unten?«, fragte Gabri und betrachtete Clara und seinen Lebensgefährten. »Was Olivier in dieser Position normalerweise macht, weiß ich, und ich hoffe, das ist es nicht.« Er drehte sich zu Peter um. »Wobei es das Lachen erklären würde.«
»Bereit?« Olivier reichte Clara ihre Handtasche, und sie standen auf.
Gabri, der sich nie weit von Oliviers Seite entfernte, umarmte Clara. »Alles in Ordnung mit dir?« Er musterte sie. Er hatte einen dicken Bauch, auch wenn er sich selbst lieber als »kräftig« bezeichnete, und sein Gesicht zeigte keine Sorgenfalten wie das von Olivier.
»Mir geht’s gut«, sagte Clara.
»Gallig, unsicher und todtraurig?«, fragte Gabri.
»So in etwa.«
»Toll. So geht’s mir auch. Und allen da drinnen.« Gabri zeigte auf die Tür. »Nur sind die nicht die großartige Künstlerin mit der Einzelausstellung. Dann geht’s dir also gut und darüber hinaus bist du berühmt.«
»Kommst du?«, fragte Peter und streckte lächelnd die Hand aus.
Sie zögerte, dann nahm sie Peters Hand. Gemeinsam gingen sie den Flur hinunter, wobei das Klappern ihrer Absätze auf dem Boden das fröhliche Geschnatter von der anderen Seite der Tür nicht ganz übertönte.
Sie lachen, dachte Clara. Sie lachen über meine Bilder.
Und in diesem Moment drang der Rest des Gedichts an die Oberfläche ihres Bewusstseins.
Nein, nein, nein, dachte Clara. Den Toten hörte niemand. Doch lag er noch still klagend:
Ich war viel weiter draußen, als ihr dachtet,
und winkte nicht, sondern ertrank.
In der Ferne konnte Armand Gamache Kinder spielen hören. Er wusste, woher die Geräusche kamen. Vom Park gegenüber, nur konnte er die Kinder durch das frische Laub der Ahornbäume nicht sehen. Manchmal saß er hier und stellte sich vor, die Rufe und das Lachen kämen von Florence und Zora, seinen kleinen Enkelinnen. Er stellte sich vor, sein Sohn Daniel und Roslyn wären im Park und würden auf ihre beiden Töchter aufpassen. Danach würden sie händchenhaltend über die ruhige Straße im Zentrum der großen Stadt zum Abendessen kommen. Oder er und Reine-Marie würden sich zu ihnen gesellen und Fangen oder Conkers spielen.
Er stellte sich gerne vor, dass sie nicht Tausende Kilometer entfernt in Paris lebten.
Meistens aber genoss er es, das Rufen, Kreischen und Lachen der Nachbarskinder zu hören. Dann lächelte er. Und entspannte sich.
Gamache griff nach seinem Bier und legte den Observateur auf seinen Knien ab. Seine Frau Reine-Marie saß ihm gegenüber auf dem Balkon. Auch sie hatte an diesem unerwartet warmen Tag Mitte Juni ein kaltes Bier vor sich stehen. Ihre Ausgabe von La Presse lag zusammengefaltet auf dem Tisch, und sie starrte in die Ferne.
»Woran denkst du?«, fragte er.
»Ach, an dies und das.«
Einen Moment lang schwieg er und betrachtete sie. Ihre Haare waren mittlerweile ergraut, so wie seine. Jahrelang hatte sie sie kastanienbraun gefärbt, aber vor einigen Monaten hatte sie damit aufgehört. Das Grau gefiel ihm. Sie waren beide Mitte fünfzig. Und ein Paar in diesem Alter sah eben so aus. Wenn es Glück hatte.
Nicht gerade wie Models. Da konnten sie keinem was vormachen. Armand Gamache war nicht dick, aber kräftig. Würde ein fremder Besucher ihn so sehen, dann würde er Monsieur Gamache vielleicht für einen zugeknöpften Akademiker halten, vielleicht Geschichts- oder Literaturprofessor an der Université de Montréal.
Aber auch das würde nicht stimmen.
Die große Wohnung stand voll mit Büchern. Historische Werke, Biographien, Romane, Kataloge zu Quebecer Antiquitäten, Lyriksammlungen. Ordentlich aufgereiht in Regalen. Auf so gut wie jedem Tisch lag mindestens ein Buch, dazu noch mehrere Zeitschriften. Auf dem Sofatisch vor dem Kamin im Wohnzimmer waren die Wochenendzeitungen ausgebreitet. Wäre der Besucher ein aufmerksamer Beobachter und dränge er bis in Gamaches Arbeitszimmer vor, würde sich ihm vermutlich die Geschichte erschließen, die all die Bücher dort erzählten.
Bald würde ihm klar werden, dass er sich nicht im Heim eines älteren Professors für französische Literatur befand. Die Regale standen voll mit Fallstudien, mit Büchern über Medizin und Forensik, mit Wälzern zum Code Civil und Richterrecht, zu Spurensicherung, DNA-Analyse, Wunden und Waffen.
Mord. Das Arbeitszimmer von Armand Gamache war randvoll davon.
Aber selbst inmitten des Todes war Platz für Philosophie- und Lyrikbände.
Als Gamache Reine-Marie ansah, überkam ihn wieder einmal das Gefühl, nach oben geheiratet zu haben. Nicht gesellschaftlich. Nicht akademisch. Aber er wurde einfach den Verdacht nicht los, dass er unverschämt viel Glück gehabt hatte.
Armand Gamache war sich bewusst, dass er in seinem Leben in vielerlei Hinsicht großes Glück hatte, aber das größte war sicher, dass er seit fünfunddreißig Jahren dieselbe Frau liebte. Übertroffen nur von dem geradezu unfassbaren Glück, dass auch sie ihn zu lieben schien.
Jetzt richtete sie ihre blauen Augen auf ihn. »Ehrlich gesagt habe ich gerade an Claras Vernissage gedacht.«
»Ach ja?«
»Wir sollten bald aufbrechen.«
»Stimmt.« Er sah auf die Uhr. Es war fünf nach fünf. Die feierliche Eröffnung von Clara Morrows Einzelausstellung im Musée hatte um fünf begonnen und würde um sieben enden. »Sobald David da ist.«
Ihr Schwiegersohn hatte sich bereits um eine halbe Stunde verspätet, und Gamache warf einen Blick ins Wohnzimmer. Er konnte seine Tochter Annie, die dort saß und las, nur schemenhaft erkennen. Ihr gegenüber saß Jean-Guy Beauvoir, sein Stellvertreter, und kraulte Henris enorme Ohren. So konnte der Schäferhund der Gamaches ganze Tage verbringen, ein dümmliches Grinsen im Gesicht.
Jean-Guy und Annie ignorierten einander. Gamaches Mund umspielte ein Lächeln. Wenigstens warfen sie nicht mit Beleidigungen oder Schlimmerem um sich.
»Oder willst du schon gehen?«, fragte Armand. »Wir könnten David auf dem Handy anrufen und ihm sagen, dass er direkt ins Musée kommen soll.«
»Lass uns noch ein paar Minuten warten.«
Gamache nickte und nahm wieder seine Zeitschrift zur Hand, gleich darauf senkte er sie erneut.
»Ist noch was?«
Reine-Marie zögerte, dann lächelte sie. »Ich habe mich nur gefragt, ob du womöglich nicht besonders erpicht darauf bist, zu der Vernissage zu gehen. Ob du dich lieber drücken willst.«
Erstaunt hob Armand eine Augenbraue.
Jean-Guy Beauvoir streichelte Henris Ohren und starrte auf die junge Frau ihm gegenüber. Er kannte sie seit fünfzehn Jahren, als er ganz neu in der Mordkommission gewesen war und sie ein Teenager. Linkisch, unbeholfen, vorlaut.
Er mochte keine Kinder. Noch weniger schlaumeiernde Teenager. Aber er hatte sich bemüht, Annie Gamache zu mögen, und sei es auch nur, weil sie die Tochter seines Chefs war.
Er hatte sich wirklich sehr bemüht und nicht aufgegeben. Und schließlich …
War es ihm gelungen.
Mittlerweile war er fast vierzig und sie fast dreißig. Anwältin. Verheiratet. Immer noch linkisch und vorlaut. Aber er hatte sich so lange bemüht, sie zu mögen, dass er endlich hinter ihre präpotente Fassade sehen konnte. Er hatte sie fröhlich lachen sehen, miterlebt, wie sie den schlimmsten Langweilern gelauscht hatte, als wären sie die interessantesten Zeitgenossen, als wäre sie hocherfreut, sie zu sehen. Als wären sie wichtig. Er hatte sie tanzen sehen, mit wild rudernden Armen, in den Nacken gelegtem Kopf, glänzenden Augen.
Und er hatte ihre Hand in seiner gespürt. Ein einziges Mal.
Im Krankenhaus. Er war von weit her zurückgekommen, hatte sich durch den Schmerz und die Dunkelheit zu dieser fremden, sanften Berührung durchgekämpft. Dass sie nicht von seiner Frau Enid stammte, wusste er. Wegen ihres krallenartigen Griffs wäre er nicht zurückgekommen.
Aber diese Hand war groß und ruhig und warm. Und sie hatte ihn aus der Tiefe geholt.
Er hatte die Lider ein wenig gehoben, und da war Annie Gamache und sah ihn besorgt an. Er fragte sich, was sie bei ihm wollte. Und dann wusste er es.
Weil sie nirgendwo sonst sein konnte. Sie konnte an keinem anderen Krankenhausbett sitzen.
Ihr Vater war tot. In einer verlassenen Fabrik erschossen. Beauvoir hatte es mit angesehen. Hatte gesehen, wie Gamache getroffen wurde. Gesehen, wie er von den Füßen gehoben wurde und auf den Betonboden stürzte.
Still dalag.
Und jetzt hielt Annie Gamache im Krankenhaus seine Hand, weil die Hand, die sie eigentlich halten wollte, nicht mehr da war.
Jean-Guy hatte Annie Gamaches traurigen Blick gesehen. Es hatte ihm das Herz zerrissen. Dann sah er etwas anderes.
Freude.
So hatte ihn noch nie jemand angesehen. Mit solch unverhohlener, ungezügelter Freude.
Genau so hatte Annie ihn angesehen.
Vergeblich hatte er versucht, ein Wort hervorzubringen. Aber sie hatte erraten, was er zu sagen versuchte.
Sie hatte sich vorgebeugt und ihm ins Ohr geflüstert, und er konnte ihr Parfüm riechen. Leicht zitronig. Sauber und frisch. Nicht Enids durchdringender schwerer Duft. Annie roch wie ein Zitronenhain im Sommer.
»Dad lebt.«
Da hatte er etwas getan, wofür er sich schämte. Es gab genug Peinlichkeiten, die im Krankenhaus noch auf ihn warteten. Doch von all den Bettpfannen, Windeln und Krankenschwestern, die ihn mit einem Schwamm wuschen, war nichts so persönlich, so intim, ein solcher Verrat wie das, was sein geschundener Körper in diesem Augenblick tat.
Er weinte.
Und obwohl Annie es sah, brachte sie es nie zur Sprache. Bis heute nicht.
Zu Henris grenzenlosem Erstaunen hörte Jean-Guy auf, seine Ohren zu kraulen, und legte die Hände übereinander, wie er es sich angewöhnt hatte.
So hatte es sich angefühlt, als Annies Hand auf seiner lag.
Mehr würde er nie von ihr bekommen. Von der verheirateten Tochter seines Chefs.
»Dein Mann verspätet sich«, sagte Jean-Guy und hörte den Vorwurf in seiner Stimme. Die Empörung.
Langsam, sehr langsam ließ Annie ihre Zeitung sinken. Und sah ihn an.
»Ja, und?«
Ja, und was eigentlich?
»Wir werden seinetwegen zu spät kommen.«
»Dann geh doch. Das ist mir gleich.«
Er hatte die Pistole geladen, an seinen Kopf gehalten und darum gebettelt, dass Annie abdrückte. Jetzt spürte er, wie die Worte einschlugen. Peng. Tief eindrangen und eine Wunde rissen.
Das ist mir gleich.
Der Schmerz war beinahe beruhigend, merkte er. Wenn er sie dazu brachte, ihn genug zu verletzen, dann würde er vielleicht nichts anderes mehr fühlen.
»Hör mal«, sagte sie mit etwas sanfterer Stimme und beugte sich vor. »Das mit Enid und dir tut mir leid. Eure Trennung.«
»Ja, na ja, so was kommt vor. Als Anwältin solltest du das wissen.«
Sie sah ihn mit demselben forschenden Blick an wie ihr Vater. Dann nickte sie.
»Ja, das kommt vor.« Kurz hielt sie inne. »Besonders wenn man so etwas durchgemacht hat wie du. Da fängt man an, über sein Leben nachzudenken. Willst du darüber reden?«
Mit Annie über Enid reden? Über all die kleinen Gemeinheiten und Zänkereien, die Kränkungen und Reibereien, die Wunden und Verletzungen? Der Gedanke widerstrebte ihm, und das war ihm vermutlich anzusehen. Annie lehnte sich zurück und wurde rot, als hätte er ihr eine Ohrfeige gegeben.
»Vergiss es«, fuhr sie ihn an und hob die Zeitung in die Höhe.
Er wollte etwas sagen, eine Brücke schlagen, einen Weg zurück zu ihr. Die Minuten vergingen, zogen sich in die Länge.
»Die Vernissage«, platzte Beauvoir schließlich heraus. Es war das Erste, was in seinem leeren Kopf aufploppte, so wie der Magic 8 Ball ein Wort ausspuckte, wenn man aufhörte, ihn zu schütteln. In diesem Fall spuckte er das Wort Vernissage aus.
Die Zeitung senkte sich, und Annies versteinertes Gesicht erschien.
»Ganz Three Pines wird da sein.«
Ihr Gesicht blieb ausdruckslos.
»Die Leute aus diesem Dorf in den Eastern Townships«, er machte eine unbestimmte Geste in Richtung Fenster. »Südlich von Montréal.«
»Ich weiß, wo die Townships sind«, sagte sie.
»Es ist Clara Morrows Ausstellung, sie werden bestimmt alle da sein.«
Sie hob die Zeitung wieder. Der kanadische Dollar war stark, las er. Die Schlaglöcher vom Winter waren noch nicht ausgebessert, las er. Die Korruption unter Regierungsbeamten sollte untersucht werden, las er.
Nichts Neues.
»Einer von ihnen hasst deinen Vater.«
Langsam sank die Zeitung. »Wie bitte?«
»Na ja«, ihr Gesichtsausdruck verriet, dass er womöglich übertrieben hatte, »nicht so sehr, dass er ihm etwas antun würde oder so.«
»Dad hat von Three Pines und den Leuten dort erzählt, aber das hat er nie erwähnt.«
Sie wirkte erschrocken, und er wünschte, er hätte nichts gesagt, aber wenigstens hatte es funktioniert. Sie sprach wieder mit ihm. Ihr Vater war die Brücke.
Annie warf die Zeitung auf den Tisch und blickte an Beauvoir vorbei zu ihren Eltern, die sich auf dem Balkon leise unterhielten.
Jetzt sah sie wieder aus wie der Teenager, als den er sie kennengelernt hatte. Sie würde niemals die schönste Frau weit und breit sein. Das war selbst damals schon klar gewesen. Annie hatte nicht die feinsten Gesichtszüge, nicht die zierlichste Figur. Sie war eher athletisch als anmutig. Sie legte zwar Wert auf ihre Kleidung, aber bequem musste sie auch sein.
Sie war starrköpfig, willensstark und körperlich stark. Zwar konnte er sie beim Armdrücken besiegen, was er wusste, weil sie es ein paarmal gemacht hatten, aber er hatte sich anstrengen müssen.
Bei Enid hätte er das nie probiert. Und sie hätte ihn nie dazu aufgefordert.
Annie Gamache hatte ihn nicht nur dazu aufgefordert, sie war auch überzeugt gewesen, dass sie gewinnen würde.
Und als sie verloren hatte, hatte sie gelacht.
Andere Frauen, auch Enid, waren charmant, Annie war voller Leben.
Spät, zu spät, hatte Jean-Guy Beauvoir begriffen, wie ungeheuer wichtig es war, wie anziehend und wie selten es vorkam, dass jemand voller Leben war.
Sie wandte ihren Blick wieder Beauvoir zu. »Warum sollte einer der Bewohner von Three Pines Dad hassen?«
Beauvoir senkte die Stimme. »Okay, ich sag’s dir.«
Annie beugte sich vor. Sie saßen so nah beieinander, dass Beauvoir ihren Geruch wahrnehmen konnte. Mit Mühe hielt er sich davon ab, ihre Hände zu nehmen.
»In Three Pines gab es einen Mord …«
»Ja, Dad hat davon erzählt. Scheint da an der Tagesordnung zu sein.«
Unwillkürlich musste Beauvoir lachen. »Wo viel Licht ist, ist starker Schatten.«
Annies erstaunter Blick brachte ihn erneut zum Lachen.
»Lass mich raten«, sagte sie. »Das ist nicht auf deinem Mist gewachsen.«
Beauvoir nickte lächelnd. »Das hat irgend so ein Deutscher gesagt. Und dann hat es dein Vater gesagt.«
»Mehr als einmal?«
»So oft, dass ich mitten in der Nacht schreiend aufwache.«
Annie lächelte. »Kenn ich. Ich war in der Schule die Einzige, die Leigh Hunt zitieren konnte.« Ihre Stimme veränderte sich leicht, als sie sich erinnerte. »Am liebreizendsten aber ist ein glückliches Gesicht.«
Als Gamache das Gelächter aus dem Wohnzimmer hörte, lächelte er.
Er deutete mit dem Kopf in die Richtung. »Meinst du, sie schließen endlich Frieden?«
»Entweder das oder es ist ein Hinweis auf die Apokalypse«, sagte Reine-Marie. »Wenn gleich vier Reiter aus dem Park angaloppiert kommen, musst du schauen, wo du bleibst, mein Lieber.«
»Es ist schön, ihn wieder lachen zu hören«, sagte Gamache.
Seit seiner Trennung von Enid wirkte Jean-Guy unnahbar. Reserviert. Besonders überschwänglich war er zwar nie gewesen, aber in letzter Zeit war er noch stiller geworden, so als wären die Mauern um ihn herum höher und dicker geworden. Und die schmale Zugbrücke immerzu hochgezogen.
Armand Gamaches Erfahrung nach war es nie gut, Mauern hochzuziehen. Was die Menschen für Schutz hielten, war in Wahrheit Gefangenschaft. Und in Gefangenschaft gedieh das wenigste.
»Es dauert einfach seine Zeit«, sagte Reine-Marie.
»Avec le temps«, stimmte Armand ihr zu. Aber insgeheim zweifelte er daran. Er wusste, dass die Zeit heilen konnte. Aber sie konnte auch weiteren Schaden anrichten. Ein Waldbrand, der sich allmählich ausbreitete, konnte alles verschlingen.
Gamache warf einen letzten Blick ins Wohnzimmer, dann wandte er sich wieder Reine-Marie zu.
»Glaubst du wirklich, dass ich nicht zu der Vernissage gehen will?«, fragte er.
Sie überlegte kurz. »Womöglich. Lass es mich so sagen: Du scheinst es nicht eilig zu haben, dort aufzutauchen.«
Gamache nickte und dachte einen Moment nach. »Ich weiß, dass alle dort sein werden. Es könnte vielleicht ein bisschen peinlich werden.«
»Du hast einen ihrer Nachbarn wegen eines Mordes verhaftet, den er nicht begangen hat«, sagte Reine-Marie. Es war kein Vorwurf. Vielmehr sagte sie es ruhig und sanft. Um Gefühle ihres Mannes hervorzulocken, deren er sich womöglich nicht einmal selbst bewusst war.
»Hältst du das für einen Fauxpas?«, fragte er mit einem Lächeln.
»Mehr als das, würde ich sagen.« Sie lachte, als sie den schalkhaften Ausdruck auf seinem inzwischen wieder glatt rasierten Gesicht sah. Er trug keinen Schnauzer mehr. Kein grauer Bart verbarg ihn. Jetzt war er nur noch Armand. Er sah sie mit seinen dunkelbraunen Augen an und ließ sie die Narbe an seiner linken Schläfe beinahe vergessen.
Dann verblasste sein Lächeln, und er nickte erneut und holte tief Luft.
»Es ist schrecklich, jemandem so etwas anzutun«, sagte er.
»Du hast es nicht absichtlich gemacht, Armand.«
»Das stimmt, aber das hat ihm seine Zeit im Gefängnis wahrscheinlich nicht versüßt.« Gamaches Blick wanderte von dem sanften Gesicht seiner Frau zu den Bäumen im Park. Natur. Er sehnte sich so sehr nach Natur, während er ständig damit beschäftigt war, Widernatürlichem hinterherzujagen. Mördern. Menschen, die anderen das Leben nahmen. Oft auf grausame und fürchterliche Art. Armand Gamache war Leiter der Mordkommission der berühmten Sûreté du Québec. Ein sehr guter.
Aber er war nicht vollkommen.
Er hatte Olivier Brulé für einen Mord verhaftet, den er nicht begangen hatte.
»Also, was ist passiert?«, fragte Annie.
»Den größten Teil kennst du, oder? Es stand ja in allen Zeitungen.«
»Natürlich habe ich die Zeitungsberichte gelesen, und ich habe mit Dad darüber gesprochen. Aber er hat nie erwähnt, dass einer der Beteiligten noch sauer auf ihn sein könnte.«
»Wie du weißt, war das vor fast einem Jahr«, sagte Jean-Guy. »Im Bistro wurde eine Leiche gefunden. Wir haben in dem Fall ermittelt, und die Beweise waren erdrückend. Wir fanden Fingerabdrücke, die Tatwaffe, Sachen, die aus der Blockhütte des Toten gestohlen worden waren. Und alles war im Bistro versteckt. Wir haben Olivier verhaftet. Er wurde vor Gericht gestellt und verurteilt.«
»Hast du geglaubt, dass er es getan hat?«
Beauvoir nickte. »Ich war mir sicher. Nicht nur dein Vater.«
»Warum hast du dann deine Meinung geändert? Hat ein anderer den Mord gestanden?«
»Nein. Aber weißt du, nach der Razzia in der Fabrik, als dein Vater sich eine Auszeit genommen hat und eine Weile in Quebec City war …«
Annie nickte.
»Na ja, in dieser Zeit sind ihm Zweifel gekommen, und deshalb hat er mich gebeten, noch mal nach Three Pines zu fahren und die Ermittlung wieder aufzunehmen.«
»Was du auch getan hast.«
Jean-Guy nickte. Natürlich. Er würde alles tun, worum der Chief Inspector ihn bat. Auch wenn er selbst keine Zweifel gehabt hatte und davon überzeugt gewesen war, dass der Richtige im Gefängnis saß. Aber er hatte weitere Nachforschungen angestellt und war dabei auf etwas gestoßen, was ihn zutiefst schockiert hatte.
Auf den wahren Mörder. Und den wahren Grund für den Mord.
»Aber seit du Olivier verhaftet hast, warst du doch schon wieder in Three Pines«, sagte Reine-Marie. »Du siehst die Leute also nicht zum ersten Mal wieder.«
Auch sie war schon öfter in Three Pines gewesen und hatte sich mit Clara und Peter und den anderen angefreundet. Allerdings hatte sie sie eine Weile nicht gesehen. Nicht seit das alles passiert war.
»Das stimmt«, sagte Armand. »Jean-Guy und ich haben Olivier nach seiner Freilassung hingebracht.«
»Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss.«
Gamache war still. Er sah wieder das von den Schneewehen reflektierte gleißende Sonnenlicht vor sich. Durch die vereisten Fenster des Bistros konnte man die Dorfbewohner erkennen, die sich dort versammelt hatten. Warm und sicher. In den Kaminen brannte ein munteres Feuer. Die Biergläser und Schalen mit Café au Lait. Das Lachen.
Olivier hatte plötzlich gezögert. Zwei Schritte vor der geschlossenen Tür war er stehen geblieben und hatte sie angestarrt.
Jean-Guy wollte vorausgehen, um sie zu öffnen, aber Gamache hatte die Hand auf seinen Arm gelegt. Zusammen hatten sie in der Eiseskälte gestanden und gewartet. Hatten darauf gewartet, dass Olivier die zwei Schritte machte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit, die wahrscheinlich nur ein paar Herzschläge gedauert hatte, hatte Olivier den Arm ausgestreckt, erneut einen Moment innegehalten und dann die Tür aufgestoßen.
»Zu gerne hätte ich Gabris Gesicht gesehen«, sagte Reine-Marie und stellte sich vor, wie der überschwängliche große Mann seinen Lebensgefährten zurückkehren sah.
Wieder zu Hause, hatte Gamache Reine-Marie alles beschrieben. Aber er wusste, dass sie sich das Ausmaß der Freude nicht vorstellen konnte. Zumindest auf Gabris Seite. Auch die anderen Dorfbewohner hatten sich gefreut, Olivier wiederzusehen. Aber …
»Was ist?«, fragte Reine-Marie.
»Na ja, Olivier hat den Mann nicht umgebracht, aber im Laufe des Prozesses kamen eine Menge unschöne Dinge ans Tageslicht, wie du vielleicht noch weißt. Olivier hatte den Eremiten bestohlen, ihre Freundschaft und die psychische Labilität des Mannes ausgenutzt. Darüber hinaus hat Olivier das Geld, das er mit den gestohlenen Sachen verdiente, heimlich dafür verwendet, eine ganze Reihe von Immobilien in Three Pines zu erwerben. Davon wusste nicht einmal Gabri.«
Reine-Marie war still und dachte darüber nach.
»Ich frage mich, was seine Freunde darüber denken«, sagte sie schließlich.
Das fragte Gamache sich auch.
»Olivier soll meinen Vater hassen?«, fragte Annie. »Aber wie kann das sein? Dad hat ihn aus dem Gefängnis geholt. Er hat ihn zurück nach Three Pines gebracht.«
»Ja, nur denkt Olivier, dass ich es war, der ihn aus dem Gefängnis geholt hat. Und dein Vater ist derjenige, der ihn hineingebracht hat.«
Annie starrte Beauvoir an, dann schüttelte sie den Kopf.
Beauvoir fuhr fort. »Dein Vater hat sich bei ihm entschuldigt. Vor versammelter Mannschaft im Bistro. Er hat Olivier gesagt, dass es ihm leidtut, was er getan hat.«
»Und was hat Olivier gesagt?«
»Dass er ihm nicht verzeihen kann. Noch nicht.«
Annie dachte darüber nach. »Wie hat Dad reagiert?«
»Er schien weder überrascht zu sein noch sich aufzuregen. Ich glaube, er wäre eher überrascht gewesen, wenn Olivier so getan hätte, als wäre alles vergeben und vergessen. Weil das nämlich gelogen gewesen wäre.«
Beauvoir wusste, schlimmer, als jemandem nicht zu verzeihen, war, nicht aufrichtig zu verzeihen.
Das musste man Olivier lassen. Statt so zu tun, als würde er die Entschuldigung akzeptieren, hatte er gesagt, wie es wirklich war. Die Verletzung ging zu tief. Er war nicht bereit zu verzeihen.
»Und jetzt?«, fragte Annie.
»Jetzt werden wir wohl abwarten müssen.«
2
»Bemerkenswert, finden Sie nicht?«
Armand Gamache drehte sich zu dem eleganten älteren Herrn neben ihm.
»Ja«, sagte der Chief Inspector und nickte. Einen Moment lang schwiegen die beiden Männer und betrachteten das vor ihnen hängende Gemälde. Die Veranstaltung war in vollem Gang, alle redeten, lachten – Freunde, die sich wiedertrafen, Fremde, die einander vorgestellt wurden.
Aber um die beiden Männer war es friedlich, als stünden sie in einer Oase der Stille.
Zufällig oder nicht, waren beide vor dem Herzstück von Clara Morrows Ausstellung stehen geblieben. Im Hauptsaal des Musée d’art contemporain hingen über die weißen Wände verteilt ihre Arbeiten, in erster Linie Porträts. Einige dicht beieinander, wie kleine Grüppchen. Andere hingen allein, isoliert. So wie dieses.
Das bescheidenste Porträt an der größten Wand.
Ohne Konkurrenz, ohne Gesellschaft. Ein Inselstaat. Ein Herrscherporträt.
Allein für sich.
»Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie es betrachten?«, fragte der Mann und richtete seinen scharfen Blick auf Gamache.
Der Chief Inspector lächelte. »Na ja, ich sehe es nicht zum ersten Mal. Wir sind mit den Morrows befreundet, und ich war dabei, als sie es das erste Mal aus ihrem Atelier geholt hat.«
»Sie Glücklicher.«
Gamache nippte an dem sehr guten Rotwein und stimmte ihm zu. Es war ein Glücksmoment gewesen.
»François Marois.« Der Herr streckte die Hand aus.
»Armand Gamache.«
Jetzt sah der Mann den Chief Inspector genauer an und nickte.
»Désolé. Ich hätte Sie erkennen müssen, Chief Inspector.«
»Nein, keineswegs. Ich freue mich immer, wenn die Leute mich nicht erkennen.« Gamache lächelte. »Sind Sie auch Künstler?«
Er sah eher aus wie ein Banker. Vielleicht war er ein Sammler, also am anderen Ende der Nahrungskette der Kunst. Er war Anfang siebzig, schätzte Gamache. Wohlhabend. Maßanzug, Seidenkrawatte. Ein Hauch eines teuren Parfüms umwehte ihn. Die wenigen übrig gebliebenen Haare waren tadellos frisiert und frisch geschnitten, er war glatt rasiert und hatte intelligente blaue Augen. All das erfasste Chief Inspector Gamache mit einem Blick. François Marois wirkte zugleich lebhaft und zurückgenommen. Heimisch in dieser exklusiven, ziemlich abgehobenen Umgebung.
Gamache warf einen Blick in den Saal, in dem sich Männer und Frauen drängten, herumspazierten, plauderten, Tabletts mit Horsd’œuvres und Weingläsern balanciert wurden. In der Mitte der Saals standen zwei unbequeme Designerbänke. Mehr Form als Funktion. Am gegenüberliegenden Ende sah er Reine-Marie im Gespräch mit einer anderen Frau. Er entdeckte Annie. David war gerade eingetroffen und zog seinen Mantel aus, dann ging er zu ihr. Gamaches Blick wanderte weiter, bis er auf Gabri und Olivier stieß, die eng beieinanderstanden. Er fragte sich, ob er zu ihnen gehen und mit Olivier reden sollte.
Und dann? Sich noch einmal entschuldigen?
Hatte Reine-Marie recht gehabt? Suchte er nach Vergebung? Sühne? Wollte er, dass sein Fehler von der Liste seiner Verfehlungen gelöscht wurde? Die Liste, die er tief in sich bewahrte und tagtäglich ergänzte.
Sein Schuldkonto.
Wollte er, dass dieser Fehler getilgt wurde?
Er konnte auch gut ohne Oliviers Vergebung leben. Aber als er ihn jetzt sah, überlief ihn ein leichter Schauer, und er fragte sich, ob er doch Vergebung wollte. Und er fragte sich, ob Olivier bereit war, sie ihm zu gewähren.
Sein Blick kehrte zu dem Mann neben ihm zurück.
Gamache fand es interessant, dass die besten Kunstwerke den Menschen und die Natur behandelten, sei es die menschliche oder eine andere, Museen und Galerien dagegen oft kalt und streng wirkten. Weder einladend noch natürlich.
Und doch schien Monsieur Marois sich wohlzufühlen. Marmor und scharfe Kanten schienen zu seinem natürlichen Lebensraum gehören.
»Nein«, antwortete Marois auf Gamaches Frage. »Ich bin kein Künstler.« Er lachte leise. »Ich fürchte, ich bin nicht einmal kreativ. Wie die meisten meiner Kollegen habe ich in meiner frühen Jugend in den Künsten dilettiert und sofort einen unerklärlichen, profunden Mangel an Talent in mir festgestellt. Es war ein Schock, offen gestanden.«
Gamache lachte. »Was führt Sie dann hierher?«
Heute war die Preview, morgen würde die offizielle Ausstellungseröffnung sein. Nur Auserwählte wurden zu solchen Previews eingeladen, wie Gamache wusste, besonders im berühmten Musée in Montréal. Die Vermögenden, die Einflussreichen, die Freunde und die Familie des Künstlers. Und der Künstler selbst. In genau dieser Reihenfolge.
Von einem Künstler wurde auf einer Vernissage wenig erwartet. Die meisten Kuratoren schätzten sich schon glücklich, wenn sie angezogen und nüchtern waren. Gamache warf einen Blick zu Clara, die in ihrem eng geschnittenen, leicht verunfallt aussehenden Kostüm verschreckt und derangiert wirkte. Der Rock war verdreht und der Blazerkragen hatte sich hochgeschoppt, so als hätte sie versucht, sich zwischen den Schulterblättern zu kratzen.
»Ich bin Kunsthändler.« Der Mann zog eine Visitenkarte hervor, und Gamache nahm sie und betrachtete den ecrufarbenen Karton. Nur Name und Telefonnummer des Mannes standen in schwarzer Prägung darauf. Sonst nichts. Der Karton hatte eine Leinenstruktur. Exklusiv. Für eine exklusive Adresse zweifellos.
»Kennen Sie Claras Arbeiten?«, fragte Gamache und schob die Karte in seine Brusttasche.
»Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit der Chefkuratorin des Musée befreundet, und sie hat mir einen Katalog zukommen lassen. Ich war bass erstaunt. Es heißt darin, dass Madame Morrow beinahe fünfzig ist und schon ihr Leben lang in Québec lebt. Trotzdem scheint niemand sie zu kennen. Sie kommt geradewegs aus dem Nichts.«
»Nein, nein, sie kommt geradewegs aus Three Pines«, sagte Gamache, und auf den fragenden Blick seines Gesprächspartners hin erklärte er: »Das ist ein winziges Dorf südlich von Montréal. An der Grenze zu Vermont. Nicht viele Leute kennen es.«
»Wie Madame Morrow. Eine unbekannte Künstlerin aus einem unbekannten Dorf. Und doch …«
Monsieur Marois breitete die Arme aus, in einer eleganten und vielsagenden Geste, die die Umgebung und die Feier umfasste.
Beide wandten sich wieder dem Porträt zu. Es zeigte den Kopf und die knochigen Schultern einer sehr alten Frau. Eine geäderte, arthritische Hand umklammerte einen zerschlissenen blauen Schal um ihren Hals. Er war verrutscht und legte die über Schüsselbein und Sehnen gespannte Haut frei.
Was die beiden Männer fesselte, war jedoch das Gesicht der Frau.
Sie starrte sie an. Die vielen Gäste, die mit ihren Gläsern anstießen, sich angeregt unterhielten. Das fröhliche Treiben.
Sie war wütend. Voller Ressentiment. Zornig über das, was sie hörte und sah. Die Fröhlichkeit um sie herum. Das Lachen. Zornig auf die Welt, von der sie zurückgelassen worden war. Die sie allein an diese Wand verbannt hatte. Wo sie zusehen und zuhören musste und nie dazugehören würde.
Das hier war ein unendlich gequälter großer Geist, ähnlich dem gefesselten Prometheus, der bitter und engherzig geworden war.
Gamache hörte ein leises Seufzen neben sich und wusste, was es bedeutete. Der Kunsthändler François Marois hatte begriffen, worum es in dem Gemälde ging. Nicht die offenkundige Wut, die sich allen offenbarte, sondern etwas Komplexeres und Subtileres. Marois hatte es erkannt. Was Clara tatsächlich erschaffen hatte.
»Mon Dieu«, hauchte Monsieur Marois. »Mein Gott.«
Er sah von dem Gemälde zu Gamache.
Am anderen Ende des Saals stand Clara, nickte und lächelte und bekam so gut wie nichts mit.
In ihren Ohren rauschte es, vor ihren Augen verschwamm alles, und ihre Hände waren taub. Gleich würde sie ohnmächtig werden.
Tief einatmen, wiederholte sie. Tief ausatmen.
Peter hatte ihr ein Glas Wein gebracht, und ihre Freundin Myrna hatte ihr einen Teller mit Horsd’œuvres hingehalten, aber Clara zitterte so sehr, dass sie beides zurückgeben musste.
Sie konzentrierte sich darauf, nicht allzu dement zu wirken. Ihr neues Kostüm kratzte, und sie fand, dass sie wie eine Buchhalterin aussah. Aus dem früheren Ostblock. Oder eine Maoistin. Eine maoistische Buchhalterin.
Nicht, dass sie diesen Look angestrebt hatte, als sie das Kostüm in einer dieser Chichi-Boutiquen in der Rue Saint-Denis in Montréal gekauft hatte. Sie hatte einfach mal etwas anderes gewollt als ihre üblichen Schlabberröcke und -kleider. Etwas Schickes und Elegantes. Minimalistisch. Etwas, das zusammenpasste.
Im Laden hatte sie einfach toll ausgesehen, sie hatte im Spiegel die lächelnde Verkäuferin angelächelt und ihr alles von der drohenden Einzelausstellung erzählt. Jedem erzählte sie davon. Taxifahrern, Kellnern, dem Jungen, der im Bus neben ihr saß und nichts davon mitbekam, weil er über die Ohrstöpsel seines iPods Musik hörte. Das war Clara egal gewesen. Sie hatte es ihm trotzdem erzählt.
Und jetzt war der Tag endlich gekommen.
Als sie an diesem Morgen in ihrem Garten in Three Pines gesessen hatte, hatte sie sich den Gedanken gestattet, dass es ein besonderer Tag werden könnte. Sie hatte sich vorgestellt, dass sie durch die riesigen Milchglastüren trat und von frenetischem Applaus empfangen wurde. Dass sie in ihrem neuen Kostüm phantastisch aussah. Die Kunstszene war hingerissen. Kritiker und Kuratoren eilten beflissen auf sie zu, um sich wenigstens einen Moment in ihrer Gegenwart zu sonnen. Sie schubsten sich gegenseitig weg, um ihr gratulieren zu können. Bemüht, die richtigen Worte zu finden, les mots justes, um ihre Gemälde zu beschreiben.
Formidable. Brillant. Überragend. Genial.
Meisterwerke, allesamt Meisterwerke.
Clara hatte in ihrem stillen Garten die Augen geschlossen, das Gesicht der gerade aufgegangenen Sonne zugewandt und gelächelt.
Der Traum wurde wahr.
Wildfremde würden an ihren Lippen hängen. Einige würden sich sogar Notizen machen. Um Rat fragen. Entzückt würden sie zuhören, während sie von ihren Visionen, ihrer Philosophie sprach, ihren Einsichten in die Kunstwelt, wohin sie sich entwickelte, woher sie kam.
Man würde sie, die kluge und schöne Frau, bewundern und achten. Elegante Frauen würden sie fragen, wo sie das Kostüm gekauft hatte. Sie würde eine Bewegung auslösen. Einen Trend.
Stattdessen fühlte sie sich jetzt wie eine derangierte Braut auf einer gefloppten Hochzeit. Auf der die Gäste sie ignorierten und sich ausschließlich dem Essen und Trinken widmeten. Auf der keiner ihren Strauß fangen oder sie zum Altar führen wollte. Oder mit ihr tanzen. Und auf der sie aussah wie eine maoistische Buchhalterin.
Sie kratzte sich am Oberschenkel und schmierte sich pâté in die Haare. Dann sah sie auf ihre Uhr.
Himmel, noch eine Stunde.
Nein, nein, nein, dachte Clara. Es ging nur noch ums Überleben. Darum, den Kopf über Wasser zu halten. Nicht in Ohnmacht zu fallen, zu kotzen oder zu pinkeln. Ihr neues Ziel war, bei Bewusstsein und kontinent zu bleiben.
»Wenigstens stehst du nicht in Flammen.«
»Was?« Clara drehte sich zu der sehr dicken schwarzen Frau in dem knallgrünen Kaftan um. Es war ihre Freundin und Nachbarin Myrna Landers. Die pensionierte Psychologin aus Montréal führte den Buchladen mit Antiquariat in Three Pines.
»Im Moment«, sagte Myrna. »Du stehst nicht in Flammen.«
»Sehr wahr. Und genau beobachtet. Ich fliege auch nicht. Ich tue ganz vieles nicht.«
»Und ganz vieles schon«, sagte Myrna lachend.
»Werd jetzt bloß nicht beleidigend«, sagte Clara.
Myrna schwieg und betrachtete Clara einen Moment. Fast jeden Tag kam Clara in Myrnas Buchladen, um eine Tasse Tee zu trinken und zu plaudern. Oder Myrna kam zu Peter und Clara zum Abendessen.
Aber heute war es anders. Dieser Tag unterschied sich von jedem anderen in Claras bisherigem Leben, und möglicherweise würde niemals wieder einer so sein wie bisher. Myrna kannte Claras Ängste, ihre Unzulänglichkeiten, ihre Enttäuschungen. So wie Clara die von Myrna kannte.
Und sie kannten auch die Träume der jeweils anderen.
»Ich weiß, dass das schwierig für dich ist«, sagte Myrna. Sie stand direkt vor Clara und versperrte ihr mit ihrem mächtigen Leib den Blick in den Saal. Sie war eine große grüne Kugel, die das laute Partyvolk ausblendete. Auf einmal waren sie in ihrer eigenen kleinen Welt.
»Ich wollte, dass es perfekt ist«, sagte Clara leise und hoffte, dass sie nicht anfangen würde zu heulen. Wenn andere kleine Mädchen von ihrer Hochzeit träumten, hatte Clara von einer Einzelausstellung geträumt. Im Musée. Hier. Sie hatte sich das Ganze nur anders vorgestellt.
»Und wer sagt, dass es nicht perfekt ist? Was stimmt denn nicht?«
Clara dachte einen Moment nach. »Dass ich solche Angst habe.«
»Und was ist das Schlimmste, was passieren kann?«, fragte Myrna ruhig.
»Dass den Leuten meine Arbeiten nicht gefallen, dass sie denken, dass ich kein Talent habe und doof bin. Eine Witzfigur. Dass die Ausstellung ein furchtbarer Fehler ist. Dass die Ausstellung ein Misserfolg wird und ich mich lächerlich mache.«
»Und?«, sagte Myrna mit einem Lächeln. »Das kann man alles überleben. Was würdest du dann tun?«
Clara dachte einen Moment nach. »Ich würde mich mit Peter zusammen ins Auto setzen und zurück nach Three Pines fahren.«
»Und dann?«
»Dann würde ich mit meinen Freunden weiterfeiern.«
»Und dann?«
»Morgen früh würde ich aufstehen …« Claras Stimme verlor sich, als sie ihr postapokalyptisches Leben vor sich sah. Sie würde morgen in ihrem ruhigen Leben in dem winzigen Dorf aufwachen. Zurückkehren in ein Leben, in dem sie mit dem Hund spazieren ging, im Bistro mit einem Drink auf der Terrasse saß oder mit Café au Lait und Croissants vor dem Kamin. In dem sie mit Freunden zu Abend aß. In ihrem Garten saß. Las, nachdachte.
Bilder malte.
An alldem würde sich durch das, was hier geschah, nichts ändern.
»Wenigstens stehe ich nicht in Flammen«, sagte sie und grinste.
Myrna nahm Claras Hände und hielt sie einen Moment fest. »Die meisten Leute würden für einen solchen Tag einen Mord begehen. Lass ihn nicht vorübergehen, ohne dich zu amüsieren. Deine Arbeiten sind Meisterwerke, Clara.«
Clara drückte die Hand ihrer Freundin. In all den Jahren und Monaten, an all den stillen Tagen, als niemand sich für das interessiert hatte, was Clara in ihrem Atelier machte, es nicht mal wahrgenommen wurde, war Myrna da gewesen. Und in diese Stille hinein hatte sie geflüstert:
»Deine Arbeiten sind Meisterwerke.«
Und Clara hatte all ihren Mut zusammengenommen und ihr geglaubt. Und es gewagt weiterzumachen. Angetrieben von ihren Träumen und dieser sanften, beruhigenden Stimme.
Jetzt trat Myrna zur Seite und gab den Blick auf einen völlig neuen Raum frei. Einen, der mit Menschen und nicht mit Bedrohungen gefüllt war. Menschen, die sich amüsierten, sich freuten. Die da waren, um Clara Morrows erste Einzelausstellung im Musée zu feiern.
»Merde«, brüllte ein Mann der neben ihm stehenden Frau ins Ohr, in dem Versuch, sich über den allgemeinen Geräuschpegel hinweg verständlich zu machen. »Die Dinger sind doch scheiße. Nicht zu fassen, dass die Morrow eine Einzelausstellung gekriegt hat.«
Die Frau neben ihm schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht. Sie trug einen fließenden Rock und ein enges T-Shirt, um Hals und Schultern hatte sie Tücher drapiert. In ihren Ohren steckten Kreolen und an jedem Finger ein Ring.
An einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit hätte man sie für eine Zigeunerin gehalten. Hier hielt man sie für das, was sie war. Eine mittelmäßig erfolgreiche Künstlerin.
Ihr Mann neben ihr, ebenfalls Künstler, bekleidet mit Cordhose und abgetragenem Jackett, um den Hals lässig einen Schal geschlungen, wandte sich wieder dem Bild zu.
»Fürchterlich.«
»Die arme Clara«, sagte seine Frau. »Die Kritiker werden sie in der Luft zerreißen.«
Jean-Guy Beauvoir, der mit dem Rücken zum Bild neben den beiden stand, drehte sich um und betrachtete es.
Es war das größte in einer Gruppe von Porträts. Drei Frauen, alle sehr alt, standen zusammen und lachten.
Sie blickten sich an, berührten einander, hielten sich bei den Händen oder am Arm, die Köpfe zueinander gebeugt. Worüber sie auch lachten, sie taten es gemeinsam. Gemeinsam würden sie auch etwas Schreckliches durchstehen. Egal was, sie hatten einander.
Mehr noch als Freundschaft, mehr als Freude und sogar Liebe brachte dieses Bild Intimität zum Ausdruck.
Jean-Guy drehte ihm schnell wieder den Rücken zu. Das konnte er nicht ertragen. Sein Blick wanderte durch den Saal, bis er sie erneut fand.
»Sieh sie dir an«, sagte der Mann mit höhnischem Blick. »Schön ist was anderes.«
Annie Gamache stand neben ihrem Mann am anderen Ende des überfüllten Saals. Sie lauschten einem älteren Herrn. David wirkte abwesend, gelangweilt. Annies Augen strahlten. Aufmerksam. Fasziniert.
Beauvoir spürte einen eifersüchtigen Stich. So sollte sie ihn ansehen.
Hier, befahl Beauvoirs innere Stimme. Schau hierher.
»Und wie sie lachen«, sagte der Mann hinter Beauvoir und musterte Claras Porträt der drei alten Frauen missbilligend. »Nicht besonders einfühlsam. Genauso gut hätte sie Clowns malen können.«
Die Frau neben ihm kicherte.
Auf der anderen Seite des Saals legte Annie Gamache eine Hand auf den Arm ihres Mannes, aber er schien es nicht zu bemerken.
Sanft legte Beauvoir seine Hand auf seinen Arm. So musste es sich anfühlen.
»Da sind Sie ja, Clara«, sagte die Chefkuratorin des Musée, fasste sie am Arm und führte sie von Myrna weg. »Herzlichen Glückwunsch. Die Ausstellung ist ein rauschender Erfolg!«
Clara kannte die Kunstszene gut genug, um zu wissen, dass das, was die einen »rauschender Erfolg« nannten, andere einfach als »so lala« bezeichnen würden. Aber immerhin war es besser als ein Tritt gegen das Schienbein.
»Meinen Sie?«
»Absolument. Die Leute sind begeistert.« Die Frau umarmte Clara heftig. Ihre Brille war aus zwei schmalen Rechtecken zusammengesetzt, und Clara fragte sich, ob sie die Welt mit einem Balken vor den Augen sah. Kleidung und strenge Kurzhaarfrisur passten perfekt zusammen. Das Gesicht war kalkweiß. Sie sah aus wie eine Installation auf zwei Beinen.
Aber sie war nett, und Clara mochte sie.
»Sehr schön«, sagte die Kuratorin und trat einen Schritt zurück, um Claras neuen Look zu betrachten. »Gefällt mir. Schick, so retro. Sie sehen aus wie …« Sie zeichnete mit einer Hand einen engen Kreis, suchte nach dem richtigen Namen.
»Audrey Hepburn?«
»C’est ça«, die Kuratorin schlug die Hände zusammen und lachte. »Sie sind eine wahre Trendsetterin.«
Auch Clara lachte und war spontan ein bisschen verliebt. Am anderen Ende des Saals sah sie Olivier, wie üblich stand Gabri neben ihm. Während der mit einem Unbekannten plauderte, starrte Olivier auf einen Punkt in der Menge.
Clara folgte seinem scharfen Blick. Er führte zu Armand Gamache.
»Also«, sagte die Kuratorin und legte ihren Arm um Claras Taille. »Wen darf ich Ihnen vorstellen?«
Bevor Clara antworten konnte, deutete die Frau auf verschiedene Leute.
»Die beiden kennen Sie wahrscheinlich.« Sie nickte in Richtung eines Paars mittleren Alters neben Beauvoir. Sie schienen wie gebannt von Claras Bild mit den drei Grazien. »Normand und Paulette. Sie arbeiten im Team. Er macht die Entwurfszeichnung, sie arbeitet sie aus.«
»Wie die alten Renaissancemeister.«
»Ein bisschen«, sagte die Kuratorin. »Oder eher wie Christo und Jeanne-Claude. Ein Künstlerpaar, das so reibungslos zusammenarbeitet, findet man selten. Sie sind ziemlich gut. Und sie scheinen Ihr Gemälde zu bewundern.«
Clara kannte die beiden und vermutete, dass »bewundern« nicht das Wort war, das sie benutzen würden.
»Wer ist das?«, fragte Clara und deutete auf den eleganten Herrn neben Gamache.
»François Marois.«
Clara riss die Augen auf und sah sich um. Warum drängten sich nicht alle um den berühmten Kunsthändler, um ein Wort mit ihm zu wechseln? Warum sprach nur Armand Gamache, der nicht einmal Künstler war, mit ihm? Vernissagen waren doch nicht dazu da, den ausstellenden Künstler zu feiern. Es gab sie, um Kontakte zu knüpfen. Und einen größeren Fang als François Marois konnte man nicht machen. Dann wurde ihr klar, dass ihn wahrscheinlich nur die wenigsten der Anwesenden überhaupt erkannten.
»Wahrscheinlich wissen Sie, dass er eigentlich nie auf Ausstellungen geht. Aber ich habe ihm einen Katalog geschickt, und er fand Ihre Arbeiten phantastisch.«
»Echt?«
Selbst wenn man das Kunst-Phantastisch ins Normale-Menschen-Phantastisch übersetzte, war es ein großes Kompliment.
»François kennt jeden mit Geld und Geschmack«, sagte die Kuratorin. »Das ist ein richtiger Coup. Wenn ihm Ihre Arbeit gefällt, sind Sie eine gemachte Frau.« Die Kuratorin sah genauer hin. »Aber den, mit dem er spricht, kenne ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Kunstprof.«
Bevor Clara sagen konnte, dass der Mann kein Professor war, sah sie, wie Marois von dem Porträt zu Armand Gamache blickte. Er wirkte wie vom Donner gerührt.
Clara fragte sich, was er gesehen hatte. Und was das hieß.
»Und dort drüben«, sagte die Kuratorin und deutete in die entgegengesetzte Richtung, »steht André Castonguay, noch ein guter Fang.« Clara sah eine bekannte Figur der Quebecer Kunstszene. Während François Marois, die éminence grise der Szene, sich langsam aus dem Geschäft zurückzog, war André Castonguay, der ein wenig jünger, größer und kräftiger als Marois war, ein Hansdampf in allen Gassen. Jetzt stand Monsieur Castonguay inmitten einer Traube von Leuten. Den inneren Kreis bildeten die Kritiker einiger bedeutender Zeitungen. Dann kam die zweite Garde der Galeristen und Kritiker. Und den äußersten Kreis bildeten die Künstler.
Sie waren die Planeten und André Castonguay ihre Sonne.
»Ich werde Sie ihm vorstellen.«
»Phantastisch«, sagte Clara. Im Geist übersetzte sie dieses »phantastisch« in das, was sie eigentlich meinte. Merde.
»Kann das sein?« François Marois sah Chief Inspector Gamache fragend an.
Gamache lächelte und nickte.
Marois drehte sich wieder zu dem Porträt.
Der Geräuschpegel stieg immer höher, als mehr und mehr Leute sich in den Saal quetschten.
Aber François Marois hatte nur für ein Gesicht Augen. Das der enttäuschten alten Frau an der Wand. Voller Ablehnung und Verzweiflung.
»Das ist Maria, oder?«, fragte er beinahe flüsternd.
Chief Inspector Gamache war sich nicht ganz sicher, ob der Kunsthändler mit ihm sprach, daher erwiderte er nichts. Marois hatte gesehen, was den meisten entging.
Clara hatte nicht einfach das Porträt einer wütenden alten Frau gemalt. Sie hatte die Jungfrau Maria gemalt. Als alte Frau. Allein gelassen von einer Welt, die müde war und Angst vor Wundern hatte. Eine Welt, die zu beschäftigt war, um einen von einem Grab gewälzten Stein zu bemerken. Sie hatte sich anderen Wundern zugewandt.
Das war Maria in ihren letzten Jahren. Vergessen. Allein.
Die in einen Saal blickte, der mit fröhlichen, weintrinkenden Menschen gefüllt war. Menschen, die an ihr vorbeigingen.
Außer François Marois, der jetzt seine Augen von dem Gemälde losriss, um wieder zu Gamache zu blicken.
»Was hat Clara Morrow da getan?«, fragte er leise.
Gamache war einen Moment lang still und sammelte seine Gedanken, bevor er antwortete.
»Na, Schwachkopf.« Ruth Zardo hakte sich mit ihrem mageren Arm bei Jean-Guy Beauvoir unter. »Rücken Sie raus mit der Sprache, wie geht’s?«
Es war ein Befehl. Wenige hatten die Kraft, Ruth zu ignorieren. Allerdings wurden noch weniger jemals von Ruth gefragt, wie es ihnen ging.
»Danke, gut.«
»Blödsinn«, sagte die alte Dichterin. »Sie sehen scheiße aus. Dünn. Blass. Faltig.«
»Damit beschreiben Sie sich selbst, Sie alte Säuferin.«
Ruth Zardo gackerte. »Stimmt. Sie sehen aus wie eine böse alte Frau. Und das ist nicht als Kompliment gemeint, falls Sie das denken.«
Beauvoir lächelte. Er freute sich, Ruth wiederzusehen. Jetzt betrachtete er die große, magere alte Frau, die sich auf ihren Stock stützte. Sie hatte dünne weiße Haare, die so kurz geschnitten waren, dass darunter ihr Schädel zum Vorschein kam. Das passte, fand Beauvoir. Ruth verbarg nichts von dem, was ihr durch den Kopf ging. Sie verbarg nur das, was in ihrem Herzen vorging.
Doch es offenbarte sich in ihren Gedichten. Aus einem Beauvoir völlig rätselhaften Grund hatte Ruth für ihre Lyrik den Literaturpreis des Generalgouverneurs erhalten. Beides, der Preis und ihre Lyrik, war Beauvoir unbegreiflich. Glücklicherweise war Ruth selbst sehr viel leichter zu entschlüsseln.
»Was wollen Sie hier?«, fragte sie und fixierte ihn.
»Und Sie? Erzählen Sie mir nicht, dass Sie aus Solidarität mit Clara den weiten Weg von Three Pines gekommen sind.«
Ruth sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren. »Natürlich nicht. Ich bin aus demselben Grund da wie der Rest der Belegschaft. Getränke und Essen umsonst. Aber ich hab fürs Erste genug. Gehen Sie nachher auch auf die Party in Three Pines?«
»Wir sind eingeladen, aber ich bleibe wahrscheinlich in Montréal.«
Ruth nickte. »Gut. Dann bleibt mehr für mich. Ich hab von Ihrer Scheidung gehört. Ich schätze mal, sie hat Sie betrogen. Wär ja kein Wunder.«
»Alte Vettel«, murmelte Beauvoir.
»Trottel«, sagte Ruth. Beauvoirs Blick war abgeschweift, und Ruth folgte ihm. Zu der jungen Frau am anderen Ende des Saals.
»Da kriegen Sie was Besseres«, sagte Ruth und spürte, wie sich der Arm, an dem sie sich festhielt, anspannte. Beauvoir sagte nichts. Sie schaute ihn mit scharfem Blick an, dann sah sie wieder zu der Frau, auf die Beauvoir starrte.
Mitte, Ende zwanzig, nicht dick, aber auch nicht dünn. Nicht hübsch, aber auch nicht hässlich. Nicht groß, aber auch nicht klein.
Eine ganz und gar durchschnittliche Erscheinung, kein bisschen bemerkenswert. Bis auf eines.
Die junge Frau strahlte Zufriedenheit aus.
In diesem Moment trat eine ältere Frau zu dem Grüppchen, legte einen Arm um die junge Frau und küsste sie auf die Wange.
Reine-Marie Gamache. Ruth hatte sie ein paarmal getroffen.
Jetzt sah die runzelige alte Dichterin Beauvoir mit gesteigertem Interesse an.
Peter Morrow plauderte mit einigen Galeristen. Eher kleine Lichter in der Kunstwelt, aber auch die sollte man nicht vernachlässigen.
André Castonguay von der Galerie Castonguay war da, und es brannte Peter unter den Nägeln, ihn endlich kennenzulernen. Auch die Kunstkritiker von der New York Times und vom Figaro hatte er gesichtet. Am anderen Ende des Saals machte ein Fotograf Fotos von Clara.
Als sie kurz den Kopf drehte, trafen sich ihre Blicke. Sie zuckte mit den Achseln, er hob sein Glas und lächelte.
Sollte er rübergehen und sich Castonguay vorstellen? Aber der stand in einer Traube von Leuten. Peter wollte sich nicht lächerlich machen, indem er angehechelt kam. Besser war es, sich fernzuhalten und so zu tun, als wäre ihm André Castonguay egal.
Peter wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Besitzer einer kleinen Galerie zu, der gerade erklärte, dass sie furchtbar gerne eine Ausstellung mit Peter machen würden, aber bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchgeplant seien.
Aus dem Augenwinkel sah er, dass die Menge um Castonguay sich teilte und Clara den Weg frei machte.
»Sie wollen wissen, was ich beim Anblick dieses Gemäldes empfinde«, sagte Armand Gamache. Die beiden Männer sahen das Porträt an. »Ich fühle mich ruhig. Getröstet.«
François Marois wirkte verwundert.
»Getröstet? Das kann doch nicht sein. Vielleicht ist man froh, dass man selbst nicht so wütend ist. Dass der eigene Zorn gemessen an dem dieser Frau erträglich ist. Welchen Titel hat Madame Morrow dem Bild gegeben?« Marois nahm seine Brille ab und beugte sich zu der Beschriftung an der Wand vor.
Dann trat er einen Schritt zurück, sein Gesicht war noch verwunderter.
»Es heißt Stillleben. Seltsam.«
Während der Kunsthändler weiterhin das Porträt betrachtete, bemerkte Gamache in einiger Entfernung Olivier. Er starrte zu ihm herüber. Der Chief Inspector lächelte ihm zum Gruß zu und war nicht überrascht, als Olivier sich wegdrehte.
Wenigstens wusste er jetzt Bescheid.
Neben ihm atmete Marois laut aus. »Ich verstehe.«
Gamache wandte sich wieder dem Kunsthändler zu. Marois wirkte nicht mehr verwundert. Sein von Herzen kommendes Lächeln durchbrach die kultivierte Fassade aus zurückhaltender Höflichkeit.
»Es ist in ihren Augen, oder?«
Gamache nickte.
Marois legte den Kopf auf die Seite, sah aber nicht das Porträt an, sondern die Vernissagenbesucher. Erstaunt. Dann wanderte sein Blick zwischen Gemälde und Besuchern hin und her.
Gamache folgte seinem Blick und war nicht überrascht, als er feststellte, dass er an der alten Frau hängen geblieben war, die mit Jean-Guy Beauvoir sprach.
Ruth Zardo.
Beauvoir wirkte verärgert und genervt, aber das war nichts Ungewöhnliches, wenn man sich mit Ruth Zardo unterhielt. Sie selbst dagegen machte einen recht zufriedenen Eindruck.
»Das ist sie, oder?«, fragte Marois und klang aufgeregt. Er sprach mit gesenkter Stimme, als wollte er seine Entdeckung geheim halten.
Gamache nickte. »Sie ist eine Nachbarin von Clara aus Three Pines.«
Fasziniert betrachtete Marois Ruth. So als wäre das Gemälde lebendig geworden. Dann wandten er und Gamache sich wieder dem Porträt zu.
Clara hatte Ruth als vergessene, streitsüchtige Jungfrau Maria gemalt. Gebeugt von Alter und Wut, von tatsächlichen und eingebildeten Bitternissen. Von zerbrochenen Freundschaften. Von verwehrten Ansprüchen und entzogener Liebe. Aber da war noch etwas anderes. Eine vage Andeutung in den müden Augen. Nichts, das sie tatsächlich sahen. Eher ein Versprechen. Eine ferne Ahnung.
Unter all den Pinselstrichen, all den Details, den Farben und den Zwischentönen des Porträts blitzte ein winziges Detail auf. Ein einzelner weißer Punkt.
In ihren Augen.
Clara Morrow hatte den Moment gemalt, in dem Verzweiflung in Hoffnung umschlug.
François Marois trat einen halben Schritt zurück und nickte ernst.
»Es ist bemerkenswert. Wunderschön.« Er drehte sich Gamache zu. »Es sei denn natürlich, es ist ein Trick.«
»Was meinen Sie damit?«, fragte Gamache.
»Vielleicht ist es überhaupt keine Hoffnung«, sagte Marois, »sondern nur eine optische Täuschung.«
3
Am nächsten Morgen stand Clara früh auf. Sie zog ihre Gummistiefel an und streifte einen Pulli über ihren Schlafanzug, schenkte sich einen Becher Kaffee ein und setzte sich in ihren Garten.
Die Leute von der Catering-Firma hatten alles aufgeräumt. Sämtliche Spuren der großen Grill- und Tanzparty vom gestrigen Abend waren beseitigt.
Sie schloss die Augen, spürte die junge Junisonne auf ihrem Gesicht und hörte die Vogelrufe und das Plätschern des unterhalb des Gartens dahinfließenden Bella Bella. Dazwischen mischte sich das Brummen der Hummeln, die in den Pfingstrosenblüten herumkletterten. Sich verstiegen.
Hin und her trudelten.
Es hatte etwas Komisches. Aber das war bei vielem so, wenn man es nicht besser wusste.
Clara Morrow hielt den warmen Becher zwischen den Händen, roch den Kaffee und das frisch gemähte Gras. Den Flieder, die Pfingstrosen und die frühen Duftrosen.
Das war das Dorf, in dem Clara als Kind unter ihrer Bettdecke gelebt hatte. Es befand sich in ihrem Zimmer, hinter dessen dünner Holztür ihre Eltern stritten. Ihre Brüder beachteten sie nicht. Das Telefon klingelte, aber niemand rief sie an. Augen huschten über sie hinweg, an ihr vorbei und durch sie hindurch. Zu jemand anderem. Jemand Schönerem. Interessanterem. Alle redeten, als wäre sie unsichtbar, und unterbrachen sie, als hätte sie nichts gesagt.
Aber wenn sie dann die Augen schloss und die Decke über den Kopf zog, sah die kleine Clara das hübsche Dörfchen in dem Tal. Mit dem Wald und den Blumen und den freundlichen Leuten.
Wo Summen und Trudeln etwas Gutes war.
Solange sie sich erinnern konnte, wollte Clara nur eines noch dringlicher als eine Einzelausstellung. Sie wollte keine Reichtümer, keine Macht, nicht einmal Liebe.