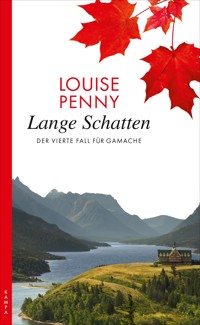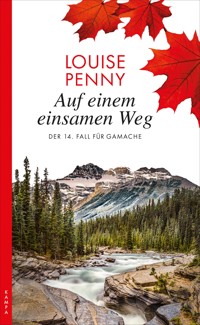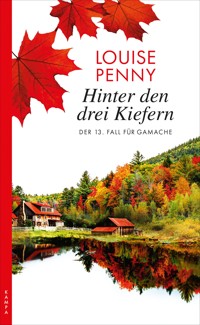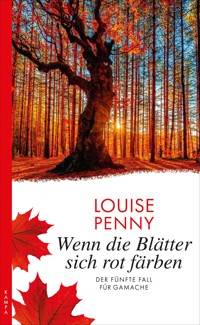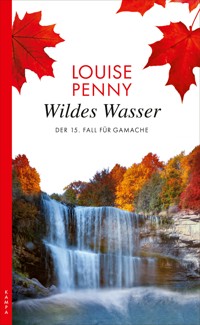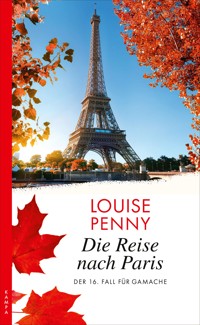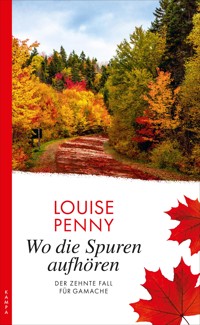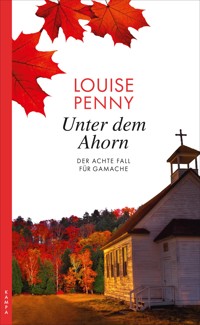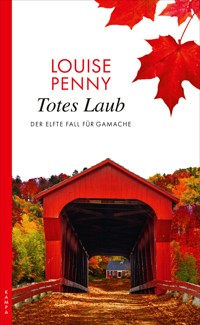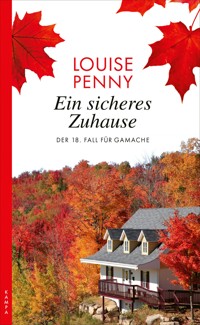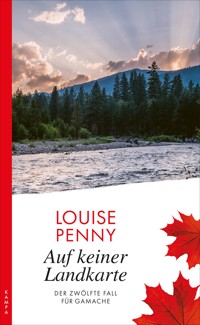Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Der Alltag kehrt zurück nach Three Pines. Das idyllische Dorf in den kanadischen Wäldern hat die Pandemie weitgehend unbeschadet überstanden. Olivier und Gabri dürfen das Bistro wieder öffnen, und Myrna schließt die Tür zum Buchladen auf. Spuren haben die vergangenen Monate trotzdem hinterlassen: Einer Professorin aus British Columbia ist es gelungen, mit ihren Theorien die Öffentlichkeit zu spalten. Chief Inspector Armand Gamache von der Sûreté du Québec beobachtet die aufgeheizte Stimmung mit Sorge. Als Professor Abigail Robinson einen Vortrag an der nahe gelegenen Université de l'Estrie halten will, soll ausgerechnet er für die Sicherheit vor Ort sorgen. Am liebsten würde er die Veranstaltung absagen lassen, doch entgegen seinen Bedenken findet sie statt. Mit fatalen Folgen. Unterdessen weilt hoher Besuch in Three Pines: die sudanesische Anwärterin auf den Friedensnobelpreis, Haniya Daoud. Doch so haben sich die Dorfbewohner eine Freiheitskämpferin nicht vorgestellt: Die »Heldin des Sudans« benimmt sich unwirsch und bissiger noch als Three Pines' schrullige Dichterin Ruth Zardo. Dann wird im Wald hinter der Auberge mitten in der Nacht Professor Robinsons Assistentin erschlagen - und etliche der Dorfbewohner könnten es gewesen sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Unruhe im Dorf
Der 17. Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Nora Petroll
Kampa
Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die während der Pandemie an vorderster Front standen, die unter oft unmöglichen Bedingungen so hart gearbeitet haben, um uns andere zu schützen. Falls ça va bien aller, so ist es dank euch.
Louise Penny, 2021
1
»Ich habe ein ungutes Gefühl, patron.« Isabelle Lacostes Stimme in seinem Headset klang besorgt und eindringlich.
Chief Inspector Gamache ließ den Blick über die aufgeregte Menge schweifen. Der Lärm in der Halle schwoll immer weiter an.
Noch vor einem Jahr wäre eine Versammlung dieser Größe nicht nur undenkbar, sondern verboten gewesen. Man hätte sie aufgelöst und jeden Einzelnen getestet. Aber dank des Impfstoffs war das tödliche Virus nun keine Bedrohung mehr. Eine Bedrohung ging nur noch von den potenziellen Ausschreitungen aus.
Niemals würde Armand Gamache den Tag vergessen, als ihn sein Freund, der Premierminister von Québec, angerufen und ihm gesagt hatte, dass ein Impfstoff gefunden sei. Er sprach unter Tränen, brachte kaum ein Wort heraus.
Als Gamache auflegte, war er leicht benommen, spürte einen Anflug von Hysterie. So hatte er sich noch nie gefühlt, jedenfalls nicht mit solcher Intensität. Es war mehr als Erleichterung, fühlte sich fast wie eine Wiedergeburt an. Auch wenn nicht jeder wiederauferstehen, nicht alles wieder zum Leben erweckt werden würde.
Nachdem die Pandemie endlich offiziell für beendet erklärt worden war, hatten sich die Bewohner von Three Pines, wo die Gamaches lebten, auf dem Dorfanger versammelt und die Namen der Toten verlesen. Die Hinterbliebenen pflanzten Bäume auf der Lichtung bei der kleinen Kirche und nannten sie von nun an den Neuen Wald.
Anschließend schloss Myrna mit großer Feierlichkeit den Buchladen auf, und Sarah öffnete wieder ihre Bäckerei. Monsieur Béliveau hängte das Ouvert-Schild in die Tür des Gemischtwarenladens, und Jubel brach los, als Olivier und Gabri den Bistrobetrieb wieder aufnahmen.
Reihenweise wurden Grills auf den Dorfanger geschoben und Burger, Hotdogs und Steaks gebraten. Sogar ein auf Zedernholz gegrillter Lachs war dabei. Sarah drapierte Gebäck, Kuchen und Butter Tarts auf einem langen Tisch, während Billy Williams half, Clara Morrows selbst gemachte Limonade eimerweise herbeizuschleppen.
Es gab Spiele für die Kinder, und später wurde auf dem Dorfanger ein großes Feuer entfacht und getanzt.
Freunde und Nachbarn lagen sich in den Armen, küssten sich sogar zur Begrüßung. Obwohl es sich komisch anfühlte, wie etwas Verbotenes. Manche zogen immer noch einen Ellbogenstoß vor. Andere trugen weiterhin Mund-Nasen-Schutz, als wäre er eine Art Glücksbringer; ein Rosenkranz, ein Hasenfuß oder ein Christophorus-Anhänger.
Als Ruth hustete, wichen alle zurück, aber das hätten sie wahrscheinlich so oder so getan.
Natürlich waren Spuren geblieben. Die zurückliegende schlimme Zeit zog einen langen Schwanz hinter sich her.
Und die Veranstaltung in der ehemaligen Universitätssporthalle unweit von Three Pines war ein Glied dieses Schwanzes.
Chief Inspector Gamache sah zu den Eingangstüren auf der gegenüberliegenden Seite der großen Halle, durch die immer noch Zuhörer hereinströmten.
»Diese Veranstaltung hätte gar nicht erst genehmigt werden dürfen«, sagte Lacoste.
Er widersprach nicht. Seiner Meinung nach war alles an der Veranstaltung der reinste Wahnsinn. Aber es nahm seinen Lauf. »Ist so weit alles unter Kontrolle?«
Lacoste antwortete nicht sofort. »Ja. Aber …«
Aber …
Gamache stand seitlich auf der Bühne und ließ den Blick durch die Halle schweifen, bis er Isabelle Lacoste entdeckte. Sie war schlicht gekleidet, der Ausweis der Sûreté du Québec hing gut sichtbar an ihrer Jacke.
Sie stand auf einer Setzstufe, um einen besseren Blick auf die wachsende Menge zu haben und die anwesenden Polizisten zu möglichen Krisenherden dirigieren zu können.
Obwohl erst Anfang dreißig, war Isabelle Lacoste eine der Erfahrensten in Gamaches Team. Sie war bei Ausschreitungen und Schießereien im Einsatz gewesen, bei Geiselnahmen und taktischen Belagerungen. Sie hatte Terroristen und Mördern gegenübergestanden. War schwer verwundet und beinahe getötet worden.
Es brauchte einiges, um Isabelle in Unruhe zu versetzen. Aber jetzt war sie eindeutig beunruhigt.
Die Zuhörer rangelten sich um die Plätze mit der besten Sicht aufs Rednerpult. Überall in der Halle kam es zu Auseinandersetzungen. Ein bisschen Gedrängel und Geschubse war in einer Ansammlung von Menschen mit gegensätzlichen Ansichten ganz normal. Das Team der Sûreté war schon mit Schlimmerem klargekommen, die Agents waren gut ausgebildet und konnten Situationen schnell entschärfen.
Aber …
Noch bevor Isabelle es ausgesprochen hatte, hatte er es selbst gespürt. Dieses Gefühl in der Magengegend. Dieses Kribbeln auf der Haut. Dieses Stechen in den Daumen …
Er sah, dass Isabelles Blick auf einen älteren Mann und eine junge Frau mitten in der Menge gerichtet war. Sie stießen sich gegenseitig die Ellbogen in die Rippen.
Nichts Gewalttätiges. Noch nicht. Außerdem bahnte sich bereits ein Polizist den Weg durch die Menge, um sie zu beschwichtigen. Warum ließ Lacoste also ausgerechnet diese beiden nicht aus den Augen?
Gamache sah genauer hin. Und spürte Gänsehaut im Nacken.
Der Mann und die Frau trugen beide den gleichen großen Button mit der Aufschrift Alles wird gut an ihren Wintermänteln.
Es war ein Slogan, der während der Pandemie aufgekommen war und inzwischen verschiedene Bedeutungen angenommen hatte. Nicht alle davon gesund, wenn man Gamache fragte.
Er stand unbeweglich da.
Während seiner dreißigjährigen Laufbahn hatte der Chief Inspector schon viele Demonstrationen und so manche Ausschreitung miterlebt. Er kannte die potenziellen Krisenherde. Die Vorboten. Und er wusste, wie schnell alles außer Kontrolle geraten konnte.
Aber so etwas hatte er in seiner gesamten Zeit als leitender Ermittler der Sûreté du Québec noch nicht gesehen.
Diese beiden, der Mann und die Frau, standen auf derselben Seite. Das zeigten die Buttons. Und dennoch richtete sich ihr Zorn, der normalerweise »den anderen« galt, auf ihr Gegenüber. Wut hing in der Luft und traf wahllos den Nächststehenden.
Die Luft in der Halle war stickig. Die Leute waren passend für die extreme Kälte draußen angezogen und schwitzten jetzt hier drinnen in ihren Parkas, Winterstiefeln, Schals und Handschuhen. Sie zogen sich die Wollmützen vom Kopf und stopften sie in die Taschen, sodass sonst gut frisierte Menschen mit ihren zerzausten Haaren aussahen, als wären sie gerade zu Tode erschrocken oder hätten einen sensationellen Geistesblitz gehabt.
Die Menge stand dicht an dicht und drohte, nicht nur körperlich, sondern auch emotional zu überhitzen. Chief Inspector Gamache konnte die angesengten Nervenenden förmlich riechen.
Frustriert blickte er auf die großen Fenster hinter Lacoste. Sie waren so mit Farbe zugekleistert, dass sie sich nicht mehr öffnen ließen, um frische Luft hereinzulassen. Sie hatten es versucht.
Gamaches geübter Blick schweifte weiter über die Menge. Registrierte, was zu sehen war und was nicht. Sein Gefühl sagte ihm, dass der Siedepunkt, der Kipppunkt noch nicht erreicht war. Als Einsatzleiter war er dafür verantwortlich, dass es dazu auch nicht kam.
Sobald sie sich dem Kipppunkt näherten, würde er die Veranstaltung abbrechen. Ihm war bewusst, dass auch das ein Risiko barg, ganz zu schweigen von der Problematik, eine Zusammenkunft aufzulösen, die nicht rechtswidrig war. Doch für ihn stand die allgemeine Sicherheit an oberster Stelle.
Die Veranstaltung zu beenden, könnte allerdings genau die Gewalt entfachen, die es zu vermeiden galt.
Eine Menschenmenge so zu lenken, dass sie sich nicht in einen Mob verwandelte, war keine Wissenschaft. Es gab Strategien; er selbst hatte Rekruten an der Sûreté-Akademie gelehrt, wie man große Veranstaltungen mit Gewaltpotenzial managte. Doch am Ende kam es immer darauf an, die Situation richtig einzuschätzen. Und auf Disziplin.
Polizeibeamte mussten nicht nur die Menge unter Kontrolle halten, sondern auch sich selbst. Als Kadett war Gamache selbst einmal Zeuge geworden, wie erfahrene Polizisten während einer Demonstration in Panik geraten waren, ausrasteten und anfingen, auf Mitbürger einzuschlagen.
Es war entsetzlich gewesen. Abscheulich.
Unter seiner Leitung war es zu so etwas noch nie gekommen, aber ausschließen ließ es sich unter den entsprechenden Umständen nicht. Den Wahnsinn von Massen mitanzusehen, war furchtbar. Der Wahnsinn von Polizisten, mit ihren Schlagstöcken und Pistolen, war noch schlimmer.
Jetzt bat Gamache die leitenden Beamten über sein Headset der Reihe nach um ihre Lageeinschätzung. Seine Stimme klang dabei ruhig und Respekt heischend.
»Inspector Lacoste, wie ist Ihre Einschätzung?«
Eine kurze Pause, während sie ihre Antwort abwägte. »Unsere Leute haben die Lage unter Kontrolle. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es riskanter, die Veranstaltung abzubrechen, als sie weiterlaufen zu lassen.«
»Merci«, sagte Gamache. »Inspector Beauvoir, wie ist die Lage draußen?«
Über Funk war er immer förmlich und sprach seine Leute mit ihrem Rang statt mit Vornamen an.
Gegen seinen Willen war Inspector Beauvoir der Posten am Eingang zugeteilt worden. Aufgebrummt, wenn man ihn fragte.
Beauvoir war Ende dreißig und durchtrainiert, auch wenn er hier und da allmählich etwas Speck ansetzte. Er teilte sich den Stellvertreterposten mit Isabelle Lacoste und war außerdem Gamaches Schwiegersohn.
»Wir werden die Raumkapazität überschreiten, patron«, berichtete er von der umgedrehten Kiste aus, auf der er stand.
Jean-Guy schirmte die Augen mit der behandschuhten Hand gegen die Sonne ab, die vom Schnee reflektiert wurde. Um sich warm zu halten, stampften die draußen Wartenden mit den Füßen und rieben die Hände aneinander. Dabei funkelten sie Beauvoir an, als wäre er persönlich schuld am Winter.
»Hier draußen sind schätzungsweise noch hundertfünfzig, vielleicht hundertachtzig Leute. Sie werden langsam ungeduldig. Manche drängeln, aber bisher noch keine Ausschreitungen.«
»Wie viele sind schon drinnen?«, fragte Gamache.
»Vierhundertsiebzig.«
»Ihr kennt das Maximum. Worauf müssen wir uns einstellen, wenn wir es erreichen?«
»Schwer zu sagen. Kinder und Familien sind anwesend. Völlig unverständlich, wie jemand ein Kind hierher …«
»Sehe ich genauso.«
Gamache hatte seine Leute angewiesen, auf Kinder besonders achtzugeben, sollte es zum Äußersten kommen.
Was natürlich ein Albtraum wäre. Leute, die sich gegenseitig zu Tode quetschten, um rein- oder rauszukommen. Und Kinder waren am verletzlichsten.
»Irgendwelche Waffen?«
»Keine Pistolen, keine Messer«, berichtete Beauvoir. »Ein paar Flaschen, außerdem haben wir etliche Schilder konfisziert. Die Leute waren ganz schön sauer. Als würde die kanadische Verfassung das Mitführen schlagstockähnlicher Gegenstände in überfüllten Räumlichkeiten erlauben …« Er blickte auf den Haufen, der vor der Backsteinwand im Schnee lag.
Die meisten Schilder waren selbst gemacht, mit Buntstift geschrieben und an Holzstöcke getackert. Irgendwie wirkten Drohungen in Buntstift noch schlimmer. Manche waren sogar das Werk von Kindern, mit der Aufschrift Ça va bien aller.
Alles wird gut.
Das reichte schon, um Beauvoirs Blut in Wallung zu bringen. Während der hinter ihnen liegenden Pandemie war der Satz ein Quell des Trosts gewesen, jetzt hatten ihn sich diese Leute angeeignet, ihn zu einem Geheimcode umgemünzt, zu einer subtilen Drohung. Und noch schlimmer: Sie zogen ihre Kinder mit hinein.
Beauvoir ließ den Blick über die Menge vor den Türen schweifen. Vereinzelt fingen Leute an, andere zu schubsen, da ihnen wohl allmählich dämmerte, dass sie nicht mehr reingelassen würden.
»Hier draußen spitzt sich die Lage zu«, sagte er. »Ich glaube, wir sollten abbrechen, patron.«
»Merci«, sagte Gamache und seufzte.
Zwar würde er den Rat berücksichtigen, und vielleicht hatte Jean-Guy sogar recht, aber in diesem speziellen Fall vertraute Gamache der Einschätzung seines Stellvertreters nicht uneingeschränkt. Sie war höchstwahrscheinlich getrübt von seinen Gefühlen. Weshalb Beauvoir auch draußen statt drinnen positioniert war.
Gamache sah auf seine Armbanduhr. Fünf Minuten vor vier.
Er musste eine Entscheidung treffen. Die Veranstaltung laufen lassen oder nicht.
Er blickte noch einmal hinter sich zu den zwei Frauen mittleren Alters, die in der Dunkelheit nebeneinanderstanden.
Die linke, in schwarzer Hose und grauem Rollkragenpulli, hielt ein Klemmbrett im Arm und sah besorgt aus.
Aber es war die andere, die Gamaches Aufmerksamkeit auf sich zog.
Professor Abigail Robinson nickte, während sie der Frau neben sich zuhörte. Sie legte die Hand auf ihren Arm und lächelte. Sie war ruhig. Fokussiert.
Sie trug einen hellblauen Kaschmirpullover und einen knielangen kamelhaarfarbenen Rock. Maßgeschneidert. Schlicht, klassisch. Etwas, dachte er, das auch seine Frau Reine-Marie tragen würde.
Kein angenehmer Gedanke.
Die Universitätsprofessorin für Statistik war der Grund, weshalb all diese Menschen an einem bitterkalten Dezembertag den Weg hierher auf sich genommen hatten.
Sie hätten Ski oder Schlittschuh fahren oder mit einer heißen Schokolade vor dem Kamin sitzen können. Stattdessen waren sie hier, zusammengepfercht. Drängelnd und schubsend. In der Hoffnung, einen guten Blick auf die Statistikerin zu ergattern.
Manche waren gekommen, um zu jubeln, andere, um zu buhen und zu protestieren. Manche, um zuzuhören, andere, um zu stören.
Und einige vielleicht – vielleicht auch nur ein Einziger –, um Schlimmeres zu tun.
Der Chief Inspector hatte die Frau, die gleich die Bühne betreten würde, noch nicht persönlich kennengelernt, obwohl ihre Assistentin, die sich als Debbie Schneider vorgestellt hatte, es ihm bei ihrer Ankunft angeboten hatte, was einem gnädigen Gefallen gleichzukommen schien, einer seltenen persönlichen Audienz.
Er hatte abgelehnt und erklärt, er müsse sich auf seinen Job konzentrieren. Was auch stimmte.
Aber er gestand sich ehrlich ein, dass er bei jeder anderen Person Ja gesagt hätte. Sogar darum gebeten hätte, sie oder ihn kennenzulernen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu besprechen. Ein paar Regeln aufzustellen. Der Person in die Augen zu sehen und diese persönliche Verbindung herzustellen zwischen Beschützer und zu Beschützendem.
Zum ersten Mal in seiner Laufbahn hatte er – höflich – abgelehnt, die Person kennenzulernen, deren Leben in seiner Hand lag. Stattdessen hatte er die Vorkehrungen mit Madame Schneider besprochen und es dabei belassen.
Er drehte sich wieder zurück zur Menge. Die Sonne ging bereits unter. In zwanzig Minuten würde es dunkel sein.
»Es läuft weiter«, sagte er.
»Oui, patron.«
2
Gamache ging noch einmal den Bereich hinter der Bühne ab, sprach mit den dort positionierten Polizisten und überprüfte die Türen und dunklen Ecken. Außerdem bat er den Lichttechniker um hellere Beleuchtung.
»Wer sind diese Leute?«, fragte die Tontechnikerin und deutete mit dem Kopf auf die Menge. »Wer veranstaltet bitte so ein Event zwischen Weihnachten und Neujahr? Und wer besucht es auch noch?«
Das war eine gute Frage.
Gamache entdeckte ein paar vertraute Gesichter unter den Anwesenden. Gute, anständige Leute. Einige von ihnen trugen Buttons. Andere nicht.
Manche von ihnen waren seine Nachbarn, Freunde sogar. Aber den weitaus größeren Teil kannte er nicht.
Die Québecer hatten feste Ansichten und scheuten sich nicht, sie kundzutun. Was gut war. Es bedeutete, das Québec etwas richtig machte, schließlich war es das Ziel jeder gesunden Gesellschaft, allen Bürgern freie Meinungsäußerung zu ermöglichen, auch wenn diese Meinung unliebsam war.
Doch selbst die freie Meinungsäußerung hatte Grenzen. Und Armand Gamache wusste, dass er gerade genau auf dieser Grenze stand.
Falls er auch nur eine Sekunde lang gedacht hatte, dass er vielleicht überreagierte, so war jeglicher Zweifel ausgeräumt worden, als er vor ein paar Stunden gemeinsam mit Beauvoir und Lacoste zur finalen Ortsbegehung eingetroffen war.
Sie waren überrascht gewesen, dass bei ihrer Ankunft bereits Autos auf dem Parkplatz standen und sich vor der Tür eine Schlange gebildet hatte. Die Wartenden traten in der bitteren Kälte von einem Bein aufs andere, schüttelten die Arme und rieben die Hände in den Fäustlingen aneinander. Über ihnen hingen Atemwolken wie milchige Gedanken.
Bis Veranstaltungsbeginn dauerte es noch Stunden.
Gamache hatte seine Handschuhe abgestreift, sein Notizheft hervorgeholt, einzelne Seiten herausgerissen und den Wartenden eine Nummer entsprechend ihrer Position in der Schlange zugeteilt. Unter die Nummer setzte er seine Initialen.
»Gehen Sie nach Hause und wärmen Sie sich auf. Zeigen Sie Ihre Nummer später an der Tür vor, dann werden Sie sofort reingelassen.«
»Geht nicht«, sagte eine Frau ganz vorn in der Schlange, als sie den Zettel entgegennahm. »Wir sind aus Moncton gekommen.«
»Moncton in New Brunswick?«, fragte Beauvoir.
»Ja«, sagte ihr Mann. »Sind die ganze Nacht durchgefahren.«
Inzwischen drängelten sich andere nach vorn, um eine Nummer zu ergattern, als wären sie am Verhungern und der Zettel etwas Essbares.
»Das Café im Ort hat geöffnet«, sagte Isabelle Lacoste. »Essen Sie dort etwas zu Mittag und kommen Sie um halb vier wieder, wenn der Einlass beginnt.«
Einige taten wie geheißen. Aber die meisten beschlossen, zu bleiben und sich abwechselnd im Auto aufzuwärmen.
Als die Sûreté-Beamten das Gebäude betraten, murmelte Lacoste: »Wann wurde dieser Zorn gesät,/und auf welchem Grund.«
Ein treffendes Zitat aus einem Gedicht von ihrer beider Freundin Ruth Zardo. Doch sie wussten genau, wer den Zorn gesät hatte, der nun auf dem Grund zu ihren Füßen Wurzeln schlug.
Weder Vergnügen noch Optimismus noch die Aussicht auf Spaß hatte das Paar dazu bewogen, fast tausend Kilometer durch die Nacht über verschneite, eisige Straßen in die Nachbarprovinz zu fahren.
Nicht Freude hatte die Wartenden aus ihren Sesseln vor dem Kamin gelockt. Sie dazu gebracht, ihre Familien zurückzulassen. Die Weihnachtsbäume noch hell erleuchtet und bunt geschmückt, die Reste des Weihnachtsschmauses im Kühlschrank. Die Silvestervorbereitungen unvollendet.
Um in der beißenden Kälte zu stehen.
Sondern Samen des Zorns, gesät von einer eloquenten Statistikerin.
Der Hausmeister, Éric Viau, wartete in der alten Sporthalle auf sie. Gamache hatte sich vor zwei Tagen schon einmal mit ihm getroffen, als er mit diesem unerwarteten Einsatz betraut worden war.
Er war gerade mit Reine-Marie und zwei ihrer Enkelinnen auf der Eislauffläche auf dem Dorfanger von Three Pines gewesen. Er trug Schlittschuhe und kniete, um der achtjährigen Florence die Schlittschuhe zuzubinden, während Reine-Marie sich um die der kleinen Zora kümmerte.
Es waren ihre ersten. Ein Weihnachtsgeschenk der Großeltern.
Florence mit ihren vor Kälte geröteten Wangen konnte es kaum erwarten, sich unter die anderen Kinder auf der Eislauffläche zu mischen. Ihre jüngere Schwester, Zora, war schweigsam und misstrauisch. Sie schien überhaupt nicht überzeugt von der Idee, sich riesige Rasiermesser unter die Füße zu schnallen und damit über einen zugefrorenen Teich zu laufen. Geschweige denn, dass es Spaß machen könnte.
»Dad«, rief jemand vom Haus der Gamaches.
»Ja?«
Daniel, groß und kräftig, stand in Jeans und kariertem Flanellhemd auf der Veranda. Er hielt ein Telefon in die Höhe. »Ein Anruf für dich. Beruflich.«
»Würdest du den Anrufer bitten, eine Nachricht zu hinterlassen, s’il te plaît?«
»Hab ich versucht, aber es scheint wichtig zu sein.«
Armand richtete sich auf und schwankte dabei leicht auf den Schlittschuhen. »Klingt Panik durch?«
»Nein.«
»Dann sag bitte, dass ich auch gerade etwas Wichtiges zu tun habe und dass ich in zwanzig Minuten zurückrufe.«
»D’accord.« Daniel verschwand nach drinnen.
»Vielleicht kann Jean-Guy drangehen?«, schlug Reine-Marie vor, die sich ebenfalls aufgerichtet hatte und weitaus sicherer auf ihren Schlittschuhen stand als ihr Ehemann.
Sie sahen zum Hügel hinter dem Dorf. Ihr Schwiegersohn stapfte mit seinem Sohn gerade wieder den Hang hinauf. Jean-Guy zog den neuen Schlitten hinter sich her, Père Noëls Geschenk an Honoré.
Bei seiner allerersten Schlittenfahrt hatte sich der Junge an seinen Vater geklammert und ununterbrochen geschrien. Ein Freudenjauchzer, als Henri, der Schäferhund der Gamaches, ihnen hinterhersprang.
Sie waren den Hang hinabgesaust, vorbei am Neuen Wald und der Kirche St. Thomas, vorbei an den Feldstein- und Backsteinhäusern mit den Schindeldächern. Um am Ende lachend in den weichen Schnee auf dem Dorfanger zu purzeln.
»Dein Enkel hat ein beeindruckendes Organ«, sagte Clara Morrow zu ihm. Sie stand mit ihrer besten Freundin, Myrna Landers, vor deren Buchladen. Beide wärmten sich die Hände an einem Rum Toddy.
»Täusche ich mich oder hat er tatsächlich ein Wort geschrien?«, fragte Myrna.
»Nein«, beeilte sich Reine-Marie zu antworten, ohne ihrer Freundin dabei in die Augen zu sehen. »Er hat einfach nur geschrien.«
Genau in dem Moment fuhren Honoré und sein Vater wieder los, und ein gellender Schrei zerschnitt die Luft.
»Guter Junge«, sagte Ruth, die alte Dichterin, die zwischen Florence und Zora auf der Bank saß und ihre Ente Rosa im Arm hielt.
»Was ruft Honoré da, papa?«, fragte Florence.
»Er klingt wie Rosa«, sagte Zora. »Was bedeutet ›fu…‹?«
»Das erklär ich dir später«, fiel ihr Armand ins Wort und warf Ruth einen bösen Blick zu. Doch die gluckste nur, während Rosa »Fuck, fuck, fuck« murmelte und selbstzufrieden dreinblickte. Aber das taten Enten oft.
Zwischen Armand und Rosa schossen tödliche Blicke hin und her, bis er blinzeln musste.
Jetzt stützten Armand und Reine-Marie ihre Enkelinnen, während sie ihre ersten schlitternden und stolpernden Schritte auf dem Eis machten. Der Anfang einer lebenslangen Schlittschuhlaufleidenschaft. Und eines Tages würden sie es ihren Enkelinnen beibringen.
»Guckt mal, guckt mal!«, rief Florence. »Guckt, wie ich laufe! Fffu…«
»Ja«, unterbrach sie ihr Großvater, und Ruth auf der Bank versuchte nicht einmal, ihr Vergnügen zu verbergen.
Es war Mittag, und Clara hatte sie alle zum Lunch eingeladen. Erbsensuppe, ofenwarmes Brot, eine Auswahl Québecer Käse und Kuchen aus Sarahs Bäckerei.
»Und heiße Schokolade«, sagte Clara.
»Hoffentlich meint sie damit Schnaps«, sagte Ruth und hievte sich von der Bank hoch.
Armand brachte die Schlittschuhe nach Hause und fand im Arbeitszimmer die Nachricht, die Daniel ihm hingelegt hatte. Sie kam von Chief Superintendent Madeleine Toussaint, die vom Ski-Chalet in Mont-Tremblant aus angerufen hatte.
Er rief zurück und hörte überrascht zu, als sie ihm schilderte, worum es ging.
»Ein Vortrag? Von einer Statistikerin?«, fragte er. Durchs Fenster konnte er seine Familie über den Dorfanger zu Claras kleinem Cottage stapfen sehen. »Kann sich nicht die Campuspolizei darum kümmern?«
»Kennen Sie diese Abigail Robinson?«, fragte ihn seine Vorgesetzte.
Gamache hatte den Namen schon mal gehört, konnte ihn aber nicht recht einordnen. »Nein, ich glaube nicht.«
»Dann sollten Sie sie vielleicht mal googeln. Voyons, Armand, es tut mir wirklich leid. Die Universität ist nicht weit von Three Pines, und es ist nur ein einstündiger Vortrag. Ich würde Sie nicht darum bitten, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass es ein einfacher Einsatz wird. Und, na ja, da ist noch etwas.«
»Ja?«
»Sie persönlich wurden angefragt.«
»Von wem?«
»Jemandem von der Universität. Es klang, als wären Sie miteinander bekannt.«
Bekannt, dachte Gamache, und fragte sich, wer es sein könnte. Er war mit einer ganze Reihe Professoren bekannt.
Anschließend hatte Gamache geduscht, sich umgezogen, schnell eine Nachricht für Reine-Marie geschrieben und war dann die paar Kilometer zur Universität gefahren, um mit dem Hausmeister zu sprechen.
Der Veranstaltungsort war die ehemalige Sporthalle der Université de l’Estrie. Seit dem Bau einer neuen Halle wurde die alte nicht mehr benutzt und nur noch für lokale Events vermietet: Benefizbälle, Wiedersehenstreffen, Kundgebungen. Im Spätsommer waren Armand und Reine-Marie dort bei einem Dinner gewesen. Das erste Indoor-Event, das seit dem offiziellen Ende der Pandemie erlaubt worden war, eine Spendenveranstaltung für Ärzte ohne Grenzen. Die zu den vielen Organisationen gehörten, die während der Krise einen starken Rückgang an Spenden verzeichnen mussten.
Aber das war vor Monaten gewesen.
Armand klopfte sich den Schnee von den Stiefeln und stellte sich dem Hausmeister vor. Er und Monsieur Viau standen mitten in der großen Sporthalle, auf deren Boden noch der verblichene Kreis des Centrecourt sichtbar war. Der unverkennbare moschusartige Geruch von Teenagerschweiß hing in der Luft. Er ließ sich nicht vertreiben, auch wenn diejenigen, von denen er stammte, inzwischen wahrscheinlich selbst Eltern waren.
An dem einen Ende des rechteckigen Raums stand eine Bühne, gegenüber befanden sich mehrere Eingangstüren, und über eine Seite zogen sich Fenster.
»Wie viele Leute passen hier rein?« Gamaches Stimme hallte durch den leeren Raum.
»Das weiß ich nicht. Bisher war das immer irrelevant. Die Halle war noch nie annähernd voll.«
»Die Feuerwehr hat Ihnen keine Kapazität genannt?«
»Sie meinen, die freiwillige Feuerwehr? Nein.«
»Könnten Sie nachfragen?«
»Ja, aber ich kenne die Antwort. Ich bin der Feuerwehrhauptmann. Sehen Sie, ich kann Ihnen versichern, dass das Gebäude den Vorschriften entspricht. Alarmanlagen, Feuerlöscher, Notausgänge … funktioniert alles einwandfrei.«
Gamache lächelte und legte die Hand auf den Arm des Mannes. »Das ist nicht als Kritik gemeint. Es tut mir leid, diese Fragen stellen zu müssen und Sie in Ihrem Urlaub zu stören.«
Der Mann entspannte sich. »Ich schätze, Sie können sich auch was Schöneres vorstellen.«
Da war etwas dran. Als Armand bei der Sporthalle angekommen war, war er im Auto sitzen geblieben und hatte seine Nachrichten gecheckt. Reine-Marie hatte ein Foto von Claras Lunch geschickt, von ihrer gemeinsamen Tochter Annie und ihrer Enkelin Idola mit einem Rentiergeweih auf dem Kopf.
Er hatte gelächelt und mit dem Finger Idolas Gesicht berührt. Dann hatte er das Handy in die Tasche gesteckt und war in die Halle gegangen.
Je eher er anfing, desto schneller konnte er nach Hause. Vielleicht war dann sogar noch etwas Kuchen übrig.
»Warum diese Buchung angenommen wurde, weiß ich nicht«, sagte der Hausmeister, während er den Chief Inspector herumführte. »Zwei Tage vor Neujahr. Und auch noch so kurzfristig. Ich hab die E-Mail erst gestern Abend bekommen, zur Hölle. Scheißrücksichtslos, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise. Wer ist diese Person überhaupt? Hab noch nie von ihr gehört. Eine Sängerin? Brauchen die mehr als ein Mikrophon? Mir wurde rein gar nichts gesagt.«
»Sie ist Dozentin einer anderen Universität. Ihr Vortrag wird auf Englisch sein. Ein Rednerpult und ein Mikrophon sollten reichen.«
Monsieur Viau starrte ihn an. »Ein Vortrag? Auf Englisch? Ich soll den Skiausflug mit meiner Familie sausen lassen, weil jemand einen Vortrag halten will?« Seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter. »Machen Sie Witze?«
»Bedauerlicherweise nein.«
»Herrgott«, sagte der Hausmeister, »gab’s denn keinen begehbaren Kleiderschrank, den sie hätte mieten können? Und weshalb sind Sie eigentlich hier? Von der Sûreté. Worüber spricht sie?«
»Statistik.«
»Um Himmels willen, da kommt doch keine Sau. Was für eine Zeitverschwendung.«
Gamache kletterte auf die Bühne und ließ den Blick durch die leere Halle schweifen.
Er war derselben Meinung wie der Hausmeister. Wenn fünfzig Leute kämen, wäre das schon eine Überraschung. Aber Armand Gamache war ein vorsichtiger Mann. Das Resultat dreier Jahrzehnte, in denen er in die überraschten Gesichter toter Menschen geblickt hatte.
»Ich kümmere mich um die Raumteiler, Chief Inspector«, sagte Monsieur Viau.
Sie verließen die Bühne und gingen zum Haupteingang, dessen Türgriffe eisverkrustet waren.
»Haben Sie zufällig einen Gebäudeplan?«
»Ja, in meinem Büro.«
Viau kam mit einigen Papierrollen zurück, die er Gamache in die Hand drückte. Bevor der Hausmeister sich verabschiedete, musterte er den Polizisten.
Natürlich hatte er Gamaches Namen erkannt, als er ihn wegen des Treffens angerufen hatte. Und er hatte den Mann erkannt, als er eingetroffen war. Seltsam, wenn jemand in Fleisch und Blut vor einem stand, den man so oft im Fernsehen gesehen hatte, während der Pandemie und auch vorher schon. Monsieur Viau hatte zwar gehört, dass der Leiter der Mordkommission der Sûreté in der Gegend wohnte, aber begegnet war er ihm nie. Bis jetzt.
Was er sah, war ein großer Mann im Parka. Etwas über eins achtzig. Nicht dick, aber kräftig. Wahrscheinlich Mitte, Ende fünfzig. Graues Haar, das sich über den Ohren leicht wellte. Und natürlich die unverkennbare, tiefe Narbe an seiner Schläfe.
Das Gesicht des Polizisten war nicht gerade faltig, aber von Linien durchzogen. Und Viau konnte sich denken, woher sie stammten.
Sie gingen nach draußen, und obwohl sie auf die Kälte vorbereitet waren, verschlug sie ihnen den Atem. Sie schnitt ihnen ins Gesicht und ließ ihre Augen tränen. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen, als der Hausmeister den Chief Inspector zum Auto begleitete.
»Warum sind Sie wirklich hier?«
Gamache kniff die Augen zusammen. Die Schneewehen reflektierten so viel grelles Sonnenlicht, dass er nahezu geblendet war.
»Dasselbe habe ich meine Vorgesetzte auch gefragt«, sagte er mit einem Lächeln. »Um ehrlich zu sein, Monsieur Viau, weiß ich es selbst nicht.«
Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Armand Gamache noch keine Recherchen über die Person angestellt, die auf dem Podium stehen würde. Und darüber, was sie und ihre Statistiken sagten.
Jetzt, kurz vor Beginn des Events, ließ Chief Inspector Gamache den Blick über die Köpfe der Menge schweifen, und er sah Monsieur Viau neben den Eingangstüren stehen. Auf seinen Mopp gestützt, beobachtete er fassungslos die hereinströmenden Leute.
Gamache hatte anhand der Gebäudepläne berechnet, dass die Halle maximal sechshundertfünfzig stehende Menschen fassen konnte. Er rundete ab auf fünfhundert, im Glauben, dass sie diese Zahl nicht annähernd erreichen würden.
Aber als er weiter recherchierte, beschlichen ihn Zweifel.
Abends, wenn alle anderen zu Bett gegangen waren, schaute er sich Videos von Professor Robinsons bisherigen Vorträgen an. Viele davon waren in den letzten Wochen viral gegangen.
Was ein trockenes Herunterrattern von Statistiken hätte sein können, war zu einer nahezu messianischen Botschaft an eine verzweifelte, hoffnungshungrige Bevölkerung geworden.
Die Pandemie war zwar vorbei, doch die Menschen waren ausgelaugt. Sie hatten die Selbstdisziplin satt, die Selbstisolation. Das Social Distancing und das Maskentragen. Sie waren erschöpft, zutiefst verstört von der monatelang anhaltenden Sorge um ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Großeltern. Um sich selbst.
Sie waren erschüttert vom Verlust ihrer Angehörigen, vom Verlust ihrer Freunde. Sie hatten Jobs und Lieblingstreffpunkte verloren. Sie hatten es satt, isoliert zu sein und vor Einsamkeit und Verzweiflung an den Rand des Wahnsinns getrieben zu werden.
Sie hatten es satt, Angst zu haben.
Professor Abigail Robinson zeigte mit ihren Statistiken, dass bessere Zeiten bevorstanden. Dass die Wirtschaft sich erholen und stärker denn je sein würde. Dass das Gesundheitssystem alle Bedürfnisse erfüllen konnte. Dass es keine Knappheit an Betten, medizinischen Geräten oder Medizin mehr geben würde. Nie wieder.
Und statt Hunderte von Opfern musste die Bevölkerung nur eins bringen.
Und genau dieses »nur eins« war das Problem.
Ihr Bericht war von der kanadischen Regierung in Auftrag gegeben worden. Von der Royal Commission, die die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sowie die getroffenen Entscheidungen untersuchte. Professor Robinson, Wissenschaftlerin und Inhaberin des Lehrstuhls für Statistik einer Universität im Westen des Landes, war damit beauftragt worden, Korrelationen aufzuzeigen und Empfehlungen zu geben.
Um die Ecke gekommen war sie mit einer einzigen.
Aber nach der Lektüre ihres Berichts hatte die Royal Commission die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse abgelehnt.
Also hatte Professor Robinson entschieden, es selbst in die Hand zu nehmen. Sie hielt ein kleines Seminar für ihre Statistikkollegen, das online gestreamt wurde, sodass es auch diejenigen erreichte, die nicht vor Ort sein konnten.
Armand hatte das Video aufgerufen und zugesehen, wie Abigail Robinson vor ihren Tabellen und Schaubildern stand. Ihre Stimme war warm, ihr Blick intelligent, während sie über Todesfälle, Überlebensraten und Ressourcen sprach.
Auch andere hatten den Stream aufgerufen. Nicht nur Akademiker, sondern die breite Masse. Das Video war tausendfach geteilt worden. Es folgten Einladungen an Professor Robinson, weitere Vorträge zu halten. Größere Vorträge. Und noch größere.
Ihre Botschaft lief auf drei Worte hinaus, die nun T-Shirts, Kappen und runde Buttons schmückten.
Alles wird gut.
Was als trockene Untersuchung begonnen hatte, für einen Aktenschrank der Regierung bestimmt, hatte sich verselbstständigt. War öffentlich geworden. Viral gegangen. Hatte eine Randbewegung ausgelöst. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie zur Massenbewegung würde. Genau wie die Pandemie verbreitete sich Professor Robinsons Kunde rasant. Erreichte Menschen, die empfänglich waren für genau diese seltsame Mischung aus Hoffnung für die Zukunft und Angst vor dem, was geschehen könnte, wenn sie Robinsons Rat nicht befolgten.
Alles wird gut sein, und alle werden gut sein, und aller Art Dinge wird gut sein.
Das war ein Zitat der von Gamache sehr geschätzten christlichen Mystikerin Juliana von Norwich. Die den Menschen in Zeiten großen Leids Hoffnung gegeben hatte.
Aber im Gegensatz zu Juliana von Norwich hatte Professor Robinsons Aussage einen dunklen Kern. Wenn Robinson »Alles wird gut« sagte, meinte sie in Wirklichkeit nicht alles. Oder alle.
Nach und nach tauchten bei ihren Veranstaltungen andere Buttons auf, mit deren Verkaufserlösen etwas finanziert wurde, was sich, wie Gamache in seinem ruhigen Arbeitszimmer neben dem vom Weihnachtsbaum erleuchteten Wohnzimmer erkannte, von einer statistischen Untersuchung zu einem Streitfall und schließlich zu einem Kreuzzug entwickelte.
Auf den neuen Buttons, getragen von Robinsons Anhängern, stand ein sehr viel düstereres Zitat. Eines, das Gamache ebenfalls kannte. Eine Gedichtzeile von einer verrückten, wenn auch genialen alten Dichterin. Mit einer geisteskranken Ente.
Oder wird es, wie immer, ZUSPÄT sein? Das »ZUSPÄT« fett und in Großbuchstaben. Wie ein Ausruf. Ein gellender Schrei. Gleichzeitig Warnung und Anschuldigung.
Innerhalb weniger Monate war ein wissenschaftliches Untersuchungsprojekt zu einer Bewegung ausgeartet. Eine undurchsichtige Wissenschaftlerin war zu einer Prophetin geworden.
Und Hoffnung war in Empörung umgeschlagen, während sich zwei Lager bildeten und aufeinander losgingen. Da waren diejenigen, die in Professor Robinsons Vorschlag den einzigen Weg nach vorn sahen. Eine barmherzige und praktikable Lösung. Und diejenigen, die darin eine Gräueltat sahen. Eine beschämende Verletzung von allem, was sie als heilig erachteten.
Während der Lärm in der Halle anschwoll, blickte Gamache zu der Frau mittleren Alters, die darauf wartete, die Bühne zu betreten, und er fragte sich, ob die Prophetin zum Messias werden würde. Oder zur Märtyrerin.
3
Am Abend vor der Veranstaltung, nachdem die Kinder gebadet im Bett lagen und es still geworden war im Haus, hatte sich Jean-Guy Beauvoir zu seinem Schwiegervater ins Arbeitszimmer gesellt.
Eigentlich war er auf dem Weg in die Küche gewesen, um das letzte Mince-Pie-Törtchen zu stibitzen, als er den Lichtspalt unter der Arbeitszimmertür bemerkte.
Er zögerte kurz, bevor er klopfte.
»Entrez.«
Jean-Guys dunkles Haar zeigte inzwischen erste graue Strähnen, und ein paar Fältchen zogen sich durch sein attraktives Gesicht. Seine Wangen waren rosig nach dem windigen Tag draußen in der Sonne. Obwohl er es lieber »wettergegerbt« nannte.
Jetzt blickte er auf den Teller in seiner Hand. Ein Klecks Soße schmolz auf dem duftenden Mince-Pie-Törtchen, das Jean-Guy in der Mikrowelle aufgewärmt hatte.
Er schluckte das Wasser hinunter, das ihm im Mund zusammenlief, und stellte den Teller vor seinen Schwiegervater auf den Tisch.
»Hier. Myrna hat sie vorhin vorbeigebracht, als wir die Schneefestung gebaut haben und du ein Nickerchen gemacht hast.«
Jean-Guy lächelte. Er wusste genau, dass sein Schwiegervater gearbeitet hatte. Er hatte angeboten, ihn zur Sporthalle zu begleiten, doch in diesem seltenen Fall hatte Armand gesagt, er solle lieber seinen Urlaub genießen. Und in diesem seltenen Fall hatte sich Beauvoir bereitwillig gefügt.
Jean-Guy und seine Familie waren von Paris zurück nach Montréal gezogen, wo er vor Kurzem wieder der Sûreté beigetreten war und sich mit Isabelle Lacoste die Aufgaben des stellvertretenden Leiters der Mordkommission teilte. Nach den Einschränkungen und den Schrecken der Pandemie war dieses Weihnachten in Three Pines eine willkommene Erholung. Eine Erleichterung.
Zu Hause angekommen, waren die Kinder in warme, trockene Kleider geschlüpft und hatten sich mit einer heißen Schokolade aufs Sofa gesetzt, während Henri und der alte Fred, die beiden Hunde, neben dem Kamin schliefen. Zusammen mit Gracie, die möglicherweise ein Hund war, vielleicht aber auch ein Frettchen.
Die Dorfbewohner waren sich sicher, dass das kleine Geschöpf ein Streifenhörnchen war. Doch Armands Patenonkel Stephen Horowitz, der inzwischen bei ihnen wohnte, bestand mit großer Freude darauf, dass sie eine Ratte sei.
»Die sind sehr intelligent, wisst ihr«, erklärte der Dreiundneunzigjährige den Kindern, als sie neben dem ehemaligen Finanzier aufs Sofa kletterten.
»Woher weißt du das?«, fragte Zora, die Ernste.
»Weil ich mal eine war.«
»Du warst eine Ratte?«, fragte Zora.
»Ja. Eine große fette, mit einem langen haarlosen Schwanz.«
Die Kinder bekamen große Augen, als er ihnen von seinen Abenteuern als Ratte an der Wall Street und der Bay Street erzählte. An der Rue Saint-Jacques in Montréal und an der Börse in Paris.
Das war am Nachmittag gewesen. Jetzt lagen sie alle im Bett und schliefen.
Obwohl sich eines der Kinder immer noch hin und her warf.
Armand klickte auf seinem Bildschirm auf Pause und hob den Blick. Er vernahm das vertraute Knarren und Knarzen, mit dem bei fallenden Temperaturen der Frost ins Gebälk des alten Hauses kroch. Zu wissen, dass seine Familie sicher in ihren Betten lag, hatte etwas zutiefst Befriedigendes.
»Merci.« Armand deutete mit dem Kopf auf das Törtchen und lächelte Jean-Guy dankbar an.
Dann nahm er seine Brille ab und rieb sich die Augen.
»Ist das die Person, für deren Sicherheit gesorgt werden soll?«, fragte Jean-Guy, setzte sich und deutete auf den Computer.
»Ja.«
Armands Antwort war ungewöhnlich knapp, daher schenkte Jean-Guy dem Standbild auf dem Bildschirm jetzt mehr Aufmerksamkeit.
Es zeigte eine Frau mittleren Alters hinter einem Rednerpult. Sie lächelte. Ein freundliches, offenes Lächeln. Da war keine Bosheit, keine Tücke. Es wirkte weder selbstgefällig noch wahnsinnig. Sie sah nett aus.
»Stimmt etwas nicht?«
Jean-Guy sah seinen Schwiegervater an, der zutiefst beunruhigt wirkte.
Armand warf seine Brille auf den Schreibtisch und deutete mit dem Kinn auf den Bildschirm. »Das ist eine Aufnahme von Abigail Robinsons letzter Veranstaltung kurz vor Weihnachten. Ich habe sie mir heute Nachmittag angesehen und daraufhin den Rektor der Universität angerufen und ihn gebeten, den Vortrag morgen abzublasen.«
»Wirklich? Was hat er gesagt?«
»Dass ich überreagiere.«
Armand hatte dem Rektor glauben wollen. Er wollte die Gebäudepläne zusammenrollen, sein Notizbuch zuklappen, seinen Parka anziehen und bei seiner Familie sein.
Er wollte neben seinen Enkelkindern auf dem Sofa sitzen, eine schwere Decke über den Beinen, und zusehen, wie Glorias Schweif hin und her schlug, wenn das Pferd den großen roten Schlitten Richtung Norden aus dem Dorf zog.
Stattdessen war er ins Auto gestiegen und nach North Harley gefahren, um mit der Kanzlerin der Universität zu sprechen.
4
Chief Inspector Gamache zog Parka und Stiefel aus und folgte der Kanzlerin in ihr Wohnzimmer.
»S’il vous plaît, Armand.« Chancellor Roberge deutete auf einen bequemen Sessel neben dem Kamin.
An den Wänden reihten sich Bücher, und über dem Kaminsims hing ein Gemälde von A.Y. Jackson. Gamache warf einen kurzen Blick darauf, ging aber weiter zu den Fenstertüren auf der gegenüberliegenden Seite des großzügigen Raums. Als er davorstand, verschränkte er die Hände hinter dem Rücken und blickte über den Lac Massawippi. Der große, von Wald umschlossene See war zugefroren. Ein riesiges weiß glitzerndes Feld. Bis auf ein rechteckiges Stück am Ufer, direkt vor dem Haus. Hier war die oberste Eisschicht abgetragen und die Fläche anschließend geflutet worden, sodass ein Eislaufplatz entstand, als das Wasser wieder gefror.
Ein Eishockeyspiel war in vollem Gang, auch wenn Armand sich nicht erklären konnte, wie die Spieler wussten, wer zu welchem Team gehörte. Sie trugen alle Pullover der Canadiens de Montréal, der Habs.
»Ihre Familie?«, fragte er, als Chancellor Roberge sich neben ihn stellte.
»Und ein paar Nachbarskinder, aber ja, vor allem meine Enkel. Sie und Reine-Marie haben inzwischen auch ein paar.«
»Vier.«
»Vier? Reicht noch nicht ganz für eine Eishockeymannschaft, aber fast.«
»Sie sind heute zum ersten Mal Schlittschuh gelaufen«, sagte er und ging jetzt zu den Sesseln. »Wenn man Eishockey doch nur auf Händen und Knien spielen könnte.«
Das Zimmer war warm und einladend. Es passte zu Colette Roberge.
Sie hatte seit zwei Jahren die hauptsächlich repräsentative Position der Universitätskanzlerin inne. Davor war sie bis zu ihrer Emeritierung Dekanin des Fachbereichs Mathematik gewesen.
Er betrachtete sie als Freundin, wenn auch nicht als enge.
»Kaffee?«, fragte sie.
»Non, merci.«
»Tee?«
»Nichts, danke, Colette.« Er lächelte und wartete, bis sie sich gesetzt hatte, bevor er selbst Platz nahm. »Wie geht es Jean-Paul? Ich würde ihm gern Hallo sagen.«
»Er ist am See und spielt den Schiedsrichter. Wie geht es Ihrer Familie? Sind alle wohlbehalten durch die Pandemie gekommen?«
»Ja, ihnen geht es prächtig. Danke.«
»Und Stephen? Nach dem, was in Paris passiert ist?«
»Ganz der Alte.«
»Das kann nicht gut sein«, sagte sie mit einem Lächeln.
Mit inzwischen Mitte siebzig war Chancellor Roberge eine unermüdliche Fürsprecherin der Universität und eine fähige Akademikerin. Selbst jetzt, während ihres Urlaubs, hatte sie sich die Zeit genommen, ihn zu empfangen, als hätte sie ihn erwartet.
Und vielleicht, dachte er, hatte sie das auch.
»Was kann ich für Sie tun, Armand?«
»Es geht um Abigail Robinson.«
Sie hob leicht die nachgezogenen Augenbrauen. Faltete die manikürten Hände und presste sie sanft zusammen. Aber ihr Gesicht blieb freundlich.
Die Kanzlerin war klug genug, keine Unwissenheit vorzutäuschen.
»Ja? Was ist mit ihr?«
»Sie wissen, dass sie morgen einen Vortrag an der Universität hält.«
»Das habe ich gesehen, ja.«
»Und Sie sind damit einverstanden?«
»Diese Entscheidung liegt nicht bei mir.« In ihre Stimme schlich sich ein dezentes Frösteln. Eine frühe Warnung. »Genauso wenig wie bei Ihnen.«
Er schlug die Beine übereinander, eine subtile Andeutung, dass er es sich gerade erst bequem machte und sich nicht einschüchtern lassen würde.
Als sie das sah, stand Chancellor Roberge auf und warf ein weiteres Holzscheit aufs Feuer, sodass Funken den Kamin hochstoben. Und mit ihnen Roberges Botschaft.
Sie hatte den ganzen Tag Zeit.
»Ich will nicht lange drum herumreden«, sagte er. »Ich finde, die Veranstaltung hätte nie genehmigt werden dürfen, aber da sie es nun mal wurde, sollte sie abgesagt werden.«
»Und damit kommen Sie zu mir? Es gibt nichts, was ich tun könnte, selbst wenn ich wollte. Wie Sie wissen, bin ich bloß Repräsentantin der Universität und besitze keinerlei Entscheidungsgewalt.«
»Mit dem Rektor habe ich schon gesprochen.«
»Tatsächlich? Und was hat er gesagt?« Gamache konnte die Belustigung in ihrer Stimme hören.
Der Rektor der Universität war zwar ein Titan auf seinem Forschungsgebiet, als Leiter und politischer Entscheidungsträger aber weit davon entfernt.
»Er hat abgelehnt.«
»Lassen Sie mich raten …« Sie schloss die Augen »Eine Universität ist dazu da, Andersdenkenden eine geschützte Plattform zu bieten.« Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie ihren Gast lächeln.
»Unrecht hat er nicht«, sagte Gamache.
»Nein.«
»Aber hier haben wir es nicht nur mit einer Andersdenkenden zu tun.« Er beugte sich zu ihr vor. »Sie haben Einfluss, Colette. Sie könnten sich an das Direktorium wenden. Dort genießen Sie Respekt. Berufen Sie eine Telefonkonferenz ein.«
»Und was sollte ich sagen?«
»Dass dieser als akademisch getarnte Vortrag nicht nur schwachsinnig ist, sondern gefährlich. Indem die Universität Professor Robinson eine Plattform gibt, läuft sie Gefahr, deren Ansichten den Anstrich von Legitimität zu geben.«
Einen Herzschlag lang sah sie ihn nachdenklich an. Zwei Herzschläge lang. Sie schien abzuwägen, doch es hätte Armand überrascht, wenn sie diese Unterhaltung nicht vorausgesehen hätte. Und ihre Antwort vorbereitet.
Das hatten sie gemein. Geschehnisse vorauszuahnen. Sich vorzubereiten. Er hatte auf der Fahrt hierher dasselbe getan. Nicht jede Diskussion gewann er, erwartete es auch gar nicht. Manche Kämpfe konnte man nur verlieren. Aber manchmal war es genug, einfach seinen Standpunkt zu vertreten.
Und er musste es versuchen.
»Wenn Sie die Veranstaltung für gefährlich halten, dann sorgen Sie doch selbst dafür, dass sie abgesagt wird«, sagte sie. »Als leitender Ermittler der Sûreté sitzen Sie am richtigen Hebel. Zumindest falls Abigail Robinson Ihrer Meinung nach das Gesetz bricht. Glauben Sie das?«
»Nein. Sonst wäre ich nicht hier, so gern ich es auch bin.«
Sie lächelte. »Also soll ich für Sie die Dreckarbeit machen, Armand? Sie wollen Ihre Macht nicht missbrauchen, verlangen es aber von mir?«
Er konnte spüren, wie sich um Chancellor Roberge regelrecht eine Eisschicht bildete, dennoch trafen ihn ihre nächsten Worte unerwartet.
»Sie würden sich hinter einer dreiundsiebzigjährigen Frau verstecken? Sind Sie wirklich so ein Feigling?«
Er legte den Kopf schief und überlegte. Ihre Worte waren ein direkter und sogar grober persönlicher Angriff. Weh tat er nicht. Er wusste, dass er kein Feigling war. Und entscheidender noch, sie wusste es auch.
Er war in seiner Laufbahn schon als so manches beschimpft worden, aber selbst seine Feinde hatten es nicht gewagt, ihn einen Feigling zu nennen.
Warum also Colette Roberge? Es war dieser Frau, die er kannte und respektierte, nicht würdig.
Er ließ sich davon jedoch nicht provozieren, im Gegenteil, er wurde noch ruhiger. Sein Blick und seine Aufmerksamkeit wurden schärfer, und sein Atem ging gleichmäßig. Wie immer, wenn er sich auf eine Konfrontation einstellte, ob physisch oder intellektuell.
Schon auf der Fahrt hierher hatte er gewusst, dass die Unterhaltung unangenehm werden würde, aber diese Reaktion der Kanzlerin hatte er nicht erwartet.
»Nun, ich habe Angst«, sagte er sachlich. »Falls Sie das meinen. Nicht nur davor, dass es zu Ausschreitungen kommt – das kann bei jeder öffentlichen Veranstaltung passieren, und bei dieser erst recht. Vor allem habe ich Angst, dass der Vortrag nicht nur dem Ruf der Universität schadet, sondern hilft, Robinsons Botschaft in die Welt zu tragen. Sie könnte die gesamte Provinz und mehr infizieren.«
»Sie betrachten freie Meinungsäußerung als Infektion? Persönliche Ansichten als Virus? Ich dachte, Sie stehen hinter der Charta der Rechte und Freiheiten. Ist das nur eine öffentlichkeitswirksame Farce? Zeigt sich da gerade Ihre Situationsethik? Freie Meinung ist schön und gut, solange niemand Ihren persönlichen Vorstellungen widerspricht, Ihrer Ideologie?«
»Ich habe keine Ideologie …«
Colette Roberge lachte. »Machen Sie sich nichts vor. Jeder hat Werte und Glaubenssätze.«
»Stimmt, die habe ich. Aber das ist etwas anderes. Sie sind mir ins Wort gefallen. Ich habe keine Ideologie, die darüber hinausgeht, den Punkt zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden und ihn zu verteidigen.«
Nach einer kurzen Pause erwiderte sie: »Und Sie glauben, dass der Vortrag diesen Punkt in Gefahr bringt.«
»Wissen Sie denn, was sie sagt? Was sie vertritt?«
»In groben Zügen, ja.«
»Und Sie haben keine Einwände?«
»Wie ich schon sagte, es steht mir nicht zu, dafür oder dagegen zu sein. Wenn wir nur Vorträge erlaubten, die unserer Meinung entsprechen, wäre die Universität bald kein Ort des Lernens mehr, finden Sie nicht? Wir würden uns nie mit neuen Ideen auseinandersetzen. Mit radikalen Ideen. Selbst mit Ideen, die als gefährlich gelten. Wir würden uns nur immer im Kreis drehen und ständig dieselben alten Dinge sagen und hören. Eine Echokammer. Nein, diese Universität ist offen für Neues.«
»Hierbei handelt es sich nicht um etwas Neues.« Er sah sie an. »Es klingt, als teilten Sie Professor Robinsons Meinung.«
»Ich teile die Meinung, dass abweichende Stimmen, unbeliebte Standpunkte, ja selbst gefährliche Gedanken wichtig sind, solange eine gewisse Grenze nicht überschritten wird.«
»Und die Grenze ist wo?«
»Diese Entscheidung liegt bei Ihnen, Chief Inspector.«
»Sie geben Ihre moralische Verantwortung gegenüber der Universität ab und übertragen sie stattdessen der Polizei?«
Ihr Wortwechsel wurde langsam lauter, zwar schrien sie sich nicht an, aber die Situation war angespannt. Armand war klar, dass sie drohten, selbst eine Grenze zu überschreiten.
Tatsächlich hatte Colette sie bereits überschritten, als sie ihn einen Feigling nannte. Und er genauso, als er ihr vorwarf, ihrer Verantwortung nicht gerecht zu werden. Aber das hatte er nicht grundlos gesagt.
»Sie befürworten Machtmissbrauch«, sagte sie, »wenn Sie freie Meinungsäußerung verhindern. So etwas nennt man Tyrannei. Seien Sie vorsichtig, Chief Inspector. Sie bewegen sich auf dünnem Eis. Ich dachte, Sie würden dafür sorgen, dass die Veranstaltung sicher über die Bühne geht. Aber gerade klingen sie wie ein Faschist.«
Gamache ließ einen Moment vergehen, dann sagte er: »Also haben Sie darum gebeten, dass mir die Aufgabe übertragen wird?«
Chancellor Roberge wurde klar, dass sie zu viel preisgegeben hatte. Und ihr wurde klar, dass der Mann ihr gegenüber es höchstwahrscheinlich genau darauf angelegt hatte. Indem er sie reizte und provozierte. Sie schubste. Bis sie ausholte und zurückschlug. Und die Grenze aus den Augen verlor, die sie sich selbst gesteckt hatte.
Aber wahrscheinlich war sie schon vor seiner Ankunft aus der Balance gewesen. Unsicher, welchen Standpunkt sie vertrat, worauf sie sich stützte. Unsicher, ob sie das Richtige getan hatte. In Wahrheit hatte sie Angst, dass es das Falsche gewesen war.
Aber es war zu spät. Immerhin wusste er nicht alles.
Jetzt nickte sie bestätigend.
»War das ein Fehler?«, fragte sie. »Ich dachte, Sie würden fair und professionell sein. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt. In Anbetracht Ihrer persönlichen Umstände sehen sie sich vielleicht nicht in der Lage, Professor Robinson zu beschützen, wenn nötig.«
Jetzt hatte sie wirklich eine Grenze überschritten, aber diesmal mit Absicht. Um von etwas abzulenken. Sie sah den fassungslosen Ausdruck in seinem Gesicht, der rasch Ärger wich.
»Tut mir leid«, sagte sie schnell, aber es klang nicht ganz aufrichtig. »Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber die Frage ist berechtigt.«
»Ist sie nicht, Madame Chancellor, und das wissen Sie. Sie haben meine Familie ins Spiel gebracht und mich der Tyrannei beschuldigt. Sie haben sogar angedeutet, ich würde zulassen, dass eine Person verletzt, ja getötet wird, nur weil ich deren Ideologie nicht teile.«
»Nein. Ich sage nur, dass Sie menschlich sind. Dass Sie Ihre Familie verteidigen würden. Und wenn wir schon dabei sind, Sie haben mich beschuldigt, die Gefährdung Tausender junger Männer und Frauen hinzunehmen, nur weil ich mich nicht einmischen will.«
Sie starrten einander an. Wutschäumend. Beide hatten ihre hart erkämpfte Beherrschung verloren.
Mein Gott, dachte Gamache und riss sich zusammen. So fängt es an. Das ist es, was Abigail Robinson sogar aus der Ferne bewirkt. Allein über sie zu sprechen, sät Wut. Und damit Angst.
Und ja, er hatte Angst. Dass ihre Statistiken und Schaubilder Wurzeln schlugen. Dass die Leute anfingen, das Untragbare mitzutragen.
Er atmete einmal tief ein und aus. »Entschuldigen Sie, Colette. Was ich gesagt habe, ging zu weit.«
Sie schwieg. Offenbar noch nicht bereit, sich ihrerseits zu entschuldigen.
»Warum hat die Universität diese Buchung angenommen?«, fragte er.
»Was fragen Sie mich? Dafür bin ich nicht zuständig.« Immer noch kurz angebunden.
»Und warum hat Professor Robinson beschlossen, ausgerechnet hierherzukommen?«
»Warum nicht?«
»Ihre bisherigen Vorträge fanden alle im Westen statt. Finden Sie es nicht verwunderlich, dass sie für ihren Besuch im Osten nicht die University of Toronto gewählt hat? Nicht die McGill oder die Université de Montréal? Keine große Plattform in einer der Großstädte, sondern eine kleine Universität in einer Kleinstadt.«
»Die Université de l’Estrie hat einen sehr guten Ruf«, erwiderte Chancellor Roberge.
»C’est vrai«, sagte er und nickte. »Das stimmt. Aber überraschend ist es trotzdem.«
Doch er wirkte abwesend. Er hing einem Gedanken nach, der ihm bis jetzt noch nicht gekommen war. Er war so sehr mit den moralischen, rechtlichen und logistischen Problemen beschäftigt gewesen, dass er sich bisher noch nicht gefragt hatte, warum ausgerechnet die Université de l’Estrie.
»Vielleicht haben die anderen Universitäten abgelehnt«, dachte er laut nach.
»Ist doch völlig egal«, sagte Chancellor Roberge.
Er seufzte. »Mir war von Anfang an nicht wohl dabei, Colette. Ich bin alles immer wieder durchgegangen, bis letzte Nacht. Da habe ich mir ihren jüngsten Vortrag und dessen Folgen angesehen. Wie die Zuhörer sich gegenseitig angriffen. Bricht sie das Gesetz? Ist es Volksverhetzung?« Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Nein. Aber ihre Vorträge haben zu einigen hässlichen Konfrontationen geführt.«
»Genau deshalb habe ich nach Ihnen gefragt. Mir ist klar, dass die Sicherheitskräfte der Universität nicht in der Lage wären, Abigail zu beschützen.«
»Abigail?«
»Ja, so heißt sie doch. Abigail Robinson.«
»Ja. Aber Sie haben sie beim Vornamen genannt. Nicht ›Professor Robinson‹.« Er stellte beide Füße auf und beugte sich zu ihr vor. »Kennen Sie sie? Persönlich?«
Und plötzlich wurde ihm noch etwas klar.
»Hat sie sich deshalb für die Université de l’Estrie entschieden? Haben Sie sie eingeladen?«
»Machen Sie Witze?«
»Nein.«
Colette Roberge sah ihm in die Augen. Dann lenkte sie ein.
»Sie haben recht, ich kannte sie. Vor Jahren. Aber ich habe sie nicht eingeladen.«
»Woher kennen Sie sie?«
»Ich weiß nicht, warum das wichtig ist, aber da Sie fragen: Ich kannte ihren Vater. Wir haben zusammen an ein paar Studien gearbeitet. Er war auch Statistiker. Ein Freund. Er bat mich, ein Auge auf Abigail zu haben, als ich Gastdozentin in Oxford war. Sie ging dorthin, um Mathematik zu studieren.«
»Wie war sie so?«
»Spielt das eine Rolle?«
»Es ist hilfreich, die Persönlichkeit einer Person zu kennen, die man beschützen soll. Ist sie aggressiv? Ängstlich? Kooperativ? Wird sie sich an Anordnungen halten oder sie infrage stellen?«
Chancellor Roberge blickte über Gamaches Schulter in die Vergangenheit.
Sie sah die klugen jungen Männer und Frauen vor sich sitzen, die fast noch Kinder waren. Sie fingen gerade an, eine bittere Wahrheit zu begreifen. Dass sie zwar ihre Mitschüler zu Hause mit Leichtigkeit überflügelt hatten, sich hier in Oxford aber ordentlich ins Zeug legen mussten, allein um dranzubleiben. Plötzlich waren sie nicht mehr außergewöhnlich, sondern nur noch durchschnittlich.
Viele schafften es nicht, konnten sich nicht anpassen. Aber Abigail war die Umstellung schnell gelungen.
»Im Gegensatz zu den anderen ihres Jahrgangs, die taktlos sein konnten, war es leicht, sie zu mögen«, sagte Roberge. »Sie kam nicht aus wohlhabendem Hause, sondern aus einem, das intellektuelle Leistungen wertschätzte. Sie war fokussiert, sympathisch.«
»Ambitioniert?«
»Nicht mehr als Sie«, sagte Roberge mit einem Lächeln.
»Und ihre Arbeit?«
»War außergewöhnlich.« Jetzt, wo es um Wissenschaft ging, entspannte sich Chancellor Roberge. »Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass Mathematik keineswegs linear ist. Sondern kurvenförmig. Ihren Höhepunkt findet sie in den klügsten und flinksten Köpfen, wo sie auf Philosophie, Musik und Kunst trifft.« Sie legte die Hände ineinander. »Beides ist miteinander verbunden. Ein Stück von Bach ist genauso sehr Mathematik wie Musik.«
Das hörte Gamache nicht zum ersten Mal. Er hatte Clara Morrow, die nicht nur eine Freundin und Nachbarin, sondern auch eine begnadete Malerin war, über genau diese Konvergenz sinnieren hören. Perspektive. Proportion. Raumaufteilung. Logik und Problemlösung. Und Porträtmalerei.
»Eine Freundin von mir zitiert gern Robert Frost«, sagte er. »Ein Gedicht beginnt mit einem Kloß im Hals. Die Künstler, die ich kenne, würden zustimmen. Gilt dasselbe auch für Mathematiker?«
Chancellor Roberge wusste, dass das keine beiläufige Frage war. Sondern eine Handgranate. Eine interessante, aber dennoch potenziell explosive Frage.
»Das würde ich nicht sagen. Ich schätze, für Mathematiker, für Statistiker, kommt der Kloß im Hals am Ende. Wenn wir sehen, wohin uns unsere Arbeit gebracht hat.«
»Und wie sie verdreht werden kann?« Als Roberge daraufhin schwieg, fuhr er fort: »Glauben Sie, Professor Robinson hat beim Anblick ihrer Diagramme einen Kloß im Hals?«
»Das müssen Sie sie selbst fragen. Sehen Sie, Armand, ich nehme sie nicht in Schutz.«
»So klingt es aber. Diesen Vortrag stattfinden zu lassen, ist falsch«, sagte er. »Ich habe die Gesetze zur Zensur vorwärts und rückwärts gelesen. Dazu, was Volksverhetzung ausmacht. Wenn ich die Veranstaltung auf dieser Grundlage absagen könnte, würde ich es tun. Und vielleicht kann ich sie morgen wegen Sicherheitsbedenken abbrechen, aber im Moment gibt es keinen haltbaren Grund.«
Seine Worte hingen zwischen ihnen in der warmen Luft, während das Feuer knackte und von der Eislauffläche draußen Freudenschreie zu ihnen heraufdrangen.
Ein Tor war gefallen, aber auf welcher Seite?
Dann legte sich wieder Stille über das Wohnzimmer.
»Ich bitte Sie«, sagte Armand leise, »flehe Sie an, diese Veranstaltung abzublasen, Colette. Unter irgendeinem Vorwand. Weil die Heizung in der Sporthalle nicht funktioniert. Oder weil den Angestellten ihr wohlverdienter Urlaub zusteht. Weil es bei der Buchung einen bürokratischen Fehler gab. Bitte. Dieses Event wird für niemanden gut ausgehen.«
Chancellor Roberge betrachtete den Mann vor sich. Sie kannte ihn seit Jahrzehnten. Hatte seinen Aufstieg miterlebt. Seinen tiefen Fall.
Und sie hatte miterlebt, wie er sich wieder hochrappelte und erneut einen Job übernahm, der für ihn viel mehr als ein Job war.
Es stand in seinem Gesicht geschrieben. Die Linien und Falten. Die nicht alle altersbedingt waren. Sie waren die Landkarte seines Lebens. Seiner Überzeugungen. Der Stellungen, die er bezogen, und der Tiefschläge, die er eingesteckt hatte.
Sie sah es in der tiefen Narbe an seiner Schläfe.
Nein, dieser Mann war kein Feigling, doch er hatte Angst, wie er selbst zugab.
Aber ihr ging es genauso.
Colette Roberge stand auf und sagte: »Ich werde die Veranstaltung nicht absagen, Armand.«
Chief Inspector Gamache war bereits vor Verlassen seines Arbeitszimmers bewusst gewesen, dass dieser Kampf womöglich aussichtslos war. Doch wenn auch ohne Zugeständnis, verließ er das Haus der Kanzlerin mit mehr Informationen, als er beim Betreten gehabt hatte. Unter anderem mit der, dass Chancellor Roberge Abigail Robinson persönlich kannte. Und zwar gut genug, um sie immer noch beim Vornamen zu nennen.
Er fragte sich, ob eine der Weihnachtskarten in den Bücherregalen oder auf dem Kaminsims mit Abigail unterzeichnet war.
Zwar mochte es nicht ausschlaggebend sein, aber keine Information war irrelevant.
»Danke, Madame Chancellor, dass Sie mich empfangen haben.«
»Es tut mir leid, Sie in die Sache mit reingezogen zu haben. Ich kann sehen, dass Ihnen nicht wohl dabei ist.«
»Berufsrisiko.«
»Und wenn man eine Enkelin mit Downsyndrom hat …«, sagte sie.
Er war gerade dabei, sich die Handschuhe anzuziehen, hielt bei diesen Worten jedoch inne und sah sie an. Offenbar wusste sie mehr, als sie zugab.
»Nein. Idola ist ein Trost, ein Balsam. Schmerzhaft ist nur, Entscheidungen wie diese zu treffen.«
»Nach der Wurzel des Schmerzes frage ich lieber nicht.«
Er lachte. »Kommen Sie morgen auch?«
»Moi? Nein. Ich werde mich unter der Bettdecke verkriechen und nicht ans Telefon gehen. Hören Sie, Armand, wir wissen doch beide, dass dieses Theater völlig unnötig ist. Professor Robinson wird morgen ihren Vortrag halten, und im Auditorium wird gähnende Leere herrschen. Und damit hat es sich.«
Sie beugte sich vor und küsste ihn auf beide Wangen.
»Joyeux Noël. Bonne année. Auch an Reine-Marie.«
»Ihnen auch, Colette, und grüßen Sie Jean-Paul.«
Auf dem Weg zu seinem Auto drehte sich Armand noch einmal um und sah die Bilder, die in einem der Vorderfenster von Roberges Haus hingen. Mit Buntstiften gemalte Regenbogen, vermutlich während der Pandemie von den Enkelkindern gemacht, und die Worte: Ça va bien aller.
Mit ernstem Gesicht wandte er sich ab. Alles wird gut. Das kam darauf an, was »gut« bedeutete. Und ihm schwante, dass er und die Kanzlerin unterschiedliche Vorstellungen davon hatten.
Colette Roberge zog ihre Strickjacke enger um sich, während sie beobachtete, wie der Chief Inspector davonfuhr.
In dem Moment hörte sie junge Stimmen, als ihre Enkelkinder mit ihren Freunden schreiend und laut diskutierend zurückkamen.
Türen knallten, kalte Luft strömte herein. Mit einem dumpfen Aufprall wurden Stiefel und Schlittschuhe in die Ecke gefeuert.
»Heiße Schokolade?«, fragte sie.
»Ja, bitte, grand-mère.«
Sie wurde von allen so genannt, selbst von denen, die nicht mit ihr verwandt waren. Auch einige ihrer Kollegen und selbst der Premierminister nannten sie grand-mère.
Sie sah es als Kosenamen, aber auch als Vorteil. Ihrer Großmutter gegenüber waren die wenigsten auf der Hut.
Sie rührte im Kakaotopf und blickte zu ihrem Ehemann in der Ecke, der den ganzen Morgen in ein Puzzle vertieft dort gesessen hatte. Während um ihn herum das Leben tobte, ohne dass er etwas davon mitbekam.
An dem Abend, als er mit Jean-Guy im Arbeitszimmer gesessen hatte, hatte Gamache sich vorgebeugt und auf seinem Laptop auf Play gedrückt. Sie hatten zugesehen, wie Abigail Robinson, die nette Frau auf dem Bildschirm, zu sprechen begann.
Zwölf Minuten später drückte Jean-Guy auf Pause.
»Sagt sie das, was ich glaube?«
Armand nickte.
»Fuck«, flüsterte Jean-Guy. Er löste den Blick vom Computer und sah seinen Schwiegervater an. »Und du wirst sie beschützen?«
»Irgendjemand muss es tun.«
»Kanntest du ihre Auffassung, als du zugestimmt hast?«
»Nein.«
»Kanntest du ihre Auffassung, als du mir erklärt hast, dass du mich bei dem Einsatz nicht brauchst?«
»Nein.«
Sie sahen einander in die Augen. Jean-Guys Gesicht war nicht länger rosig, sondern rot. Die Wut war gesät.
»Ich geh nach oben«, sagte Jean-Guy.
»Ich komme mit.«
Armand schaltete die Weihnachtsbaumbeleuchtung aus. In der Dunkelheit konnte er die drei riesigen Kiefern sehen, die auf dem Dorfanger thronten. Ihre bunten Lichterketten leuchteten rot, blau und grün unter der Schneelast auf den Zweigen.
Henri und Fred folgten ihnen langsam die Treppe hoch. Gracie schlief schon in Stephens Zimmer.
Armand gab Florence und Zora einen Gutenachtkuss und ging dann ins Nebenzimmer, wo Jean-Guy stand und auf seine Tochter hinabsah. Ein kühler Windzug blähte die Vorhänge und ließ die Temperatur im Zimmer fallen. Als ob sich etwas Garstiges anschliche.
Armand schloss das Fenster bis auf einen Spaltbreit, dann zog er die Decke über Honoré. Irgendwie hatte er es geschafft, seinen neuen Schlitten mit ins Bett zu schmuggeln. Gamache gab dem Jungen einen Kuss und stellte sich dann neben seinen Schwiegersohn.
Die kleine Idola schlief friedlich, ohne der Kräfte gewahr zu sein, die sich um sie zusammenbrauten.
Jean-Guy blickte auf. »Ich weiß, dass du Isabelle und andere aus dem Team für die Veranstaltung morgen herbeordert hast. Ich will auch helfen.«
»Das ist keine gute Idee, und du weißt es.«
»Wenn nicht als Mitglied des Teams, komme ich eben als Zuhörer. Egal wie, ich gehe hin.«
Armand sah, dass die Saat Wurzeln geschlagen hatte. »Ich gebe dir morgen früh Bescheid.«
Später in der Nacht ging Jean-Guy nach unten ins Wohnzimmer und setzte sich in den Sessel neben dem Kamin, in dem jetzt nur noch Glut glomm. Er rief das Video auf, das ihm Armand gezeigt hatte, und diesmal schaute er es bis zum Ende.
Jetzt verstand er, warum Armand zu Chancellor Roberge gefahren war, um sie zu bitten, vielleicht sogar anzuflehen, den Vortrag abzusagen.
Und er wusste, warum sein Schwiegervater ihn nicht in der Nähe dieser Professorin haben wollte.
5
»Professor Robinson? Ich bin Chief Inspector Gamache von der Sûreté.« Er konnte sich nicht länger davor drücken, mit ihr zu sprechen. »Sind Sie bereit?«
Abigail Robinson sah den Mann, der zu ihr getreten war, an.
Sie hatten bisher noch kein Wort miteinander gesprochen, doch laut Debbie war er der Einsatzleiter. Das hätte sie jedoch nicht erwähnen müssen. Seine Autorität war unverkennbar.
Er trug keine Uniform, sondern Jackett und Krawatte. Hochwertiger Stoff, gut geschnitten.
Wenn auch nicht im herkömmlichen Sinne gut aussehend, so hatte er doch etwas Einnehmendes an sich. Vielleicht lag es an seiner Ruhe. Aber am bemerkenswertesten waren, jetzt wo er vor ihr stand, seine Augen.
Sie waren tiefbraun und klar. Wachsam, aber das war zu erwarten gewesen, schließlich war er für die Sicherheit zuständig und Wachsamkeit dafür unerlässlich.
Sie sah Intelligenz in seinen Augen, aber da war noch mehr. In seinem Blick lag Bedächtigkeit.