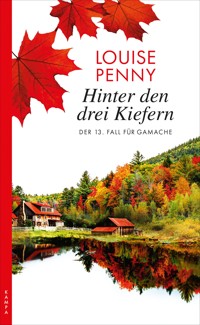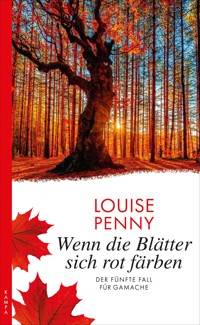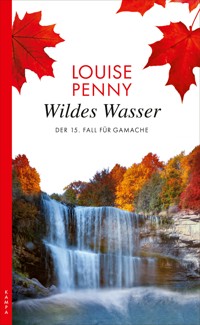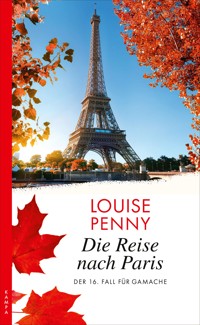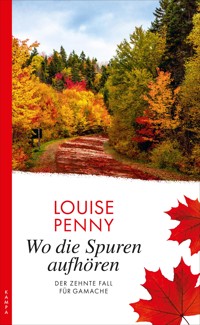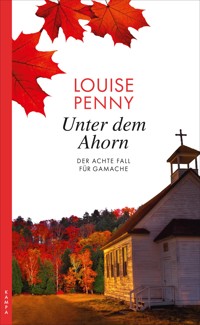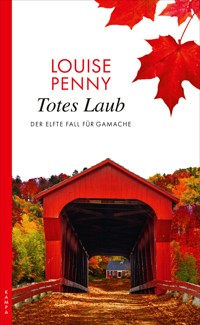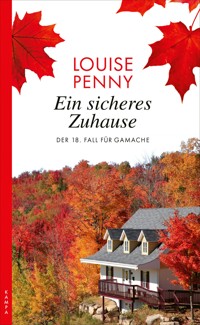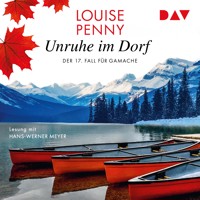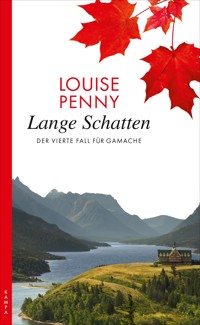
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Anlässlich ihres 35. Hochzeitstages wollte Chief Inspector Armand Gamache von der Sûreté du Québec mit seiner Frau Reine-Marie ein paar ruhige Tage in dem fast schon überirdisch schönen Manoir Bellechasse verbringen, einem Hotel am See inmitten der kanadischen Wildnis. Doch dann reisen die zerstrittenen Finneys an, um zu Ehren des kürzlich verstorbenen Familienpatriarchen eine Statue zu errichten, die allerdings nach der Zeremonie umkippt und eine der Töchter unter sich begräbt. Der Drahtzieher hinter dem Anschlag muss im abgelegenen Manoir Bellechasse wohnen. Gamache blickt hinter die Kulissen des Hotels und beginnt Fragen zu stellen. Nicht alle Angestellten haben eine weiße Weste, und auch den Mitgliedern der Familie Finney mangelt es nicht an Motiven: Das tote Familienoberhaupt hatte einige dunkle Geheimnisse, und zwischen den Hinterbliebenen herrschen Eifersucht und Neid.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Lange Schatten
Der vierte Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englischen von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Für meine Eltern, in liebender Erinnerung
Prolog
Vor mehr als einem Jahrhundert entdeckten die Geld- magnaten den Lac Massawippi. Sie kamen eigens von Montréal, Boston, New York angereist und drangen tief in die kanadischen Wälder vor, wo sie ein großes Jagdhaus errichteten. Wobei sie sich natürlich nicht selbst die Hände schmutzig machten. Zumindest nicht hier und nicht mit ehrlicher Arbeit. Nein, diese Leute heuerten Männer mit Namen wie Zoétique, Télesphore und Honoré an, damit sie die mächtigen, uralten Bäume umschlugen. Zuerst sträubten sich die Québecer, lebten sie doch seit Urzeiten in diesen Wäldern. Sie scheuten sich, etwas so Schönes zu zerstören, und einige von ihnen, die mehr Weitblick hatten, wussten, dass das Ende gekommen war. Aber alldem ließ sich mit Geld abhelfen, und nach und nach wich der Wald, und an seiner statt erhob sich das herrliche Manoir Bellechasse. Nachdem die Männer die mächtigen Stämme gefällt, entrindet und über Monate immer wieder gedreht hatten, damit sie gleichmäßig trockneten, wuchteten sie sie schließlich aufeinander. Der Bau eines solchen Hauses war eine hohe Kunst. Wobei die Männer mit den scharfen Augen und schwieligen Händen keineswegs vollkommene Proportionen im Sinn hatten, vielmehr wussten sie, dass die Bewohner des Hauses dem ersten Winter zum Opfer fallen würden, wenn sie die Stämme nicht sorgsam auswählten. Ein coureur du bois konnte seinen Blick Stunden über den entrindeten Stamm eines mächtigen Baums wandern lassen, so als wolle er ihn entziffern. Er ging immer wieder um ihn herum, setzte sich auf einen Stumpf, stopfte sich seine Pfeife und starrte ihn an, bis er endlich wusste, welchen Platz der Baum von nun an einnehmen würde.
Es dauerte Jahre, bis das Jagdhaus fertiggestellt war. Wie ein Blitzableiter stand der letzte Mann auf dem herrlichen Kupferdach und überblickte aus einer Höhe, auf die er nie wieder gelangen würde, den Wald und den einsamen, verwunschenen See. Wenn die Augen dieses Mannes weit genug hätten blicken können, dann hätte er etwas Schreckliches näher kommen gesehen, wie ein drohendes Gewitter. Das nicht nur auf das Haus, sondern genau auf die Stelle zukam, wo er auf dem schimmernden Kupferdach stand. An ebendieser Stelle würde sich etwas Grauenvolles zutragen.
Er hatte früher schon Kupferdächer gedeckt, immer auf dieselbe Weise. An diesem Tag aber war er noch einmal auf das Dach geklettert, das alle für fertig gehalten hatten, und hatte über die gesamte Länge des Firstes eine Art Kappe gesetzt. Er hatte keine Ahnung, warum, fand nur, dass es gut aussah und irgendwie passte. Außerdem hatte er genug Kupfer übrig. Fortan hatte er diese Art First immer wieder für große Gebäude in der Gegend benutzt, die mehr und mehr Leute anzog. Aber hier machte er es zum ersten Mal.
Nach dem letzten Hammerschlag stieg er langsam und bedächtig die Leiter hinab.
Dann paddelten die Männer davon, die Herzen schwer, aber die Taschen voll Geld. Als sie noch einmal zurücksahen, dachten die Phantasiebegabteren unter ihnen, dass sie etwas gebaut hatten, das wie der Wald aussah, nur war er widernatürlicherweise zur Seite gekippt.
Von Anfang an haftete dem Manoir Bellechasse etwas Widernatürliches an. Mit den golden schimmernden Stämmen war es von überwältigender Schönheit. Es bestand aus Holz und Flechtwerk und stand nah am Ufer. So wie die Geldmagnaten über alles andere herrschten, herrschte es über den See. Daran konnten sie offenbar nichts ändern.
Einmal im Jahr nun verließen Männer mit Namen wie Andrew, Douglas oder Charles ihre Eisenbahn- oder Whiskey-Imperien, tauschten ihre Gamaschen gegen weiche Ledermokassins und fuhren mit dem Kanu zu dem Haus am Ufer des einsam gelegenen Sees. Sie waren es wieder einmal müde, Geld zu scheffeln, und suchten für kurze Zeit Ablenkung.
Das Manoir Bellechasse war aus einem einzigen Grund geplant und gebaut worden. Damit diese Männer töten konnten.
Es war eine nette Abwechslung.
Jahr um Jahr wich die Wildnis weiter zurück. Die Füchse und Hirsche, die Elche und Bären, all die wilden Tiere, die die Geldmagnaten jagten, verkrochen sich tiefer in die Wälder. Auch die Abinaki, die die Geldmagnaten häufig zu dem großen Jagdhaus gepaddelt hatten, hatten sich schließlich zurückgezogen. Siedlungen und Dörfer schossen wie Pilze aus dem Boden. Großstädter entdeckten die nahe gelegenen Seen und ließen sich Wochenenddomizile an deren Ufern bauen.
Aber das Bellechasse überdauerte. Es wechselte die Besitzer, und nach und nach verschwanden die erschreckt dreinblickenden ausgestopften Köpfe vor langer Zeit erlegter Hirsche und Elche und sogar des einen oder anderen Pumas von den Wänden und wanderten auf den Dachboden des Jagdhauses.
So, wie das Vermögen der ersten Besitzer des Jagdhauses zusammenschrumpfte, verlor das Haus an Glanz. Lange Jahre lag es verlassen da, für eine einzelne Familie war es viel zu groß und für ein Hotel zu abgelegen. Gerade als der Wald beschlossen hatte, das Anwesen zurückzuerobern, wurde es aufgekauft. Eine Straße wurde gebaut, Vorhänge aufgehängt, Spinnen, Käfer und Eulen daraus verjagt und zahlende Gäste angelockt. Das Manoir Bellechasse wurde eines der elegantesten Hotels von ganz Québec.
Aber auch wenn sich im Laufe eines Jahrhunderts der Lac Massawippi verändert hatte, Québec und Kanada, ja, im Grunde alles sich verändert hatte, war eines gleich geblieben.
Die Geldmagnaten waren zurück. Sie waren erneut ins Manoir Bellechasse gekommen, um zu töten.
1
Zu Beginn des Sommers fielen die Gäste in dem einsamen Haus am See ein, herbeizitiert von identischen Einladungen auf edlem Papier in Umschlägen, die von der allzu bekannten krakeligen Handschrift wie von einem Spinnennetz überzogen waren. Das schwere Bütten war durch die Briefschlitze herrschaftlicher Häuser in Vancouver und Toronto und eines bescheidenen kleinen Cottages in Three Pines geworfen worden und mit einem Plumps auf den Dielen gelandet.
Der Briefträger hatte sich Zeit gelassen, als er den Brief in seiner Tasche durch das kleine Dorf in Québec getragen hatte. Er sagte sich, dass es keinen Sinn hatte, sich bei dieser Hitze zu verausgaben, und er blieb stehen und nahm den Hut ab, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Gewerkschaftsvorschrift. Aber der eigentliche Grund für seine Langsamkeit war nicht die stechende Sonne, es war etwas ganz Persönliches. In Three Pines trödelte er immer. Er spazierte langsam an den Staudenbeeten mit den Rosen, den Lilien und dem Fingerhut vorbei, der sich stolz in die Höhe reckte. Mit den Kindern suchte er den Teich auf dem Dorfanger nach Fröschen ab. Er setzte sich auf warme Natursteinmauern und sah dem Treiben in dem alten Dorf zu. Das verlängerte seinen Arbeitstag um Stunden, und er war stets der letzte Austräger, der zurück auf das Hauptpostamt kam. Die Kollegen machten sich deswegen über ihn lustig, und wahrscheinlich war das auch der Grund, dachte er, warum man ihn bislang noch nicht befördert hatte. Seit mehr als zwanzig Jahren ließ er sich nun Zeit. Statt sich zu beeilen, schlenderte er durch Three Pines und redete mit den Leuten, die ihre Hunde spazieren führten, oder er gesellte sich auf eine Limonade oder einen Eistee vor dem Bistro zu ihnen. Oder, im Winter, auf einen Milchkaffee vor dem knisternden Feuer im Kamin. Manchmal kamen die Dorfbewohner vorbei, wenn er im Bistro zu Mittag aß, holten sich ihre Post bei ihm ab und plauderten kurz mit ihm. Er brachte Neuigkeiten aus den anderen Dörfern, die auf seiner Route lagen, so wie ein fahrender Sänger im Mittelalter Neuigkeiten über Pest, Kriege oder Sturmfluten aus fernen Gefilden gebracht hatte. So etwas gab es hier, in diesem kleinen friedlichen Dorf, nie. In seiner Vorstellung war Three Pines, in ein Tal geschmiegt und von dichten Wäldern umgeben, von der Außenwelt abgeschnitten. Diesen Eindruck machte es jedenfalls. Es verschaffte einem eine Atempause.
So kam es, dass er sich immer Zeit ließ, wie auch an diesem Tag, an dem er einen Packen Umschläge in seiner schweißnassen Hand hielt und hoffte, dass er das schöne dicke Papier des zuoberst liegenden Briefs nicht ruinierte. Dann fiel sein Blick auf die Handschrift, und er ging noch ein wenig langsamer. Nach so vielen Jahren als Briefträger wusste er, dass er nicht nur Briefe überbrachte. Seine Route war gesäumt von Bomben, die er in Briefkästen und durch Briefschlitze geworfen hatte. Wundervolle Nachrichten: die Geburt eines Kindes, ein Lottogewinn, der Tod einer entfernten Erbtante. Aber da er ein guter und feinfühliger Mann war, wusste er, dass er auch schlechte Nachrichten überbrachte. Der Gedanke an den Schmerz, den er manchmal verursachte, brach ihm das Herz, besonders wenn es dieses Dorf betraf.
Er wusste, dass er etwas in der Hand hielt, das genau dazu und zu noch Schlimmerem führen konnte. Seine Gewissheit hatte wahrscheinlich nicht nur mit seinen telepathischen Kräften zu tun, sondern auch mit einer ihm nicht bewussten Begabung, Handschriften entziffern zu können. Sowohl die Worte als auch das, was ihnen zugrunde lag. Die schlichte, völlig normale dreizeilige Adresse auf dem Umschlag verriet ihm mehr als nur den Ort, an dem er den Brief abzugeben hatte. Die Hand war alt, dachte er, und sie hatte gezittert. Nicht nur wegen des Alters, sondern auch vor Wut. Von diesem Brief war nichts Gutes zu erwarten. Auf einmal wollte er ihn so schnell wie möglich loswerden.
Eigentlich hatte er vorgehabt, im Bistro vorbeizuschauen, ein kaltes Bier und ein Sandwich zu bestellen, mit Olivier, dem Besitzer, zu plaudern und, weil er heute ein wenig faul war, darauf zu warten, ob nicht jemand kam, um sich seine Post bei ihm abzuholen. Aber auf einmal war die Faulheit vergessen. Die erstaunten Dorfbewohner waren mit einem ungewohnten Anblick konfrontiert: ihrem Postboten, der es eilig hatte. Abrupt machte er auf dem Absatz kehrt und ging mit entschlossenen Schritten weg vom Bistro, zu einem rostigen Briefkasten vor einem Cottage, das am Dorfanger stand. Die Klappe des Briefkastens quietschte erbärmlich, als er sie öffnete. Das verstand er gut. Er warf den Brief ein und ließ die Klappe schnell wieder zufallen. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn der Briefkasten gewürgt und das verfluchte Ding wieder ausgespien hätte. Die Briefe waren für ihn zu Lebewesen geworden und die Briefkästen so etwas wie Haustiere. Und diesem Briefkasten hier hatte er eben etwas Schreckliches angetan. Genau wie den Leuten, denen er gehörte.
Selbst wenn Armand Gamache mit Blindheit geschlagen gewesen wäre, hätte er genau gewusst, wo er sich befand. Es war der Geruch. Die Kombination von Holzfeuer, alten Büchern und Geißblatt.
»Monsieur und Madame Gamache, es ist mir eine Freude.«
Clementine Dubois watschelte um den Empfangstisch des Manoir Bellechasse, die Haut hing wie Flügel an ihren ausgebreiteten Armen herunter und zitterte, was sie wie einen Vogel oder einen lädierten Engel aussehen ließ, als sie zielstrebig auf sie zukam. Auch Reine-Marie Gamache streckte die Arme aus, nicht dass sie die dicke Frau ganz hätte umfassen können. Sie umarmten sich und küssten sich auf die Wangen. Nachdem auch Gamache Küsschen mit Madame Dubois ausgetauscht hatte, trat diese einen Schritt zurück und musterte das Paar. Vor ihr stand Reine-Marie, eine Frau in mittleren Jahren, klein, weder allzu beleibt noch allzu schlank, die Haare ergraut und ein Gesicht, in dem ein erfülltes Leben seine Spuren hinterlassen hatte. Sie war attraktiv, ohne eigentlich hübsch zu sein. Ebendas, was man auf Französisch soignée nannte. Sie trug einen gut sitzenden dunkelblauen Rock, der ihr bis zur Wade reichte, und eine frisch gebügelte weiße Bluse. Schlicht, elegant, klassisch.
Der Mann, Mitte fünfzig, war groß und kräftig. Er war zwar nicht dick, aber man sah ihm an, dass er gute Bücher, eine ausgezeichnete Küche und müßige Spaziergänge zu schätzen wusste. Er sah wie ein Professor aus, aber Clementine Dubois wusste, dass er das nicht war. Sein einstmals welliges dunkles Haar begann sich oben zu lichten und grau zu werden, besonders an den Schläfen und den Löckchen an den Seiten, die fast bis zum Kragen reichten. Bis auf den gepflegten Schnurrbart war er glatt rasiert. Er trug ein marineblaues Jackett, kakifarbene Hose und ein hellblaues Hemd mit Krawatte. Wie immer war er korrekt gekleidet, selbst in der zunehmenden Hitze an diesem Tag Ende Juni. Das Bemerkenswerteste an ihm waren allerdings seine Augen. Ein tiefes, warmes Braun. Ruhe und Gelassenheit umgaben ihn wie andere Männer eine Rasierwasserwolke.
»Sie sehen erschöpft aus.«
Die meisten Hotelbesitzer hätten gerufen: »Sie sehen fabelhaft aus.« »Mais, voyons, Sie haben sich kein bisschen verändert.« Oder sogar: »Sie sehen jünger aus denn je«, wohl wissend, dass alte Ohren niemals müde werden, das zu hören.
Aber auch wenn Gamaches Ohren noch nicht für alt gelten konnten, müde waren sie. Es war ein langes Jahr gewesen, und sie hatten mehr vernehmen müssen, als sie wollten. Wie immer waren die Gamaches ins Manoir Bellechasse gekommen, um all das hinter sich zu lassen. Während der Großteil der Menschheit das neue Jahr Anfang Januar feierte, begingen die Gamaches es im Sommer, wenn sie diesen von der Welt abgeschiedenen Ort aufsuchten und neu begannen.
»Wir sind tatsächlich etwas erschöpft«, gab Reine-Marie zu und ließ sich dankbar in den bequemen Sessel neben dem Empfangstisch sinken.
»Darum werden wir uns schon kümmern.« Madame Dubois kehrte mit ein, zwei schnellen Schritten zu ihrem Tisch zurück und ließ sich mit einer eleganten Drehung auf ihrem Armlehnstuhl nieder. Sie zog das Meldebuch zu sich heran und setzte ihre Lesebrille auf. »So, in welches Zimmer haben wir Sie denn dieses Jahr gesteckt?«
Armand Gamache setzte sich neben seine Frau, und sie wechselten einen Blick. Würden sie in diesem Buch zurückblättern, dann fänden sie Jahr für Jahr ihre Unterschriften, bis zu einem Juni vor dreißig Jahren, als der junge Armand genug Geld gespart und Reine-Marie hierhergebracht hatte. Für eine Nacht. In das allerkleinste, nach hinten gelegene Zimmer des eleganten, ehrwürdigen Manoir. Ohne Blick auf die Berge oder den See oder den Garten mit den üppigen Pfingstrosen und den früh blühenden Rosen. Er hatte monatelang gespart, weil er wollte, dass dieser Besuch etwas Besonderes wurde. Weil er wollte, dass Reine-Marie wusste, wie sehr er sie liebte, wie viel sie ihm bedeutete.
Hier hatten sie ihre erste gemeinsame Nacht verbracht, der süße Geruch des Waldes, des Thymians und Flieders war in so dichten Wolken durch das Fenster ins Zimmer geströmt, dass man glaubte, ihn greifen zu können. Den betörendsten Duft aber hatte sie verströmt, frisch und warm in seinen starken Armen. In dieser Nacht hatte er ihr einen Liebesbrief geschrieben. Er hatte sie vorsichtig mit dem glatten weißen Laken zugedeckt, dann hatte er sich in den Schaukelstuhl gesetzt, natürlich ohne zu schaukeln, weil er fürchtete, dass er gegen die Wand hinter ihm oder mit den Schienbeinen an das Bettgestell vor ihm stoßen und Reine-Marie stören könnte, und ihren ruhigen Atemzügen gelauscht. Dann hatte er auf dem Briefpapier des Manoir Bellechasse zu schreiben begonnen: Meine Liebe kennt keine …
Wie kann ein Mensch solch eine …
Mein Herz und meine Seele sind wie aus einem tiefen Schlaf …
Meine Liebe für dich …
Die ganze Nacht hatte er geschrieben, und am nächsten Morgen hatte Reine-Marie am Badezimmerspiegel folgende Nachricht gefunden.
Ich liebe dich.
Schon damals war Clementine Dubois hier im Manoir gewesen, dick, teigig und freundlich. Schon damals war sie alt gewesen, und jedes Jahr hatte Gamache Sorge, dass eine unbekannte, geschäftsmäßige Stimme sagen würde: »Guten Tag, Manoir Bellechasse. Wie kann ich Ihnen helfen«, wenn er die Reservierung vornahm. Stattdessen hieß es stets: »Monsieur Gamache, wie schön, von Ihnen zu hören. Ich hoffe, Sie wollen uns wieder mit Ihrem Besuch beehren?« So ähnlich, wie wenn man seine Oma besuchte. Allerdings in einem weitaus nobleren Haus.
Während sich Gamache und Reine-Marie ganz offensichtlich verändert hatten – sie hatten geheiratet, zwei Kinder und eine Enkeltochter bekommen, und das zweite Enkelkind war unterwegs –, schien Clementine Dubois weder zu altern noch schwächer zu werden. Genauso wenig wie Madame Dubois’ Liebe, das Manoir. Es machte fast den Eindruck, als wären die beiden eins, beide gastfreundlich und sorgend, großzügig und offen. Darüber hinaus auf eine rätselhafte und wunderbare Weise unwandelbar in einer Welt, die ständigem Wandel unterworfen zu sein schien. Allerdings nicht immer zum Besseren.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Reine-Marie, als sie Madame Dubois’ Miene sah.
»Ich scheine alt zu werden«, sagte sie und blickte mit einem verstörten Ausdruck auf. Gamache lächelte ihr beruhigend zu. Seiner Rechnung nach musste sie mindestens hundertzwanzig sein.
»Wenn Sie kein Zimmer frei haben, ist das nicht schlimm. Dann kommen wir in einer anderen Woche wieder«, sagte er. Von Montréal, wo sie wohnten, bis zu den Eastern Townships in Québec brauchte man mit dem Auto nicht länger als zwei Stunden.
»Nein, nein, ich habe ein Zimmer, aber ich hatte gehofft, es wäre ein schöneres. Als Sie wegen der Reservierung anriefen, hätte ich Ihnen gleich das Seezimmer reservieren sollen, in dem Sie letztes Jahr waren. Aber wir sind ausgebucht. Eine Familie, die Finneys, hat die übrigen fünf Zimmer genommen. Sie sind hier …«
Sie unterbrach sich und blickte mit einem für sie völlig untypischen sorgenvollen Ausdruck auf das Buch, sodass sich die Gamaches fragend ansahen.
»Sie sind hier …?«, versuchte Gamache ihr auf die Sprünge zu helfen, als das Schweigen fortdauerte.
»Ach, wir haben bestimmt noch Gelegenheit, darüber zu plaudern«, sagte sie und lächelte. »Es tut mir jedenfalls leid, dass wir kein besseres Zimmer für Sie haben.«
»Wenn wir das Seezimmer unbedingt gewollt hätten, hätten wir Sie darum gebeten«, sagte Reine-Marie. »Sie müssen wissen, Armand macht gerne mal eine Reise ins Ungewisse. Abenteuerlustig, wie er ist.«
Clementine Dubois lachte, sie wusste genau, dass das nicht stimmte. Dieser Mann lebte Tag für Tag im Ungewissen. Deshalb wollte sie ja auch, dass ihre alljährlichen Besuche im Manoir so luxuriös und bequem wie möglich ausfielen. Und friedvoll.
»Wir haben uns noch nie ein bestimmtes Zimmer gewünscht«, sagte Gamache mit seiner tiefen, angenehmen Stimme. »Können Sie sich vorstellen, warum?«
Madame Dubois schüttelte den Kopf. Sie hatte sich das schon lange gefragt, aber sie nahm ihre Gäste nie ins Verhör, insbesondere diese nicht. »Die anderen machen das alle«, sagte sie. »Die Familie hier hat sogar einen Preisnachlass herausschlagen wollen. Fahren im Mercedes und BMW vor und feilschen dann.« Sie lächelte. Nicht böse, sondern verwundert, dass es Leute gab, die den Hals offenbar nicht vollkriegten.
»Wir wollen es dem Schicksal überlassen«, sagte er. Sie fragte sich, ob er einen Witz machte, und musterte sein Gesicht, aber er wirkte völlig ernst. »Wir sind mit dem zufrieden, was Sie uns zuteilen.«
Und Clementine Dubois wusste, dass das stimmte. Ihr ging es genauso. Jeden Morgen, wenn sie aufwachte, war sie überrascht, einen neuen Tag begrüßen zu dürfen, überrascht, hier zu sein, in diesem alten Jagdhaus, an den Ufern des glitzernden Sees, umgeben von Wäldern und Bächen, Gärten und Gästen. Es war ihr Zuhause, und die Gäste waren wie eine Familie für sie. Wobei Madame Dubois aus bitterer Erfahrung wusste, dass man sich seine Verwandten nicht auswählen konnte und sie auch nicht immer mochte.
»Das hier ist es.« Sie hielt eine lange Schlüsselkette in die Höhe, an der ein alter Messingschlüssel baumelte. »Das Waldzimmer. Es liegt leider nach hinten hinaus.«
Reine-Marie lächelte. »Wir kennen es, danke.«
Die Tage flossen sanft ineinander, während die Gamaches im Lac Massawippi schwammen und durch die duftenden Wälder spazierten. Sie lasen und plauderten mit den anderen Gästen, die sie nach und nach besser kennenlernten.
Sie waren den Finneys vor ein paar Tagen das erste Mal begegnet, aber sie waren ihnen in dem einsam gelegenen Feriendomizil bereits eine gern gesehene Gesellschaft geworden. Sie waren wie erfahrene Reisende auf großer Fahrt, die sich nie zu distanziert und nie zu aufdringlich verhielten. Sie wussten nicht einmal, womit die anderen ihren Lebensunterhalt verdienten, was Armand Gamache aber nur recht war.
Es war früher Nachmittag, und Gamache beobachtete eine Biene, die auf einer besonders prächtigen knallrosa Rosenblüte herumkrabbelte, als eine Bewegung in seinem Augenwinkel seine Aufmerksamkeit erregte. Er drehte sich auf seinem Liegestuhl um und sah zu, wie Thomas Finney, der Sohn der Familie, und seine Frau Sandra aus dem Haus in den hellen Sonnenschein traten. Sandra schob sich mit ihrer schlanken Hand eine riesige schwarze Sonnenbrille auf die Nase, die sie ein wenig wie eine Fliege aussehen ließ. Sie wirkte wie ein Fremdkörper an diesem Ort, auf jeden Fall war es nicht ihre natürliche Umgebung. Gamache schätzte sie auf Ende fünfzig, Anfang sechzig, auch wenn sie sich ganz offensichtlich bemühte, für wesentlich jünger durchzugehen. Merkwürdig, dachte er, dass gefärbte Haare, dicke Schminke und jugendliche Kleidung einen Menschen letztlich älter aussehen ließen.
Sie schritten auf den See zu, wobei Sandras Absätze den Rasen vertikutierten, und blieben immer mal wieder stehen, als warteten sie auf Applaus. Aber das einzige Geräusch, das Gamache vernahm, kam von einer Biene in einer Rose, deren Flügelchen ein zartes Rattern wie von Rotorblättern erzeugten.
Thomas stand oben auf dem Kamm des flachen Hügels, der zum See hinunterführte, ein Admiral auf seiner Brücke. Seine stechenden blauen Augen wanderten über das Wasser wie die Nelsons bei Trafalgar. Gamache wurde bewusst, dass er jedes Mal, wenn er Thomas sah, an einen Mann denken musste, der sich auf eine große Schlacht vorbereitete. Thomas Finney war unbestritten ein gut aussehender Mann Anfang sechzig. Mit seinen grauen Haaren und fein geschnittenen Zügen gab er eine elegante Erscheinung ab. In den wenigen Tagen, die sie bislang gemeinsam hier verbracht hatten, hatte Gamache allerdings auch einen gewissen Sinn für Ironie an dem Mann bemerkt, einen zurückhaltenden Humor. Er war überheblich und arrogant, aber er schien sich dessen auch bewusst zu sein und sich darüber lustig zu machen. Das gefiel Gamache, und er merkte, dass er sich für den Mann langsam zu erwärmen begann. Wobei er sich in der Gluthitze des heutigen Tages für alles zu erwärmen begann, insbesondere die alte Ausgabe des Life-Magazins, dessen Druckerschwärze auf seine verschwitzten Hände abfärbte. , las er auf seine Handfläche eintätowiert. Leben, nur verkehrt herum.
Thomas und Sandra waren geradewegs an seinen alten Eltern vorbeigelaufen, die es sich auf der schattigen Veranda bequem gemacht hatten. Gamache wunderte sich erneut darüber, wie gut es die einzelnen Mitglieder dieser Familie verstanden, so zu tun, als wären die anderen unsichtbar. Über seine Lesebrille hinweg sah Gamache, wie Thomas und Sandra ihren Blick über die wenigen Leute im Garten und am Ufer schweifen ließen. Julia Martin, die ältere der beiden Schwestern und einige Jahre jünger als Thomas, saß allein auf einem bequemen Liegestuhl an der Anlegestelle und las. Sie trug einen schlichten weißen Badeanzug. Mit Ende fünfzig war sie immer noch schlank und glänzte wie ein Pokal. Sie sah aus, als habe sie in Sonnenblumenöl gebadet und brutzle jetzt in der Sonne. Mit einem gewissen Grauen stellte sich Gamache vor, wie ihre Haut Blasen zu werfen begann. Von Zeit zu Zeit ließ Julia ihr Buch sinken und blickte über den stillen See. Nachdenklich. Nach allem, was Gamache von Julia Martin wusste, hatte sie auch Grund, über das eine oder andere nachzudenken.
Auf dem Rasen vor dem Ufer tummelte sich der Rest der Familie, das heißt, die jüngere Schwester Mariana und ihr Kind Bean. Während Thomas und Julia schlank und gut aussehend waren, war Mariana klein, dicklich und ziemlich hässlich. Sie war die Antithese zu den beiden. Ihre Kleider schienen einen heimlichen Groll gegen sie zu hegen und rutschten entweder an ihr herunter oder hoch, sodass sie ständig an sich herumzupfen musste und etwas zurechtschob, -zog oder -rückte.
Das etwa zehnjährige Kind dagegen war mit seinen langen, von der Sonne gebleichten blonden Haaren, den dichten dunklen Wimpern und strahlend blauen Augen sehr hübsch. Im Moment schien Mariana Tai-Chi zu machen, allerdings sahen die Figuren so aus, als hätte sie sie selbst erfunden.
»Sieh mal, Schätzchen, ein Kranich. Mommy ist ein Kranich.«
Die dickliche Frau stand auf einem Bein, die Arme gen Himmel gestreckt und auch den Hals so weit wie irgend möglich nach oben gereckt.
Bean ignorierte Mommy allerdings und las einfach weiter. Gamache dachte, wie sehr sich dieses Kind langweilen musste.
»Das ist die allerschwierigste Übung«, sagte Mariana lauter als nötig und erdrosselte sich im nächsten Augenblick beinahe mit einem ihrer Schals. Gamache hatte bemerkt, dass Mariana ihre Tai-Chi-, Yoga- und Meditationsübungen immer nur dann machte, wenn Thomas auf der Bildfläche erschien.
Versuchte sie, ihren Bruder zu beeindrucken, fragte er sich, oder wollte sie, dass er sich für sie schämte? Thomas sah kurz zu dem schwankenden fetten Kranich und dirigierte Sandra in die andere Richtung. Sie fanden zwei einsame Stühle im Schatten.
»Du spionierst den beiden doch nicht etwa hinterher?«, fragte Reine-Marie und ließ ihr Buch sinken.
»Hinterherspionieren wäre zu viel gesagt. Ich beobachte.«
»Solltest du das im Urlaub nicht eigentlich sein lassen?« Dann fügte sie jedoch gleich darauf hinzu: »Und? Was Interessantes gesehen?«
Er lachte und schüttelte den Kopf. »Nichts.«
»Also ich weiß nicht«, sagte Reine-Marie und sah sich nach den im Garten verteilten Finneys um. »Komisches Familientreffen. Da nehmen alle die lange Fahrt auf sich, nur um sich dann aus dem Weg zu gehen.«
»Könnte schlimmer sein«, sagte er. »Sie könnten sich auch gegenseitig umbringen.«
Reine-Marie lachte. »Das schaffen sie nie auf die Distanz.«
Gamache grunzte zustimmend und stellte zufrieden fest, dass es ihm egal war. Es war deren Problem, nicht seins. Abgesehen davon hatte er die Finneys nach den wenigen Tagen komischerweise irgendwie ins Herz geschlossen.
»Votre thé glacé, madame.« Der junge Mann sprach Französisch mit einem netten englisch-kanadischen Akzent.
»Merci, Elliot.« Reine-Marie beschattete ihre Augen gegen die Nachmittagssonne und lächelte den Kellner an.
»Un plaisir.« Er strahlte und reichte Reine-Marie einen Eistee und Gamache Zitronenlimonade, dann ging er weiter, um die übrigen Getränke zu servieren.
»Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich so jung war«, sagte Gamache wehmütig.
»Du magst ja einmal so jung gewesen sein, aber du warst niemals so …« Sie nickte in die Richtung von Elliot in seiner schwarzen Hose und dem knapp sitzenden kurzen weißen Jäckchen, der gerade mit weit ausholenden Schritten über den kurz geschnittenen Rasen ging.
»O nein, schon wieder ein Konkurrent, den ich verprügeln muss?«
»Vielleicht.«
»Das würde ich tun, das weißt du.« Er nahm ihre Hand.
»Das würdest du sicher nicht tun. Du würdest ihm zuhören, bis er tot umfällt.«
»Das ist nicht die schlechteste Strategie. Zermalme ihn mit Geistesgröße.«
»Mir steht sein Grauen regelrecht vor Augen.«
Gamache nippte an seiner Limonade, und gleich darauf verzog er das Gesicht, und es stiegen ihm Tränen in die Augen.
»Ach, welche Frau könnte diesem Anblick widerstehen?« Sie betrachtete seine blinzelnden, tränenden Augen und die jämmerliche Miene.
»Zucker. Ich brauch Zucker«, keuchte er.
»Warte, ich frage den Kellner.«
»Mach dir keine Mühe. Das erledige ich selbst.« Er hustete, dann sah er sie gespielt streng an und erhob sich schwungvoll von seinem bequemen Stuhl.
Mit der Limonade in der Hand wanderte er durch den Garten auf die breite, vor der schlimmsten Nachmittagssonne geschützten Terrasse, auf der es jetzt schon etwas kühler war. Bert Finney ließ sein Buch sinken und sah zu Gamache, dann lächelte er und nickte höflich.
»Guten Tag«, sagte er. »Warm heute.«
»Wobei es sich hier durchaus aushalten lässt, finde ich«, erwiderte Gamache und lächelte das alte Paar an, das still nebeneinandersaß. Finney war um einiges älter als seine Frau. Sie war nach Gamaches Schätzung Mitte achtzig, während er mindestens neunzig sein musste und etwas Durchsichtiges an sich hatte, wie viele Menschen, die sich dem Ende ihres Lebens näherten.
»Ich wollte gerade ins Haus gehen. Kann ich Ihnen vielleicht etwas mitbringen?«, fragte er und dachte erneut, dass Bert Finney bei all seiner Vornehmheit der unansehnlichste Mensch war, den er kannte. Er schalt sich selbst oberflächlich, schaffte es aber immerhin, den Mann nicht anzustarren. Monsieur Finney war so hässlich, dass er fast schon wieder attraktiv war, so als wäre Schönheit eine runde Sache, und dieser Mann hätte die gemeine Welt einmal ganz umrundet.
Seine Haut war pockennarbig, seine große schiefe Nase rot und mit blauen Äderchen überzogen, als hätte er Burgunder geschnupft, und der wäre hängen geblieben. Seine hervorstehenden gelblichen Zähne standen ihm kreuz und quer im Mund, so als wüssten sie nicht, wohin. Seine kleinen Augen irrten umher und schielten leicht. Amblyopie, dachte Gamache. Früher glaubte man, es ginge der böse Blick von solchen Augen aus, und Leute wie dieser Mann wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, wenn sie Glück hatten, und wenn sie Pech hatten, fanden sie sich an einen Pfahl gebunden wieder.
Irene Finney saß in einem geblümten Sommerkleid neben ihrem Mann. Sie war mollig, hatte weiches weißes Haar, das sie locker hochgesteckt trug, und obwohl sie ihr Gesicht abgewandt hatte, konnte er sehen, dass sie zarte, helle Haut hatte. Sie sah aus wie ein weiches, einladendes Kissen, das neben einer zerklüfteten Felswand lag.
»Vielen Dank, aber wir sind wunschlos glücklich.«
Gamache hatte bemerkt, dass Finney als einziges Mitglied der Familie immer bemüht war, französisch mit ihm zu sprechen.
Im Inneren des Manoir war es ein paar Grad kühler. Es war geradezu frisch, was an einem so heißen Tag sehr angenehm war. Es dauerte einen Moment, bis sich Gamaches Augen an das Dämmerlicht gewöhnten.
Die dunkle Ahorntür zum Speisesaal war geschlossen, und Gamache klopfte leise, dann öffnete er sie und trat in den holzverkleideten Raum. Die Tische waren schon für das Abendessen eingedeckt, frisch gebügelte weiße Damastdecken, Silberbesteck, feines Porzellan und kleine Blumengestecke. Es roch nach Rosen und Holz, nach Politur und Kräutern, Schönheit und Ordnung. Durch die bis zum Boden reichenden Fenster, die zum Garten hinaussahen, fiel die Sonne. Sie waren geschlossen, damit die Hitze draußen und die kühle Luft drinnen blieb. Im Manoir Bellechasse gab es keine Klimaanlage, stattdessen dienten die mächtigen Baumstämme als natürliche Isolierung, die in den kältesten Québecer Wintern die Wärme im Haus und die Hitze an den heißesten Sommertagen draußen hielt. Dieser Tag war noch längst nicht der heißeste. Um die achtundzwanzig Grad, schätzte Gamache. Aber er war dennoch für die Handwerkskunst der coureurs du bois dankbar, die dieses Haus errichtet und jeden Stamm einzeln ausgewählt hatten, sodass nichts eindringen konnte, was nicht eindringen sollte.
»Monsieur Gamache.« Pierre Patenaude trat auf ihn zu, lächelte und wischte sich dabei die Hände an einem Tuch ab. Er war ein paar Jahre jünger als Gamache und um einiges dünner. Das musste an dem vielen Gerenne zwischen den Tischen liegen, dachte dieser. Dabei schien der Maître d’ immer die Ruhe selbst zu sein. Er hatte Zeit für die Gäste und behandelte jeden einzelnen von ihnen so, als wäre er der einzige Gast im Hotel, ohne dass er dabei einen anderen vernachlässigte oder gar ganz übersah. Das war eine besondere Begabung der besten Maîtres d’, und das Manoir Bellechasse war bekannt dafür, sich nur mit dem Besten zufriedenzugeben.
»Was kann ich für Sie tun?«
Gamache hob etwas verschämt sein Glas. »Es tut mir leid, Sie mit solchen Kleinigkeiten zu belästigen, aber ich brauche noch ein bisschen Zucker.«
»Oje. Das habe ich befürchtet. Er scheint ausgegangen zu sein. Ich habe schon einen der garçons geschickt, um welchen zu besorgen. Désolé. Aber wenn Sie so gut sein und hier warten wollen, ich glaube, ich weiß, wo die Köchin ihren Notvorrat versteckt. So etwas ist wirklich noch nie vorgekommen.«
Genauso wenig, dachte Gamache, war er jemals Zeuge geworden, wie der unerschütterliche Maître d’ durch irgendetwas aus der Ruhe gebracht wurde.
»Ich möchte Sie keinesfalls in Bedrängnis bringen«, rief Gamache Patenaude hinterher, aber dieser war bereits durch die Tür verschwunden.
Kurz darauf kehrte der Maître d’ mit einer kleinen Porzellandose in der Hand zurück.
»Glück gehabt. Ich musste allerdings erst unsere Köchin niederringen.«
»Ach, das waren die Schreie, die ich eben gehört habe. Vielen Dank!«
»Pour vous, monsieur, c’est un plaisir.« Patenaude nahm sein Tuch wieder zur Hand und fuhr fort, eine Silberschüssel zu polieren, während Gamache den wertvollen Zucker in seine Limonade löffelte. Beide Männer sahen im einvernehmlichen Schweigen zu den Fenstern in den Garten und auf den stillen See hinaus. Ein Kanu trieb langsam vorbei.
»Ich habe gerade vorhin meine Instrumente überprüft«, sagte der Maître d’. »Es zieht ein Sturm auf.«
»Wirklich?«
Der Himmel war klar, und es regte sich kein Lüftchen, aber so wie alle Gäste in dem wunderbaren alten Jagdhaus glaubte Gamache fest an die Wettervorhersagen des Maître d’, die dieser mithilfe seiner auf dem ganzen Anwesen verteilten, selbstgebauten Instrumente erstellte. Es sei ein Hobby, hatte der Maître d’ einmal erklärt, das von Vater zu Sohn weitergegeben wurde.
»Manche Väter bringen ihren Söhnen bei, wie man jagt und fischt. Meiner nahm mich mit in den Wald und führte mich in die Wetterkunde ein«, hatte er gesagt, als er Gamache und Reine-Marie das Barometer und das alte Glasgefäß gezeigt hatte, das bis zur Tülle mit Wasser gefüllt war. »Jetzt bringe ich es ihnen bei.« Pierre Patenaude hatte in Richtung der jungen Leute gedeutet, die hier arbeiteten. Gamache hoffte, dass sie gut aufpassten.
Im Bellechasse gab es kein Fernsehen, und selbst Radio konnte man nur ausnahmsweise empfangen, und das bedeutete, dass auch die Wetterberichte der großen Wetterstationen nicht zu ihnen gelangten. Damit blieben nur Patenaude und seine sagenumwobene Fähigkeit zur Wettervorhersage. Jeden Tag, wenn sie zum Frühstück herunterkamen, war der neue Wetterbericht an die Tür des Speisesaals geheftet. Das linderte die schlimmsten Entzugserscheinungen, da sie nun einmal einer Nation angehörten, die nach Wetternachrichten süchtig war.
Jetzt sah Patenaude hinaus in den friedvollen Garten. Es rührte sich kein Blättchen.
»Ja. Zuerst kommt die Hitze, dann das Gewitter. Sieht mir ganz nach einem heftigen Unwetter aus.«
»Danke.« Gamache hob sein Limonadenglas und ging wieder hinaus.
Er liebte Sommergewitter, besonders im Bellechasse. Hier konnte man sie kommen sehen, anders als in Montréal, wo sie unvermittelt über einem loszubrechen schienen. Zuerst färbten die dunklen Wolken den Himmel am gegenüberliegenden Seeufer schwarz, um sich nach einer Weile in schweren Regenfällen zu ergießen. Das Gewitter schien sich zu sammeln, tief Luft zu holen, und dann marschierte es in einer breiten Phalanx los über den See. Mittlerweile nahm der Wind an Stärke zu, fing sich in den großen Bäumen und schüttelte sie wild hin und her. Dann schlug das Gewitter zu. Bumm! Und während der Sturm heulte und blies und sich gegen das Haus warf, würde er sich zusammen mit Reine-Marie hinter den dicken Wänden des Manoir in Sicherheit befinden.
Als er hinaustrat, prallte er gegen die Hitze wie gegen eine Mauer.
»Zucker gefunden?«, fragte Reine-Marie, streckte die Hand aus und berührte seine Wange, als er sich vorbeugte, um ihr einen Kuss zu geben, bevor er sich setzte.
»Ja.«
Sie nahm ihre Lektüre wieder auf, und Gamache griff nach dem Devoir, aber seine große Hand blieb über den Schlagzeilen in der Luft hängen. Neues Unabhängigkeitsreferendum? Bandenkrieg unter Bikern. Viele Tote bei einem Erdbeben.
Seine Hand wanderte weiter zu dem Limonadenglas. Das ganze Jahr über lief ihm bei dem Gedanken an die hausgemachte Limonade im Manoir Bellechasse das Wasser im Mund zusammen. Sie schmeckte frisch und sauber, süß und sauer. Sie roch nach Sonne und Sommer.
Gamache spürte, wie seine Schultern nachgaben. Die angespannte Wachsamkeit ließ nach. Wie angenehm. Er nahm seinen weichen Sonnenhut ab und wischte sich über die Stirn. Es wurde immer schwüler.
Während er so friedlich dasaß, konnte Gamache sich plötzlich nicht mehr vorstellen, dass sich ein Sturm zusammenbrauen sollte. Aber er merkte, wie der Schweiß in schmalen Bahnen an seinem Rückgrat entlanglief. Er meinte den wachsenden Luftdruck zu spüren, und die Worte, die der Maître d’ ihm hinterhergerufen hatte, kamen ihm wieder in den Sinn.
»Morgen wird es mörderisch.«
2
Nachdem sich die Gamaches mit einer Runde im See und einem Gin Tonic auf dem Steg erfrischt hatten, duschten sie und gesellten sich zu den anderen Gästen im Speisesaal. Kerzen brannten in Sturmlampen, und jeder Tisch war mit einem kleinen Blumengesteck aus alten englischen Rosen geschmückt. Auf dem Kaminsims stand ein üppigeres Gesteck, fast eine Skulptur aus Pfingstrosen und Flieder, zartblauem Rittersporn und hinfällig entrücktem Tränendem Herz.
Die Finneys saßen zusammen an einem Tisch, die Männer in Dinnerjacketts, die Frauen in luftigen Sommerkleidern, da es selbst zu dieser Stunde noch warm war. Bean trug weiße Shorts und ein froschgrünes T-Shirt.
Die Gäste sahen zu, wie die Sonne hinter den sanften Hügeln am Lake Massawippi unterging, und genossen dabei die verschiedenen Gänge, angefangen bei dem amuse-bouche aus einheimischem Karibu. Reine-Marie hatte die escargots à l’ail gewählt, gefolgt von gebratener Entenbrust mit einem confit von wildem Ingwer, Mandarine und Kumquat. Gamache aß einen bunten Gartensalat mit gehobeltem Parmesan, danach Wildlachs mit Sauerampferjoghurt.
»Und zum Dessert?« Pierre zog eine Flasche aus dem Weinkühler und schenkte ihnen nach.
»Was können Sie denn empfehlen?« Reine-Marie traute ihren Ohren nicht. Hatte sie das wirklich gefragt?
»Für Madame hätten wir frisches Minzeeis auf einem mit dunkler Bioschokoladencreme gefüllten Eclair, und für Monsieur einen Pudding du chômeur à l’érable avec crème chantilly.«
»Oje«, flüsterte Reine-Marie und wandte sich an ihren Mann. »Wie heißt dieser berühmte Satz von Oscar Wilde noch mal?«
»›Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht.‹«
Sie bestellten das Dessert.
Als sie zu guter Letzt keinen einzigen Bissen mehr hätten hinunterbringen können, kam der Käsewagen, beladen mit verschiedenen von den Mönchen in der nahe gelegenen Benediktinerabtei Saint-Benoit-du-Lac hergestellten Käsesorten. Die Brüder führten ein Leben in Kontemplation, sie hielten Vieh, gingen ihrer Arbeit in der Käserei nach und übten sich in gregorianischen Gesängen von so großer Schönheit, dass sie weltberühmt damit geworden waren, was bei Männern, die sich bewusst von der Welt zurückgezogen hatten, nicht einer gewissen Ironie entbehrte.
Während Armand Gamache seinen fromage bleu genoss, blickte er über den See in einen nur langsam verblassenden Himmel, so als würde ein so schöner Tag nur unwillig zu einem Ende kommen. In der Ferne war ein einzelnes Licht zu sehen. Ein Cottage. Es wirkte keineswegs wie ein Eindringling in der unberührten Natur, im Gegenteil, es hatte etwas Anheimelndes. Gamache stellte sich vor, dass eine Familie am Ufer saß und nach Sternschnuppen Ausschau hielt oder in der schlichten Stube beim Licht von Propangaslampen Rommé, Scrabble oder Cribbage spielte. Sie hatten natürlich Strom dort, aber ihm gefiel die Vorstellung, dass Menschen, die tief in den Wäldern von Québec lebten, nur Gaslampen benutzten.
»Ich habe heute mit Roslyn in Paris gesprochen.« Reine-Marie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, der dabei leise knarrte.
»Wie geht es ihr?« Gamache musterte das Gesicht seiner Frau, obwohl er wusste, dass, wenn es ein Problem gäbe, sie ihm dies schon längst mitgeteilt hätte.
»So gut wie nie. Noch zwei Monate. Es wird also im September zur Welt kommen. Ihre Mutter fliegt nach Paris, um sich um Florence zu kümmern, wenn das Kleine da ist, und Roslyn hat gefragt, ob wir nicht auch kommen wollen.«
Er lächelte. Sie hatten natürlich schon darüber geredet. Nichts könnte sie davon abhalten, ihre Enkelin Florence, ihren Sohn und ihre Schwiegertochter zu besuchen. Und das neue Baby. Jedes Mal, wenn Gamache daran dachte, überkam ihn ein schier unfassbares Glücksgefühl. Allein die Vorstellung, dass sein Kind selbst ein Kind hatte, schien ihm geradezu unglaublich.
»Sie haben schon Namen ausgesucht«, sagte sie beiläufig. Aber Gamache kannte seine Frau, ihr Gesicht, ihre Hände, ihren Körper, ihre Stimme. Und die Stimme hatte plötzlich einen etwas anderen Ton angenommen.
»Erzähl.« Er legte die Gabel mit dem Käse auf den Teller und faltete seine großen, ausdrucksstarken Hände auf der weißen Damasttischdecke.
Reine-Marie sah ihren Ehemann an. Er wirkte immer so ruhig und gelassen, was aber nur noch zu dem Eindruck von Stärke beitrug.
»Wenn es ein Mädchen wird, soll sie Geneviève Marie Gamache heißen.«
Gamache wiederholte den Namen. Geneviève Marie Gamache. »Das klingt schön.«
War das der Name, den sie auf Geburtstags- und Weihnachtskarten schreiben würden? Geneviève Marie Gamache. Würde die Kleine auf kurzen Beinchen die Treppe zu ihrer Wohnung in Outremont hochrennen und laut »Grandpapa, Grandpapa!« rufen? Und würde er »Geneviève« rufen und sie mit seinen starken Armen auffangen und sie sicher und warm an seine Brust drücken, was den Menschen vorbehalten war, die er liebte? Würde er sie und ihre Schwester Florence eines Tages auf Spaziergänge durch den Parc Mont Royal mitnehmen und ihnen seine Lieblingsgedichte beibringen?
Wo lebt ein Mensch so seelenschwach,
Dass er noch niemals bei sich sprach:
»Das ist mein Land, mein Heimatland!«
So wie es sein eigener Vater getan hatte.
Geneviève.
»Und wenn es ein Junge wird«, fuhr Reine-Marie fort, »wollen sie ihn Honoré nennen.«
Schweigen. Schließlich sagte Gamache: »Aha«, und senkte den Blick.
»Das ist ein wunderschöner Name, Armand, und eine noch schönere Geste.«
Gamache nickte, sagte aber immer noch kein Wort. Er hatte sich schon manchmal gefragt, was er empfände, wenn dieser Fall eintreten sollte. Aus irgendeinem Grund hatte er damit gerechnet, vielleicht weil er seinen Sohn kannte. Sie waren sich so ähnlich. Groß und kräftig gebaut, sanftmütig. Und hatte er damals nicht selbst mit sich gerungen, ob er Daniel Honoré nennen sollte? Bis zum Tag der Taufe hatte er Honoré Daniel heißen sollen.
Aber dann hatte er es seinem Sohn doch nicht antun wollen. War das Leben nicht auch ohne einen Namen wie Honoré Gamache schon schwer genug?
»Er bittet dich, ihn anzurufen.«
Gamache sah auf seine Uhr. Fast zehn. »Ich melde mich morgen früh bei ihm.«
»Und was willst du ihm sagen?«
Gamache drückte die Hände seiner Frau und ließ sie wieder los, dann lächelte er sie an. »Wie wäre es mit Espresso und einem Glas Likör im Salon?«
Sie sah ihn fragend an. »Möchtest du dir nicht kurz die Beine vertreten? Ich werde mich um den Espresso kümmern.«
»Danke, meine Liebe.«
»Ich warte auf dich.«
»Wo lebt ein Mensch so seelenschwach«, murmelte Armand Gamache, während er langsam die Dunkelheit durchmaß. Der süße Duft des nächtlichen Gartens begleitete ihn und die Sterne, den Mond und das Licht von der anderen Seite des Sees. Von der Familie im Wald. Seiner Phantasiefamilie. Vater, Mutter und glückliche, gedeihende Kinder.
Kein Leid, kein Verlust, kein scharfes Klopfen abends an der Tür.
In diesem Moment ging das Licht am anderen Ufer aus, und alles war in völlige Dunkelheit getaucht. Die Familie hatte sich friedlich schlafen gelegt.
Honoré Gamache. War das wirklich so falsch? War es falsch, was er empfand? Was sollte er Daniel morgen früh sagen?
Er starrte ins Leere und dachte kurz nach, bis er bemerkte, dass sein Blick auf etwas Leuchtendem ruhte. Vor dem Wald. Er sah sich um, ob jemand in der Nähe war, ein weiterer Zeuge. Aber Terrasse und Garten lagen verwaist da.
Neugierig ging Gamache über das weiche Gras darauf zu. Er warf einen Blick zurück auf die fröhlich funkelnden Lichter des Manoir und die Leute, die sich durch die Zimmer bewegten. Dann drehte er sich wieder um.
Der Wald lag dunkel da. Aber nicht still. Tiere liefen darin herum, Zweige knackten, gelegentlich war ein leises Krachen zu hören, wenn etwas von den Bäumen zu Boden fiel. Gamache hatte keine Angst vor der Dunkelheit, aber wie die meisten phantasiebegabten Kanadier fürchtete er sich ein kleines bisschen vor dem Wald.
Aber das weiß leuchtende Ding dort rief nach ihm, und er fühlte sich unwiderstehlich davon angezogen, so wie Odysseus von den Sirenen.
Es stand direkt am Waldrand. Er ging darauf zu, überrascht, wie groß es war, ein gleichmäßiger Quader ähnlich einem riesigen Zuckerwürfel. Er reichte ihm bis zur Hüfte, und Gamache streckte die Hand aus, nur um sie sofort wieder zurückzuziehen. Die Oberfläche war kalt, fast klamm. Er streckte erneut die Hand aus, entschlossener dieses Mal, und ließ sie einen Moment auf dem Ding ruhen. Er lächelte.
Es war aus Marmor. Er hatte Angst vor einem Marmorblock gehabt, dachte er und musste über sich lachen. Wie peinlich. Gamache trat einen Schritt zurück und starrte ihn an. Der weiße Stein leuchtete, als hätte er das wenige Mondlicht, das auf ihn fiel, eingefangen. Es war nichts als ein Marmorblock, sagte er sich. Kein Bär, kein Puma. Nichts Beängstigendes, nichts, was irgendwie unheimlich war. Aber er fand es dennoch unheimlich. Es erinnerte ihn an etwas.
»Peters praller pinker Pickel platzt.«
Gamache erstarrte.
»Peters praller pinker Pickel platzt.«
Da war es wieder.
Er drehte sich um und sah eine Gestalt mitten auf dem Rasen. Sie war von einer durchsichtigen Nebelschwade umgeben, und unter ihrer Nase glühte ein roter Punkt.
Julia Martin war nach draußen gekommen, um heimlich eine Zigarette zu rauchen. Gamache räusperte sich laut und raschelte mit der Hand durch einen Busch. Sofort fiel der rote Punkt zu Boden und verschwand unter einem zierlichen Fuß.
»Guten Abend«, rief sie heiter, auch wenn Gamache bezweifelte, dass sie wusste, wem sie gegenüberstand.
»Guten Abend, Madame«, sagte Gamache mit einer kleinen Verbeugung, nachdem er zu ihr getreten war. Sie war schlank und trug ein elegantes Abendkleid. Ihre Haare waren frisch frisiert, und sie hatte sich geschminkt und die Nägel lackiert, obwohl sie doch hier in der Wildnis waren. Sie wedelte mit ihrer schlanken Hand vor ihrem Gesicht herum, um den beißenden Zigarettenrauch zu vertreiben.
»Mücken«, sagte sie. »Kriebelmücken. Das Einzige, was einem die Ostküste verleiden kann.«
»Gibt es im Westen keine Kriebelmücken?«, fragte er.
»In Vancouver nicht. Ein paar Pferdebremsen auf dem Golfplatz. Sie können einen allerdings in den Wahnsinn treiben.«
Das konnte sich Gamache gut vorstellen, nachdem er selbst einmal von Pferdebremsen verfolgt worden war.
»Zum Glück hält einem der Zigarettenrauch die Viecher vom Leib«, sagte er mit einem Lächeln. Sie zögerte, dann kicherte sie. Sie war ein umgänglicher Mensch und lachte oft und gerne. Vertraulich berührte sie seinen Arm, obwohl sie keineswegs auf vertrautem Fuße miteinander standen. Aber sie trat einem damit nicht zu nahe, es war reine Gewohnheit. Als er sie in den letzten Tagen beobachtet hatte, hatte er bemerkt, dass sie jeden anfasste. Und jeden anlächelte.
»Sie haben mich ertappt, Monsieur. Beim heimlichen Rauchen. Ist das nicht lächerlich?«
»Hätte Ihre Familie etwas dagegen?«
»In meinem Alter kümmere ich mich schon längst nicht mehr darum, was andere von mir denken.«
»Ist das wahr? Ich wünschte, bei mir wäre das auch so.«
»Na ja, vielleicht kümmert es mich ein bisschen«, gab sie zu. »Ich war länger nicht mehr mit meiner Familie zusammen.« Als sie sich zum Manoir wandte, folgte er ihrem Blick. Drinnen beugte sich Thomas gerade zu seiner Mutter und sagte etwas zu ihr, während Sandra und Mariana zusahen, schweigend und ohne zu bemerken, dass sie beobachtet wurden.
»Als die Einladung eintraf, wollte ich zuerst eigentlich nicht kommen. Dieses Familientreffen findet einmal im Jahr statt, müssen Sie wissen, aber ich habe mich bisher immer davor gedrückt. Es ist so weit von Vancouver.«
Sie konnte die Einladung noch vor sich sehen, wie sie mit der Anschrift nach oben auf dem polierten Parkett in ihrer Eingangshalle lag und aussah, als sei sie aus großer Höhe heruntergefallen. Sie kannte dieses Gefühl. Sie hatte den dicken weißen Umschlag mit der allzu bekannten krakeligen Handschrift angestarrt. Es war ein Willenskampf. Aber sie wusste, wer gewinnen würde. Wer immer gewann.
»Ich will sie nicht enttäuschen«, sagte Julia Martin schließlich leise.
»Das können Sie doch gar nicht.«
Sie wandte sich ihm mit großen Augen zu. »Meinen Sie?«
Er hatte es aus reiner Höflichkeit gesagt. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie die Finneys zueinander standen.
Sie sah, dass er zögerte, und lachte erneut. »Verzeihen Sie mir, Monsieur. Jeden Tag, den ich mit meiner Familie verbringe, regrediere ich um zehn Jahre. Mittlerweile fühle ich mich wie ein linkischer, unsicherer Teenager. Heimlich zum Rauchen in den Garten zu verschwinden! Sie eigentlich auch?«
»Im Garten rauchen? Nein, das mache ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich wollte mir nur die Beine vertreten.«
»Passen Sie bloß auf. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen etwas zustößt.« Sie schien ein wenig mit ihm zu flirten.
»Ich passe immer auf, Madame Martin«, sagte Gamache, ohne darauf einzugehen. Er vermutete, dass das ihrem normalen Umgangston entsprach und sie eigentlich nichts weiter damit im Sinn hatte. Er hatte sie nun schon seit einigen Tagen beobachtet, und sie redete mit allen so, Männern wie Frauen, Fremden wie Verwandten, Hunden, Eichhörnchen, Kolibris. Kokett, nett.
Aus dem Augenwinkel sah er eine Bewegung. Er hatte den Eindruck, etwas Weißes wäre vorbeigezischt, und einen Moment lang setzte sein Herzschlag aus. War das Marmording zum Leben erwacht? Kam es etwa vom Waldrand auf sie zu? Er drehte sich um und sah auf der Terrasse eine Gestalt im Schatten verschwinden. Im nächsten Moment tauchte sie wieder auf.
»Elliott«, rief Julia Martin, »wie schön. Sie bringen mir sicher meinen Brandy und Bénédictine, oder?«
»Ja, Madame.« Der junge Kellner lächelte, als er das Glas von dem Silbertablett nahm und ihr reichte. Dann wandte er sich an Gamache. »Und für Monsieur? Darf ich Ihnen auch etwas bringen?«
Er sah so jung aus, so unbedarft.
Und doch wusste Gamache, dass der junge Mann an der Ecke des Hauses gestanden und sie beobachtet hatte. Warum?
Dann musste er über sich selbst lachen. Er sah Dinge, die nicht da waren, hörte Worte, die nicht gesprochen wurden. Eigentlich war er ins Manoir Bellechasse gekommen, um genau das abzustellen, er wollte sich entspannen und nicht mehr jeden Flecken auf dem Teppich verdächtig finden und überall Messer blitzen sehen. Nicht mehr die versteckten Gemeinheiten wahrnehmen, die sich im Gewand ganz normaler Worte in ein Gespräch schleichen konnten. Und die Empfindungen, die glatt gestrichen, gefaltet und in etwas anderes verwandelt wurden, wie eine Art Gefühlsorigami. Es sah hübsch aus, aber dahinter verbarg sich oft etwas ganz und gar Abstoßendes.
Es war schlimm genug, dass er sich angewöhnt hatte zu überlegen, ob die älteren Nebendarsteller noch lebten, wenn er einen alten Film sah. Und wie sie gestorben waren. Aber wenn er anfing, bei ganz normalen Passanten auf der Straße den Schädel unter der Haut zu erkennen, war es an der Zeit abzuschalten.
Und doch musterte er jetzt misstrauisch den jungen Kellner Elliot und war nahe daran, ihn des Hinterherspionierens zu bezichtigen.
»Nein, danke. Madame Gamache hat schon für mich im Salon bestellt.«
Julia sah Elliot nach, als er sich zurückzog.
»Ein attraktiver junger Mann«, sagte Gamache.
»Finden Sie?«, fragte sie mit amüsierter Stimme, ohne dass man ihre Miene im Dunkeln erkennen konnte. Dann fuhr sie fort: »Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich einmal einen ähnlichen Job hatte, als ich ungefähr so alt war wie er, allerdings lange nichts so Großartiges wie das Hotel hier. Es war ein Ferienjob in einem Imbiss auf der Main in Montréal. Sie wissen schon, Boulevard Saint-Laurent.«
»Ja, kenne ich.«
»Natürlich. Verzeihen Sie. Ein übler Laden. Der Besitzer zahlte einen Hungerlohn und konnte seine Pfoten nicht von mir lassen. Ekelhaft.«
Sie hielt inne.
»Aber ich war begeistert. Mein erster Job. Ich hatte meinen Eltern erzählt, dass ich einen Segelkurs im Jachtklub machte, und sprang stattdessen in den 24er und fuhr nach Osten. Unbekanntes Terrain für Anglos in den Sechzigern. Eine richtige Mutprobe«, sagte sie mit unüberhörbarer Selbstironie in der Stimme. Gamache konnte sich jedoch an die Zeit erinnern und wusste, dass sie recht hatte.
»Ich erinnere mich an meinen ersten Gehaltsscheck. Ich zeigte ihn zu Hause meinen Eltern. Wissen Sie, was meine Mutter sagte?«
Gamache schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Sie betrachtete den Scheck, dann gab sie ihn mir zurück und sagte, ich sei bestimmt stolz auf mich. Und das war ich auch. Aber es war klar, dass sie eigentlich etwas anderes meinte. Und da tat ich etwas sehr Dummes. Ich fragte sie, was sie meinte. Seither weiß ich, dass ich keine Fragen stellen sollte, wenn ich nicht auf die Antwort vorbereitet bin. Sie sagte, ich sei privilegiert und würde das Geld überhaupt nicht brauchen, jemand anderes allerdings schon. Im Grunde hätte ich es einem armen Mädchen gestohlen, das den Job tatsächlich brauchen würde.«
»Das ist nicht nett«, sagte Gamache. »Aber sie hat es doch bestimmt nicht so gemeint.«
»Doch, das hat sie, und sie hatte recht. Am nächsten Tag habe ich gekündigt, aber gelegentlich ging ich an dem Laden vorbei und warf einen Blick durchs Fenster, um der neuen Bedienung bei der Arbeit zuzusehen. Und ich war glücklich.«
»Armut kann die Menschen erdrücken«, sagte Gamache leise. »Aber das kann ein privilegiertes Leben auch.«
»Ich habe das Mädchen sogar beneidet«, sagte Julia. »Dumm, ich weiß. Romantisch. Ich bin sicher, dass sie kein leichtes Leben hatte. Aber ich dachte, dass es vielleicht wenigstens ihr eigenes ist.« Sie lachte und nippte an ihrem Glas. »Sehr gut. Meinen Sie, dass er von den Mönchen hier in der Abtei stammt?«
»Der Bénédictine? Ich weiß es nicht.«
Sie lachte. »Diese Worte höre ich nicht oft.«
»Welche Worte?«
»›Ich weiß es nicht.‹ Meine Familie weiß immer alles. Mein Mann weiß immer alles.«
Die letzten Tage hatten sie über das Wetter geplaudert, den Garten, das Essen im Manoir. Das war das erste ernsthafte Gespräch, das er mit einem der Finneys führte, und es war das erste Mal, dass diese Frau ihren Ehemann erwähnte.
»Ich bin schon ein paar Tage früher ins Manoir gekommen. Um …«
Sie schien nicht zu wissen, was sie sagen sollte, und Gamache wartete. Er hatte alle Zeit und Geduld der Welt.
»Ich bin gerade dabei, mich scheiden zu lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.«
»Ich habe davon gehört.«
Die meisten Kanadier hatten davon gehört. Julia Martin war mit David Martin verheiratet, dessen spektakulärer wirtschaftlicher Erfolg und noch spektakulärerer Niedergang von den Medien genüsslich auseinandergenommen worden war. Er hatte sein Vermögen mit Versicherungen gemacht und war zu einem der reichsten Männer Kanadas aufgestiegen. Sein Niedergang hatte vor einigen Jahren begonnen. Er hatte sich quälend lange hingezogen, so als rutsche jemand einen schlammigen Abhang hinunter. Man hatte ständig den Eindruck, er könnte die Talfahrt aufhalten, aber stattdessen sammelte sich dabei immer schneller immer mehr Schlamm und Dreck an. Bis es schließlich selbst seine Feinde nicht mehr mit ansehen konnten.
Er hatte alles verloren, sogar seine Freiheit.
Seine Frau hatte ihm beigestanden. Groß, elegant, würdevoll. Statt mit ihrem privilegierten Leben Neid zu wecken, hatte sie es irgendwie geschafft, die Zuneigung der Leute zu gewinnen. Die Leute mochten ihre Fröhlichkeit, die sich mit Sensibilität paarte. Ihre Würde und Aufrichtigkeit machten es möglich, sich mit ihr zu identifizieren. Zu guter Letzt bewunderten sie diese Frau sogar, weil sie sich öffentlich entschuldigte, als schließlich klar war, dass ihr Mann alle und jeden angelogen und Zehntausende von Menschen um ihre gesamten Ersparnisse gebracht hatte. Und sie hatte versprochen, das Geld zurückzuzahlen.
Inzwischen saß David Martin in einem Staatsgefängnis in British Columbia ein, und Julia Martin war nach Hause zurückgekehrt. Sie würde nach Toronto ziehen, hatte sie der Presse erklärt, kurz bevor sie verschwunden war. Und jetzt war sie hier, in Québec. Mitten in den Wäldern.
»Ich wollte mich vor dem Familientreffen ausruhen, endlich wieder zu Atem kommen. Ich bin gern für mich allein. Das habe ich vermisst.«
»Verstehe«, sagte er. Und das tat er. »Aber eines begreife ich nicht.«
»Ja?« Sie klang wachsam, wie eine Frau, die es gewohnt war, dass ihr allzu persönliche Fragen gestellt werden.
»Peters praller pinker Pickel platzt?«
Sie lachte. »Das ist so ein Spruch aus unserer Kindheit.«
Auf einer Hälfte ihres Gesichts spielte das goldene Licht aus dem Manoir. Die beiden standen schweigend da und sahen zu, wie die Leute von Zimmer zu Zimmer gingen. Es war fast so, als würden sie einer Theateraufführung beiwohnen. Die Bühne erleuchtet und für verschiedene Szenen verschiedene Kulissen, durch die sich die Schauspieler bewegten.
Er sah wieder zu seiner Gesprächspartnerin und wunderte sich. Warum war der Rest der Familie im Haus und sie hier draußen im Dunkeln, allein, und beobachtete sie?
Sie hatten sich im Salon mit der hohen Holzdecke und den edlen Möbeln versammelt. Mariana ging gerade zum Klavier, wurde aber von Madame Finney wieder verscheucht.
»Die arme Mariana.« Julia lachte. »Es ändert sich doch nie etwas. Magilla kommt nie dazu zu spielen. Thomas ist der Musiker in der Familie, so wie mein Vater. Er war sehr talentiert.«
Gamache ließ seinen Blick zu dem alten Mann auf dem Sofa wandern. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die gichtigen Hände gefällige Klänge hervorbrachten, aber wahrscheinlich waren sie ja nicht immer so verkrüppelt gewesen.
Thomas setzte sich auf die Klavierbank, hob die Hände und schickte sich an, die Nachtluft mit einer Melodie von Bach zu erfüllen.
»Er spielt wunderschön«, sagte Julia. »Das hatte ich ganz vergessen.«
Gamache stimmte ihr zu. Durchs Fenster sah er, wie Reine-Marie Platz nahm und ein Kellner zwei Espressi und zwei Gläser Cognac vor sie stellte. Er wollte zurück ins Haus.
»Es fehlt übrigens noch einer von uns.«
»Ach?«
Sie hatte versucht, es zu verbergen, aber Gamache war der Unterton in ihrer Stimme nicht entgangen.
Reine-Marie rührte ihren Espresso um und hatte den Kopf dem Fenster zugewandt. Er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnte. Da sie im Licht saß, sah sie mit Sicherheit nur die Spiegelung des Zimmers in der Scheibe.
Hier bin ich, flüsterte seine Seele. Hier drüben.
Sie drehte den Kopf ein wenig weiter, sodass ihre Augen direkt auf ihn gerichtet waren.
Das war natürlich Zufall. Aber der Teil von ihm, der auf die Vernunft nicht viel gab, war überzeugt, dass sie ihn gehört hatte.
»Morgen kommt Spot, mein jüngerer Bruder. Er bringt wahrscheinlich seine Frau Claire mit.«
Es war das erste Mal, dass er Julia Martin etwas sagen hörte, das nicht freundlich oder nett war. An den Worten lag es jedoch nicht, sie waren neutral. Der Ton war verräterisch.
Er war voller Angst.
Sie kehrten zum Manoir Bellechasse zurück, und als Gamache Julia Martin die Tür aufhielt, fiel sein Blick erneut auf den Marmorblock am Waldrand. Er konnte nur eine Ecke davon sehen, aber plötzlich wusste er, woran er ihn erinnerte.
An einen Grabstein.
3
Pierre Patenaude drückte die Schwingtür zur Küche in dem Augenblick auf, als drinnen lautes Gelächter ertönte. Kaum war er eingetreten, hörte es schlagartig auf, und er fragte sich, was ihn mehr ärgerte, das Lachen oder sein unvermitteltes Abbrechen.
Elliot stand in der Mitte des Raums, eine Hand auf die schmale Hüfte gestützt, die andere leicht erhoben, der gestreckte Zeigefinger in der Luft erstarrt, mit einem begehrlichen und zugleich säuerlichen Ausdruck im Gesicht. Er äffte außerordentlich treffend einen der Gäste nach.
»Was ist hier los?«
Pierre konnte den strengen, missbilligenden Ton in seiner Stimme selbst nicht leiden. Und er konnte den Ausdruck auf ihren Gesichtern nicht leiden. Furcht. Außer auf dem von Elliot. Der wirkte zufrieden.
Das Personal hatte sich noch nie vor ihm gefürchtet, und es gab auch keinen Grund, warum sie es jetzt tun sollten. Es lag nur an diesem Elliot. Vom ersten Tag an hatte er die anderen gegen den Maître d’ aufgewiegelt. Er spürte es. Dass auf einmal nicht mehr alle Fäden bei ihm zusammenliefen und er sich wie ein Außenseiter im Manoir vorkam.
Wie hatte der junge Mann das nur geschafft?
Im Grunde wusste Pierre es genau. Elliot hatte die schlimmsten Seiten an ihm zum Vorschein gebracht, hatte ihn verhöhnt, sämtliche Regeln übertreten und Pierre dazu gezwungen, den Zuchtmeister zu spielen, der er gar nicht war. Die anderen jungen Leute waren alle lernwillig, sie waren bereit, zuzuhören und sich etwas beibringen zu lassen, sie waren dankbar für den geregelten Tagesablauf und die Führung durch den Maître d’. Er brachte ihnen bei, die Gäste zu respektieren, höflich und freundlich zu sein, selbst wenn man sie schikanierte. Er erklärte ihnen, dass die Gäste gutes Geld dafür bezahlten, verwöhnt zu werden, aber es ging noch um mehr. Sie kamen ins Manoir, damit sich jemand um sie kümmerte.
Pierre fühlte sich manchmal wie ein Arzt in der Notaufnahme. Die Leute strömten durch die Tür, Opfer des Stadtlebens, niedergedrückt von der Bürde des Alltags. Zu viele Forderungen, zu wenig Zeit, zu viele Rechnungen, E-Mails, Meetings, Telefonate, zu wenig Dankbarkeit und viel zu viel, wirklich viel zu viel Druck – das alles hatte sie gebrochen. Er erinnerte sich, wie erschöpft sein Vater immer aus dem Büro nach Hause gekommen war, völlig geschafft.
Sie verrichteten im Manoir Bellechasse keine niedrigen Arbeiten, das wusste Pierre. Diese Arbeit war ehrenvoll und wichtig. Sie sorgten dafür, dass Leute geheilt wurden. Wobei manche natürlich schwerer verletzt waren als andere.
Nicht jeder eignete sich für diese Art Arbeit.
Elliot zum Beispiel.
»Ich habe nur Spaß gemacht.«
Das sagte Elliot, als wäre es das Normalste von der Welt, mitten in der engen, vollbesetzten Küche zu stehen und die Gäste nachzuäffen, und der Maître d’ wäre derjenige, der nicht ganz normal war. Pierre spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Er sah sich um.
Die große, alte Küche bot sich als Treffpunkt für das Personal an. Selbst die Gärtner waren da, aßen Kuchen und tranken Tee und Kaffee. Und sahen zu, wie er sich von einem Neunzehnjährigen demütigen ließ. Pierre sagte sich, dass Elliot noch jung sei. Aber das hatte er sich schon so oft gesagt, dass es seine Bedeutung verloren hatte.
Er wusste, dass er es aufgeben sollte.
»Du hast unsere Gäste lächerlich gemacht.«