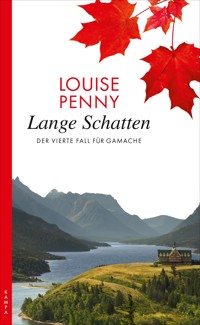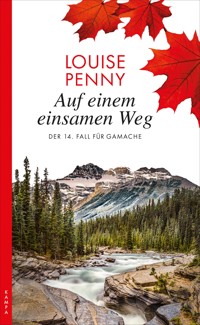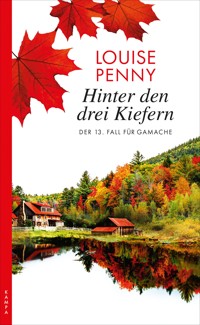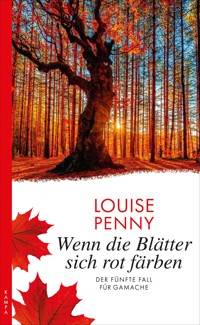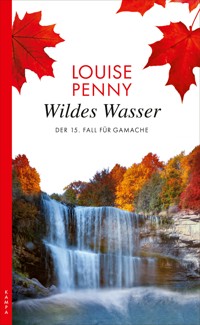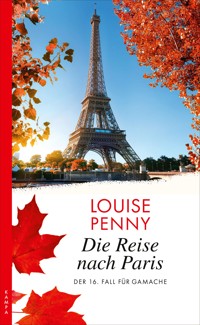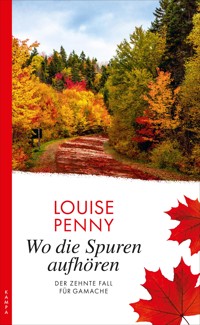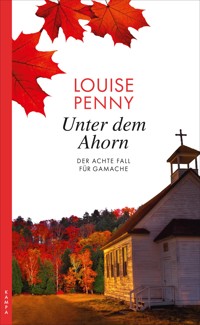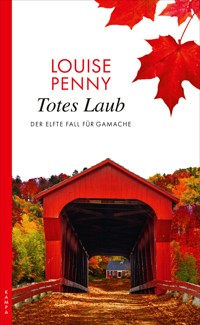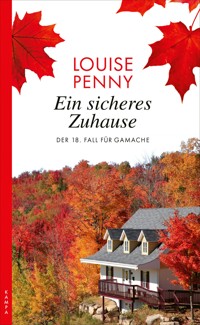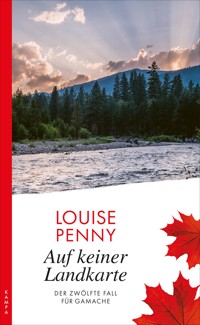Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Wenn es einen Ort gibt, an dem es an Weihnachtsbäumen nicht mangelt, dann ist es das idyllische Three Pines. An den Feiertagen ist es in dem tief eingeschneiten Dorf inmitten der kanadischen Wälder noch ruhiger als sonst. Friedlich ist es auch in den Büros der Sûreté von Montréal. Inspector Armand Gamache, Chef der Mordkommission, nutzt die besinnliche Zeit für einen ganz speziellen Brauch: Den zweiten Weihnachtstag verbringt er wie jedes Jahr mit seiner Frau Reine-Marie in seinem Büro, um bei Truthahn-Sandwiches die Akten ungelöster Fälle durchzugehen - in der Hoffnung, doch noch etwas zu entdecken. Doch diesmal wird die Weihnachtstradition gestört, ein neuer Fall fordert Gamaches ganze Aufmerksamkeit. In Three Pines ist ein Mord passiert, mitten auf dem zugefrorenen See während des jährlichen Curling-Wettbewerbs. Und obwohlalle Dorfbewohner anwesend waren, will niemand etwas gesehen haben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Tief eingeschneit
Der zweite Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Gabriele Werbeck und Andrea Stumpf
Kampa
1
Wenn CC de Poitiers gewusst hätte, dass sie ermordet werden würde, hätte sie ihrem Ehemann Richard möglicherweise ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Sie wäre vielleicht sogar noch zum Krippenspiel in Miss Edwards Mädchenschule, der Madenschule, wie CC ihre unförmige Tochter gerne aufzog, gegangen, in dem diese mitwirkte. Hätte CC de Poitiers gewusst, dass ihr Ende nahte, hätte sie vielleicht gearbeitet, statt sich in dem billigsten Zimmer, das das Ritz in Montréal im Angebot hatte, einzumieten. Aber das einzige Ende, von dessen Herannahen sie wusste, blühte einem Mann namens Saul.
»Und, wie findest du es? Gefällt es dir?« Sie balancierte das Buch auf ihrem bleichen Bauch.
Saul betrachtete es nicht zum ersten Mal. Die letzten Tage hatte sie es alle fünf Minuten aus ihrer riesigen Handtasche gezogen. Während irgendwelcher Geschäftstreffen, Essenseinladungen oder Taxifahrten durch die verschneiten Straßen von Montréal beugte sich CC unvermittelt nach unten und tauchte triumphierend mit ihrem Werk in der Hand wieder auf, als sei es das Produkt einer neuerlichen Jungfrauengeburt.
»Mir gefällt das Bild«, sagte er und war sich seiner Unverschämtheit durchaus bewusst. Er hatte das Bild selbst aufgenommen. Er wusste, dass sie mehr hören wollte, förmlich darum bettelte, und er wusste, dass er keine Lust dazu hatte. Er fragte sich, wie viel Zeit er noch mit CC de Poitiers verbringen konnte, ohne so zu werden wie sie. Nicht körperlich, natürlich. Mit ihren achtundvierzig war sie ein paar Jahre jünger als er. Sie war schlank, drahtig, durchtrainiert, ihre Zähne strahlten viel zu weiß, und ihre Haare waren viel zu blond. Wenn man sie anfasste, hatte man das Gefühl, eine Eisschicht zu berühren. Das fühlte sich schön und zerbrechlich an, was er attraktiv fand. Aber es war auch gefährlich. Wenn diese Eisschicht jemals brechen, in Stücke gehen sollte, würde er mit zerbrechen.
Ihr Äußeres war nicht das Problem. Während er sie dabei beobachtete, wie sie ihr Buch mit größerer Zärtlichkeit streichelte, als sie ihm gegenüber jemals gezeigt hatte, fragte er sich, ob das Eiswasser in ihren Eingeweiden auf irgendeinem Wege in ihn eingedrungen war, vielleicht beim Sex, und ihn langsam gefrieren ließ. Er konnte sein Innerstes schon nicht mehr spüren.
Mit seinen zweiundfünfzig Jahren stellte Saul Petrov langsam fest, dass seine Freunde nicht mehr ganz so brillant, nicht mehr ganz so clever, nicht mehr ganz so schlank waren wie früher. Die meisten langweilten ihn mittlerweile sogar. Auch bei ihnen hatte er schon das eine oder andere verräterische Gähnen bemerkt. Sie wurden dick, glatzköpfig und träge, und er befürchtete, dass es bei ihm nicht anders war. Das Schlimme daran war nicht einmal, dass die Frauen ihn kaum mehr ansahen oder dass er überlegte, ob er seine Alpinski gegen Langlaufski tauschen sollte, auch nicht dass sein Hausarzt ihn zu einer ersten Prostata-Untersuchung einbestellt hatte. Das konnte er alles hinnehmen. Was Saul Petrov um zwei Uhr morgens weckte und ihm mit derselben Stimme ins Ohr flüsterte, die ihn als Kind gewarnt hatte, unter seinem Bett würden Löwen hausen, war die Gewissheit, dass die Leute ihn mittlerweile langweilig fanden. Bei solchen Gelegenheiten holte er ganz tief Luft und versuchte, sich mit der Mutmaßung zu beruhigen, das unterdrückte Gähnen seines Tischnachbarn habe mit dem Wein, dem magret de canard oder dem überheizten Restaurant zu tun, zumal sie alle in dicken Winterpullovern steckten.
Aber die nächtliche Stimme suchte ihn weiter heim und warnte ihn vor bevorstehenden Gefahren: vor einer drohenden Katastrophe; davor, dass er beim Erzählen zu weit ausholte, dass die Aufmerksamkeitsspanne zu kurz war, dass zu viele Augenlider zu schwer wurden; vor schnellen und verstohlenen Blicken auf Armbanduhren, der impliziten Überlegung, wann man endlich gehen konnte; vor Augen, die im Raum herumwanderten, verzweifelt Ausschau nach anregenderer Gesellschaft hielten.
So kam es, dass er sich von CC verführen ließ. Verführen und verschlingen, sodass der Löwe unter seinem Bett zum Löwen in seinem Bett wurde. Er vermutete inzwischen, dass diese egozentrische Frau genug davon hatte, nur um sich selbst, um ihren Ehemann und selbst diese Katastrophe von Tochter zu kreisen, und deshalb nun ihn umkreiste, um sich ihn einzuverleiben.
Er hatte durch ihre Gesellschaft schon ihre Grausamkeit angenommen. Er hatte sogar angefangen, sich zu verachten. Allerdings noch lange nicht so sehr, wie er sie verachtete.
»Es ist ein wunderbares Buch«, sagte sie, ohne ihm Beachtung zu schenken. »Stimmt das etwa nicht? Wer wollte das nicht haben?« Sie fuchtelte mit dem Buch vor seinem Gesicht herum. »Die Leute werden sich darauf stürzen. So viele Menschen da draußen sind hilfsbedürftig.« Sie drehte sich um und sah zum Fenster ihres Hotelzimmers hinaus auf das Gebäude gegenüber, als überschaute sie eine ihretwegen versammelte Menschenmenge. »Ich habe es für sie gemacht.« Jetzt wandte sie sich mit großen, ernsten Augen zu ihm um.
Glaubte sie das wirklich?, fragte er sich.
Er hatte das Buch natürlich gelesen. Be Calm – Ruhe finden hatte sie es genannt, nach dem Unternehmen, das sie vor ein paar Jahren gegründet hatte, was zum Lachen war, wenn man sah, was für ein Nervenbündel sie war. Die unruhigen, nervösen Hände, die ständig etwas glatt strichen und gerade rückten. Ihre schnippische Art, die Ungeduld, die schnell in Ärger umschlug.
Trotz ihres gelassenen, unterkühlten Auftretens würde man CC de Poitiers ganz sicher nicht mit dem Begriff Ruhe beschreiben.
Sie war mit ihrem Buch bei allen möglichen Verlagen Klinken putzen gegangen, angefangen bei den renommierten Verlagshäusern in New York bis hin zu Publications Réjan et Maison des cartes, einem Kleinstverlag in dem Dörfchen St. Polycarpe an der Schnellstraße zwischen Montréal und Toronto, in dem sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten.
Alle hatten abgelehnt, da sie sofort gemerkt hatten, dass das Manuskript eine fade Mischung aus albernen Selbsthilferezepten war, in unausgegorene buddhistische und hinduistische Lehren verpackt und abgesondert von einer Frau, die auf dem Umschlagfoto so aussah, als würde sie ihre eigenen Jungen auffressen.
»Kein Schwein will Erleuchtung«, hatte sie zu Saul in ihrem Büro in Montréal gesagt, als ein ganzer Schwung Absagen eingetroffen war, dabei hatte sie die Briefe in Fetzen gerissen und auf den Boden fallen lassen, damit die Putzfrau sie einsammelte. »Mit dieser Welt liegt es im Argen, das sage ich dir. Die Leute sind brutal und unsensibel, das Einzige, wonach ihnen der Sinn steht, ist, sich gegenseitig aufs Kreuz zu legen. Es gibt keine Liebe und kein Mitgefühl. Das«, sie holte mit ihrem Buch weit aus, als sei es ein alter mythischer Hammer, mit dem sie auf den Amboss der Rache schlagen wollte, »wird den Leuten beibringen, ihr Glück zu finden.«
Ihre Stimme war leise, die Worte erzitterten unter dem Gewicht ihrer Gehässigkeit. Sie hatte ihr Buch schließlich im Selbstverlag herausgebracht, damit es rechtzeitig vor Weihnachten auf den Markt kam. Dass es in dem Buch ständig um Licht ging und es exakt zur Wintersonnenwende auf den Markt gekommen war, hielt Saul für reinste Ironie. Am dunkelsten Tag des Jahres.
»Wie heißt der Verlag noch mal, bei dem es herausgekommen ist?« Er konnte sich einfach nicht zurückhalten. Sie schwieg. »Ach ja, jetzt erinnere ich mich«, sagte er. »Es wollte keiner. Das muss schrecklich gewesen sein.« Er zögerte einen Moment und überlegte, ob er noch mehr Salz in die Wunde streuen sollte. Ach, warum nicht, es war sowieso schon egal. »Ich frage mich, wie du dich da gefühlt hast?« Bildete er sich nur ein, dass sie zusammenzuckte?
Aber sie schwieg weiter, sehr beredt, und ihr Gesicht blieb ausdruckslos. Was CC nicht mochte, existierte nicht. Dazu zählten auch ihr Ehemann und ihre Tochter. Dazu zählten alle Unannehmlichkeiten, jede Kritik, jedes harte Wort, das nicht von ihr selbst kam, alle Gefühle. CC lebte, soweit Saul wusste, in ihrer eigenen Welt, in der sie vollkommen war, in der sie ihre Gefühle und ihr Versagen verbergen konnte.
Er fragte sich, wie lange es noch dauern würde, bis diese Welt mit einem Riesenknall in die Luft flog. Er hoffte, dass er dabei war, wenn das passierte. Nur nicht zu nah.
Die Leute sind brutal und unsensibel, hatte sie gesagt. Brutal und unsensibel. Es war gar nicht so lange her, dass er die Welt für schön gehalten hatte, damals hatte er sich bereit erklärt, als freiberuflicher Fotograf und als Liebhaber von CC zu fungieren. Jeden Morgen war er früh aufgewacht und hatte den Tag begonnen, als sei es der erste und alles möglich, er hatte gesehen, wie bezaubernd Montréal war. Er hatte gesehen, wie die Leute lächelten, wenn man ihnen in einem der Cafés ihren Cappuccino brachte oder sie ihre Blumen oder ihr Baguette in Empfang nahmen. Er hatte gesehen, wie im Herbst die Kinder die heruntergefallenen Kastanien zum Basteln einsammelten. Er hatte die alten Frauen gesehen, die untergehakt die Main Street entlanggegangen waren.
Er war weder so dumm noch so blind, dass er nicht auch all die obdachlosen Männer und Frauen bemerkte oder die bleichen, geschundenen Gesichter, die von einer langen, trostlosen Nacht zeugten und einem noch längeren vor ihnen liegenden Tag.
Aber tief in seinem Herzen hielt er das Leben für schön. Das spiegelte sich in seinen Fotos, die das Licht, das Strahlen, die Hoffnung einfingen. Natürlich auch die Schatten, die das Licht von Natur aus begleiteten.
Ironischerweise war es genau das, was CCs Aufmerksamkeit erregt und sie dazu gebracht hatte, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Artikel in einer Hochglanzzeitschrift aus Montréal hatte ihn als »angesagten« Fotografen bezeichnet, und CC gab sich immer nur mit dem Besten zufrieden. Weshalb sie auch immer ein Zimmer im Ritz nahmen. Ein enges, trübseliges Zimmer auf einer der unteren Etagen ohne Aussicht und Charme, aber im Ritz. CC würde das Shampoo und das Briefpapier mitnehmen, um damit ihren Wert zu demonstrieren, so wie sie ihn genommen hatte. Sie benutzte diese Dinge, um damit bei Leuten Eindruck zu schinden, denen das eigentlich egal war, so wie bei ihm. Irgendwann sortierte sie dann aus. So hatte sie ihren Ehemann ausgemustert, so ignorierte sie ihre Tochter oder machte sich über sie lustig.
In der Welt ging es brutal und unsensibel zu.
Davon war er mittlerweile auch überzeugt.
Er hasste CC de Poitiers.
Er stieg aus dem Bett, ließ CC de Poitiers und ihr Buch, das sie zärtlich betrachtete, zurück. Er sah sie an, und ihr Bild verschwamm vor seinen Augen. Er legte den Kopf schief und fragte sich, ob er wieder einmal zu viel getrunken hatte. Aber ihr Bild verschwamm noch mehr, dann wurde es wieder scharf, als würde er zwei verschiedene Frauen durch ein Prisma ansehen, die eine schön, glamourös, lebendig und die andere eine dumme, blondierte Ziege, ewig meckernd, bockig, kratzbürstig. Und gefährlich.
»Was ist das?« Er griff in den Papierkorb und holte eine Mappe heraus. Eine Künstlermappe, offenbar. Sie war sorgfältig und mit viel Geschmack in altes Büttenpapier gebunden. Er schlug sie auf, und ihm stockte der Atem.
Eine Serie von Arbeiten, licht und leicht, die auf dem Papier zu leuchten schienen. Er spürte, wie sich etwas in seiner Brust regte. Die Bilder zeigten eine sowohl bezaubernde als auch verletzliche Welt. Vor allem aber war es eine Welt, in der es noch Hoffnung und Trost gab. Es war eindeutig die Welt, die der Künstler täglich sah, die Welt, in der der Künstler lebte. So wie er selbst einmal in einer Welt voller Licht und Hoffnung gelebt hatte.
Die Bilder sahen einfach aus, waren in Wirklichkeit aber sehr komplex. Motive und Farben waren übereinandergeschichtet. Der Künstler musste viele Stunden und Tage daran gearbeitet haben, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Er blickte auf das vor ihm liegende Blatt. Ein majestätischer Baum ragte hoch in den Himmel, als strecke er sich nach der Sonne. Der Künstler hatte ihn fotografiert und dabei einen Moment der Bewegung eingefangen, ohne dass das Bild deswegen unruhig wirkte. Im Gegenteil, es strahlte Würde aus, Ruhe und vor allem Kraft. Die Spitzen der Zweige schienen zu schmelzen oder zu verschwimmen, so als bliebe bei allem Selbstvertrauen und Streben ein winziger Zweifel. Es war brillant.
Jeder Gedanke an CC war vergessen. Er war in den Baum geklettert, spürte beinahe das Kratzen der rauen Rinde, wie damals, als er auf dem Schoß seines Großvaters gesessen und sich an dessen unrasierte Wange geschmiegt hatte. Wie hatte der Künstler das nur zustande gebracht?
Er entdeckte keine Signatur. Er blätterte weiter und spürte, wie sich langsam ein Lächeln auf sein gefrorenes Gesicht stahl und bis in sein verhärtetes Herz drang.
Wenn eines Tages die Geschichte mit CC beendet war, könnte er vielleicht wieder seine eigentliche Arbeit aufnehmen und Bilder wie diese hier schaffen.
Mit einem Seufzer entwich all die Dunkelheit, die sich in ihm angesammelt hatte.
»Und, gefällt es dir?« CC hob ihr Buch hoch und wedelte damit herum.
2
Crie legte ihr Kostüm vorsichtig zurecht, um den weißen Chiffon nicht zu zerreißen. Das Krippenspiel hatte schon begonnen. Sie hörte die unteren Klassen »Es ist ein Ros’ entsprungen« singen, auch wenn es sich verdächtig nach »Es ist ein Ross entsprungen« anhörte. Einen kurzen Moment fragte sie sich, ob sie damit gemeint war. Machten sie sich über sie lustig? Sie verdrängte den Gedanken und fing leise vor sich hin summend an, in das Kostüm zu steigen.
»Wer ist das?« Über das Geplapper der vielen Kinder hinweg war die Stimme von Madame Latour, der Musiklehrerin, zu hören. »Wer summt da?«
Madames vogelähnliches, kluges Gesicht sah um die Ecke, wohin sich Crie verzogen hatte, um sich in Ruhe umzuziehen. Instinktiv packte Crie das Kostüm und versuchte, ihren fast nackten, vierzehnjährigen Körper damit zu bedecken. Was natürlich nicht ging. Zu viel Körper und zu wenig Chiffon.
»Warst du das?«
Crie starrte sie an und brachte vor Angst keinen Ton heraus. Ihre Mutter hatte sie gewarnt. Hatte sie davor gewarnt, in der Öffentlichkeit zu singen.
Aber heute war ihr so leicht ums Herz gewesen, dass sie sich zu einem Summen hatte hinreißen lassen.
Madame Latour sah auf das fette Mädchen und spürte Ekel in sich aufsteigen. Diese Fettwülste und die schrecklichen Dellen, die Unterwäsche, die unter den Fleischmassen verschwand. Das Gesicht wie eingefroren, ein starrer Blick. Der Physik- und Biologielehrer, Monsieur Drapeau, hatte gesagt, dass Crie in seinen Fächern die Beste sei, woraufhin ein anderer Lehrer eingeworfen hatte, dass in diesem Halbjahr Vitamine und Mineralstoffe Unterrichtsthema gewesen seien und dass Crie das Buch wahrscheinlich verschlungen hätte.
Wie dem auch war, sie nahm jedenfalls an der Aufführung teil, vielleicht ging sie endlich einmal aus sich heraus, auch wenn das natürlich einen ziemlichen Kraftakt darstellen würde.
»Du musst dich beeilen. Du bist gleich dran.« Sie verschwand, ohne auf eine Antwort zu warten.
Das war die erste Weihnachtsaufführung, an der Crie in den fünf Jahren, die sie nun schon Miss Edwards Mädchenschule besuchte, teilnahm. Die anderen Jahre hatte sie sich irgendwelche Entschuldigungen überlegt, während die anderen Schüler sich Gedanken über Kostüme machten. Keiner hatte je versucht, sie zum Mitmachen zu überreden. Stattdessen hatte man ihr die Aufgabe übertragen, für das Bühnenlicht zu sorgen, da sie nun mal ein Händchen für alles Technische hatte, wie Madame Latour es formulierte. Tote Materie, hatte sie gemeint. So kam es, dass Crie die Weihnachtsaufführung jedes Jahr allein im Dunkeln und nur von hinten sah, während die schönen, strahlenden, talentierten Mädchen tanzend und singend und von Crie ins rechte Licht gesetzt die Geschichte vom Weihnachtswunder vorgetragen hatten.
Nicht so in diesem Jahr.
Sie zog ihr Kostüm an und musterte sich im Spiegel. Eine riesige Schneeflocke aus Chiffon blickte zurück. Sie musste zugeben, dass es eher nach einer Schneeverwehung als einer einzelnen Schneeflocke aussah, aber immerhin war es ein Kostüm und eigentlich auch recht schön. Den anderen Mädchen hatten ihre Mütter geholfen, aber Crie hatte ihres ganz alleine genäht. Um Mommy zu überraschen, hatte sie sich eingeredet und versucht, die andere Stimme zum Schweigen zu bringen.
Wenn sie genau hinsah, konnte sie die winzigen Blutstropfen sehen, wo ihre dicken, plumpen Finger mit der Nadel herumgestochert und die eigene Hand getroffen hatten. Aber sie hatte sich davon nicht beirren lassen, bis das Kostüm fertig war. Und dann hatte sie einen Geistesblitz. Wirklich, es war der beste Gedanke, den sie in ihren vierzehn Jahren gehabt hatte.
Ihre Mutter verehrte das Licht, das wusste sie. Danach, erzählte sie ihr ohne Unterlass, strebten alle Menschen. Deshalb spreche man auch von Erleuchtung. Deshalb würden kluge Leute als Leuchten oder helle Köpfe bezeichnet. Würden dünne Leute sich durchsetzen. Weil zwischen leicht und licht eine innere Verwandtschaft bestand.
Es war alles völlig einleuchtend.
Deshalb spielte Crie jetzt eine Schneeflocke. Das weißeste, leichteste aller Elemente. Und was brachte sie zum Strahlen? Nun, sie war in einen Ramschladen gegangen und hatte von ihrem Taschengeld eine Tube Glitzercreme gekauft. Mit starr nach vorne gerichtetem Blick und angehaltenem Atem hatte sie es geschafft, an den Schokoladenriegeln vorbeizugehen. Crie machte jetzt schon seit einem Monat Diät, bestimmt würde ihre Mutter es bald bemerken.
Sie trug die Glitzercreme auf und sah sich das Ergebnis an.
Das erste Mal in ihrem Leben fand sich Crie schön. Und sie wusste, dass in wenigen Minuten ihre Mutter dasselbe denken würde.
Clara Morrow sah durch die mit Eisblumen übersäten Sprossenfenster in ihrem Wohnzimmer auf das winzige Dorf Three Pines. Sie beugte sich vor und wischte die Scheibe an einer Stelle frei. Jetzt, wo wir etwas Geld haben, dachte sie, sollten wir die alten Fenster endlich ersetzen. Clara wusste, dass das die vernünftigste Entscheidung wäre, doch die meisten ihrer Entscheidungen wurden nicht von der Vernunft gesteuert. Aber sie fügten sich in ihr Leben. Während sie die an eine Schneekugel erinnernde Szenerie betrachtete, wurde ihr klar, dass es ihr gefiel, das Dorf durch das schöne Muster, das der Frost auf das alte Glas malte, hindurch anzusehen.
Sie nippte an ihrer heißen Schokolade und beobachtete die bunt gekleideten Dorfbewohner, die durch den in sanften Flocken fallenden Schnee spazierten, sich mit behandschuhten Händen zuwinkten und ab und zu stehen blieben, um miteinander zu plaudern, wobei sie wie Comicfiguren beim Sprechen kleine Wölkchen hervorstießen. Einige waren auf dem Weg in Oliviers Bistro auf einen café au lait, andere holten frisches Brot oder einen gateau au chocolat in Sarahs Bäckerei. Myrnas Buchladen neben dem Bistro war heute geschlossen. Monsieur Béliveau schippte Schnee vor seinem Gemischtwarenladen und winkte Gabri zu, der mit wehendem Mantel über den Dorfanger zu seiner Pension an der Ecke eilte. Für einen Fremden hätten die Dorfbewohner einer wie der andere ausgesehen, ja selbst geschlechtslos. Im Winter sahen in Québec alle gleich aus. Große rudernde, watschelnde, dick verpackte Daunen- und Watteberge, sodass selbst die Schlanken mollig wirkten und die Molligen wie Kugeln. Alle sahen gleich aus. Bis auf die Strickmützen auf ihren Köpfen. Clara konnte sehen, wie Ruths hellgrüne Toque Waynes bunt gestreifter Pudelmütze zunickte, die Pat an langen Herbstabenden gestrickt hatte. Die Lévesque-Kinder trugen verschiedene Blautöne, während sie auf dem zugefrorenen Teich ihrem Eishockeypuck hinterherjagten, die kleine Rose im Tor fror so sehr, dass Clara ihren wasserblauen Bommel zittern sah. Ihre Brüder liebten sie, und jedes Mal, wenn sie auf das Tor zurasten, taten sie so, als stolperten sie, und statt einen scharfen Schlagschuss abzugeben, schlitterten sie langsam auf sie zu, bis sie alle in einem riesigen, lachenden Haufen an der Torlinie endeten. Das Ganze erinnerte Clara an einen der Kunstdrucke von Currier und Ives, die sie als Kind stundenlang betrachten konnte und sich dabei immer gewünscht hatte, hineinsteigen zu können.
Three Pines lag unter einer dicken weißen Decke. In den letzten paar Wochen waren dreißig Zentimeter Schnee gefallen, und jedem der alten Häuser am Dorfanger war eine strahlend weiße Mütze aufgesetzt worden. Rauch stieg aus den Kaminen auf, als hätten die Häuser eigene Stimmen und einen eigenen Atem, die Gartentore und Haustüren waren weihnachtlich geschmückt. Nachts erstrahlte das stille kleine Dorf in den Eastern Townships im Glanz der Lichterketten. In Vorbereitung des großen Tages war unter Erwachsenen und Kindern fröhliche Geschäftigkeit ausgebrochen.
»Vielleicht springt ihr Auto nicht an«, Claras Ehemann Peter trat ins Zimmer. Er war groß und schlank und sah aus wie ein Top-Manager, wie sein Vater. Aber anders als dieser verbrachte er seine Tage damit, sich über seine Staffelei zu beugen und mit akribischer Genauigkeit seine abstrakten Bilder zu malen, wobei er regelmäßig auch ein wenig Ölfarbe in seine lockigen grauen Haare brachte. Sie gingen für Tausende von Dollar an Sammler auf der ganzen Welt, aber weil er so langsam arbeitete und nur ein oder zwei im Jahr produzierte, lebten er und Clara in Armut. Bis vor nicht allzu langer Zeit jedenfalls. Claras Gemälde von Kriegerinnen und ihren Uteri und schmelzenden Bäumen mussten erst noch ihren Markt finden.
»Sie kommt schon noch«, sagte Clara. Peter sah seine Frau an, ihre Augen waren blau und warm, ihr einst dunkles Haar von Grau durchzogen, obwohl sie erst Ende vierzig war. Um den Bauch und die Hüften herum wurde sie langsam etwas rundlich, kürzlich hatte sie davon gesprochen, dass sie wieder Madeleines Gymnastikkurs besuchen wollte. Er war klug genug, keine Antwort zu geben, als sie ihn fragte, wie er die Idee fände.
»Bist du sicher, dass ich nicht mitfahren kann?«, fragte er mehr aus Höflichkeit als aus einem echten Bedürfnis heraus, sich in Myrnas Blechkiste zu quetschen und sich auf dem langen Weg bis in die Stadt durchschütteln zu lassen.
»Natürlich nicht. Ich will doch dein Weihnachtsgeschenk kaufen. Abgesehen davon ist im Auto nicht genug Platz für Myrna, mich, dich und die Geschenke. Wir müssten dich in Montréal zurücklassen.«
Vor ihrem offenen Gartentor hielt ein winziges Auto, dem eine mächtige schwarze Frau entstieg. Das mochte Clara an den Ausflügen mit Myrna vielleicht am liebsten. Zuzusehen, wie sie in ihr mikroskopisch kleines Auto ein- und ausstieg. Clara war überzeugt, dass Myrna im Grunde größer als das Auto war. Es war schon zum Schreien, Myrna im Sommer dabei zu beobachten, wie sie sich hineinwand, während ihr Kleid sich bis zur Taille hochschob. Myrna lachte nur darüber. Im Winter war es noch lustiger, weil sie dann einen dicken rosafarbenen Anorak trug, der ihren Umfang nahezu verdoppelte.
»Ich stamme von einer Insel, Kindchen. Mir ist einfach kalt.«
»Du stammst von der Insel Montréal«, stellte Clara fest.
»Stimmt«, bekannte Myrna mit einem Lachen. »Allerdings von der Südseite. Ich liebe den Winter. Es ist die einzige Zeit, in der ich eine rosa Haut bekomme. Was meinst du? Ginge ich durch?«
»Als was?«
»Als Weiße.«
»Willst du das denn?«
Myrna sah ihre beste Freundin auf einmal ganz ernst an, dann lächelte sie. »Nein. Nein, nicht mehr. Nein.«
Die Antwort schien ihr zu gefallen, auch wenn sie darüber ein bisschen überrascht zu sein schien.
Jetzt stiefelte die falsche Weiße in ihrer aufgeplusterten rosa Haut, mit mehrfach um den Hals geschlungenen Schals und einer lila Mütze mit orangefarbenem Bommel den gerade erst freigeschaufelten Weg hoch.
Sie wären schnell in Montréal. Es war eine kurze Fahrt, weniger als anderthalb Stunden, selbst bei diesen Witterungsverhältnissen. Clara freute sich auf den Nachmittag, den sie mit Weihnachtseinkäufen verbringen wollte, aber der Höhepunkt des Ausflugs, eines jeden Ausflugs nach Montréal zur Weihnachtszeit, war ein Geheimnis. Ihr ganz persönliches Vergnügen.
Clara Morrow konnte es kaum erwarten, das Weihnachtsschaufenster von Ogilvy’s zu sehen.
Das Nobelkaufhaus mitten in Montréal hatte das schönste Weihnachtsschaufenster auf der ganzen Welt. Mitte November wurden die riesigen Fensterscheiben plötzlich mit schwarzem Papier bedeckt. Dann begann das gespannte Warten. Wann würde der Schleier, hinter dem sich das Wunderwerk verbarg, gelüftet? Als Kind hatte Clara das aufregender gefunden als die Santa-Claus-Parade. Kaum hatte sich herumgesprochen, dass Ogilvy’s das Papier endlich wieder entfernt hatte, war Clara nach Downtown zu dem magischen Schaufenster geeilt.
Dann war es so weit. Clara lief auf das Schaufenster zu, aber kurz davor blieb sie stehen, gerade so, dass es außerhalb ihrer Sichtweite war. Sie schloss die Augen und sammelte sich, dann machte sie einen Schritt nach vorne, öffnete die Augen und sah es. Claras Dorf. Der Ort, an den sie sich in ihrer Kindheit flüchtete, wenn Enttäuschungen und erste Grausamkeiten ihre zarte Seele bedrückten. Sommer wie Winter, alles was sie tun musste, war, die Augen zu schließen, und schon war sie dort. Bei den tanzenden Bären und Schlittschuh laufenden Enten und bei den Fröschen in ihren viktorianischen Kostümen, die von einer Brücke ihre Angeln ins Wasser hielten. Nachts, wenn das Monster unter den Dielen ihres Zimmers schnaubte und schnaufte und mit seinen langen Krallen schabte, dann kniff sie ihre kleinen blauen Augen zusammen und versetzte sich in das magische Fenster und in das Dorf, das das Monster niemals finden konnte, weil der Eingang von Freundlichkeit bewacht wurde.
Als sie älter war, geschah etwas ganz Wunderbares. Sie verliebte sich in Peter Morrow und erklärte sich bereit, New York später im Sturm zu erobern. Stattdessen zog sie in das kleine Dorf südlich von Montréal, das er so sehr mochte. Clara kannte die Gegend nicht, sie war ein richtiges Stadtkind, aber sie liebte Peter so sehr, dass sie nicht eine Sekunde zögerte.
So kam es, dass Clara, clevere und zynische Absolventin der Kunstakademie, vor sechsundzwanzig Jahren aus ihrem klapprigen VW Käfer stieg und in Tränen ausbrach.
Peter hatte sie in das verzauberte Dorf ihrer Kindheit gebracht. Das Dorf, das sie in dem Gefühl der eigenen Wichtigkeit und in der Überheblichkeit, die das Erwachsenendasein begleiteten, vergessen hatte. Ogilvy’s Schaufenster gab es also in Wirklichkeit, und es hieß Three Pines. Sie hatten ein kleines Haus am Dorfanger gekauft und sich ein Leben geschaffen, das mehr Zauber in sich barg, als Clara jemals zu träumen gewagt hätte.
Ein paar Minuten später öffnete Clara in dem gut geheizten Auto den Reißverschluss ihres Anoraks und betrachtete die vorüberziehende Schneelandschaft. Dies war ein besonderes Weihnachten, aus Gründen, die zugleich furchtbar und wunderbar waren. Ihre liebe Freundin und Nachbarin Jane Neal war vor gut einem Jahr ermordet worden und hatte Clara ihr gesamtes Vermögen vermacht. Das vorangegangene Weihnachten hatte sie ein zu schlechtes Gewissen gehabt, um etwas von dem Geld auszugeben. Sie hätte das Gefühl gehabt, von Janes Tod zu profitieren.
Myrna warf Clara einen Blick zu, ihre Gedanken nahmen dieselbe Richtung. Sie erinnerte sich an die liebe, tote Jane Neal und den Rat, den sie Clara nach dem Mord an Jane gegeben hatte. Myrna war es gewohnt, Ratschläge zu erteilen. Sie hatte in Montréal als Psychotherapeutin gearbeitet, bis ihr klar geworden war, dass die meisten ihrer Patienten eigentlich gar nicht wollten, dass es ihnen besser ging. Sie wollten eine Pille und die Bestätigung, dass es nicht ihre Schuld war, wenn irgendetwas schiefging.
Irgendwann hatte Myrna das Handtuch geworfen. Sie hatte ihr kleines rotes Auto mit Büchern und Kleidern vollgeladen und war über die Brücke gefahren, von der Insel Montréal herunter, nach Süden in Richtung der Grenze zu den USA. Sie wollte nach Florida, sich an den Strand setzen und überlegen, was sie tun sollte.
Aber das Schicksal und eine Heißhungerattacke waren ihr dazwischengekommen. Myrna war in gemütlichem Tempo über die gewundenen Landstraßen gefahren und erst etwa eine Stunde unterwegs, als sie plötzlich Hunger überkam. Das Auto schnaufte auf einer Schotterstraße einen Hügel hoch, von der Kuppe aus sah sie plötzlich versteckt in den Wäldern ein Dorf zu ihren Füßen liegen. Myrna war so verzaubert von dem Anblick, dass sie anhielt und ausstieg. Das Frühjahr neigte sich dem Ende zu, und die Sonne nahm langsam an Kraft zu. Ein Bach rauschte unter einer alten steinernen Mühle durch, an einer weiß gestrichenen Holzkirche vorbei und mäanderte am Rand des Dorfes entlang. Das Dorf selbst bildete einen Kreis um den Dorfanger, von dem in alle vier Richtungen unbefestigte Straßen abgingen. Die alten Häuser um den Dorfanger waren zum Teil im Québecer Stil mit steil abfallenden Blechdächern und schmalen Gauben gebaut, andere waren geschindelt und hatten breite, offene Veranden. Mindestens eines war aus Naturstein, errichtet aus den Steinen der umliegenden Felder, von einem Pionier, der im Wettlauf mit dem herannahenden, mörderischen Winter geschuftet hatte.
Auf dem Anger befand sich ein Teich, an dessen einem Ende erhoben sich drei majestätische Kiefern.
Myrna holte ihre Karte von Québec hervor. Nach ein paar Minuten faltete sie sie wieder zusammen und lehnte sich verwundert gegen das Auto. Das Dorf war nicht in der Karte verzeichnet. Es waren Orte darin verzeichnet, die seit Jahrzehnten nicht mehr existierten. Es waren winzige Fischerdörfer und Weiler, die aus zwei Häusern und einer Kirche bestanden, darin verzeichnet.
Aber dieses Dorf nicht.
Sie sah zu den Dorfbewohnern hinunter, die in ihren Gärten arbeiteten, ihre Hunde ausführten oder lesend auf einer Bank am Teich saßen.
Vielleicht war es ein verzaubertes Dorf wie im Märchen, tauchte nur alle paar Jahre auf und erschien dann auch nur Leuten, die sich danach sehnten. Dennoch zögerte Myrna. Bestimmt gab es auch dort nicht das, wonach sie sich sehnte. Beinahe hätte sie kehrtgemacht und wäre nach Williamsburg gefahren, das wenigstens auf der Karte stand, aber dann entschloss sie sich, das Wagnis einzugehen.
Three Pines hatte all das, wonach sie sich sehnte.
Es gab Croissants und café au lait. Es gab Steak mit Pommes frites und die New York Times. Es gab eine Bäckerei, ein Bistro, eine Pension, einen Gemischtwarenladen. Hier fand sie Frieden, Stille und Heiterkeit. Sie fand große Freude und große Traurigkeit und die Fähigkeit, beides zu akzeptieren und zufrieden zu sein. Sie fand Gemeinschaft und Freundlichkeit.
Und einen leer stehenden Laden mit einer Wohnung darüber. Für sie.
Myrna blieb für immer.
Innerhalb von nur wenig mehr als einer Stunde war Myrna aus einer Welt des Zweifels in eine Welt der Zufriedenheit gewechselt. Das war vor sechs Jahren. Heute brachte sie neue und gebrauchte Bücher und ebensolche Ratschläge unter ihre Freunde.
»Um Himmels willen, komm doch endlich mal wieder in die Pötte«, hatte sie zu Clara gesagt. »Es ist Monate her, seit Jane gestorben ist. Du hast geholfen, den Mord an ihr aufzuklären. Du weißt genau, dass Jane sich ärgern würde, dass sie dir all ihr Geld hinterlassen hat, und du freust dich nicht einmal darüber. Hätte sie es doch mir gegeben.« Myrna hatte in gespieltem Bedauern den Kopf geschüttelt. »Ich hätte etwas damit anzufangen gewusst. Zack, runter nach Jamaika, ein netter Rastafari, ein gutes Buch …«
»Moment mal. Du angelst dir einen Rastafari und liest dann ein Buch?«
»Na klar. Beide erfüllen jeweils einen bestimmten Zweck. Ein Rastafari ist ganz toll, wenn er hart ist, bei einem Buch ist das nicht der Fall.«
Clara lachte. Sie teilten die Abneigung gegen gebundene Bücher. Mit dem festen Einband hatte man im Bett wenig Freude.
»Anders als bei einem Rastafari«, sagte Myrna.
Myrna hatte ihre Freundin dazu gebracht, den Tod von Jane zu akzeptieren und das Geld auszugeben. Was Clara an diesem Tag auch vorhatte. Endlich würden sich auf der Rückbank des Autos schwere Papiertüten in satten Farben stapeln, mit Tragegriffen aus Kordel und geprägten Schriftzügen mit Namen wie Holt Renfrew und Ogilvy. Keine einzige quietschgelbe Plastiktüte aus dem Ramschladen. Auch wenn Clara Ramschläden insgeheim liebte.
Zu Hause starrte Peter aus dem Fenster und zwang sich dazu, aufzustehen und etwas mit seiner Zeit anzufangen, ins Atelier zu gehen und an seinem Gemälde zu arbeiten. In diesem Moment sah er, dass an einer Stelle das Eis von der Scheibe gekratzt worden war. In Form eines Herzens. Er lächelte und sah hindurch, sah, dass in Three Pines alles seinen gewohnt gemütlichen Lauf nahm. Dann blickte er nach oben, zu dem verschachtelten alten Haus auf dem Hügel. Das alte Hadley-Haus. Noch während er hinaufblickte, fingen die Eisblumen wieder an zu wachsen und füllten das Herz mit Eis.
3
»Von wem ist das?«, fragte Saul CC und hob die Mappe mit den Bildern in die Höhe.
»Was?«
»Die Mappe hier.« Er stand nackt im Hotelzimmer. »Ich habe sie im Papierkorb gefunden. Von wem ist sie?«
»Von mir.«
»Von dir?« Er starrte sie verblüfft an. Einen Moment lang fragte er sich, ob er sie falsch eingeschätzt hatte. Das waren eindeutig die Arbeiten eines begnadeten Künstlers.
»Natürlich nicht. Irgendein Spaßvogel aus dem Dorf hat sie mir gegeben, damit ich sie den Galeristen, mit denen ich befreundet bin, zeige. Hat versucht, mir in den Hintern zu kriechen, ich hätte mich totlachen können. ›Ach bitte, CC, du kennst doch die tollsten Leute.‹ ›Ach, CC, würde es dir sehr viel ausmachen, meine Arbeiten einigen von deinen Freunden zu zeigen?‹ Schreckliche Nervensäge. Stell dir nur vor, mich um einen Gefallen zu bitten! Hatte sogar den traurigen Mut, mich unumwunden zu fragen, ob ich sie nicht Denis Fortin zeigen könnte.«
»Was hast du gesagt?« Das Herz wurde ihm schwer. Er kannte die Antwort eigentlich schon.
»Ich sagte, dass ich das gerne tun würde. Jetzt leg das Ding endlich wieder dorthin zurück, wo du es gefunden hast.«
Saul zögerte, dann klappte er die Mappe zu und warf sie in den Papierkorb, er verachtete sich dafür, dass er sich an der Vernichtung dieser wunderbaren Bilder beteiligte, noch mehr aber verachtete er sich dafür, dass er das sogar wollte.
»Hast du heute Nachmittag nichts vor?«, fragte er.
Sie rückte das Glas und die Lampe auf dem Nachttischchen zurecht, bewegte beide einen Millimeter, bis sie genau da standen, wo sie sollten.
»Nichts Wichtiges«, sagte sie und wischte eine riesige Staubflocke vom Tisch. Also wirklich, so was im Ritz. Sie musste mit dem Manager reden. Sie sah zu Saul, der am Fenster stand.
»Du lässt dich ganz schön gehen.«
Er hatte einmal eine gute Figur, dachte sie. Aber jetzt war er wabbelig. CC war schon mit fetten Männern im Bett gewesen. Sie war mit richtiggehenden Hänflingen im Bett gewesen. Sie konnte beiden Extremen etwas abgewinnen. Es war das Zwischenstadium, das absolut abstoßend war.
Sie ekelte sich vor Saul und konnte sich nicht mehr erinnern, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen war, dass diese Geschichte etwas taugte. Dann sah sie auf den glänzenden weißen Umschlag ihres Buchs, und es fiel ihr wieder ein.
Das Foto. Saul war ein phantastischer Fotograf. Über dem Titel Be Calm war ihr Gesicht zu sehen. Die Haare so blond, dass sie beinahe weiß erschienen, der Mund rot und verführerisch, die Augen von einem hinreißenden, klugen Blau. Und ihr Gesicht so bleich, dass es sich vor dem hellen Hintergrund fast auflöste und der Eindruck erzeugt wurde, dass ihre Augen, ihr Mund und ihre Ohren über dem Umschlag schwebten.
CC war hingerissen von dem Bild.
Nach Weihnachten würde sie Saul in die Wüste schicken. Wenn er den letzten Auftrag ausgeführt hatte. Sie bemerkte, dass er gegen den Schreibtischstuhl gestoßen sein musste, als er die Mappe entdeckt hatte. Er stand schief. Sie spürte, wie die Spannung in ihr wuchs. Was fiel ihm eigentlich ein, sie absichtlich so zu ärgern, und das wegen dieser dummen Mappe. CC sprang aus dem Bett, rückte das böse Ding gerade und nutzte die Gelegenheit, das Telefon parallel zur Tischkante auszurichten.
Dann schlüpfte sie ins Bett zurück und strich das Laken über ihrem Schoß glatt. Vielleicht sollte sie ein Taxi ins Büro nehmen. Aber dann erinnerte sie sich, dass sie noch etwas vorhatte. Etwas Wichtiges.
Ogilvy’s hatte Schlussverkauf, und in einem Laden mit Kunsthandwerk auf der Rue de la Montagne hatte sie ein Paar Eskimostiefel gesehen, das sie haben wollte.
In nicht allzu ferner Zeit hätte sie ihre eigene Kleider- und Möbelkollektion, die in Geschäften in ganz Québec verkauft würde. Auf der ganzen Welt. Bald würden all die arroganten Chichi-Designer, die sich über sie lustig gemacht hatten, zu Kreuze kriechen. Bald würden alle Li Bien kennen, ihre eigene Design- und Lebensphilosophie. Feng-Shui war passé. Die Leute sehnten sich nach etwas Neuem, bei ihr bekamen sie es. Li Bien wäre in aller Munde und in jedem Haus.
»Hast du schon ein Haus für die Feiertage gemietet?«, fragte sie.
»Nein, ich fahre morgen hin. Warum hast du eigentlich in dieser Einöde ein Haus gekauft?«
»Ich hatte meine Gründe.« Sie spürte Wut in sich aufsteigen, weil er ihre Entscheidungen infrage stellte.
Es hatte fünf Jahre gedauert, bis sie ein Haus in Three Pines kaufen konnte. Wenn nötig, konnte CC de Poitiers geduldig sein, allerdings musste es auch einen guten Grund geben.
Sie hatte das lausige Dorf des Öfteren besucht, Kontakte zu Immobilienmaklern aus der Umgebung geknüpft und sogar mit Verkäufern in den Läden der nahe gelegenen Ortschaften Saint-Rémy und Williamsburg gesprochen. Es hatte Jahre gedauert. Offensichtlich kamen Häuser in Three Pines nicht allzu oft auf den Markt.
Vor nicht ganz einem Jahr hatte sie einen Anruf von einer Immobilienmaklerin namens Yolande Fontaine erhalten. Es gebe ein Haus. Ein echtes Schmuckstück, viktorianischer Stil, das auf dem Hügel stand, der sich über dem Dorf erhob. Das Haus des Mühlenbesitzers. Das Haus dessen, der das Sagen hatte.
»Wie viel?«, hatte CC gefragt, überzeugt, dass es ihre Mittel überstieg. Sie müsste ihre Firma beleihen, alles belasten, was sie besaß, und ihren Mann dazu bringen, seine Versicherungspolice und seine Altersvorsorge zu versilbern.
Die Antwort der Immobilienmaklerin hatte sie überrascht. Der Preis lag weit unter Marktwert.
»Da ist nur eine Kleinigkeit«, hatte Yolande mit ihrer unangenehmen Stimme erklärt.
»Nur heraus damit.«
»Es gab da einen Mord. Und einen Mordversuch.«
»Ist das alles?«
»Na ja, theoretisch fand auch noch eine Entführung statt. Jedenfalls ist das Haus deshalb so günstig. Ein echtes Schnäppchen. Wunderbare Rohre, fast alles Kupfer. Das Dach wurde erst vor zwanzig Jahren neu gedeckt. Das …«
»Ich nehme es.«
»Möchten Sie es sich nicht erst ansehen?« Yolande hätte sich ohrfeigen können, kaum hatte sie die Frage gestellt. Wenn diese dumme Kuh das alte Hadley-Haus unbesehen kaufen wollte, ohne Besichtigung, ohne Exorzismus, dann sollte sie doch.
»Bereiten Sie schon mal den Vertrag vor. Ich komme heute Nachmittag mit einem Scheck vorbei.«
Und das hatte sie getan. Sie hatte ihren Mann eine Woche später davon in Kenntnis gesetzt, weil sie seine Unterschrift brauchte, um sich seine Altersvorsorge vorzeitig auszahlen zu lassen. Er hatte protestiert, aber so zaghaft, dass ein Unbeteiligter es nicht einmal als Protest erkannt hätte.
Das alte Hadley-Haus, der monströse Kasten auf dem Hügel, gehörte ihr. Ihr Glück war vollkommen. Es war perfekt. Three Pines war perfekt. Zumindest wäre es das, wenn sie erst einmal damit fertig war.
Saul schnaubte und wandte sich ab. Er wusste, was die Stunde geschlagen hatte. CC würden ihn fallen lassen, sobald sein nächster Auftrag in diesem gottverlassenen Nest abgeschlossen war. Er sollte für ihren ersten Katalog Fotos von ihr machen, wie sie an Weihnachten unter den Ureinwohnern herumtollte. Wenn möglich sollte er Aufnahmen von den Dörflern machen, wie sie CC voller Staunen und Bewunderung ansahen. Dafür müsste er sicher einige Scheinchen hinblättern.
Alles, was CC tat, hatte einen Zweck, und der ließ sich seiner Meinung nach auf zwei Dinge reduzieren: Entweder nutzte es ihrem Konto oder ihrem Ego.
Warum hatte sie ein Haus in einem Dorf gekauft, von dem noch nie jemand gehört hatte? Es ging nicht um Prestige. Deshalb musste es das andere sein.
Geld.
CC wusste etwas von dem Dorf, das niemand sonst wusste, und das hatte mit Geld zu tun.
Auf einmal erschien ihm Three Pines doch ganz interessant.
»Crie! Beweg dich, um Gottes willen.«
Das konnte man durchaus wörtlich verstehen. Der zierliche, verhätschelte Nachwuchs eines Treuhandvermögens und eines Schönheitswettbewerbs rang darum, hinter der Schneeverwehung, die Crie darstellte, gesehen zu werden. Sie hatte es auf die Bühne geschafft und tanzte und wirbelte mit den anderen, engelsgleichen Schneeflocken herum, bis sie plötzlich abrupt innehielt. Es störte offenbar niemanden, dass es in Jerusalem eigentlich keinen Schnee gab. Die Lehrerin nahm völlig zu Recht an, dass jemand, der an die Jungfrauengeburt glaubte, auch glauben konnte, dass in dieser wundersamen Nacht Schnee gefallen war. Was dagegen störte, war, dass eine der Flocken, eine Art Mikroklima für sich, mitten auf der Bühne zu Eis erstarrt war. Direkt vor dem Jesuskind.
»Beweg endlich deinen dicken Hintern!«
Wie all die anderen Beleidigungen glitt auch diese an Crie ab. Sie bildeten das Hintergrundrauschen ihres Lebens. Crie nahm sie kaum noch wahr. Jetzt stand sie stocksteif auf der Bühne und starrte ins Publikum, als hätte sie der Blitz getroffen.
»Brie hat Lampenfieber«, flüsterte Madame Bruneau, die den Theaterkurs leitete, der Musiklehrerin, Madame Latour, zu, als erwartete sie, dass diese etwas dagegen unternahm. Selbst die Lehrer nannten Crie hinter ihrem Rücken Brie. Zumindest glaubten sie, dass es hinter ihrem Rücken wäre. Im Grunde hatten sie längst aufgehört, sich darum zu kümmern, was das seltsame und schweigsame Mädchen mitbekam und was nicht.
»Das sehe ich«, gab Madame Latour patzig zurück. Der ungeheure Stress, jedes Jahr Miss Edwards Krippenspiel auf die Beine zu stellen, hatte merklich an ihr gezehrt.
Aber es war nicht das Lampenfieber, das Crie erstarren ließ. Es war etwas, das nicht da war, was sie zum Innehalten brachte.
Crie wusste aus langer Erfahrung, dass das, was man nicht sah, am schlimmsten war.
Was Crie nicht sah, brach ihr das Herz.
»Ich erinnere mich, was mein erster Guru, Ramen Das, zu mir sagte«, CC lief mittlerweile in einem weißen Bademantel im Hotelzimmer herum, packte Briefpapier und Seifen ein und erzählte ihre Lieblingsgeschichte. »›CC Das‹, sagte er. So nannte Ramen Das mich«, erklärte CC dem Briefpapier. »Nur wenigen Frauen wurde diese Ehre zuteil, besonders im Indien der damaligen Zeit.«
Ramen Das hatte vielleicht gar nicht gemerkt, dass CC eine Frau war, dachte Saul.
»Das war vor zwanzig Jahren. Ich war noch ein Kind, unschuldig, aber selbst damals war ich schon auf der Suche nach der Wahrheit. Ich traf in den Bergen auf Ramen Das, und wir hatten sofort eine spirituelle Verbindung.«
Sie legte ihre Hände aneinander, und Saul hoffte, dass sie jetzt nicht sagen würde …
»Namaste«, sagte CC und verbeugte sich. »Das hat er mir beigebracht. Sehr spirituell.«
Sie nahm das Wort »spirituell« so oft in den Mund, dass es für Saul jede Bedeutung verloren hatte.
»Er sagte: ›CC Das, du hast eine große spirituelle Begabung. Du musst diesen Ort verlassen und sie der Welt zuteilwerden lassen. Du musst den Menschen sagen, wie sie Ruhe finden, to be calm‹, sagte er.«
Während sie redete, formte Saul jedes der Worte gleichzeitig lautlos mit den Lippen.
»›CC Das‹, sagte er, ›wer, wenn nicht du, weiß, dass alles weiß ist, wenn sich die Chakras im Gleichgewicht befinden. Wenn alles weiß ist, ist alles gut.‹«
Saul fragte sich, ob sie gerade einen indischen Mystiker mit einem Ku-Klux-Klan-Mitglied verwechselte. Wenn, dann war das wirklich höchst ironisch.
»›Du musst wieder in die Welt zurück‹, sagte er. ›Es wäre falsch, dich noch länger hier zu halten. Du musst ein Unternehmen gründen und es Be Calm nennen.‹ Und das tat ich. Deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben. Um das Wort der Spiritualität zu verbreiten. Die Menschen müssen davon erfahren. Diese ganzen dubiosen Sekten führen die Menschen nur in die Irre und nutzen sie aus. Es war meine Pflicht, ihnen von Li Bien zu berichten.«
»Moment, das verstehe ich nicht«, sagte Saul und sah mit Genugtuung, dass Ärger in ihren Augen aufblitzte. CCs Reaktionen waren bis aufs Letzte vorhersehbar. Sie hasste es, wenn man andeutete, dass ihre Ideen aus irgendeinem Grund nicht völlig einsichtig waren. »War es Ramen Das, der dir von Li Bien erzählt hat?«
»Nein, du Idiot. Ramen Das war in Indien. Li Bien ist eine alte orientalische Philosophie, die in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird.«
»Von alten chinesischen Philosophen?« Da sie ihm ohnehin bald den Laufpass geben würde, konnte er ihr jetzt ruhig eins reinwürgen. Dann hätte er später eine lustige Geschichte zu erzählen. Um seiner Unterhaltung etwas von ihrer Geistlosigkeit zu nehmen. Er würde CC zur Lachnummer machen.
Sie schnalzte mit der Zunge und schnaubte. »Du weißt, dass meine Familie aus Frankreich stammt. Frankreich kann auf eine lange, ehrenvolle Geschichte der Kolonisierung des Ostens zurückblicken.«
»O ja. Zum Beispiel in Vietnam.«
»Genau. In meiner Familie gab es Diplomaten, die einige der alten spirituellen Lehren mit zurückbrachten, unter anderem Li Bien. Ich habe dir das doch alles schon erzählt. Vielleicht hast du nicht zugehört. Abgesehen davon steht es in meinem Buch. Hast du es etwa nicht gelesen?«
Sie warf es in seine Richtung, und er duckte sich, nachdem es ihn bereits am Arm getroffen hatte.
»Natürlich habe ich dein verdammtes Buch gelesen. Ich habe es wieder und wieder durchgekaut und dann noch mal.« Er musste sich sehr zusammenreißen, es nicht als den hochgradigen Schwachsinn zu bezeichnen, der es seiner Meinung nach war. »Ich kenne die Geschichte. Deine Mutter hat eine Li-Bien-Kugel bemalt, das ist die einzige Hinterlassenschaft, die du von ihr besitzt.«
»Nicht nur von ihr, Arschloch. Von meiner ganzen Familie.« Mittlerweile zischte sie nur noch. Er wollte sie ärgern, aber mit dieser Reaktion hatte er nicht gerechnet. Als sie sich erhob und ihre Gestalt die Sonne verdunkelte, ihn allen Lichtes beraubte, fühlte er sich plötzlich wie ein Zwerg, ein Kind. Er schrumpfte und winselte und kauerte sich zusammen. Innerlich. Nach außen hin stand er stocksteif da und starrte sie an. Er fragte sich, was ein solches Monster hervorgebracht hatte.
CC hätte ihm am liebsten die Arme herausgerissen. Die Glupschaugen aus den Höhlen gedrückt, das Fleisch von den Knochen gekratzt. Sie spürte eine Kraft in ihrer Brust wachsen und sich ausdehnen, wie ein Stern, der sich in eine Supernova verwandelte. Sie wollte den Pulsschlag an seinem Hals spüren, während sie ihn würgte. Sie hätte es gekonnt. Obwohl er größer und kräftiger war, hätte sie es tun können. Wenn sie sich so fühlte, gab es nichts, was sie aufhalten konnte, das wusste sie.
Nach einem Mittagessen aus gedünstetem Lachs und gigot d’agneau hatten sich Clara und Myrna getrennt, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Aber zunächst wollte sich Clara auf die Suche nach Siegfried Sassoon machen.
»Du willst in eine Buchhandlung?«, fragte Myrna.
»Natürlich nicht. Ich will mir die Haare schneiden lassen.« Also wirklich, Myrna hatte keine Ahnung mehr.
»Von Siegfried Sassoon?«
»Nicht von ihm persönlich, aber von jemandem in seinem Salon.«
»Soweit ich weiß, ist es die Hölle, in der Jugend und Lachen verschwinden.«
Clara hatte Bilder von Sassoon-Salons gesehen und dachte, dass Myrnas Beschreibung zwar ein wenig übertrieben war, aber nicht ganz danebenlag, ging man nach den finster dreinschauenden Frauen mit den Schmollmündern auf den Fotos.
Einige Stunden später kämpfte sich eine erschöpfte und zufriedene Clara, bepackt mit Tüten voller Geschenke, die Rue St. Catherine hoch. Ihre Shoppingtour war höchst erfolgreich gewesen. Sie hatte für Peter das perfekte Geschenk gefunden und für Verwandte und Freunde hübsche Kleinigkeiten. Myrna hatte recht. Jane hätte ihren Spaß daran gehabt, zu sehen, dass sie das Geld ausgab. Auch was Sassoon anging, hatte Myrna recht, wenn Clara auch nicht gleich darauf gekommen war, was sie meinte.
»Seidenstrümpfe? Schokoriegel?«, erklang hinter ihr die melodische, warme Stimme.
»Gerade habe ich an dich gedacht, du hinterhältiges Luder. Du hast mich in die finstersten Gassen Montréals geschickt, wo ich Wildfremde fragen musste, wo ich Siegfried Sassoon finde.«
Myrna lehnte sich brüllend vor Lachen gegen die Wand eines alten Bankgebäudes.
»Ich weiß nicht, ob ich mich aufregen soll oder erleichtert bin, dass keiner ahnte, dass ich mir von einem toten Dichter aus dem Ersten Weltkrieg die Haare schneiden lassen wollte. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er Vidal und nicht Siegfried heißt?« Mittlerweile lachte auch Clara und ließ ihre Taschen auf den schneebedeckten Bürgersteig plumpsen.
»Du siehst toll aus«, sagte Myrna, als sie sich schließlich wieder beruhigt hatte, und trat einen Schritt zurück, um Clara zu mustern.
»Ich habe eine Mütze auf dem Kopf, du dumme Kuh«, sagte Clara, und beide Frauen brachen erneut in Lachen aus, als sich Clara die Pudelmütze tief über die Ohren zog.
Es war schwer, unter diesen Umständen nicht unbeschwert zu sein. Es war fast vier am Nachmittag des 22. Dezember, und die Sonne war bereits untergegangen. Die Straßen von Montréal, über denen immer ein gewisser Zauber lag, erstrahlten zu dieser Zeit des Jahres im Lichterglanz. Die ganze Rue St. Catherine war mit Weihnachtsschmuck dekoriert, dessen Leuchten und Glitzern von den Schneeflocken vervielfältigt wurde. Jetzt, zur Stoßzeit, krochen die Autos im Schneckentempo vorbei, und die Fußgänger eilten die verschneiten Bürgersteige entlang und blieben gelegentlich stehen, um in ein hell erleuchtetes Schaufenster zu blicken.
Ihr Ziel lag direkt vor ihnen. Ogilvy’s. Das Schaufenster. Sogar aus einer Entfernung von einem halben Häuserblock konnte Clara den Schimmer sehen, und die Verzauberung, die sich auf den Gesichtern der Kinder davor spiegelte. Augenblicklich spürte sie die Kälte nicht mehr, und die Menschenmassen, die eben noch gedrängelt und geschubst hatten, wichen zurück; selbst Myrna verschwand im Hintergrund, als sich Clara dem Schaufenster näherte. Da war es. Die alte Mühle im Wald.
»Wir treffen uns drinnen«, flüsterte Myrna, aber ihre Freundin war nicht mehr da. Clara war in das Schaufenster geklettert. Vorbei an den entzückten Kindern, die davorstanden, über den Lumpenhaufen auf dem Bürgersteig hinweg mitten in das idyllische Winterbild. Sie ging gerade über die Holzbrücke, auf Großmutter Bär in der hölzernen Mühle zu.
»Haben Sie ein bisschen Kleingeld übrig?«
Ein würgendes Geräusch durchfuhr Claras Welt.
»Iiih, das ist ja eklig, Mommy«, rief ein Kind, als Clara ihre Augen von dem Schaufenster losriss und nach unten sah. Der Haufen Lumpen hatte sich übergeben, und sein Mageninhalt dampfte auf der verkrusteten Decke, in die sich der Mann eingewickelt hatte. Oder die Frau. Clara wusste es nicht, es war ihr auch egal. Sie ärgerte sich, weil sie das ganze Jahr über, all die Wochen und Tage auf diesen Moment gewartet hatte und irgendein Penner einfach darauf gekotzt hatte. Jetzt heulten die Kinder, und der Zauber war dahin.
Clara wandte sich von dem Schaufenster ab und sah sich nach Myrna um. Sie musste schon hineingegangen sein, dachte Clara, zu dem großen Ereignis. Sie waren an diesem Tag nicht nur wegen des Schaufensters bei Ogilvy’s. Ruth Zardo, eine Nachbarin und gute Freundin aus dem Dorf, stellte in der Buchhandlung im Untergeschoss des Kaufhauses ihr neuestes Buch vor.
Normalerweise übergab sie ihre schmalen Gedichtbände einer anonymen Leserschaft, nach einer Lesung im Bistro in Three Pines. Aber es war etwas Erstaunliches passiert. Die alte, verbitterte Dichterin aus Three Pines hatte den Literaturpreis des Generalgouverneurs gewonnen. Das hatte alle umgehauen. Nicht etwa, weil sie es nicht verdiente. Clara wusste, dass ihre Gedichte wunderbar waren.
Wer verletzte dich so unheilbar,
dass du die ausgestreckte Hand mit Verachtung strafst?
Es war nicht immer so.
Nein, Ruth Zardo verdiente den Preis. Es hatte sie nur erschreckt, dass andere das auch wussten.
Wird es mir mit meinen Arbeiten eines Tages ähnlich ergehen?, fragte sich Clara, als sie von der Drehtür in die parfümgeschwängerte gedämpfte Atmosphäre von Ogilvy’s gewirbelt wurde. Werde auch ich eines Tages ans Licht der Öffentlichkeit befördert? Endlich hatte sie den Mut aufgebracht, CC de Poitiers, der neuen Nachbarin, eine Mappe mit ihren Arbeiten zu übergeben, nachdem sie im Bistro zufällig mitbekommen hatte, wie diese von ihrem Busenfreund Denis Fortin erzählte.
Wenn man eine Ausstellung in der Galerie Fortin in Outremont, dem Intellektuellenviertel von Montréal, hatte, bedeutete das, man hatte es geschafft. Fortin wählte nur die Allerbesten aus, die aktuellsten, vielversprechendsten und respektlosesten Künstler. Er hatte auf der ganzen Welt Verbindungen. Selbst … durfte sie wagen, das zu denken? Zum Museum of Modern Art in New York. Das MOMA. MOMA mia.
Clara stellte sich die Vernissage in der Galerie Fortin vor. Sie würde vor Witz sprühen, umringt von Bewunderern, weniger bedeutende Künstler und umso bedeutendere Kritiker würden an ihren Lippen hängen, damit ihnen bloß keines ihrer klugen Worte entging. Peter würde etwas abseits von dem Kreis der Bewunderer stehen und das Ganze mit einem angedeuteten Lächeln beobachten. Er wäre stolz auf sie und würde sie endlich als ebenbürtige Künstlerin betrachten.
Crie saß auf der schneebedeckten Treppe von Miss Edwards Schule. Inzwischen war es dunkel. Drinnen und draußen. Sie starrte stur geradeaus, ohne etwas zu sehen, auf ihrer Mütze und ihren Schultern sammelte sich der Schnee. Neben ihr stand eine Tasche, in die sie ihr Schneeflocken-Kostüm gestopft hatte. Und ihr Zeugnis.
Nur Einser.
Ihre Lehrer hatten ts, ts, ts gemacht, den Kopf geschüttelt und geseufzt, dass gerade ein derart gestörtes Kind so viel Verstand besaß. Das ist eine dicke, fette Ungerechtigkeit, hatte einer von ihnen gesagt, und alle hatten gelacht. Bis auf Crie, die zufällig in dem Moment vorbeigegangen war.
Die Lehrer kamen überein, dass sie mit demjenigen, der sie so sehr verletzt hatte, dass sie kaum zu sprechen oder anderen in die Augen zu sehen wagte, ein ernstes Wörtchen sprechen mussten.
Schließlich stand Crie auf und machte sich mit vorsichtigen Schritten auf den Weg in die Innenstadt von Montréal, auf dem glatten, steilen Weg und unter der Last des unerträglich schweren Gewichts der Chiffon-Schneeflocke ununterbrochen um Balance ringend.
4
Als Clara durch das Kaufhaus ging, fragte sie sich, was schlimmer war, der Gestank des armen Penners oder der aufdringliche Geruch aus der Parfümerieabteilung. Nachdem etwa zum fünften Mal irgendein abgemagertes junges Ding Clara angesprüht hatte, wusste sie die Antwort. Sie ekelte sich schon vor sich selbst.
»Das wurde aber auch Zeit.« Ruth Zardo hinkte auf Clara zu. »Du siehst aus wie eine Beutelratte.« Sie küssten sich zur Begrüßung auf die Wangen. »Und du stinkst.«
»Das bin nicht ich, das ist Myrna«, flüsterte Clara, nickte zu der neben ihr stehenden Freundin und wedelte sich mit der Hand vor der Nase herum. Die Begrüßung der Dichterin war sehr viel herzlicher als sonst ausgefallen.
»Hier, kauf das.« Ruth reichte ihr ein Exemplar ihres neuen Buchs, Mir geht’s GUT. »Ich schreibe dir sogar eine Widmung rein. Aber zuerst musst du es kaufen.«
Ruth Zardo, groß gewachsen und würdevoll, ging auf ihren Stock gestützt zu dem kleinen Tisch in einer Ecke des riesigen Ladens, um dort auf jemanden zu warten, der das Buch von ihr signiert haben wollte.
Clara ging und zahlte das Buch, dann ließ sie es sich signieren. Sie kannte ausnahmslos alle, die sich hier eingefunden hatten. Da waren Gabri Dubeau und sein Freund Olivier Brulé. Gabri war groß und ausladend, eindeutig ein Schleckermaul, das nicht Nein sagen konnte. Er war Mitte dreißig und hatte entschieden, dass er genug davon hatte, jung, gestählt und schwul durchs Leben zu gehen. Na ja, nicht unbedingt davon, schwul zu sein. Neben ihm stand Olivier, gut aussehend, schlank, elegant. Anders als sein Freund war er blond, zupfte gerade ein beunruhigendes Strähnchen Haare von seinem seidenen Rollkragenpullover und wünschte sich dabei ganz offensichtlich, er könne es wieder einpflanzen.
Ruth hätte nicht den ganzen Weg nach Montréal zurücklegen müssen, um ihr Buch vorzustellen. Die einzigen Leute, die gekommen waren, stammten aus Three Pines.
»Das ist reine Zeitverschwendung«, sagte sie und beugte den Kopf mit den kurz geschnittenen weißen Haaren über Claras Buch. »Niemand aus Montréal ist gekommen, nicht eine lausige Seele. Nur ihr. Wie öde.«
»Vielen herzlichen Dank, alte Wortklauberin«, sagte Gabri, der zwei Bücher in seinen großen Händen hielt.
»Weißt du«, Ruth sah hoch, »das hier ist eine Buchhandlung«, sagte sie betont langsam und laut. »Hier kommen Leute her, die lesen können. Es ist keine öffentliche Badeanstalt.«
»Eigentlich schade.« Gabri sah zu Clara.
»Es ist Myrna«, sagte sie, aber da Myrna auf der anderen Seite des Gangs stand und mit Emilie Longpré plauderte, glaubte ihr kein Mensch.
»Wenigstens überdeckst du den Mief von Ruth’ Gedichten«, sagte Gabri und hielt Mir geht’s GUT von sich weg.
»Alte Schwuchtel«, zischte Ruth.
»Alte Schachtel«, zischte Gabri und zwinkerte Clara zu. »Salut, ma chère.«
»Salut, mon amour. Was ist das andere, das du da hast, für ein Buch?«, fragte Clara.
»Das ist von CC de Poitiers. Wusstest du, dass unsere neue Nachbarin ein Buch geschrieben hat?«
»Gott, das heißt, sie hat mehr Bücher geschrieben als gelesen!«, sagte Ruth.
»Dort drüben liegen sie.« Er deutete auf einen Stapel weißer Bücher auf dem Tisch mit den Remittenden. Ruth schnaubte, dann wurde sie still, als ihr klar wurde, dass es vielleicht nur eine Frage von Tagen war, bis sich ihre kleine Sammlung von sorgsam komponierten Gedichten zu CCs Müll in den Büchersarg gesellte.
Einige Leute standen herum, unter anderem die drei Grazien von Three Pines: Emilie Longpré, eine zierliche, elegante Erscheinung in einem schmal geschnittenen Rock, Bluse und Seidenschal; Kaye Thompson, mit ihren über neunzig die Älteste der drei Freundinnen und verhutzelt und verschrumpelt wie eine Kartoffel, die nach Wick VapoRub roch; und Beatrice Mayer, mit einem wilden roten Schopf, der weiche, plumpe Körper unter einem voluminösen bernsteinfarbenen Kaftan und klobigen Ketten um den Hals nicht unbedingt vorteilhaft verborgen. Mother Bea, wie man sie nannte, hielt ein Exemplar von CCs Buch in der Hand. Sie drehte sich um und sah in Claras Richtung, nur einen Moment lang. Aber der reichte.
Mother Bea wirkte völlig fassungslos, ohne dass Clara ihre Miene richtig deuten konnte. War es Ärger? Angst? Auf jeden Fall hatte sie etwas sehr verstört, dachte Clara. Dann verschwand der Ausdruck, und an seine Stelle trat wieder die vertraute friedliche und heitere Miene in Mothers rosigem und faltigem Gesicht.
»Kommt, wir gehen rüber«, Ruth stand unbeholfen auf und nahm dankbar Gabris Arm. »Hier passiert sowieso nicht viel. Wenn später die nach großer Lyrik gierigen Horden einfallen, komme ich schnell zu meinem Tisch zurück.«
»Bonjour, meine Liebe.« Die zierliche Emilie Longpré küsste Clara auf beide Wangen. Selbst im Winter, wenn die meisten Québecer unter den vielen Woll- und Steppschichten wie Karikaturen ihrer selbst aussahen, wirkte Em elegant und grazil. Ihre Haare waren von einem geschmackvollen Hellbraun und gut frisiert. Kleidung und Make-up waren zurückhaltend und entsprachen dem Anlass. Mit ihren zweiundachtzig Jahren war sie eine der Matriarchinnen des Dorfs.
»Hast du das gesehen?« Olivier reichte Clara ein Buch. CC starrte sie an, grausam und kalt.
Be Calm – Ruhe finden.
Clara blickte zu Mother. Jetzt war ihr klar, warum sich Mother so aufregte.
»Hör dir das an.« Gabri begann den Klappentext vorzulesen. »Ms de Poitiers hat offiziell erklärt, dass Feng-Shui der Vergangenheit angehört.«
»Selbstverständlich, es ist eine alte chinesische Lehre«, sagte Kaye.
»An seiner statt«, fuhr Gabri fort, »schenkt uns diese neue Doyenne des Designs eine wesentlich komplexere, wesentlich tiefer gehende Philosophie, die nicht nur unser Zuhause bereichern und sein Erscheinungsbild prägen wird, sondern auch unsere Seele, jede Sekunde unseres Lebens, jede unserer Entscheidungen, jeden unserer Atemzüge. Der Weg ist bereitet für Li Bien, den Weg des Lichts.«
»Was ist Li Bien?«, fragte Olivier in die Runde. Clara glaubte zu sehen, wie Mother ihren Mund öffnete und dann wieder schloss.
»Mother?«, fragte sie.
»Ich? Nein, meine Liebe, ich habe keine Ahnung. Warum fragst du?«
»Ich dachte, du bist vielleicht mit Li Bien vertraut, weil du doch ein Yoga- und Meditationszentrum leitest«, sagte Clara vorsichtig.
»Ich bin mit sämtlichen spirituellen Wegen vertraut«, sagte sie, was eine gelinde Übertreibung war, wie Clara fand. »Aber mit diesem nicht.« Deutlicher brauchte sie nicht zu werden.
»Es ist dennoch ein merkwürdiger Zufall«, sagte Gabri, »findest du nicht?«
»Was denn?«, fragte Mother mit heiterer Stimme und Miene, aber mit bis zu den Ohren hochgezogenen Schultern.
»Na ja, dass CC ihr Buch Be Calm nennt. So heißt doch dein Meditationszentrum.«
Schweigen.
»Und?«, sagte Gabri, der ahnte, dass er in ein Fettnäpfchen getreten war.
»Das muss ein Zufall sein«, erklärte Emilie ruhig. »Vielleicht ist es auch eine Verneigung vor dir, ma belle.« Sie wandte sich zu Mother und legte eine schmale Hand auf den rundlichen Arm ihrer Freundin. »Sie wohnt jetzt seit ungefähr einem Jahr in dem alten Hadley-Haus und empfindet deine Arbeit bestimmt als Inspiration. Es ist eine Hommage an deine Spiritualität.«
»Und ihr Haufen Mist ist wahrscheinlich höher als deiner«, beruhigte Kaye sie. »Das muss ein gutes Gefühl sein. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist«, sagte sie zu Ruth, die erfreut auf ihre Heldin blickte.
»Schöne Frisur.« Olivier wandte sich an Clara, in der Hoffnung, die Stimmung aufzulockern.
»Danke.« Clara fuhr sich mit der Hand durch die Haare, was dazu führte, dass sie in alle Richtungen abstanden und sie aussehen ließen, als hätte sie gerade jemand erschreckt.
»Du hast recht«, sagte Olivier zu Myrna. »Sie sieht aus wie ein verängstigter Infanterist in den Schützengräben von Vimy. Dieser Look steht nicht vielen. Sehr mutig, sehr neues Millennium. Ich beglückwünsche dich.«
Claras Augen verengten sich, und sie warf Myrna, die von einem Ohr zum anderen grinste, einen bitterbösen Blick zu.
»Scheiß auf den Papst«, sagte Kaye.
CC rückte den Stuhl erneut zurecht. Sie stand angekleidet und allein in dem Hotelzimmer. Saul war gegangen, ohne ihr einen Abschiedskuss zu geben oder einen einzufordern.
Sie war erleichtert, als er ging. Jetzt konnte sie es endlich tun.
CC stand am Fenster, ein Exemplar von Be Calm in der Hand. Langsam hob sie das Buch und drückte es an ihre Brust, als hätte ihr genau das ihr ganzes Leben lang gefehlt.