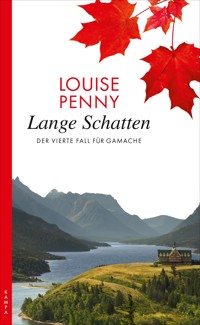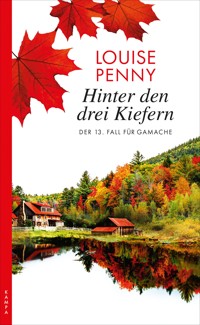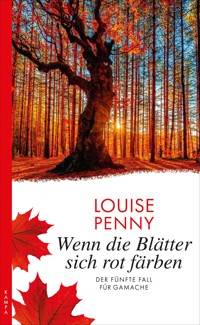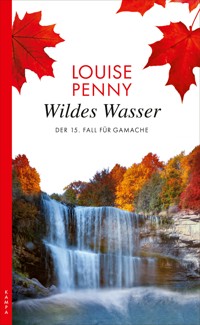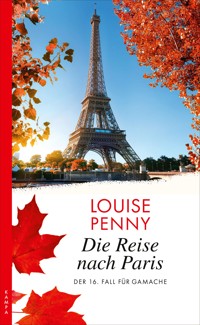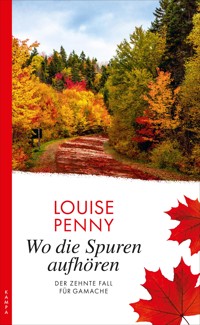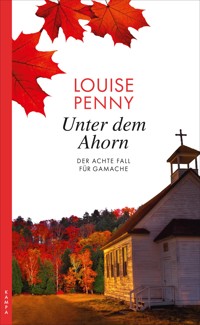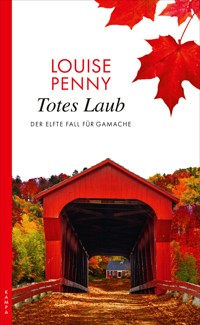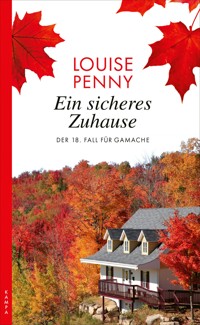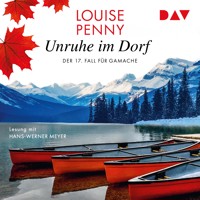Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Gabri Dubeau, der zusammen mit seinem Lebensgefährten Olivier die Pension in Three Pines führt, will eine Séance organisieren, um Kontakt mit den Toten aufzunehmen. Am Ostersonntag treffen sich einige Mutige im leer stehenden Hadley-Haus, das auf einer Anhöhe über den Dächern von Three Pines liegt. Schlimme Dinge sind dort geschehen: ein Mord, eine Entführung und noch ein versuchter Mord. Seitdem gilt das Haus als verhext. Doch statt dass bei der Séance Tote lebendig werden, erschrickt die allseits beliebte Madeleine Favreau im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. Oder war es ein heimtückisch geplanter Mord? Inspector Armand Gamache trifft auf eine Mauer des Schweigens. Keiner in Three Pines kann sich vorstellen, dass irgendjemand der Frau etwas Böses wollte. Während Gamache versucht, den dunklen Geheimnissen auf den Grund zu gehen, gerät er selbst in Schwierigkeiten: In seinem Team bei der Sûreté du Québec lauert ein Maulwurf, und Gamache muss herausfinden, wer Freund und wer Feind ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Das verlassene Haus
Der dritte Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englischen von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Für meinen Bruder Rob und seine Familie, Audi, Kim, Adam und Sarah, in Liebe.
1
Clara Morrow kniete im frischen feuchten Gras auf dem Dorfanger und dachte an die Auferweckung der Toten, die sie gleich nach dem Abendessen in Angriff nehmen wollten, während sie sorgsam das Osterei versteckte. Als sie sich eine Strähne aus dem Gesicht strich, verschmierte sie Grashalme, Erde und irgendwelches andere braune Zeug, das womöglich keine Erde war, in ihren zerzausten Haaren. Um sie herum schlenderten Dorfbewohner mit Körbchen voll bunter Eier auf der Suche nach den besten Verstecken über die Wiese. Mitten auf dem Anger saß Ruth Zardo auf einer Bank und ließ Eier um sich herum auf den Boden fallen, gelegentlich holte sie aus und warf eines gegen irgendjemandes Kopf oder Hinterteil. Für eine so alte und verrückte Frau traf sie bedenklich gut, dachte Clara.
»Kommst du heute Abend?«, fragte Clara, um die alte Dichterin von Monsieur Béliveau abzulenken, den sie gerade ins Visier nahm.
»Machst du Witze? Die Lebenden sind schlimm genug, warum sollte ich wollen, dass auch nur einer von den Toten aufersteht?«
Mit diesen Worten warf Ruth Monsieur Béliveau das Ei an den Hinterkopf. Zum Glück trug der Besitzer des Dorfladens eine Wollmütze, und zum Glück hatte er für die weißhaarige alte Hexe auf der Bank viel übrig. Ruth suchte sich ihre Opfer mit Bedacht aus. Es waren fast ausschließlich Leute, die sie mochten.
Wobei es nicht weiter schlimm gewesen wäre, von einem Schokoladenei getroffen zu werden, aber die hier waren nicht aus Schokolade. Diesen Fehler hatten sie nur einmal gemacht.
Als das Dorf Three Pines vor einigen Jahren zum ersten Mal beschlossen hatte, am Ostersonntag ein großes Eiersuchen zu veranstalten, waren alle furchtbar aufgeregt gewesen. Die Dorfbewohner trafen sich in Oliviers Bistro, und über dem einen oder anderen Gläschen Wein und Stück Brie verteilten sie tütenweise Schokoladeneier, die am nächsten Tag versteckt werden sollten. Alle riefen »Ooh« und »Aah« und waren ein klein wenig neidisch. Ach, wären sie doch nur wieder Kinder. Aber es war sicher auch schön, die freudigen Gesichter ihrer Kinder zu sehen. Außerdem fanden die Kinder womöglich nicht alle Eier, insbesondere die, die sie hinter Oliviers Bar versteckt hatten.
»Sie sind entzückend.« Gabri nahm eine winzige, perfekt geformte Marzipangans und biss ihr den Kopf ab.
»Gabri.« Olivier, sein Lebensgefährte, riss den Rest der Gans aus Gabris Pranke. »Die sind für die Kleinen.«
»Du willst sie doch bloß für dich selbst haben.« Gabri wandte sich zu Myrna und zischte ihr laut und vernehmlich zu: »Tolle Idee. Schwule, die Süßigkeiten an Kinder verteilen. Ruf doch schon mal die Sittenpolizei!«
Der scheue, blonde Olivier lief knallrot an.
Myrna lächelte. Sie sah selbst wie ein riesiges Osterei aus, schwarz, dick und in einen leuchtend violetten und roten Kaftan gehüllt.
Die meisten Bewohner des kleinen Dorfs hatten sich im Bistro versammelt und standen an der langen, auf Hochglanz polierten Bar oder hatten es sich in einem der bequemen, alten Polstersessel gemütlich gemacht. Alles zu verkaufen. Oliviers Bistro war gleichzeitig ein Antiquitätenladen. An allem baumelten dezente Preisschildchen, auch an Gabri, wenn er sich nicht genügend beachtet und gelobt fühlte.
Es war Anfang April, und in den offenen Kaminen knisterte ein munteres Feuer, das den von Alter und Sonne nachgedunkelten Dielenboden und die Balken zum Leuchten brachte. Die Bedienungen schlängelten sich geschickt zwischen den Tischen durch und boten Getränke und weichen, reifen Brie von Monsieur Pagés Farm an. Das Bistro befand sich in der Mitte des alten Québecer Dorfes, genau am Rand des Dorfangers. Zu seiner Linken und Rechten waren die übrigen Geschäfte untergebracht, in alten Ziegelhäusern, die alle durch Türen verbunden waren und dem Dorfleben ein solides Fundament gaben. Monsieur Béliveaus Gemischtwarenladen, Sarahs Bäckerei, das Bistro und zu guter Letzt Myrnas Buchladen. Seit Urzeiten standen auf der gegenüberliegenden Seite des Angers drei knorrige Kiefern wie die drei Weisen, die an ihrem Ziel angekommen waren. Vom Dorf führten unbefestigte Straßen auf verschlungenen Wegen durch die Berge und Wälder.
Three Pines selbst war ein blinder Fleck auf der Landkarte. Die Zeit rauschte dahin, und manchmal streifte sie das Dorf, aber nie für lange und kaum jemals Spuren hinterlassend. Seit Jahrhunderten duckte sich das Dorf zwischen die zerklüfteten kanadischen Berge, und wenn überhaupt, dann wurde es nur durch Zufall in seinem Versteck gefunden. Manchmal erklomm ein müder Reisender den Hügel und erblickte dort unten, als wäre es Shangri-La, den einladenden Kreis von alten Häusern. Einige bestanden aus verwitterten Feldsteinen, errichtet von Siedlern, die das Land von tief wurzelnden Bäumen und schweren Felsbrocken befreit und sich dabei einen krummen Rücken geholt hatten. Andere waren aus roten Ziegeln und von den United Empire Loyalists, die auf ihrer Flucht aus den USA hier gelandet waren, erbaut worden. Wieder andere hatten die geschwungenen Metalldächer der Québecer Häuser mit ihren hohen Giebeln und breiten Veranden. Ganz am Ende befand sich Oliviers Bistro, in dem man immer auf einen Café au lait und frisch gebackene Croissants, freundliche Gespräche und nette Gesellschaft zählen konnte. Hatte man Three Pines erst einmal gefunden, vergaß man es nicht mehr so schnell. Aber es wurde nur von Verirrten gefunden.
Myrna sah zu ihrer Freundin Clara Morrow hinüber, die ihr die Zunge herausstreckte. Myrna streckte ihrerseits die Zunge heraus. Clara verdrehte die Augen. Myrna verdrehte die Augen, dann nahm sie neben Clara auf dem bequemen Sofa vor dem Kamin Platz.
»Du hast hoffentlich nicht wieder Gartenmulch geraucht, während ich in Montréal war, oder?«
»Dieses Mal nicht«, lachte Clara. »Du hast etwas an der Nase.«
Myrna betastete ihre Nase, fand etwas und besah es sich. »Hm, entweder ist es Schokolade oder Haut. Das lässt sich nur auf eine Art herausfinden.«
Sie steckte es in den Mund.
»Igitt«, jaulte Clara auf. »Und du wunderst dich, dass du Single bist.«
»Das tu ich doch gar nicht.« Myrna lächelte. »Ich brauche keinen Mann, um mich als ganze Frau zu fühlen.«
»Ach ja? Und was war mit Raoul?«
»Ach, Raoul«, sagte Myrna verträumt. »Der war süß.«
»Er war ein richtiges Gummibärchen«, stimmte Clara zu.
»Er machte mich zu einer ganzen Frau«, sagte Myrna. »Rundete mich sozusagen ab.« Sie tätschelte ihren Bauch, der groß und ausladend war, wie die ganze Frau.
»Seht euch das an.« Eine rasiermesserscharfe Stimme brachte sie beide zum Verstummen.
Ruth Zardo stand mitten im Bistro und streckte eine Hand mit einem Schokoladenhasen in die Luft, als wäre er eine Granate. Er war aus dunkler Schokolade, die langen Ohren wachsam aufgestellt, das Gesicht so realistisch, dass Clara fast damit rechnete, seine feinen Schnurrbarthaare aus Zuckerguss würden gleich zu zittern beginnen. In seinen Pfoten hielt er ein Körbchen aus weißer und brauner Schokolade und in dem Körbchen lag ein Dutzend hübsch bemalter Zuckereier. Der Hase war entzückend und Clara betete, dass Ruth damit nicht nach jemandem werfen würde.
»Ein Hoppelhäschen«, zischte die alte Dichterin.
»Die esse ich auch«, sagte Gabri zu Myrna. »Am liebsten in Form eines Doppelhäschens.«
Myrna lachte und wünschte sofort, sie hätte es nicht getan. Ruth funkelte sie an.
»Ruth.« Clara erhob sich und näherte sich Ruth vorsichtig, den Scotch ihres Ehemanns Peter als Lockmittel in der Hand. »Tu bitte dem Häschen nichts.«
So etwas hatte sie noch nie gesagt.
»Es ist ein Hase«, sagte Ruth langsam, als wäre Clara ein begriffsstutziges Kind. »Woher hat er also die hier?«
Sie deutete auf die Eier.
»Seit wann haben Hasen Eier?«, wiederholte Ruth und sah die verwunderten Dorfbewohner an. »Darüber habt ihr noch nie nachgedacht, hm? Woher kriegen sie die? Vermutlich von Schokoladenhühnern. Das Häschen muss ein paar Schokoladenhühnern die Eier gestohlen haben, und die suchen jetzt völlig verzweifelt nach ihren Babys.«
Das Komische war, dass Clara bei den Worten der alten Dichterin tatsächlich ein paar Schokoladenhühner vor sich sah, die völlig aufgelöst auf der Suche nach ihren Eiern herumrannten. Eier, die der Osterhase gestohlen hatte.
Ruth ließ den Schokoladenhasen auf den Boden fallen, wo er zerbrach.
»O Gott«, sagte Gabri und lief, um die Reste aufzuheben. »Der war für Olivier.«
»Wirklich?«, fragte Olivier, der offenbar vergessen hatte, dass er ihn selbst gekauft hatte.
»Ostern ist ein höchst merkwürdiges Fest«, stellte Ruth finster fest. »Ich habe es nie gemocht.«
»Was von heute an wohl auf Gegenseitigkeit beruht«, erwiderte Gabri und hielt den kaputten Hasen wie ein verletztes Kind. Er ist ein so sanftmütiger Mann, dachte Clara nicht zum ersten Mal. Gabri war groß und kräftig, regelrecht bullig, darüber vergaß man leicht, wie sensibel er war. Außer in Momenten wie diesem, wenn er zärtlich einen sterbenden Schokoladenhasen im Arm wiegte.
»Wie feiern wir Ostern?«, fragte die alte Dichterin, schnappte sich Peters Scotch aus Claras Hand und stürzte ihn hinunter. »Wir suchen Eier und essen kleine Osterlämmer.«
»Aber wir gehen auch in die Kirche«, sagte Monsieur Béliveau.
»In Sarahs Bäckerei gehen mehr Leute als in die Kirche«, giftete Ruth. »Und dort kaufen sie Gebäck heidnischen Ursprungs. Ich weiß, ihr haltet mich für verrückt, dabei bin ich wahrscheinlich die einzig Vernünftige hier.«
Mit dieser verwirrenden Bemerkung humpelte sie zur Tür, wo sie sich noch einmal umdrehte.
»Versteckt lieber keine Schokoladeneier für die Kinder. Es wird etwas Schlimmes geschehen.«
Wie Jeremia, der weinende Prophet, sollte sie recht behalten.
Am nächsten Morgen waren die Eier verschwunden. Alles, was man von ihnen noch fand, war das Einwickelpapier. Zuerst hatten die Dorfbewohner die älteren Kinder in Verdacht oder sogar Ruth, die das Ganze sabotiert haben könnte.
»Seht euch das an«, rief Peter und hielt die zerfetzte Schachtel eines Schokoladenhasen in die Höhe. »Abdrücke von Zähnen. Und Krallen.«
»Dann war es also doch Ruth«, sagte Gabri, nahm die Schachtel und besah sie.
»Schaut.« Clara rannte einem Einwickelpapier hinterher, das über den Dorfanger wehte. »Das ist auch ganz zerfetzt.«
Sie verbrachten den Vormittag damit, buntem Einwickelpapier hinterherzulaufen und die Reste des Schlachtfests zu beseitigen, danach versammelten sie sich wieder bei Olivier, um sich am Feuer aufzuwärmen.
»Ernsthaft«, sagte Ruth zu Clara und Peter beim Mittagessen im Bistro. »Damit war doch zu rechnen.«
»Ich gebe zu, dass es nicht wirklich überraschend ist«, Peter lachte und schnitt in seinen goldbraunen Croque Monsieur, der geschmolzene Camembert konnte den geräucherten Schinken und das blättrige Croissant kaum zusammenhalten. Um ihn herum waren besorgte Eltern damit beschäftigt, ihre weinenden Kinder mit Kakao zu besänftigen.
»Letzte Nacht muss jedes wilde Tier aus einem Umkreis von ein paar Kilometern in unserem Dorf gewesen sein«, sagte Ruth und ließ die Eiswürfel in ihrem Scotch kreisen. »Um sich den Bauch mit Ostereiern vollzuschlagen. Füchse, Waschbären, Eichhörnchen.«
»Braunbären«, sagte Myrna, die sich zu ihnen gesellte. »Himmel, das ist ganz schön unheimlich. All diese Bären, die nach ihrem langen Winterschlaf aufwachen und halb verhungert aus ihren Höhlen kriechen.«
»Man muss sich mal ihre Überraschung vorstellen, als sie die Schokoladeneier und -hasen fanden«, sagte Clara zwischen zwei Löffeln ihrer cremigen Fischsuppe mit Lachsstückchen, Kammmuscheln und Shrimps. Sie nahm ein knuspriges Baguette, riss ein Stück ab und bestrich es mit Oliviers exquisiter Süßrahmbutter. »Die Bären müssen sich gefragt haben, welches Wunder während ihres Winterschlafs geschehen ist.«
»Nicht alles, was aufersteht, ist ein Wunder«, sagte Ruth, blickte von der goldfarbenen Flüssigkeit, ihrem Mittagsmahl, auf und sah aus dem Fenster. »Nicht alles, was wieder zum Leben erwacht, soll das auch tun. Das ist eine seltsame Jahreszeit. Den einen Tag regnet es, den nächsten Tag gibt es Schnee. Nichts ist gewiss. Alles ist völlig unberechenbar.«
»Jede Jahreszeit ist unberechenbar«, sagte Peter. »Im Herbst gibt es Orkane, im Winter Schneestürme.«
»Damit bestätigst du nur, was ich sage«, sagte Ruth. »Man hat Namen für die Bedrohung. Man weiß in diesen Jahreszeiten, was zu erwarten ist. Nur nicht im Frühjahr. Im Frühjahr passieren die schlimmsten Überflutungen. Waldbrände, Frosteinbrüche, Schneestürme und Schlammlawinen. Die Natur ist in Aufruhr. Es kann alles passieren.«
»Im Frühjahr gibt es aber auch so schöne Tage, dass einem das Herz aufgeht«, sagte Clara.
»Stimmt, das Wunder der Wiedergeburt. Soweit ich weiß, gründen ganze Religionen auf dieser Idee. Aber es gibt Dinge, die besser begraben bleiben sollten.« Die alte Dichterin erhob sich und trank ihren Scotch aus. »Noch ist es nicht vorbei. Die Bären werden zurückkommen.«
»Das würde ich auch«, sagte Myrna, »wenn ich auf ein Dorf stieße, das ganz aus Schokolade besteht.«
Clara lächelte, aber ihre Augen ruhten dabei weiter auf Ruth, die heute noch etwas anderes als Zorn oder Überdruss ausstrahlte. Clara nahm etwas sehr viel Beunruhigenderes wahr.
Angst.
2
Ruth hatte recht gehabt. Die Bären kamen von da an Jahr für Jahr zu Ostern und suchten nach Schokoladeneiern. Als sie nie mehr welche fanden, gaben sie es irgendwann auf und blieben in den Wäldern um Three Pines herum. Die Dorfbewohner lernten schnell, dass sie zur Osterzeit keine ausgedehnten Spaziergänge in den Wäldern machen und niemals zwischen ein Bärenjunges und seine Mutter geraten sollten.
Das ist eben die Natur, erklärte Clara. Aber eine gewisse Besorgnis blieb. In gewisser Weise hatten sie es sich selbst zuzuschreiben.
Wieder einmal ließ sich Clara auf alle viere nieder, dieses Mal mit den hübschen Holzeiern, die sie nun statt der essbaren nahmen. Diese Idee stammte von Hanna und Roar Parra. Die beiden kamen aus der ehemaligen Tschechoslowakei und bewiesen großes Geschick beim Bemalen von Eiern.
Den Winter über schnitzte Roar die Holzeier, und Hanna verteilte sie an alle, die Lust hatten, sie zu bemalen. Bald holten sich Leute aus den gesamten Cantons de l’Est Eier. Schulkinder bemalten sie im Kunstunterricht, Eltern besannen sich auf ihre brachliegenden Talente, und Großeltern malten Bilder aus ihrer Kindheit. Während des langen Québecer Winters wurde gemalt, und an Karfreitag fingen sie an, sie zu verstecken. Wenn die Kinder sie gefunden hatten, tauschten sie die hölzernen Stellvertreter gegen richtige Eier aus. Richtige Schokoladeneier zumindest.
»Seht euch das an«, rief Clara vom Ufer des Teichs auf dem Dorfanger. Monsieur Béliveau und Madeleine Favreau gingen zu ihr. Monsieur Béliveaus lange, schlanke Gestalt klappte wie ein Messer zusammen, als er sich bückte. Dort in dem hohen Gras war ein Nest mit Eiern.
»Sie sind echt«, er lächelte und schob das Gras auseinander, um es Madeleine zu zeigen.
»Wie hübsch«, sagte Mad und streckte die Hand aus.
»Nicht doch«, sagte er. »Wenn du sie anfasst, wird die Mutter sie nicht mehr ausbrüten.«
Mad zog ihre Hand schnell zurück und blickte Clara freundlich lächelnd an. Clara hatte Madeleine von Anfang an gemocht, auch wenn sie sich nicht besonders gut kannten. Mad war erst vor ein paar Jahren hergezogen. Sie war ein wenig jünger als sie, eine schöne, lebhafte Frau mit kurzen, dunklen Haaren und intelligenten braunen Augen. Sie machte stets einen glücklichen und zufriedenen Eindruck. Warum auch nicht?, dachte Clara. Nach dem, was sie durchgemacht hatte.
»Was sind das für Eier?«, fragte Clara.
Madeleine zog die Augenbrauen in die Höhe und breitete die Arme aus. Keine Ahnung.
Monsieur Béliveau klappte sich erneut mit einer eleganten Bewegung zusammen. »Jedenfalls kein Huhn, trop grand. Ente vielleicht oder Gans.«
»Das wird lustig«, sagte Madeleine. »Eine kleine Familie auf dem Anger.« Sie wandte sich zu Clara. »Wann findet die Séance statt?«
»Willst du kommen?« Clara war überrascht, freute sich aber. »Hazel auch?«
»Nein. Sophie kommt morgen Vormittag nach Hause, und Hazel meint, sie müsse davor kochen und putzen, aber ehrlich gesagt …« Madeleine senkte ihre Stimme verschwörerisch. »Ich glaube, sie hat Angst vor Gespenstern. Monsieur Béliveau dagegen will kommen.«
»Wir sollten dankbar sein, dass Hazel beschlossen hat, stattdessen zu kochen«, sagte Monsieur Béliveau. »Sie hat einen wunderbaren Auflauf für uns vorbereitet.«
Das sieht Hazel ähnlich, dachte Clara. Immer kümmert sie sich um andere. Clara machte sich manchmal ein bisschen Sorgen, dass Hazels Großzügigkeit ausgenutzt werden könnte, insbesondere von ihrer Tochter, aber ihr war durchaus klar, dass sie das nichts anging.
»Vor dem Abendessen liegt aber noch eine Menge Arbeit vor uns, mein Lieber.« Madeleine lächelte Monsieur Béliveau strahlend an und legte eine Hand auf seine Schulter. Der ältere Mann lächelte. Seit dem Tod seiner Frau hatte er nicht mehr oft gelächelt, jetzt tat er es wieder, noch ein Grund für Clara, Madeleine zu mögen. Sie sah den beiden hinterher, wie sie mit ihren Körben voll Ostereier unterm Arm durch die spätnachmittägliche Aprilsonne davongingen, das zarte Frühlingslicht fiel auf den zarten Frühling einer Beziehung. Monsieur Béliveau, groß, schlank und leicht gebeugt, schien beinahe ein wenig zu hüpfen.
Clara erhob sich und streckte ihr achtundvierzig Jahre altes Kreuz, dann blickte sie sich um. Der Anger sah aus wie ein Podex-Feld. Sämtliche Dorfbewohner standen gebückt da und versteckten Eier. Clara wünschte, sie hätte ihren Skizzenblock dabei.
An Three Pines war gewiss nichts hip, nichts war schick oder modisch oder irgendetwas anderes von den Dingen, die Clara wichtig gewesen waren, als sie vor fünfundzwanzig Jahren ihr Kunststudium abgeschlossen hatte. Hier war nichts designed. Stattdessen schien sich das Dorf an den drei Kiefern auf dem Dorfanger orientiert zu haben und sich einfach eines Tages aus der Erde erhoben zu haben und gewachsen zu sein.
Clara sog die nach Frühling riechende Luft ein und sah zu dem Haus, in dem sie mit Peter wohnte. Es war aus Ziegeln, hatte eine Veranda aus Holz und zum Dorfanger hin eine Mauer aus Feldsteinen. Vom Gartentor führte ein Weg zwischen ein paar kurz vor der Blüte stehenden Apfelbäumen zur Haustür. Von dort wanderte Claras Blick die anderen Häuser um den Dorfanger entlang. Wie ihre Bewohner waren die Häuser von Three Pines standfest und durch ihre Umgebung geprägt. Sie hatten Stürme und Kriege, Verluste und Kummer überdauert. Und daraus war eine enge und friedliche Gemeinschaft hervorgegangen.
Clara liebte ihr Dorf. Die Häuser, die Läden, den Dorfanger, die Staudengärten und selbst die Straßen mit ihren Schlaglöchern. Montréal war nicht einmal zwei Autostunden entfernt, und die Grenze zu den USA lag praktisch um die Ecke. Aber am meisten mochte sie die Leute, die diesen Karfreitag damit verbrachten, Holzeier für die Kinder zu verstecken.
Dieses Jahr lag Ostern spät, es ging schon auf Ende April zu. Sie hatten nicht immer solches Glück mit dem Wetter. Zumindest einmal war das Dorf unter einer dicken Schneedecke aufgewacht, die auch die ersten Knospen und bemalten Eier unter sich begrub. Oft war es bitterkalt, und die Dorfbewohner mussten sich zwischendurch in Oliviers Bistro aufwärmen und die halb erfrorenen, zitternden Finger um einen Becher mit heißem Cidre oder Kakao schließen.
Heute nicht. Dieser Apriltag erstrahlte in einem ganz besonderen Glanz. Ein wahres Feiertagswetter, sonnig und warm. Der Schnee war weggeschmolzen, selbst an den sonnenabgewandten Stellen, wo er sich immer lange hielt. Das Gras schoss in die Höhe, und über den Bäumen lag ein zarter grüner Schleier. Man bekam den Eindruck, die Aura von Three Pines wäre plötzlich sichtbar geworden. Alles war in goldgrünes Licht getaucht.
Tulpen drängten an die Oberfläche, und bald bestünde der Dorfanger aus einem einzigen Blütenmeer, dunkelblaue Hyazinthen, Tulpen und Narzissen, die munter mit den Köpfen nickten, und dann die Maiglöckchen, die das Dorf mit ihrem Duft und Heiterkeit erfüllen würden.
An diesem Karfreitag roch Three Pines nach frischer Erde und Verheißungen. Und vielleicht ein, zwei Würmern.
»Du kannst sagen, was du willst, ich werde nicht mitgehen.«
Clara hörte das Zischeln und Wispern. Sie kauerte in dem hohen Gras am Teich. Sie konnte das flüsternde Paar nicht sehen, aber es war klar, dass sie sich nur ein paar Meter von ihr entfernt befanden. Die Frau sprach Französisch, aber ihre Stimme klang so angespannt und erregt, dass sie sie nicht erkannte.
»Es ist doch nur eine Séance«, sagte eine Männerstimme. »Das wird ein Riesenspaß.«
»Um Himmels willen, das ist ein Sakrileg. Eine Séance an Karfreitag!«
Es gab eine Pause. Clara wand sich unbehaglich. Nicht etwa, weil sie lauschte, sondern weil sie einen Krampf in den Beinen bekam.
»Komm schon, Odile. Du bist nicht einmal gläubig. Was soll schon passieren?«
Odile, dachte Clara. Die einzige Odile, die sie kannte, war Odile Montmagny. Und die war …
Die Frau flüsterte wieder:
»Des Winters Frost, des Lenzes erster Falter,
Beide setzen ihr Zeichen, das sich mischt
Zu Freude und Kummer auf dem Angesicht
Von Kindheit, Jugend und Alter.«
Überraschtes Schweigen breitete sich aus.
… eine richtig schlechte Dichterin, brachte Clara den Gedanken zu Ende.
Odile hatte in einem feierlichen Ton gesprochen, so als würden die Worte noch etwas anderem als dem mangelnden Talent der Dichterin Ausdruck verleihen.
»Ich werde auf dich aufpassen«, sagte der Mann. Jetzt wusste Clara auch, wer er war. Odiles Freund, Gilles Sandon.
»Warum willst du da eigentlich hin, Gilles?«
»Nur zum Spaß.«
»Nicht etwa, weil sie da ist?«
Stille, bis auf den brüllenden Schmerz in Claras Beinen.
»Er wird auch dort sein, das ist dir doch klar?«, zischte Odile.
»Wer?«
»Du weißt genau, wer, Monsieur Béliveau«, sagte Odile. »Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Gilles.«
Wieder gab es eine Pause, dann sprach Sandon mit tiefer, tonloser Stimme, als versuchte er, sämtliche Emotionen von sich fernzuhalten.
»Keine Sorge. Ich werde ihn schon nicht umbringen.«
Clara vergaß ihre Beine. Monsieur Béliveau umbringen? Wer würde an so etwas auch nur denken? Der Gemischtwarenhändler hatte noch nicht einmal irgendwann jemandem zu wenig Wechselgeld herausgegeben. Was hatte Gilles Sandon nur gegen ihn?
Als sie hörte, dass die beiden weggingen, richtete sie sich mit einem erleichterten Seufzer auf. Sie starrte ihnen nach, Odile mollig und leicht watschelnd, Gilles ein Bär von einem Mann, sein Markenzeichen, der rote Bart, war sogar von hinten sichtbar.
Clara sah auf ihre verschwitzten Hände, mit denen sie die Holzostereier umklammert hielt. Die quietschbunten Farben hatten auf ihre Handflächen abgefärbt.
Die Séance schien plötzlich gar nicht mehr so eine lustige Idee wie noch vor ein paar Tagen, als Gabri im Bistro den Zettel aufgehängt hatte, auf dem der Besuch des berühmten Mediums Madame Isadore Blavatsky angekündigt worden war. Statt mit freudiger Erwartung war Clara nun mit Furcht erfüllt.
3
Madame Isadore Blavatsky war an diesem Abend nicht ganz sie selbst. Genau genommen war sie überhaupt nicht Madame Isadore Blavatsky.
»Nennen Sie mich doch bitte Jeanne.« Die unscheinbare Frau stand im Hinterzimmer des Bistros und streckte ihre Hand aus. »Jeanne Chauvet.«
»Guten Tag, Madame Chauvet.« Clara lächelte und schüttelte die schlaffe Hand. »Bitte entschuldigen Sie.«
»Jeanne«, erinnerte die Frau sie mit kaum vernehmbarer Stimme.
Clara ging zu Gabri, der eine Platte mit Räucherlachs herumreichte. Das Zimmer begann sich langsam zu füllen. »Lachs?« Er hielt Clara die Platte hin.
»Wer ist das?«, fragte Clara.
»Madame Blavatsky, das berühmte ungarische Medium. Spürst du ihre Aura etwa nicht?«
Madeleine und Monsieur Béliveau winkten ihr zu. Clara winkte zurück, dann sah sie zu Jeanne, die so aussah, als würde sie in Ohnmacht fallen, wenn jemand auch nur Buh machte. »Aber sicher spüre ich etwas, junger Freund, und das ist Ärger.«
Gabri Dubeau schwankte zwischen der Freude darüber, »junger Freund« genannt zu werden, und Rechtfertigungsdruck.
»Das ist nicht Madame Blavatsky. Sie tut nicht einmal so. Sie heißt Jeanne Soundso«, sagte Clara, nahm sich geistesabwesend ein Stück Lachs und legte es auf eine Scheibe Pumpernickel. »Du hast uns Madame Blavatsky versprochen.«
»Du weißt nicht einmal, wer Madame Blavatsky ist.«
»Jedenfalls weiß ich, wer sie nicht ist.« Clara nickte und lächelte der kleinen Frau mittleren Alters zu, die etwas verwundert zwischen ihnen stand.
»Und, wärst du gekommen, wenn du gewusst hättest, dass sie das Medium ist?« Gabri deutete mit der Platte auf Jeanne. Eine Kaper rollte herunter und ging für immer auf dem bunt gemusterten Perserteppich verloren.
Warum ziehen wir eigentlich nie unsere Lehren, überlegte Clara seufzend. Jedes Mal, wenn Gabri einen Gast hat, lädt er zu irgendeiner merkwürdigen Veranstaltung ein, wie das eine Mal, als der Poker-Profi da war und uns unser Geld abknöpfte, oder diese Sängerin, im Vergleich zu der sogar Ruth wie Maria Callas klingt. So schrecklich diese von Gabri organisierten Zusammenkünfte allerdings auch für die Bewohner von Three Pines waren, noch schlimmer mussten sie für die nichts ahnenden Gäste sein, die dazu verdonnert waren, ein ganzes Dorf zu unterhalten, wo sie doch nur ein paar ruhige Tage auf dem Land verbringen wollten.
Sie beobachtete Jeanne Chauvet, die sich im Raum umsah, sich die Hände an ihrer Polyesterhose abwischte und das Porträt über dem prasselnden Kaminfeuer anlächelte. Sie schien vor Claras Augen zu verschwinden. Es war fast wie ein Zaubertrick, wenn auch keiner, der für ihre Qualitäten als Medium sprach. Clara empfand Mitgefühl für die Frau. Also wirklich, was dachte sich Gabri eigentlich dabei?
»Was hast du dir eigentlich dabei gedacht?«
»Warum? Sie ist ein Medium. Das hat sie mir gesagt, als sie ihr Zimmer bezogen hat. Gut, sie heißt nicht Madame Blavatsky. Und stammt auch nicht aus Ungarn. Aber sie hält spiritistische Sitzungen ab.«
»Moment mal.« Clara beschlich ein Verdacht. »Weiß sie überhaupt von deiner Planung für diesen Abend?«
»Ach, das hat sie bestimmt vorhergesehen.«
»Nachdem die ersten Leute eingetroffen waren, vielleicht. Gabri, wie kannst du ihr das antun? Und uns?«
»Es macht ihr Spaß. Sieh sie dir an. Sie wirkt doch schon viel entspannter.«
Myrna hatte ihr ein Glas Weißwein geholt, und Jeanne Chauvet trank ihn, als wäre er das Wasser vor der Verwandlung. Myrna sah zu Clara herüber und zog die Augenbrauen in die Höhe. Noch mehr davon und Myrna müsste die Séance abhalten.
»Séance?«, fragte Jeanne eine Minute später, als Myrna sich erkundigte, was sie erwarten würde. »Hält hier jemand eine Séance ab?«
Alle Blicke wanderten zu Gabri, der die Lachsplatte behutsam auf einem Tisch abstellte und neben Jeanne trat. Gabris riesenhafte Erscheinung schien die unscheinbare Frau noch mehr schrumpfen zu lassen, bis man nur noch ihre Kleider zu sehen meinte. Clara schätzte sie auf Anfang vierzig. Ihre stumpfen braunen Haare sahen aus wie selbst geschnitten. Ihre Augen waren von einem wässrigen Blau und ihre Kleidung stammte vom Wühltisch. Clara hatte den größten Teil ihres Künstlerinnenlebens in Armut verbracht und kannte die Zeichen. Sie fragte sich kurz, warum Jeanne nach Three Pines gekommen war und sich einen Aufenthalt in Gabris Pension leistete, der zwar keine astronomisch hohen Preise verlangte, aber auch nicht gerade billig war.
Jeanne machte mittlerweile keinen verängstigten Eindruck mehr, sondern nur noch einen verwirrten. Clara wäre am liebsten zu ihr gegangen, hätte den Arm um die Schultern der zierlichen Frau gelegt und sie vor dem, was auf sie zukam, beschützt. Sie hätte ihr am liebsten ein gutes, warmes Abendessen bereitet und dann ein warmes Bad eingelassen, und mithilfe einiger freundlicher Worte hätte sie vielleicht ein wenig Farbe in die Frau gezaubert.
Auch Clara sah sich in dem Raum um. Peter hatte es kategorisch abgelehnt, sich ihnen anzuschließen, und das Ganze als dummen Hokuspokus bezeichnet. Aber als sie gegangen war, hatte er ihre Hand einen Moment länger als sonst gehalten und gesagt, sie solle auf sich aufpassen. Clara hatte gelächelt, als sie unter dem Sternenhimmel um den Dorfanger zum hell erleuchteten Bistro gegangen war. Peter war streng anglikanisch erzogen worden. Solche Sachen riefen tiefe Abneigung in ihm hervor. Und machten ihm Angst.
Während des Abendessens hatten sie sich in eine kleine Debatte verstrickt, bei der Peter natürlich den Standpunkt vertreten hatte, dass das Ganze bekloppt war.
»Du nennst mich also bekloppt?«, hatte Clara gefragt, wohl wissend, dass er das nicht getan hatte, aber sie wollte sehen, wie er sich wand. Er hatte seinen grau gelockten Kopf gehoben und ihr einen wütenden Blick zugeworfen. Der große, schlanke Mann wirkte mit seiner Adlernase und den intelligenten Augen eher wie ein Bankdirektor als der Künstler, der er war. Ein Künstler allerdings, der keine Verbindung zu seinem Herzen zu haben schien. Er lebte in einer ganz und gar rationalen Welt, in der alles Unerklärliche »bekloppt« oder »Hokuspokus« oder »verrückt« war. Gefühle waren verrückt. Bis auf seine aufrichtige und bedingungslose Liebe zu Clara.
»Nein, ich habe dieses Medium gemeint. Das ist doch Scharlatanerie. Verbindung zu den Toten aufnehmen, die Zukunft voraussagen. Blödsinn. Der Trick ist so alt wie Methusalem.«
»Meinst du den aus der Bibel?«
»Fang bloß keinen Streit an«, hatte Peter warnend gesagt.
»Nein, will ich ja gar nicht. Aber wo geht es denn ständig um Verwandlungen? Von Wasser in Wein. Brot in Fleisch. Und um Magie. Auf dem Wasser wandeln, das Meer teilen, die Blinden sehend machen und die Lahmen gehend.«
»Das waren Wunder, keine Magie.«
»Ah, verstehe.« Clara hatte genickt und gelächelt und sich wieder ihrem Essen zugewandt.
So kam es, dass Clara sich in Begleitung von Myrna wiederfand. Madeleine und Monsieur Béliveau waren auch schon da und standen zwar nicht händchenhaltend herum, aber doch beinahe. Sein Arm in der Strickjacke berührte ihren, und sie zog ihn nicht zurück. Erneut stellte Clara ohne jeden Neid fest, wie attraktiv Madeleine war. Sie gehörte zu den Frauen, die andere Frauen zur Freundin und Männer zur Ehefrau haben wollten.
Clara lächelte Monsieur Béliveau an und errötete. Weil sie ihn in einem intimen Moment erwischt hatte, Zeuge von Empfindungen geworden war, die nicht für fremde Augen bestimmt waren. Einen Moment lang dachte sie darüber nach, aber dann wurde ihr klar, dass ihr Erröten mehr mit ihr selbst als mit ihm zu tun hatte. Nach dem Gespräch, das sie an diesem Nachmittag belauscht hatte, sah sie Monsieur Béliveau in einem neuen Licht. Der sanftmütige Gemischtwarenhändler war nicht mehr nur ein freundlicher, angenehmer Zeitgenosse, er war zu einem Geheimnis geworden. Clara behagte diese Verwandlung nicht. Sie mochte sich selbst nicht dafür, dass sie so empfänglich dafür war, was andere redeten.
Gilles Sandon stand vor dem Kamin und rieb sich über seine klammen Oberschenkel, die in einer riesigen Jeans steckten. Der Kamin verschwand praktisch hinter seinem enormen Körper. Odile Montmagny brachte ihm ein Glas Wein, das er entgegennahm, ohne den Blick von Monsieur Béliveau abzuwenden, der sich dessen allerdings nicht bewusst zu sein schien.
Clara hatte Odile immer gemocht. Sie waren ungefähr gleich alt und beide künstlerisch tätig, Clara malte, und Odile schrieb. Sie behauptete, sie arbeite an einem Versepos, einer Ode an die Anglos von Québec, was etwas merkwürdig war, da sie selbst Frankokanadierin war. Ihre Lesung in der Royal Canadian Legion in Saint-Rémy würde Clara nie vergessen. Fast alle hiesigen Schriftsteller waren eingeladen worden, so auch Ruth und Odile. Ruth hatte zuerst aus ihrem bitterbösen Gedicht An die Gemeinde vorgetragen:
Ich beneide euer stetes Lodern,
Angeheizt von Gottesloben.
Ich beneide, das glaubt mir,
dass ihr zusammen eins seid: ihr.
Und ich sehe, ihr seht niemals ein,
ich muss für mich alleine sein.
Dann war Odile an der Reihe gewesen. Sie war aufgesprungen und hatte, ohne zwischendurch Luft zu holen, ihr Gedicht heruntergerasselt.
Frühling kommt mit aller Macht,
Der Schnee, er schmilzt, das Eis, es kracht,
Und aus der Erde bricht,
Getaucht in sanftes Sonnenlicht,
Ein duftend zartes kleines Schlicht.
»Bezauberndes Gedicht«, log Clara, als die Lesung zu Ende war und sich alle um die Bar drängten, sie hatten jetzt einen Drink nötig. »Nur aus Neugier: Was ist ein Schlicht?«
»Das habe ich erfunden«, sagte Odile fröhlich. »Ich brauchte ein Wort, das sich auf bricht und Licht reimt.«
»Wie Wicht?«, schlug Ruth vor. Clara warf ihr einen warnenden Blick zu, während Odile darüber nachzudenken schien.
»Zu abgedroschen, leider.«
»Gegen den Wicht ist das Schlicht natürlich eine Wucht«, sagte Ruth zu Clara, bevor sie sich wieder an Odile wandte. »Nun, ich fühle mich jedenfalls bereichert, wenn nicht gar befruchtet. Die einzige Dichterin, mit der man dich vergleichen möchte, ist die große Sarah Binks.«
Odile hatte noch nie etwas von Sarah Binks gehört, wusste allerdings auch, dass sie eher in der französischen Literatur bewandert war. Sarah Binks musste eine sehr bedeutende englischsprachige Dichterin sein. Dieses Kompliment aus Ruth Zardos Mund hatte Odile Montmagnys Schaffenskraft neuen Schwung verliehen, und wenn es ruhig in ihrem Laden war, dem Maison Biologique in Saint-Rémy, holte sie ihr abgegriffenes, eselsohriges Schulheft hervor und dichtete drauflos, wobei sie manchmal nicht einmal auf eine Inspiration wartete.
Clara rang selbst oft genug mit ihrer Arbeit, sie identifizierte sich daher mit Odile und ermutigte sie. Peter hielt Odile natürlich für bekloppt. Aber Clara wusste es besser, sie wusste, dass sich große Künstler oft nicht durch Genie auszeichneten, sondern durch Beharrlichkeit, und Odile war beharrlich.
Acht Leute hatten sich an diesem Karfreitag in dem gemütlichen Hinterzimmer des Bistros eingefunden, um die Toten auferstehen zu lassen, nur die Frage, wer es tun würde, war noch nicht geklärt.
»Ich nicht«, sagte Jeanne. »Ich dachte, einer von Ihnen wäre das Medium.«
»Gabri?« Gilles Sandon wandte sich an den Gastgeber.
»Aber Sie haben mir doch erzählt, dass Sie spiritistische Sitzungen abhalten«, sagte Gabri in bettelndem Ton zu Jeanne.
»Das tue ich auch. Mit Tarotkarten, Runen und Ähnlichem. Ich nehme aber keine Verbindung mit Toten auf. Jedenfalls nicht oft.«
Es ist komisch, dachte Clara, wenn man nur lange genug wartete und ruhig blieb, sagten die Leute die merkwürdigsten Dinge.
»Nicht oft?«, fragte sie Jeanne.
»Manchmal«, gab diese zu und wich einen kleinen Schritt zurück, so als wäre sie angegriffen worden. Clara zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht und versuchte weniger forsch zu wirken, wobei gegenüber dieser Frau selbst ein Schokoladenhase einen forschen Eindruck gemacht hätte.
»Könnten Sie es nicht heute Abend machen? Bitte!«, sagte Gabri. Er sah seine kleine Party schon den Bach runtergehen.
Winzig, farblos und unscheinbar stand Jeanne in ihrer Mitte. Da sah Clara etwas über das Gesicht der mausgrauen Frau huschen. Ein Lächeln. Nein. Ein Grinsen.
4
Hazel Smyth eilte geschäftig durch ihr gemütliches, vollgestopftes Haus. Sie musste noch tausend Dinge tun, bevor ihre Tochter Sophie von der Universität nach Hause kam. Die Betten waren schon frisch bezogen. Die Bohnen köchelten vor sich hin, der Teig für das Brot ging, und der Kühlschrank barst fast vor lauter leckeren Sachen. Hazel ließ sich auf das alte unbequeme Rosshaarsofa im Wohnzimmer fallen, sie spürte jeden Tag ihrer zweiundvierzig Jahre und noch ein paar mehr. Aus dem Sofa schienen Tausende winziger Nadeln zu ragen, die sich in einen bohrten, wenn man darauf Platz nahm, als wehrte es sich gegen das zusätzliche Gewicht. Und doch hing Hazel daran, vielleicht weil es sonst niemand tat. Sie wusste, dass es zu gleichen Teilen aus Rosshaar und Erinnerungen, die oft genauso wehtaten, bestand.
»Du hast es also wirklich noch, Haze?«, hatte Madeleine vor einigen Jahren lachend ausgerufen, als sie das erste Mal in das Zimmer gekommen war. Sie war sofort zu dem alten Sofa gegangen und hatte sich über die Rückenlehne gehängt, so als hätte sie vergessen, wie Menschen sitzen, hatte der verblüfften Hazel ihren schmalen Hintern entgegengestreckt.
»Wahnsinn«, tönte Mads Stimme gedämpft aus dem Spalt zwischen Sofa und Wand hervor. »Erinnerst du dich noch, wie wir von hier hinten deine Eltern belauscht haben?«
Das hatte Hazel ganz vergessen. Eine weitere Erinnerung, die zu dem dick gepolsterten Sofa gehörte. Plötzlich erklang lautes Lachen, und Madeleine warf sich herum wie das Schulmädchen, das sie einmal gewesen war, blickte Hazel an und streckte ihr die Hand entgegen. Hazel beugte sich vor und sah etwas zwischen den schmalen Fingern. Etwas sauberes Weißes. Es sah wie ein kleiner, verblichener Knochen aus. Hazel holte tief Luft, ein wenig besorgt, was das Sofa wohl ausgespuckt hatte.
»Das ist für dich.« Madeleine legte das kleine weiße Ding vorsichtig in Hazels ausgestreckte Hand. Madeleine strahlte. Man konnte es nicht anders nennen. Sie hatte einen Schal um ihren kahlen Kopf gewickelt und ihre Augenbrauen unbeholfen nachgezeichnet, sodass sie stets ein bisschen erstaunt aussah. Die bläulichen Ringe unter ihren Augen verrieten eine Müdigkeit, die nichts mehr mit schlaflosen Nächten zu tun hatte. Trotz alledem hatte Madeleine gestrahlt. Und ihre Freude durchdrang den öden Raum bis in die letzte Ecke.
Sie hatten sich seit zwanzig Jahren nicht gesehen, und obwohl Hazel sich an jedes einzelne Ereignis aus der Zeit ihrer Jugendfreundschaft erinnerte, hatte sie merkwürdigerweise vergessen, wie lebendig sie sich in Madeleines Gegenwart immer gefühlt hatte. Sie sah auf ihre Hand. Das Ding war kein Knochen, sondern ein zusammengerollter Zettel.
»Der steckte immer noch im Sofa«, sagte Madeleine. »Stell dir das einmal vor. Nach all den Jahren. Wahrscheinlich hat er auf uns gewartet. Auf genau diesen Moment.«
Madeleine schien etwas Magisches an sich zu haben, erinnerte sich Hazel. Und wo es etwas Magisches gab, da geschahen auch Wunder.
»Wo hast du ihn gefunden?«
»Da hinten.« Mad deutete mit der Hand hinter das Sofa. »Ich hatte ihn in ein kleines Loch gesteckt, als du mal auf dem Klo warst.«
»Ein kleines Loch?«
»Ein kleines Loch, das ein kleiner Stift gemacht hat.« Madeleines Augen funkelten, während sie so tat, als würde sie mit einem Stift ein Loch in das Sofa bohren, und Hazel musste lachen. Sie konnte sie regelrecht vor sich sehen, wie sie in dem kostbaren Möbelstück ihrer Eltern herumbohrte. Madeleine war furchtlos. Hazel gehörte zu denen, die in der Schule Aufsicht gewesen waren, Madeleine zu denen, die sich immer verspätet ins Klassenzimmer schlichen, nachdem sie noch schnell im Gebüsch eine gequalmt hatten.
Hazel sah auf das kleine weiße Röhrchen in ihrer Hand, das vor Sonnenlicht und fremden Blicken geschützt nach Jahrzehnten von dem Sofa wieder ausgespuckt worden war.
Dann wickelte sie den Zettel auseinander. Und sie wusste, dass sie mit Grund Angst davor gehabt hatte. Denn sein Inhalt änderte schlagartig und für alle Zeiten ihr Leben. In runden, mit satter lila Tinte geschriebenen Buchstaben stand dort ein einziger, einfacher Satz.
Ich mag dich.
Hazel wagte es nicht, Madeleine in die Augen zu sehen. Aber als sie von dem winzigen Notizzettel aufblickte, stellte sie fest, dass ihr Wohnzimmer, das an diesem Morgen noch so düster gewirkt hatte, auf einmal einen warmen, freundlichen Eindruck machte und die ausgeblichenen Farben zu leuchten begonnen hatten. Als ihr Blick wieder zu Madeleine zurückkehrte, war das Wunder geschehen. Aus einem waren zwei geworden.
Madeleine fuhr nach Montréal, um die Behandlung abzuschließen, aber sobald wie möglich kam sie in das Cottage auf dem Land zurück, umgeben von sanften Hügeln, Wäldern und Wiesen voller Frühlingsblumen. Madeleine hatte ein Zuhause gefunden, genau wie Hazel.
Jetzt nahm Hazel ihre Stopfsachen von dem alten Sofa. Sie machte sich Sorgen. Sorgen darüber, was im Bistro vor sich ging.
Sie hatten das Runenorakel gemacht, das auf den altnordischen Symbolen der Weissagung beruhte. Nach den Runensteinen war Clara ein Auerochse, Myrna eine Fackel und Gabri ein Karfunkel, auch wenn Clara ihm erklärte, die Rune würde nicht Karfunkel, sondern Furunkel bedeuten.
»Stimmt! Ich habe eines am Hintern«, sagte Gabri beeindruckt. »Und deine Rune stimmt auch, du Kuh.«
Monsieur Béliveau griff in den kleinen Weidenkorb und zog einen Stein mit einem Symbol in Form eines Diamanten heraus.
»Hochzeit«, mutmaßte Monsieur Béliveau. Madeleine lächelte, sagte aber nichts.
»Nein«, sagte Jeanne, nahm den Stein und betrachtete ihn. »Das ist der Gott Ing.«
»Lassen Sie mich mal.« Gilles Sandon griff mit seiner großen, schwieligen Hand in das Körbchen und zog sie wieder heraus. Als er die Faust öffnete, erblickten sie einen Stein mit dem Buchstaben R. Er sah für Clara ein bisschen wie die Holzeier aus, die sie für die Kinder versteckt hatten. Die waren auch mit Symbolen bemalt. Aber Eier waren Symbole des Lebens, während Steine Symbole des Todes waren.
»Was bedeutet das?«, fragte Gilles.
»Das steht für Rad, das Rad des Lebens. Eine Reise«, sagte Jeanne und sah zu Gilles. »Oft von Mühsal und schwerer Arbeit begleitet.«
»Verraten Sie mir was Neues!«
Odile lachte, genau wie Clara. Gilles arbeitete schwer, und sein Körper zeugte von den Jahren als Holzfäller. Stark und kräftig, oft genug übersät mit blauen Flecken und kleineren Blessuren.
»Allerdings«, sagte Jeanne und legte ihre Hand auf den Stein, der noch immer auf Gilles’ schwieliger Handfläche lag, »liegt er verkehrt herum. Das R steht auf dem Kopf.«
Auf einmal waren alle ganz still. Gabri hatte in den Erläuterungen zu den Runensymbolen entdeckt, dass sein Stein tatsächlich »Karfunkel« und nicht »Furunkel« bedeutete, und er hatte mit Clara geschimpft und ihr angedroht, sie von der weiteren Versorgung mit Pasteten und Rotwein abzuschneiden. Jetzt wandten sie sich wieder den anderen zu, die Jeanne gespannt zuhörten.
»Und was bedeutet das?«, fragte Odile.
»Es bedeutet, dass der Weg nicht leicht ist. Es soll Sie ermahnen, vorsichtig zu sein.«
»Und was bedeutet seiner?« Gilles deutete auf Monsieur Béliveau.
»Gott Ing? Er verweist auf Fruchtbarkeit und Männlichkeit.« Jeanne lächelte den ruhigen, sanften Gemischtwarenhändler an. »Daneben gemahnt er eindringlich daran, dass wir alles Natürliche achten sollen.«
Gilles lachte, ein höhnisches, gemeines, kleines Lachen.
»Und jetzt Madeleine«, sagte Myrna, um die Spannung zu lösen.
»Gut.« Mad griff in das Körbchen und zog einen Stein heraus. »Bestimmt sagt meiner, dass ich selbstsüchtig und herzlos bin. P.« Lächelnd besah sie sich das Symbol. »P wie pinkeln? Erstaunlich, ich muss nämlich aufs Klo.«
»Das Symbol P steht für Freude«, sagte Jeanne. »Und noch etwas.«
Madeleine zögerte. Während Clara sie ansah, schien die unglaubliche Energie, die diese Frau umgab, schwächer zu werden, zu verschwinden. Es machte den Eindruck, als würde sie einen kurzen Moment lang in sich zusammenfallen.
»Es liegt auch verkehrt herum«, sagte Madeleine.
Hazel stopfte die löchrigen Socken, aber im Geist war sie mit etwas anderem beschäftigt. Sie blickte auf die Uhr. Halb elf. Noch früh, sagte sie sich.
Sie überlegte, was in dem Bistro drüben in Three Pines wohl vor sich ging. Madeleine hatte gefragt, ob sie mitkommen wolle, aber Hazel hatte abgelehnt.
»Sag bloß, du fürchtest dich«, hatte Madeleine sie aufgezogen.
»Natürlich nicht. Aber ich halte solche Sachen für Blödsinn, reine Zeitverschwendung.«
»Du hast also keine Angst vor Gespenstern? Du würdest in ein Haus neben einem Friedhof ziehen?«
Hazel dachte kurz nach. »Wahrscheinlich nicht, aber nur weil es Probleme mit dem Wiederverkauf gäbe.«
»Du und dein Sinn fürs Praktische.« Madeleine lachte.
»Glaubst du, dass diese Frau tatsächlich Kontakt zu den Toten aufnehmen kann?«
»Ich weiß es nicht«, gab Mad zu. »Darüber habe ich offen gestanden überhaupt nicht nachgedacht. Ich denke, es wird einfach ein lustiger Abend.«
»Viele Leute glauben an Gespenster und Geisterhäuser«, sagte Hazel. »Ich habe erst gestern von einem solchen Haus gelesen. Es steht in Philadelphia. Es wird von dem Geist eines Mönchs heimgesucht, und Besucher des Hauses berichten, dass sie menschliche Schatten auf der Treppe gesehen haben, und da war noch etwas, was war es noch mal? Es hat mir einen Schauer über den Rücken gejagt. Ach ja. Eine kalte Stelle, direkt neben einem großen Ohrensessel. Offenbar stirbt jeder, der darin sitzt, aber vorher sieht er erst noch das Gespenst einer alten Frau.«
»Hast du nicht gerade gesagt, du glaubst nicht an Gespenster?«
»Tu ich auch nicht, aber viele andere Leute tun es.«
»In vielen Kulturen spielen Geister und höhere Wesen eine Rolle«, erklärte Madeleine.
»Aber von denen sprechen wir ja nicht, oder? Ich glaube, es gibt da Unterschiede. Ein Gespenst führt nichts Gutes im Schilde. Es ist irgendwie rachsüchtig, wütend. Ich weiß nicht, ob man damit herumspielen sollte. Und das Haus, in dem sich das Bistro befindet, steht dort schon seit Hunderten von Jahren. Weiß der Himmel, wie viele Leute dort gestorben sind. Nein, ich bleibe lieber hier, schau ein bisschen fern und bringe der armen Madame Bellows nebenan etwas zum Abendessen. Und geh Gespenstern aus dem Weg.«
Jetzt saß Hazel im schwachen Lichtschein einer einzelnen Lampe im Wohnzimmer. Die Erinnerung an das Gespräch ließ sie frösteln, so als hätte sich ein Gespenst, das Kälte um sich verbreitete, neben ihr niedergelassen. Sie stand auf und knipste sämtliche Lichter an. Aber das Zimmer blieb düster. Ohne Madeleine schien es jeder Gemütlichkeit zu entbehren.
Wenn alle Lichter angeknipst waren, konnte sie nur leider nicht mehr zum Fenster hinaussehen. Dann sah sie nur noch ihr eigenes Spiegelbild. Zumindest hoffte sie, dass es ihr Spiegelbild war. Da saß eine Frau mittleren Alters in einem spießigen Tweedrock und einem olivfarbenen Twinset auf einem Sofa. Um ihren Hals lag eine schmale Perlenkette. Es hätte ihre Mutter sein können. Vielleicht war sie es ja auch.
Peter Morrow stand auf der Schwelle zu Claras Atelier und spähte ins Dunkle. Er hatte das Geschirr gespült, im Wohnzimmer vor dem Kamin gelesen und dann gelangweilt beschlossen, in sein Atelier zu gehen und eine Weile an seinem neuesten Bild zu arbeiten. Er hatte in der festen Absicht, direkt in sein Atelier auf der Rückseite des kleinen Hauses zu gehen, die Küche durchquert.
Wie kam es dann, dass er jetzt in der offenen Tür zu Claras Atelier stand?
Es war dunkel und absolut still dort drin. Er spürte sein Herz in der Brust schlagen. Seine Hände waren kalt, und er merkte, dass er die Luft angehalten hatte.
Es war so einfach, völlig normal.
Er streckte die Hand aus und knipste die Deckenlampen an. Dann ging er hinein.
Sie saßen auf Holzstühlen im Kreis. Jeanne zählte und machte einen beunruhigten Eindruck.
»Acht ist keine gute Zahl. Das gefällt mir nicht.«
»Was meinen Sie mit ›keine gute Zahl‹?« Madeleine spürte, wie ihr Herz schneller zu klopfen begann.
»Sie kommt gleich nach sieben«, sagte Jeanne, als würde das alles erklären. »Die umgedrehte Acht steht für Unendlichkeit.« Sie zeichnete das Symbol mit dem Finger in der Luft nach. »Die Energie ist in der Schleife gefangen. Sie findet keinen Ausgang. Sie wird immer stärker und immer wütender und frustrierter dabei.« Sie seufzte. »Ich habe kein gutes Gefühl.«
Die Lampen waren alle ausgeschaltet, und das einzige Licht kam von dem knisternden Kaminfeuer, das ihre Gesichter flackernd beleuchtete. Einige saßen im Dunkeln, den Rücken zum Feuer; die anderen waren nur eine Reihe körperloser, verängstigter Gesichter.
»Ich möchte, dass Sie alle Ihren Geist frei machen.«
Jeannes Stimme klang tief und voll. Sie saß mit dem Rücken zum Feuer, sodass ihr Gesicht im Schatten lag. Clara hatte den Eindruck, dass sie sich bewusst diesen Platz ausgesucht hatte, war sich aber nicht ganz sicher.
»Sie müssen tief atmen und Ihre Sorgen und Ängste loslassen. Geister können die Energie spüren. Negative Energie wird nur böse Geister anlocken. Wir wollen das Bistro mit positiver Energie und Freundlichkeit füllen, um die guten Geister anzulocken.«
»Scheiße«, flüsterte Gabri. »Das war keine gute Idee.«
»Halt die Klappe«, zischte Myrna neben ihm. »Gute Gedanken, du Trottel, und zwar hopp.«
»Ich habe Angst«, flüsterte er.
»Dann unterdrück sie. Denk dich an deinen Lieblingsort, Gabri, deinen Lieblingsort«, sagte Myrna heiser.
»Das ist mein Lieblingsort«, erwiderte Gabri. »Bitte, nimm sie zuerst, bitte, sie ist saftig und dick. Bitte, nimm nicht mich.«
»Du Furunkel«, zischte Myrna.
»Still, bitte«, sagte Jeanne mit mehr Autorität, als Clara ihr zugetraut hätte. »Wenn unvermittelt ein lautes Geräusch zu hören sein sollte, möchte ich, dass Sie sich alle an den Händen nehmen, haben Sie das verstanden.«
»Warum?«, flüsterte Gabri auf seiner anderen Seite Odile zu. »Erwartet sie was Schlimmes?«
»Psst«, sagte Jeanne leise, und sie stellten das Flüstern ein. Sie stellten das Atmen ein. »Sie kommen.«
Sie stellten ihren Herzschlag ein.
Peter trat in Claras Atelier. Er war schon unzählige Male hier drin gewesen und wusste, dass sie die Tür aus einem bestimmten Grund offen ließ. Weil sie nichts zu verbergen hatte. Und doch fühlte er sich irgendwie schuldig.
Er sah sich rasch um und ging zu der großen Staffelei, die mitten im Raum stand. Das Atelier roch nach Ölfarben, Lösungsmitteln und Holz, darunter lag eine Note von starkem Kaffee. Viele Jahre des Schaffens und viele Kannen Kaffee hatten den Raum auf angenehme Weise imprägniert. Warum fühlte sich Peter dann so bedroht?
Er blieb vor der Staffelei stehen. Clara hatte ein Tuch über die Leinwand gehängt. Er stand da und überlegte, sagte sich, dass er gehen sollte, flehte sich selbst an, das, was er vorhatte, nicht zu tun.
Als er sah, wie sich seine rechte Hand ausstreckte, konnte er kaum glauben, dass er das tat. Wie ein Mensch, der seinen Körper verlassen hatte, wusste er, dass er keine Kontrolle mehr über das Kommende hatte. Es schien vorherbestimmt zu sein.
Seine Hand griff nach dem fleckigen alten Tuch und zog.
Es war still im Raum. Clara hätte am liebsten Myrnas Hand ergriffen, aber sie traute sich nicht, sich zu bewegen. Für den Fall, dass irgendetwas kam und seine Aufmerksamkeit auf sie richten würde.
Dann hörte sie es. Sie alle hörten es.
Schritte.
Das Drehen eines Türknaufs. Ein Wimmern wie von einem verängstigten Hundewelpen.
Unvermittelt ertönten mehrere ohrenbetäubende Schläge. Ein Mann brüllte, Clara spürte, wie von beiden Seiten Hände nach ihr tasteten. Sie nahm sie und umklammerte sie, als hinge ihr Leben davon ab, während sie ständig wiederholte: »Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen.«
»Lasst mich rein«, heulte eine Stimme von draußen.
»O Gott, es ist ein böser Geist«, sagte Myrna. »Das ist deine Schuld«, sagte sie zu Gabri, dessen Augen vor Schreck weit aufgerissen waren.
»Pest«, heulte die körperlose Stimme. »Ihr seid die Pest.«
Eine Fensterscheibe klirrte, und ein furchterregendes Gesicht erschien. Alle im Kreis wichen keuchend zurück.
»Mach auf, du Blödmann, ich weiß, dass du da drin bist«, schrie die Stimme. Es war gewiss nicht das, was Clara als Letztes auf Erden zu hören erwartet hätte. Sie hatte immer gemeint, es wäre: »Was hast du dir dabei nur gedacht?«
Gabri erhob sich zitternd von seinem Stuhl.
»Herr im Himmel«, rief er und schlug ein Kreuz. »Es ist ein Vortoter.«
Hinter dem Fenster kniff Ruth Zardo die Augen zusammen und schlug ein halbes Kreuz.
Peter starrte das Bild auf der Staffelei an. Seine Kiefer verkrampften sich, und seine Augen wurden hart. Es war viel schlimmer, als er erwartet hatte, viel schlimmer als befürchtet, und Peter war von Haus aus ein furchtsamer Mensch. Vor ihm stand Claras neuestes Werk, dasjenige, das sie bald Denis Fortin zeigen würde, dem einflussreichen Galeristen aus Montréal. Bislang hatte Clara praktisch unbehelligt von irgendeiner Art von Publikum ihre unverständlichen Werke geschaffen. Zumindest fand Peter sie unverständlich.
Dann hatte eines Tages wie aus dem Nichts aufgetaucht Denis Fortin an ihre Tür geklopft. Peter war natürlich davon ausgegangen, dass der renommierte Galerist mit Kontakten in der gesamten Kunstwelt seinetwegen gekommen war. Schließlich war er der weithin bekannte Künstler. Seine akribisch genau gemalten Bilder verkauften sich für Tausende von Dollars und hingen in den besten Häusern Kanadas. Peter hatte Fortin deswegen mit der größten Selbstverständlichkeit in sein Atelier geführt, wo ihm höflich erklärt wurde, dass seine Bilder ja ganz schön wären, aber er, der Galerist, eigentlich wegen Clara Morrow gekommen sei.
Wenn Fortin gesagt hätte, eigentlich sei er ein Marsmännchen, wäre Peter auch nicht erstaunter gewesen. Er wollte Claras Bilder sehen? Warum das denn? Dann fing er an zu begreifen und starrte Fortin fassungslos an.
»Warum?«, hatte er gestammelt. Dann war die Reihe an Fortin zu starren.
»Clara Morrow wohnt doch hier? Die Künstlerin? Ein Freund zeigte mir ihre Mappe. Ist diese Mappe nicht von ihr?«
Fortin hatte eine Mappe aus seiner Aktentasche genommen und tatsächlich, da war Claras weinender Baum. Der Wörter weinte. Welcher Baum weint Wörter?, hatte sich Peter gefragt, als Clara ihm das Bild das erste Mal gezeigt hatte. Und jetzt sagte Denis Fortin, der bedeutendste Galerist in Québec, es sei ein beeindruckendes Werk.
»Das ist meins«, sagte Clara und war zwischen die beiden Männer getreten.
Verwundert, so als wäre das alles ein Traum, hatte sie Fortin in ihrem Atelier herumgeführt. Und sie hatte ihm ihre neueste Arbeit beschrieben, die sich unter der leinenen Tarnkappe befand. Fortin hatte auf das Tuch gestarrt, aber er hatte nicht danach gegriffen, hatte nicht einmal gefragt, ob sie es vielleicht entfernen würde.
»Wann wird es fertig sein?«
»In ein paar Tagen«, hatte Clara gesagt, ohne recht zu wissen, woher sie den Mut dazu nahm.
»Wie wäre es mit der ersten Woche im Mai?« Er hatte gelächelt und mit großer Herzlichkeit ihre Hand geschüttelt. »Ich bringe meine Kuratoren mit, dann können wir alle gemeinsam entscheiden.«
Entscheiden?
Der bedeutende Denis Fortin würde in gut einer Woche wiederkommen, um Claras neueste Arbeit zu sehen. Und wenn sie ihm gefiel, dann war ihr Weg zum Erfolg vorgezeichnet.
Jetzt stand Peter da und starrte das Werk an.
Plötzlich spürte er, wie etwas nach ihm griff. Von hinten. Es drang in ihn ein und verbiss sich dort. Peter keuchte vor Schmerz, ein schneidender, scharfer Schmerz. Tränen stiegen ihm die Augen, als er von dem Gespenst überwältigt wurde, das ihn schon sein ganzes Leben lang verfolgte. Vor dem er sich als Kind versteckt hatte, vor dem er weggelaufen, das er vergraben und verleugnet hatte. Es war ihm hinterhergejagt, und schließlich hatte es ihn gefunden. Hier, in dem Atelier seiner geliebten Frau. Hier, vor ihrem Werk, hatte ihn das schreckliche Monster gefunden.
Und verschlang ihn.
5
Was wollte Ruth denn?, fragte Olivier, als er die Gläser mit Single Malt Scotch vor Myrna und Gabri stellte. Odile und Gilles waren nach Hause gegangen, aber alle anderen waren noch im Bistro. Clara winkte Peter zu, der aus seiner Jacke schlüpfte und sie an einen Haken neben der Tür hängte. Sie hatte ihn gleich nach dem Ende der Séance angerufen und ihn zur Manöverkritik eingeladen.
»Na ja, zuerst dachten wir, sie würde ›Pest‹ rufen, ›ihr seid die Pest‹«, sagte Myrna, »aber dann wurde uns klar, dass sie ›Nest‹ und ›ich hab ein Nest‹ rief.«
»Nest? Wirklich?«, fragte Olivier, der sich auf der Lehne von Gabris Sessel niedergelassen hatte und an einem Cognac nippte. »Nest? Glaubt ihr, dass sie das eigentlich immer meint?«
»Und wir haben uns immer verhört?«, fragte Myrna. »Du stinkst wie ein Nest? Hat sie das neulich zu mir gesagt?«
»Dem wünsche ich ein Nest an den Hals?«, fragte Clara. »Gut möglich. Sie ist ja ein schräger Vogel.«
Monsieur Béliveau lachte und sah zu Madeleine, die blass und still neben ihm saß.
Der schöne Frühlingstag hatte in einem kalten und feuchten Abend geendet. Jetzt ging es auf Mitternacht zu, und sie waren die Letzten im Bistro.
»Was wollte sie denn?«, fragte Peter.
»Hilfe wegen ein paar Enteneiern. Erinnerst du dich an das Nest, das wir heute Nachmittag am Teich gefunden haben?«, fragte Clara an Mad gerichtet. »Geht es dir gut?«
»Ja, mir geht’s gut.« Madeleine lächelte. »Ich bin nur leicht nervös.«
»Das tut mir leid«, sagte Jeanne. Sie saß auf einem Holzstuhl, ein bisschen abseits von den anderen, und hatte sich in eine farblose Erscheinung zurückverwandelt; das starke, ruhige Medium schien sich in Luft aufgelöst zu haben, kaum war das Licht angegangen.
»Nein, nein, das hat nichts mit der Séance zu tun«, versicherte ihr Madeleine. »Wir haben nach dem Abendessen Kaffee getrunken, und es war wahrscheinlich kein koffeinfreier. Davon werde ich immer nervös.«
»Aber das ist doch nicht möglich«, sagte Monsieur Béliveau. »Ich bin sicher, er war koffeinfrei.« Allerdings war er auch ein wenig nervös.
»Was ist denn nun mit dem Nest?«, fragte Olivier und strich über die Bügelfalte seiner makellosen Cordhose.
»Offenbar ist Ruth zum Teich gegangen, nachdem wir weg waren, und hat die Eier angefasst«, erklärte Clara.
»O nein«, sagte Mad.
»Dann kamen die Vögel zurück und wollten sich nicht mehr auf das Nest setzen«, sagte Clara. »Genau wie Sie vorausgesagt haben. Deshalb hat Ruth die Eier mit nach Hause genommen.«
»Um sie zu essen?«, fragte Myrna.
»Um sie auszubrüten«, sagte Gabri, der mit Clara zusammen Ruth zu ihrem Häuschen begleitet und ihr seine Hilfe angeboten hatte.
»Sie hat sich aber doch hoffentlich nicht auf sie draufgesetzt?«, fragte Myrna, die nicht genau wusste, ob sie die Vorstellung amüsant oder abstoßend finden sollte.
»Nein, es war sogar richtig rührend. Als wir eintrafen, lagen die Eier auf einer weichen Flanelldecke, und sie hatte sie samt Decke auf kleinster Flamme in den Ofen gesteckt.«
»Gute Idee«, sagte Peter. Wie die anderen hätte er eigentlich auch gedacht, dass Ruth sich die Eier einverleiben und nicht zu retten versuchen würde.
»Ich glaube nicht, dass sie diesen Ofen in den letzten Jahren auch nur einmal angestellt hat. Sie sagt immer, dass er zu viel Gas verbraucht«, sagte Myrna.
»Jetzt hat sie ihn jedenfalls angestellt«, sagte Clara. »Um die Eier auszubrüten. Die armen Eltern.« Sie nahm ihren Scotch und sah auf den dunklen Dorfanger, stellte sich die Enteneltern vor, wie sie am Teich hockten, dort, wo ihre kleine Familie gewesen war und die Küken in ihren Schalen gesessen und darauf vertraut hatten, dass Mutter und Vater sie warm hielten und beschützten. Entenpaare blieben ein Leben lang zusammen, wie Clara wusste. Deshalb war die Entenjagd ja auch so grausam. Im Herbst sah man immer wieder die eine oder andere einsame, quakende Ente, die nach ihrem Gefährten rief, wartete. Und den Rest ihres Lebens warten würde.
Warteten die Enteneltern auch? Warteten sie darauf, dass ihre Kleinen zurückkehrten? Glaubten Enten an Wunder?
»Sie muss euch allen wirklich eine Heidenangst eingejagt haben«, Olivier lachte, als er sich Ruth am Fenster vorstellte.
»Glücklicherweise hat unsere gute Clara sofort auf die spirituelle Krise reagiert und die Gefahr mit einem uralten Gebet gebannt«, erklärte Gabri.
»Will noch jemand was zu trinken?«, fragte Clara.
»Komm, Herr Jesus«, fing Gabri an, und die anderen fielen ein, »sei unser Gast und segne, was Du uns bescheret hast.«
Peter prustete los und spürte, wie ihm der Scotch übers Kinn lief.
»Amen.« Peter blickte ihr in die blitzenden blauen Augen.
»Amen«, riefen alle im Chor, auch Clara, die selbst lachen musste.
»Das hast du gesagt?«, fragte Peter.
»Na ja, ich dachte, dass sich dann mein Abendessen vielleicht wieder vor mir materialisieren würde.«
Mittlerweile lachten alle, selbst der gesetzte, brave Monsieur Béliveau grölte und musste sich die Tränen aus den Augen wischen.
»Ruths Erscheinen hat der Séance auf jeden Fall ein Ende bereitet«, sagte Clara, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte.
»Ich glaube, wir wären sowieso nicht besonders erfolgreich gewesen«, sagte Jeanne.
»Inwiefern?«, fragte Peter, neugierig auf ihre Ausflüchte.
»Ich fürchte, dieser Ort ist zu heiter«, sagte Jeanne an Olivier gerichtet. »Den Eindruck hatte ich von Anfang an.«
»Also wirklich!«, sagte Olivier. »Das können wir unmöglich auf uns sitzen lassen.«
»Warum haben Sie die Séance dann überhaupt abgehalten?« Peter gab nicht auf, er war sicher, sie ertappt zu haben.
»Na ja, es war ja eigentlich nicht meine Idee. Ich hatte vor, hier einen ruhigen Abend zu verbringen, die Linguine Primavera zu probieren und sämtliche alten Hefte von Country Life zu lesen. Ganz ohne böse Geister um mich.«
Jeanne sah Peter in die Augen, ihr Lächeln verschwand.
»Außer einem«, sagte Monsieur Béliveau. Peter riss seinen Blick von Jeanne los und sah zu Béliveau, halb erwartete er, dass dieser mit krummem Zeigefinger auf ihn deuten würde. Aber stattdessen wandte Monsieur Béliveau ihm sein habichtähnliches Profil zu und starrte zum Fenster hinaus.
»Was meinen Sie damit?«, fragte Jeanne, die seinem Blick gefolgt war, aber durch die Spitzengardinen und die alten Glasscheiben nur die anheimelnden Lichter aus den Häusern im Dorf sehen konnte.
»Da oben.« Monsieur Béliveau deutete mit dem Kinn in die Richtung. »Hinter dem Dorf. Sie können es in der Dunkelheit nicht erkennen, wenn Sie nicht wissen, wonach Sie Ausschau halten müssen.«
Clara sah nicht hinaus. Sie wusste, wovon er sprach, und hoffte im Stillen, er würde nicht weiterreden.
»Aber es ist da«, fuhr er fort, »wenn Sie nach oben sehen, zu dem Hügel über dem Dorf, dann können Sie dort eine Stelle erkennen, die schwärzer als der Rest ist.«
»Was ist da?«, fragte Jeanne.
»Das Böse«, sagte er, und es wurde still im Raum. Selbst das Feuer schien aufzuhören zu knistern.
Jeanne trat zum Fenster und tat, was er gesagt hatte. Sie ließ ihren Blick über das freundliche Dorf wandern. Es dauerte eine Weile, aber dann entdeckte sie über den Lichtern von Three Pines die Stelle, die schwärzer als die Nacht war.
»Das alte Hadley-Haus«, flüsterte Madeleine.
Jeanne wandte sich wieder dem Kreis zu, der gar keinen gemütlichen Eindruck mehr machte, alle saßen auf einmal angespannt und wachsam da. Myrna nahm ihr Glas Scotch und nippte daran.
»Was meinen Sie mit dem Bösen?«, fragte Jeanne Monsieur Béliveau. »Das ist eine schwere Anschuldigung, egal ob es einen Menschen oder einen Ort betrifft.«
»Dort oben geschehen schlimme Dinge«, sagte er schlicht und blickte prüfend in die Runde, ob ihm jemand widersprach.
»Er hat recht«, sagte Gabri, nahm Oliviers Hand und wandte sich an Clara und Peter. »Soll ich es erzählen?«
Clara sah zu Peter, der mit den Achseln zuckte. Das alte Hadley-Haus war mittlerweile verwaist. Seit Monaten stand es leer. Aber Peter wusste, dass es nicht völlig verwaist war. Zum einen hatte er einen Teil von sich selbst dort gelassen. Glücklicherweise keine Hand und auch nicht seine Nase oder einen Fuß. Nichts Greifbares, dafür etwas, das nach einem anderen Maß Substanz und Gewicht hatte. Er hatte dort seine Hoffnung gelassen und sein Vertrauen. Und auch seinen Glauben. Das bisschen, das er gehabt hatte. Dort oben.
Peter Morrow wusste, dass das alte Hadley-Haus verhext war. Es stahl Dinge. Auch Menschenleben. Und Freunde. Seelen und Glauben. Es hatte ihm seinen besten Freund gestohlen, Ben Hadley. Und das Einzige, was diese Monstrosität auf dem Hügel zurückgab, war Kummer.