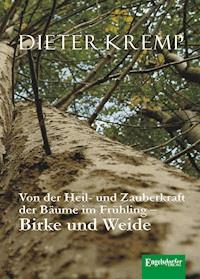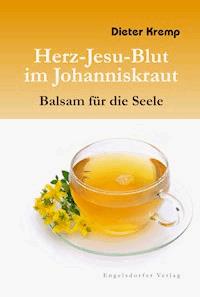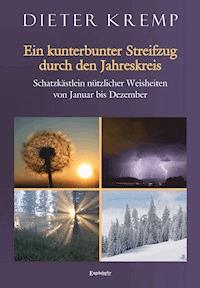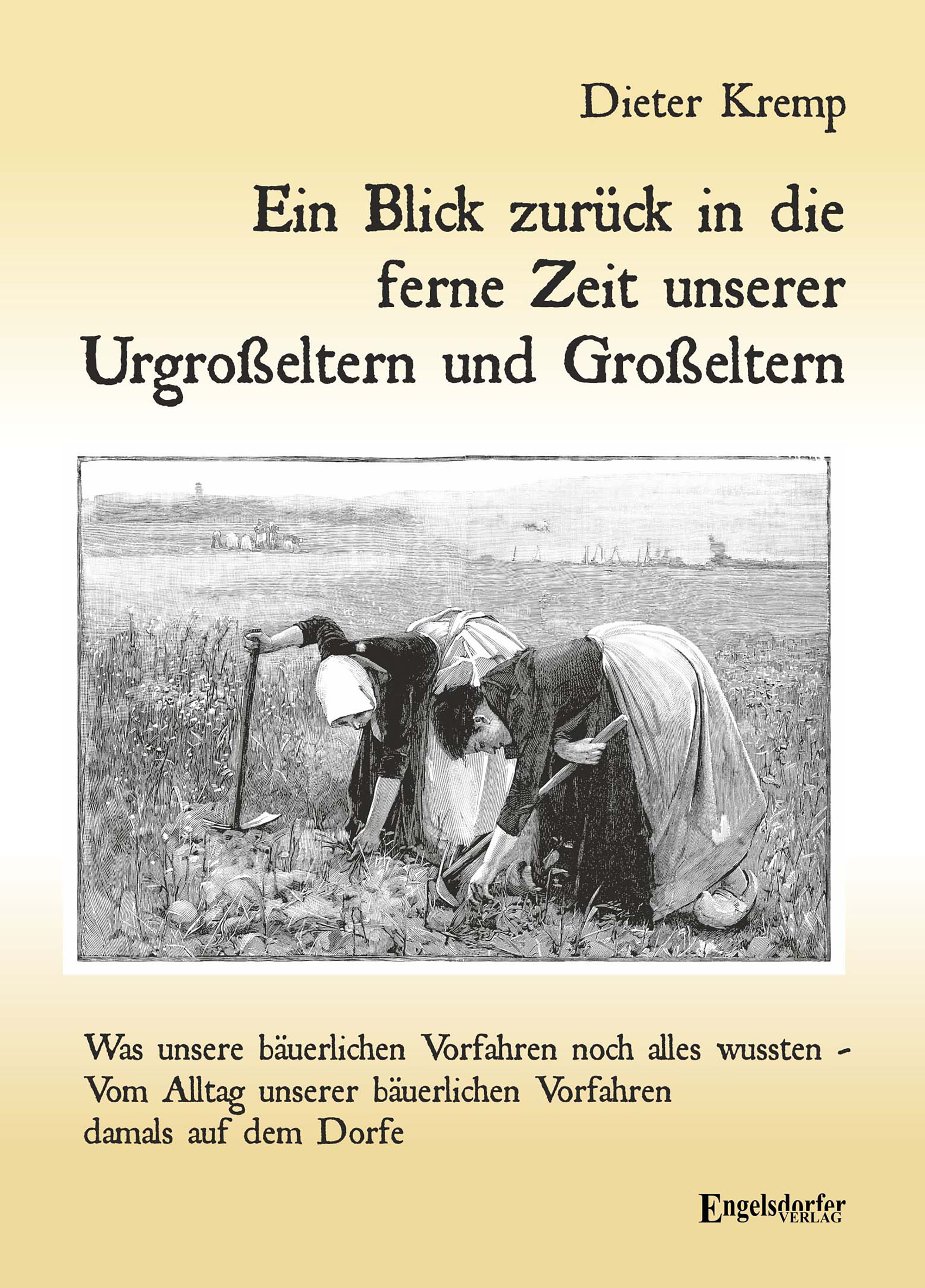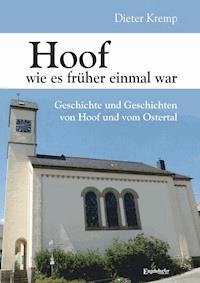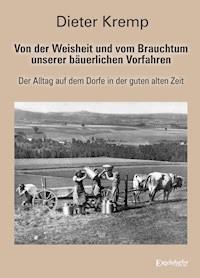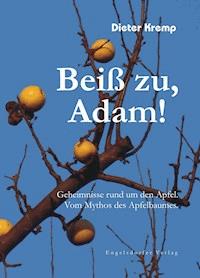
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor unternimmt eine Reise in den Garten Eden, einen Ausflug zu Adam und Eva ins Paradies, wo die Urgeschichte des Apfels beginnt. Der Autor lüftet die Geheimnisse des Liebesapfels und den magischen Zauber des Apfelbaums, des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen, der in allen Religionen und Kulturkreisen eine mystische Rolle spielt. Der Apfelbaum als weibliches Fruchtbarkeitssymbol, der zahlreichen Göttinnen geweiht ist, wird in diesem Buch in vielfältiger Weise vorgestellt, auch der Mythos Apfel im Volksglauben, in Visionen und Prophezeiungen. Das Buch ist gewürzt mit einer Vielzahl von Apfelrezepten für die Küche, von den paradiesischen Früchten in der Weihnachtszeit und von Großmutters Bratäpfeln als Klassiker im Advent. Die Herstellung von Apfelwein und Apfelbrand, von Apfelessig, Apfelringen, Kompott und Marmelade runden das Apfelbuch ab. Das Buch ist bunt geziert mit Apfelgedichten, Apfelreimen und Apfelmärchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kremp
Beiß zu, Adam!
Geheimnisse rund um den Apfel
Vom Mythos des Apfelbaumes
Engelsdorfer Verlag 2011
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
eISBN: 978-3-86268-389-5
Copyright (2011) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Das Buch widme ich meiner Frau Waltrud, meiner Tochter Julia, meiner Schwiegertochter Jutta, meinem Sohn Stefan, meinem Schwiegersohn Dieter, meinen Enkeln Helena, Joshua und Samuel und den Obst- und Gartenbauvereinen im Ostertal.
„Und wenn morgen die Welt untergehen würde, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum.“
(Martin Luther)
„Adam war ein Mensch – das erklärt alles. Er wollte den Apfel nicht des Apfels wegen, sondern nur, weil er verboten war.“
(Mark Twain)
„Er labte mich mit Rosinenkuchen, erquickte mich mit Äpfeln; denn ich bin krank vor Liebe.“
(Bibel, Hoheslied)
„Ein Apfel am Tag und der Doktor bleibt, wo er mag.“
(Redewendung)
Inhalt
Beiß zu, Adam! Geheimnisse des Apfels
Adam und Eva
Der Biss in den Apfel
Von der Zauberkraft des Apfelbaumes
Die Äpfel der Hesperiden
Der Apfel – die Frucht der Liebe
Von der magischen Behandlung des Apfelbaumes
Der Baum des Lebens und der Liebe
Der biblische Apfel
Der Apfel in der Geschichte
Die Frucht des Paradieses
Apfelrezepte
Liebesapfel im Volksbrauchtum
Die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen
Der Apfel in der Mythologie
Der „Frauenapfel“
Vom heilenden Zauber des Apfelbaums und des Apfels
Vom Wildapfel zum Kulturapfel
Der Adamsapfel
Der Apfelbaum: Steckbrief, Herkunft und Nutzung
Vom schlafenden Apfel
Der Apfel in der Volkskunde
Der Apfelbaum und seine Göttinnen
Holzäpfel, bitter wie Galle und sauer wie Essig
Rezepte mit Holzäpfeln
Der Apfel, die Frucht jedes Glaubens
Zu der Apfelverkäuferin
Der Apfel stand Pate
Der Apfel in Visionen und Prophezeiungen
Apfelbräuche in der Weihnachtszeit
Till Eulenspiegel und der gebratene Apfel
Der Apfel, ein Name mit keltischem Hintergrund
Vom Mythos des Apfels
Die dreifaltige Göttin Ostara und der Apfel
Äpfel, die Paradiesfrüchte in der Weihnachtsküche
Rund um den Weihnachtsapfel
Weihnachtliche Apfelrezepte
Apfelgedichte zur Weihnachtszeit
Knecht Ruprecht
Am Weihnachtsbaum durften Äpfel nicht fehlen
Großmutters Bratäpfel – ein Klassiker im Advent
Bratapfelrezepte
Der Bratapfel
Was Großvater noch wusste
Wie man Äpfel richtig im Haushalt lagert
Lob dem Apfel
Von der heilsamen Wirkung des Apfels
Gesunde Phenole im Apfel
Apfeldiät und Apfelkuren heilen Krankheiten
Apfelchips werden immer beliebter
Großmutters Apfelringe sind wieder im Kommen
Rezepte mit Apfelringen
Apfeltee beruhigt und stärkt das Immunsystem
Rezepte von Apfeltees
Einkehr
Rezepte von Apfelkompott
Apfellikör bringt ein Stückchen paradiesisches Wohlbehagen
Rezepte von Apfellikören
Apfelbowle zur Erfrischung
Rezepte Apfelmarmeladen
Apfelessig – Gesundheit aus der Natur
Apfelbrand – Schnaps aus Äpfeln
Rezepte mit Apfelschnaps (Apfelbrand)
Calvados – Apfelbrand aus der Normandie
Der Apfelwein heißt auch Viez
Rezepte mit Apfelwein
Rezepte mit Apfelsaft
Herstellung von Apfelmost
Kuriose Apfelnamen
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Die Deutschen lieben den Apfel
Zitate und sprichwörtliche Redensarten rund um den Apfel
Wenn der „Abbelkrotz“ im Halse „krebbt“
Der Kulturapfel – eine 12 000-jährige Geschichte
Keine Chance für die kalte Sophie
Den Winter überlisten mit blühenden Apfelbaumzweigen
Heute ist der Ohrwurm im Obstgarten hoch willkommen
Die Quitte – ein Apfel für Aphrodite
Quitten – goldene Früchte als Duftspender
Quittenrezepte
Zieräpfel – dekorativ und nützlich
Tomaten – die wahren Paradies- und Liebesäpfel
Tomatenrezepte
Der Birnbaum, Mann und Frau zugleich
Der Schuh auf dem Birnbaum
Birne mit Geist
Ein Baumhaus für Kinder im Apfelbaum
Kulturgeschichte der Streuobstwiesen
Das Märchen vom Apfelbaum
Im Apfel liegt Dein Glück
Die Entstehung des edlen Apfels
Apfelsymbolik
Baum des Lebens und der Liebe
Der Apfel, die Frucht der Unsterblichkeit bei den Kelten
Vom Baum in die Küche
Salate, Vorspeisen und Suppen mit Äpfeln
Apfelhauptgerichte
Apfeldesserts
Apfelkuchen und Apfeltorten
Der Apfelbaum als „Messgerät“
In den Klostergärten wurde der Apfelanbau gepflegt
Altbewährte Apfelsorten
Ein Freund der Baumzucht
Der Riese, der Königssohn und der Apfel
Wir brauchen alte Obstsorten
Streuobstbau – keine Erfindung der Neuzeit
Zum Schutz unserer alten Obstsorten
Sommer-, Herbst- und Winteräpfel
Tafel-, Wirtschafts- und Mostäpfel
Die Geschichte der drei Äpfel – aus Tausendundeine Nacht
Das Märchen vom wunderbaren Apfel
Der verzauberte Apfelbaum
Der Tod auf dem Apfelbaum
Der Apfel des Paradieses
Quellen
Beiß zu, Adam! Geheimnisse des Apfels
Er umschließt ein essbares Geheimnis, dem unsere gemeinsame Urmutter Eva nicht widerstehen konnte. Farbig ist er, rund, glänzend, wohlschmeckend und überdies zur Vermehrung bereit – so wurde er Freude dem Schauenden, Nutzen dem Rechnenden, Rettung dem Hungernden und beziehungsreiches Symbol dem Fragenden: der Apfel.
Warum es wohl gerade ein Apfel war, in den Adam beißen musste? Nun, wer hätte denn eine haarige Kokosnuss vorgezogen oder eine Zitrone, der man die saure Natur schon ansieht, wenn daneben die rote Backe eines Apfels freundlich einlud? Das Geheimnis, das die erste Eva mit dem Apfel verbindet, ist gewiss nichts weiter als der Wunsch, den Herrn Gebieter satt zu machen und somit bei guter Laune zu halten, und das mit möglichst wenig Arbeit. Oder wollte Eva Adam mit dem Apfel verführen? Aber es muss doch ein Holzapfel gewesen sein, der sauer wie Essig und bitter wie Galle gewesen war. War Adam blind vor Liebe?
Eine Kokosnuss essbereit zu machen oder einen Blättersalat anzurichten, das hätte doch Mühe gekostet, sogar Kunstfertigkeit, und Eva war gewiss keine gute Hausfrau. Das konnte sie schließlich erst werden, nachdem das Haus gebaut war.
Das Zutrauen zum Apfel wollte Eva trotz gewisser Erfahrungen niemals aufgeben. Mit verzehrender Treue hing sie ihm weiterhin an. Unzählige ihrer Töchter haben seither den Apfel weitergegeben, ohne Arg und ohne allzu böse Folgen. Ganz ohne Folgen freilich nicht immer, denn ein wenig Heimlichkeit ist geblieben.
Seiner runden Form wegen ist der Apfel zum Symbol der Vollkommenheit geworden. Der Vollkommenheit muss das Glück verschwistert sein, und so wird der Apfel zum Symbol des Glücks, der Welt und auch der Herrschaft, die in göttlichem Willen ihre Wurzel hat. Der Reichsapfel war ihr Zeichen. Im alten Persien trug man Stäbe, auf denen ein goldener Apfel befestigt war.
Auch alte Sagen und Mythen zeugen von einer weiter Verbreitung dieser Schau. Als Adonis, der frühlingshafte Jüngling, zum ersten Mal in die Unterwelt kommt, wird er gefragt, was das Herrlichste sei, das er auf der Erde zurückgelassen habe, und ohne Zögern sagt er: „Sonne, Mond und Äpfel“, lauter runde Sachen also.
Zu größter Berühmtheit und einem Namen, der immer noch Klang hat, gelangten die Äpfel der Hesperiden, obschon es nichts weiter mit ihnen auf sich hat, als dass eben ein Herakles unglaubliche Abenteuer bestehen musste. Athene, der er sie opferte, brachte sie wieder in den Garten auf der Insel der Seligen im fernen Westen zurück. Diese Insel möchte Teneriffa gewesen sein, und das Dorf Orotawa trägt stolz drei goldene Äpfel im Wappen.
Herakles mag einen lichten Moment gehabt haben, als er darauf verfiel, gerade Athene die Äpfel zu opfern. Nur der Zeitpunkt war falsch, denn Athenes Interesse an dieser Frucht war zu dieser Zeit noch nicht erwacht. Aber der Augenblick sollte kommen, da sie durch einen Apfel merklich aus ihrer göttlichen Ruhe gebracht werden würde.
Herakles bekam den erstaunlichen Beinamen Apfelgott oder Melon, allerdings nicht durch diesen Apfelraub. In Griechenland gab es Hirten, die ihm regelmäßig ein Schaf opferten. Nun konnten sie einmal wegen des Hochwassers nicht rechtzeitig ein Tier herbeiholen und so verfielen sie, als intelligente Griechen, auf einen kleinen, frommen Schwindel. „Melon“ bedeutet sowohl Schaf als auch Apfel. Also ließen sie Schafe und Hochwasser sein, nahmen einen Apfel, steckten Holzstäbchen als Beiwerk hinein und das Melon-Opfer war bereit. Bei dieser praktischen Sitte blieben sie, und sie konnten schließlich ihr Gewissen damit beschwichtigen, dass es beim Opfer weniger auf die Materie als auf den Geist ankomme. Solche „Schafe“ kann man heute noch dort sehen.
Eine so vielsagende Frucht konnte freilich nicht nur Symbol für Glanz und Herrlichkeit sein. Ihr Ausdrucksvermögen, ihre inneren Wesensbeziehungen reichten ein großes Stück weiter. Ist des Apfels äußere Form Ausdruck für Vollendung und hohes Wesen, so birgt er doch im Innern etwas recht Irdisches: Kerne. Zweifellos ist es diese braune, zum Schoß der Erde verlangende Füllung, die den Apfel auch zum Symbol der Fruchtbarkeit werden ließ.
Als Persephone gerade Blumen pflückte – ein stets mädchengefährdendes Tun – kam Hades aus dem Gebüsch und entführte sie in die Unterwelt. Mutter Demeter hatte wohl anderes mit der Tochter im Sinn und gab ihrem Zorn so mächtigen Ausdruck, dass Hades den Raub beinahe hätte freilassen müssen. Doch was tat er? Er bot Persephone einen Granatapfel an. Ahnungslos biss sie hinein, und dieser Bissen band sie so stark an die Erde, dass sie fortan für den dritten Teil eines jeden Jahres zu ihr zurückkehren musste. Der Granatapfel blüht rot und hat besonders viele Kerne.
Innere Bindung durch einen Apfel ist i n den Mittelmeerländern ein altbeliebtes Motiv. Da gab es religiöse Feiern, deren Teilnehmerinnen bei Strafe nicht vom Apfel essen durften; sie sollten während dieser Zeit frei bleiben von seinem zum Irdischen drängenden Einfluss. Auch Moslems sehen diesen Zug. Allah nahm, nach ihrer Sage, am ersten Tag einen Apfel und teilte ihn. Adam und Eva erhielten jeder eine Hälfte und dazu den Auftrag, die fehlende Hälfte zu suchen. Die beiden hatten es noch leicht, doch die Aufgabe galt auch ihren Kindern und Kindeskindern, und so sucht seither die eine Hälfte der Menschheit die ihr entsprechende.
Nun, in der Götterwelt der Alten geht es für unsere Begriffe überwältigend sündig zu, und man scheint sich dort an den sonnigen Gestaden wenig Gedanken darüber gemacht zu haben, ob die Liebe zwischen den Geschlechtern unter anderem auch metaphysische Aspekte gehabt habe. Dass sie jedoch Folgen haben könne, überraschende, neckische, auch grauenvolle, gewiss, das wusste man und nahm es hin.
Da war die Sache mit Peleus, dem Vater des Achill, des Helden mit der weichen Ferse. Auf Beschluss der Götter sollte er in zweiter Ehe Thetis heiraten. Diese jedoch war der Sache abgeneigt. Sie sträubte sich und bot ihre ganze Fantasie auf, um sich dem ungewünschten Werber zu entziehen. Aber ob sie Gestalt des strömenden Wassers, die der bissigen Raubkatze oder der verzehrenden Flamme annahm. Peleus hielt fest, was ihm zugesprochen. Dann kam die Hochzeit des Jahres. Alle Unsterblichen waren eingeladen und überreichten glänzende Geschenke. Nur eine hatte man geflissentlich vergessen, Eris, und das war verständlich, war sie doch die Göttin der Zwietracht. Man wünschte sie nicht. Sie aber ließ sich nun mal nicht ausschließen, diese Hüterin des Unfriedens. Eris gedachte sich ihren Anteil Vergnügen an diesem Fest auf eigene Weise zu gewinnen, eines boshaften und mit spielerischer Mühelosigkeit zu erlangendes Vergnügens: Sie warf in den Festsaal einen goldenen Apfel, in den sie zuvor zwei abgefeimt biedere Worte geritzt hatte: „Der Schönsten“ stand da.
Wie vorauszusehen, ging die Saat sofort auf: Hohe Damen vergaßen die guten Umgangsformen, vergaßen, dass Bescheidenheit nicht nur deine Zierde der Schlechtweggekommenen ist, vergaßen den Rat der Weisen, kurz, sie zankten sich um den Apfel. Nachdem durch Zuruf die Lage soweit geklärt war, dass nur noch drei der Damen in engere Wahl kamen, wurde beschlossen, ein unschuldiger und daher hellblickender Hirtenknabe solle die Entscheidung treffen. Paris wurde für dieses Amt ausersehen, und vor ihn traten auf dem Berge Ida die göttlichen Damen Hera, Athene und Aphrodite.
Da dieser ersten und berühmtesten Wahl einer Schönheitskönigin, im Gegensatz zu späteren Bräuchen, keine Zeugen beiwohnten, sind verständlicherweise mancherlei Berichte im Umlauf. Sicherlich darf man jenem Bericht vertrauen, in dem gesagt wird, dass Paris von angeborener Gründlichkeit war und deshalb darauf bestand, die zu beurteilenden Schönheiten erst einmal ungeschminkt und unverhüllt zu besehn.
Zwei von ihnen hielten dies für ein unschickliches Ansinnen und zeigten sich empört. Die Dritte hingegen, Aphrodite, hielt das Benehmen der Anderen für Prüderie und erklärte, gerechtes Urteil setze Offenbarung voraus. Sie tat, was der junge Richter forderte. Hera und Athene mussten, Groll im Herzen, es der Schamlosen gleichtun, wollten sie nicht ihre Chancen aufs Spiel setzen; und das wäre doch noch härter gewesen. Der Apfel aus Paris’ in Aphrodites Hand wurde Ausgang einer Geschichtslawine, die das stolze Troja zermalmte.
Eine andere Frau, die Fürstin Libussa in Böhmen, sah im Apfel gleich der Eris ein Mittel, Zwietracht zu erzeugen. Nur tat sie es nicht aus Bosheit, sondern aus Klugheit. Und sie entzweite nicht Frauen, sondern Männer. Die Fürstin hatte drei Generale, die durch ihre Machtgelüste das Land in Gefahr brachten. So ließ sie die drei Generale rufen, legte einen schönen Apfel vor sie hin und sagte mit feinem Lächeln: „Wer der Verdienstvollste unter euch ist, der mag den Apfel nehmen.“ Sofort zogen sie blank und brachten sich gegenseitig um.
Zu anderem Zweck als die zanksäende Eris bediente sich die schöne Atlanta des Apfels. Ihr hatte ein Orakel große Unannehmlichkeiten in Aussicht gestellt für den Fall, dass sie eine Ehe einginge. Sie sollte dann ihre reizende Gestalt verlieren.
So etwas kommt zwar vor, muss aber doch nicht immer sein. Jedenfalls war es von dem Onkel recht hässlich, die Seele des Mädchens so zu vergiften. Atlanta beschloss, Jungfrau zu bleiben. Um die Bewerber abzuschrecken, gab sie bekannt, dass dem Tode verfalle, wer im Wettlauf mit ihr verlöre. Sie konnte das leichthin verkünden, war sie doch zu Fuß die Schnellste der Sterblichen. Ihr Vorgehen freilich war befremdlich, Der laufende Bewerber bekam eine kleine Vorgabe, sie rannte mit dem Speer in der Hand hinterdrein. Erreichte sie ihn, und sie erreichte eben jeden, dann vollstreckte sie das Urteil gleich selbst. Trotz der bedenklich hohen Wahrscheinlichkeit, von Frauenhand getroffen zu werden, fanden sich immer wieder kühne Jünglinge, denen ein Abenteuer den höchsten Einsatz wert war. Eines Tages kam Hippomenes und meldete sich mit siegesgewisser Lässigkeit zum Wettkampf. Da er sich zuvor bemüht hatte, mit Aphrodite in gutes Einvernehmen zu kommen, war seine Zuversicht nicht grundlos: Aphrodite hatte ihm drei goldene Äpfel gegeben und eine weibliche Gebrauchsanweisung dazu.
Der Wettlauf begann. Atlanta holte langsam auf. Doch als sie nahe kam, ließ Hippomenes einen Apfel ins Gras fallen. Atlanta, von Form und Glanz des Gegenstandes angezogen, geriet ein wenig ins Stocken und verlor kostbare Sekunden. Dasselbe gelang nochmals mit den beiden Reserveäpfeln, und dann war Hippomenes am Ziel. Aber er beging einen vernichtenden Fehler. Im Rausch seines Glücks vergaß er, Aphrodite die Äpfel zurückzugeben, und dann, von allen wohlwollenden Geistern verlassen, umarmte er noch dazu Atlanta im Tempel einer anderen Gottheit. Das war zuviel, man wird es zugeben, wenn auch nur eigentlich des Guten. Göttlicher Zorn musste über die beiden kommen, und sie wurden auf der Stelle in Löwen verwandelt. Da diese ein relativ trauliches Eheleben führen, war das doch noch gnädiger als eine Verwandlung etwa in Spinnen oder Siebenschläfer. Leider aber hat durch die Überschwänglichkeit des Jünglings das schwarzseherische Orakel Recht bekommen.
Wer arglos und herzhaft in einen Apfel beißt, und dann zu spät sieht, dass ein Wurm schon vor ihm drin war, der stößt wohl leicht eine Verwünschung aus. Warum nur der herrliche Apfel einen so widerlichen Gast beherbergt? In Rumänien erzählt man sich folgende Erklärung:
Es war als das goldene Zeitalter der Menschen zu Ende ging. Die Leute waren nicht mehr zufrieden damit, von einem gütigen Gott gespendet zu bekommen. Sie wollten selbst Kräfte lenken und Macht in Händen haben. Damals wuchs der Anfang des Teufels auf der Erde. Die Menschen sahen Vorteil und Vergnügen darin, vom Bösen allerlei Künste zu lernen. Da beschloss Gott einzugreifen. Er kam auf die Erde, versammelte die Menschen und sagte, er wolle ihre Künste sehen. In einer Scheune zwischen Apfelbäumen zeigten sie, was sie gelernt hatten. Schließlich forderte Gott sie auf, einen Apfel anzufertigen. Das überstieg nun die Teufelskünste der Prüflinge bei weitem und ihre Versuche blieben kläglich stecken. Da wurde Gott zornig, schleuderte einen Blitz unter die bösen Menschen und diese krochen als hässliche kleine Würmer in die Äpfel der umstehenden Bäume. Bilden hatten sie diese nicht können, nun mussten sie sie zerstören. Seither sind manche Äpfel wurmstichig.
Auch der Büchsenobstesser wird sich noch daran erinnern, dass der Apfel recht geeignet dazu ist, Runden und andere Zeichen in die Schale geritzt oder ins Fleisch geschnitten zu bekommen. Dies, in Verbindung mit seinen guten Flugeigenschaften, ließ ihn findigen Leuten für die Nachrichtenübermittlung geeignet erscheinen.
Akonitus, ein schnelldenkender Griechenjüngling, kannte die Methode. Doch hielt er es für einfältig, nur gerade eine verliebte Botschaft auf solche Weise abzusenden, und auch für zu wenig förderlich, wenn es um eine greifbare Eroberung ging. Er tat ein Weiteres und Stärkeres: Zu deinem Fest auf der Insel Delos verfing er sich im Blick eines blühenden Mädchens aus vornehmem Athener Hause. Bei ihrem Vater würde der keine Beachtung finden, das wusste er. Als er ihr wieder einmal folgte, ging sie zum Tempel der Diana, um dort zu opfern. Ein witzig-kühner Gedanke kam da Akonitus, und er kaufte rasch einen Apfel, ritzte etwas in die Schale und ließ ihn dann der Kydippe, so hieß das Mädchen, vor die Füße rollen, als sie bei der Göttin weilte. Kydippe konnte den Apfel nicht liegenlassen, Neugierde regte sich in ihr, sie nahm ihn auf und las hörbar, wie es eben üblich war: „Ich schwöre bei Diana, Akonitus wird mein Gemahl.“ Da war es geschehen. Diana hatte den Schwur gehört, und dem Vater der Kydippe blieb kein Ausweg, er musste die Tochter dem gewitzten Burschen überlassen.
Solche Kniffe verfingen freilich nicht überall, und meist wurden sie ja auch nicht benötigt. Wenn die Beherrschung des Wortes mangelhaft war, die Zunge im entscheidenden Moment versagte, da musste oft der Apfel einspringen. Manchmal gewann er die Bedeutung einer Redeformel. Schon das Zuwerfen – etwas burschikos, vielleicht auch nur verlegen- oder das Überreichen eines Apfels galt als Liebeserklärung und Werbung, und wurde deshalb ernt genommen. Der Apfel war der wichtigste Buchstabe des ganzen symbolischen Alphabets.
War die Zungenfertigkeit der Umworbenen nun vielleicht größer als die des Werbenden, so wird sie sich doch in einem solchen Fall einer dem Augenblick frommen Zurückhaltung befleißigt haben.
Die Germanen sahen den Apfel als Träger von Kräften für ein ewiges Leben in Jugend. Iduna gibt den Helden, die Walhalla betreten, Äpfel in goldenen Schalen. Und als es Loki gewinnt, Iduna zu rauben, da erleiden die göttlichen Helden einen Rückfall in die irdische Schwäche zu altern. Doch sie gewinnen Iduna zurück, und, einmal gelabt an ihren Äpfeln, haben sie auch gleich ihre Jugendkraft wieder gewonnen.
In Ungarn gab es bei Werbung und Hochzeit ausgesuchte schöne Äpfel zu sehen, die vielfach mit Geldstücken gespickt waren. Dass um solcherart gespickte Äpfel auf Hochzeiten Wettläufe veranstaltet wurden, nimmt nicht wunder.
Das Land, in dem alles Liebeswerben einzig auf die Ehe zielt, blieb bisher noch unentdeckt. So war auch die Sprache des Apfels nicht immer „ernst“, sondern vielleicht spielerisch und tändelnd.
Uralt sind mancherlei Bräuche, bei denen wir den Apfel in geheimnisvollen Diensten sehen, vom Symbol zum Zaubermittel schon fast hinüber wechselnd. Da gab es Leute, die, anders als der junge Akonitus, die Frucht mit kaum sichtbaren zauberischen Zeichen versahen. Es kam dann darauf an, zu erreichen, dass die richtige Person den Apfel verzehrte, wozu Geschick gehörte. Ein Italiener erzählt, dass einmal ein solcher Apfel, der für einen Mann bestimmt war, versehentlich in den Magen eines Schweins geriet. Das gute Tier sei daraufhin der Herstellerin des Zauberapfels nicht mehr von der Seite gewichen.
Verbreitet mag auch noch die Verwendung von Äpfeln für das Orakel zu sein. Ein Mädchen nimmt drei Äpfel mit ins Schlafgemach. In die Schale hat sie zuvor je einen Namen geritzt. Erwacht sie nachts, so isst sie im Dunkeln einen Apfel auf, und wessen Name darauf stand, der wird es sein.
In österreichischen Landen trugen die Mädchen vom heiligen Abend bis zum Mittag des Neujahrstages immer einen Apfel bei sich. Neujahr um zwölf Uhr mittags stellten sie sich vor die Haustür und aßen den Apfel, während die Kirchenglocke zum Gebet läutete. Der erste Bursche, der dann vorbeikam, war der Richtige. Kluge Leute helfen dem Orakel gerne ein wenig nach oder beugen vor, und das lässt sich bei einer solchen Gelegenheit doch ganz gut einrichten.
Orakelmächtig sind auch die Apfelkerne, und sie ähneln dabei im Gebrauch den Sternschnuppen. Bringt man einen spitzen Kern mit der gebotenen Feierlichkeit in die züngelnden Flammen und es gibt einen kleinen Knall, dann ist zwar der Kern geplatzt, aber der heimliche Wunsch wird in Erfüllung gehen.
Hat das Orakel recht behalten oder der werbende Liebesapfel zwei junge Leute ernstlich eines Sinnes gemacht, dann kann ein Fest gefeiert werden, für unzählige das Fest ihres Lebens. Auch da tritt der Apfel noch einmal in Dienst. In China hat ein kleiner Knabe die Aufgabe, in die Ecken des ehelichen Gemachs vier Äpfel zu legen. Sie sind hier Zeichen des ehelichen Friedens. Zieht die Braut in das Haus ein, so bekommt sie eine Apfelgabe. Einen Apfel muss sie anbeißen, verborgen unter ihrem Schleier. Die angebliche Friedenssymbolik möchte man friedlich anzweifeln und den ganzen Vorgang eher für einen Fruchtbarkeitsritus halten, was dem starken Wunsch der Chinesen nach Kindern entspricht.
Eben diese Bedeutung soll eine Sitte in Griechenland haben. Hochzeiter werden beim Verlassen der Kirche mit getrockneten Granatäpfeln beworfen. Platzen diese dabei, so dass die Kerne herausfallen, dann hat auch schon das Orakel gesprochen und verkündet: Viele Kinder werden kommen.
Von Äpfeln erzählen auch Grimms Märchen. In „Eisenhans“ wirft eine Königstochter – selbst im Märchen können sich nur Vermögende einen solchen Luxus leisten – drei goldene Äpfel unter die versammelten Ritter. Sie will einen bestimmten herausfinden. Es gelingt. Die Rittersleute spielen begeistert mit, und schließlich erweist sich der Geschickteste auch als der Gesuchte.
In „Schneewittchen“ macht sich die böse Stiefmutter dreimal auf den Weg zu den sieben Zwergen. Zweimal können die kleinen Helfer das Schneewittchen vor dem Ärgsten bewahren. Beim drittenmal jedoch fällt der Frau eine teuflische List ein. Sie benutzt die im Menschen von Kindheit an schlummernde Liebe zum Apfel, vergiftet ihn aber zuvor. „Schneewittchen lustert den schönen Apfel an … und konnte nicht widerstehen“, heißt es betrübt. Einmal mehr hatte der Apfel den Verführer spielen müssen. Glücklicherweise ist alles dann noch gut ausgegangen.
Der Apfel sättigt und nimmt den Durst. Er hält den Menschen bei bester Laune. Er macht ihn freundlich und freudig, er macht ihn mutig und übermütig, Dinge, die Eva sehr schätzte. Dass dazu der gute Adam auch leichtsinnig wurde, sie störte es nicht. Sie würde es ihm abgewöhnen im Laufe der Zeit. Auch dieser Drang ist bis heute Evas Töchtern erhalten geblieben.
Adam und Eva
Der Apfel des Paradieses
Jede Frucht hat ihr Geheimnis,
ob Apfel oder Birne gleich.
Der Apfel aus dem Paradies,
er wächst als Frucht so weiblich,
man denkt sogleich,
das ist symbolisch.
Die Birne, wie sie aufrecht wächst,
das sieht man, sie ist männlich.
War es der Apfel aus dem Paradies,
den Eva ihren Adam essen ließ?
Als er die Frucht genossen,
ist ihm ein Trieb gesprossen.
Wenn man die Frucht genießt,
gibt man den Römern recht:
Die Frucht ist weiblich,
ein frauliches Geschlecht,
die Eva ihren Adam schmausen ließ.
Das Wunder der Natur ward wahr,
als Eva Adam einen Sohn gebar.
Die Geburt der Menschheit war vollbracht
und Gottes Segen darüber wacht.
Der Biss in den Apfel
Die von der goldenen Sonne verklärten Tage des Altweibersommers neigen sich dem Ende zu. Schon beginnen Rückblicke. Die Ernte ist eingebracht, auch die Apfelernte. An der Tatsache, dass die Ernte nur der Lohn systematischer Arbeit vorher ist, hat sich genauso wenig geändert, wie daran, dass die Früchte umso intensiver und genussvoller angenommen werden, je größer die Anstrengung war.
Wir haben einen Apfel in der Hand. Wir stehen auf einem Gipfel. Gemeinsamkeiten? Ja. Es gibt heute schnell gezüchtete Früchte, oft tiefgefroren, fad im Geschmack und Geruch. Und es gibt mit Seilbahnen erfahrene Bergspitzen, die menschenüberfüllt sind … Und es gibt noch den „Natur-Apfel“, vielleicht kleiner, weniger perfekt, mit Stellen und Flecken. Wenn wir aber ihn in die Hand nehmen, seine nicht wachsglatte, sondern seine naturbelassene Oberfläche spüren, seinen Duft längst vor seinem Geschmack einsaugen, meinen wir das Jahr des Apfelbaumes vor uns zu sehen: Aus der Ruhe in die Frühlingssonne streben die Knospen, der weiß-rosa Blütenwipfel zeichnet sich ab gegen den weiß-blauen Himmel über der grün-gelben Wiese. Die Wanderung durch sommerliche Felder lässt uns schattige Ruhe unter seinem grünen Dach finden … Und nun beschert uns der Herbst seine Frucht, bevor wieder die Ruhestarre der Kälte ihn greift. Der Biss in den Apfel ist der Blick vom Gipfel ins Land der Berge nach mühevollem Aufstieg …. Daseinsgenuss erreichen wir als Krönung einer Anstrengung, eines langen Weges – und dieser Genuss ist eine wesentliche Grundlage unseres immer wieder durch uns selber neu gestaltenden Wohlbefindens.
Wir müssen in unserem Leben viele kleine Ernten einbringen! Auch viele Apfelernten. Um ernten zu können, müssen wir die biologischen Wachstumsbedingungen berücksichtigen – und nach getaner, notweniger Arbeit die heitere Gelassenheit besitzen, die Ernte zu erwarten, uns daran zu erfreuen und zugleich in Vorsorge an das nächste Jahr (und beim Bergsteigen an den sicheren Abstieg) zu denken!
Von der Zauberkraft des Apfelbaumes
Uralt ist die Verwendung des Apfelbaumes als Lebens- und Geburtsbaum. Zur Geburtsstunde wurde dem Kind ein Apfelbaum gepflanzt, der Auskunft über die Entwicklung des Neugeborenen geben sollte; verkümmerte er, so war auch dem Kind dies Schicksal beschieden, gedieh er aber prächtig, so geschah dem Kind das gleiche. Von jeher waren Wohl und Wehe des Menschen mit dem der Bäume eng verbunden, die Menschenseele wurde mit der Baumseele identifiziert.
Als Fruchtbarkeitssymbol hatte der Apfel in den Hochzeitsbräuchen vieler Völker wichtige Funktionen. Der Reichtum des Apfels an Kernen gibt einen deutlichen Hinweis auf die Fruchtbarkeit des Frauenschoßes. Nach dem Gesetz des Solon mussten griechische Brautpaare zur Hochzeit Äpfel oder Quittenäpfel verzehren, um die Nachkommenschaft zu sichern.
Plutarch legte dieses Gesetz so aus, dass der Quittenapfel, der neben dem Wohlgeruch und dem lieblichen Geschmack auch etwas Herbes und Zusammenziehendes hat, auf die Mischung von Freude und Leid in der kommenden Ehe hinweisen sollte.
In Deutschland sagt man: „Sie hat des Apfels Kunde nicht“, von einem Mädchen, das noch nichts vom Geschlechtsverkehr wusste. Eine Jungfrau sollte keinen Doppelapfel essen, sonst bekam sie Zwillinge, ein Glaube, der sich auch sonst bei Doppelfrüchten findet, die von Frauen gegessen werden. Der Apfel symbolisiert im besonderen Maße das weibliche Geschlecht. Vergräbt man die Nachgeburt einer Wöchnerin unter einem Apfelbaum, so bekommt sie das nächste Mal ein Mädchen, vergräbt sie die Nachgeburt unter einem Birnbaum, so wird das nächste Kind ein Junge.
In Schlesien stellte sich die Braut hinter den Altar und ließ einen Apfel an ihrem Lein herabgleiten; damit sollte gewährleistet werden, dass sie keine Schwierigkeit bei der Entbindung habe.
In Westfalen gab es bei der Hochzeit den Wettlauf nach dem „Brautapfel“, einem mit Geld gespickten Apfel. In der Schweiz schälten Brautführer und Brautleute einen Apfel; aus den Figuren, die die abgelegten Apfelschalen bildeten, konnte man auf die Zukunft der Hochzeiter schließen.
Der Apfelbaum ist auch Orakelbaum: mit Hilfe seiner Frucht kann man Leben oder Tod vorhersagen. Werden beim Schneiden des Weihnachtsapfels die Kerne durchtrennt, bedeutet das für den Betreffenden den Tod im Laufe des kommenden Jahres. Das gleiche wird eintreten, wenn beim Durchschneiden des Apfels eine kreuzförmige Figur entsteht. Gelingt es, beim Schälen des Apfels die Schale nicht abreißen zu lassen, hat man noch lange zu leben und ist auch sonst von Glück begünstigt; träumt man jedoch im Winter von einem Apfel, so bedeutet das eine Leiche im Haus. Der im Herbst blühende Apfelbaum sagt ebenfalls Tod und Unglück voraus. Und wenn man sich verirrt hat, muss man an den zu Weihnachten oder Neujahr verzehrten Apfel denken, und man findet seinen Weg wieder.
Besondere Aufmerksamkeit zogen die Pflanzen auf sich, die in der Heiligen Nacht blühten. Von einer solchen Begebenheit berichtet der Pfarrer Dilher (1663): „Nicht weit von dem nürnbergischen Stättlein Grävenberg und auch in der Vor-Statt desselben stehen etliche Bäume, welche den Herbst vorher Aepfel tragen … und hernach wiederum, mitten in der Christnacht, nach dem alten Kalender gerechnet, nicht allein blühen, sondern alsbald auch darauf kleine Aepfelchen tragen, die ungefähr einer Kirsche Größe tragen, und des folgenden morgens die Blüht noch an den oberen Theil haben.“
Dieser Volksglaube von den wunderbaren „Weihnachtsäpfeln“, die während der Christnacht blühten und gleichzeitig Früchte trugen, hat sich Jahrhunderte lang gehalten.
Der Apfel konnte aber auch schreckliche Dinge vollbringen; wenn man ihn zu Weihnachten oder Neujahr vor dem Gottesdienst aß, bekam man Geschwüre, weil das Nüchternheitsgebot der Kirche übergangen worden war. In die gleiche Richtung ging das Gebot, nach dem ein Todkranker kurz vor seinem Ende keinen Apfel essen durfte. Er konnte dann das letzte Abendmahl nicht empfangen und war auf ewig verdammt.
Apfelbäume standen mit Hexen und Unholden in Verbindung.
Unter ihnen, wie unter vielen anderen Bäumen, tanzten Freitags die Hexen.
Auch der Alp erscheint in Gestalt eines Apfels, und der Eingang zur Höhle der Unsterblichen liegt unter einem Apfelbaum.
Der Apfel als Lebensbaum musste auch Kräfte in sich bergen, die den Menschen gesunden ließen. Schon auf die Ungeborenen übt der Apfel seinen wohltuenden Einfluss aus. Eine Frau wird schöne, gesunde Kinder gebären, wenn sie während der Schwangerschaft viele Äpfel isst; vielleicht sogar einen Knaben zur Welt bringen. Das Neugeborene bekommt auch gleich einen Apfel, um dessen Lebenskraft auf das Kind zu übertragen.
Ein solcher Baum verfügt auch über apotropäische Fähigkeiten, er kann Unheil abwenden. Wer an einem hohen kirchlichen Feiertag (außer zu Weihnachten und Neujahr) früh morgens auf nüchternem Magen einen Apfel isst, bleibt das ganze Jahr über gegen angezauberte Krankheiten gefeit. Auch kann man Krankheiten auf diesen Baum übertragen. Wird man von Fieber, Schwindsucht oder Zahnweh geplagt, geht man zum Apfelbaum und spricht:
„Apfelbaum ich tu dir klagen, die Schwindsucht tut mich plagen, der erste Vogel, der über dich fliegen tut, benehme mich der Schwindsucht gut.“
Hilft das bei Zahnschmerzen nicht, dann geht man nicht z um Bader, sondern in der Osternacht zum Apfelbaum, setzt den rechten Fuß gegen den Stamm und spricht:
„Neu Himmel! Neu Erde! Zahn ich versprech dich, dass du mir nicht schwellst noch schwärest, bis wieder Ostern wird.“
Der Apfel konnte in der Sympathie – Medizin auch erfolgreich gegen Warzen eingesetzt werden. Ein Apfel wurde geteilt und beide Hälften auf die Warzen gelegt. Danach fügte man den Apfel wieder zusammen und vergrub ihn; war der Apfel verfault, so waren auch die Warzen verschwunden. – Schabt man einen Apfel nach oben zu ab, dient er als Brechmittel, schabt man ihn nach unten zu, ist er ein brauchbares Mittel gegen Durchfall. Soll einem Säufer das Trinken abgewöhnt werden, gibt man ihm einen Apfel, den ein Sterbender in seinen Händen hält. Wenn aber jemand als trinkfest gelten will, so muss er morgens einen sauren Apfel essen und einen Schluck Wasser darauf trinken.
Es ist erstaunlich, dass die Früchte dieses Lebensbaumes in der seriöseren Heilkunde kaum Beachtung fanden. Nur im „New Kreutterbuch“ von 1543 heißt es: „Aller apfelbäum bletter, blüet und zweyglein haben die krafft, damit sie zusammenziehen. Die äppfel ziehen auch zusammen, wenn sie noch herbe sind, aber die zeitigen (reifen) haben die krafft nit. Die im Lentzen zeitig werden, bringen und vermehren die Galle, schwächen die nerven und blähen den leib.“
Damit ist nicht viel anzufangen, und auch in späteren Zeiten wird dem Apfel nur in Spezialfällen Heilkraft zugesprochen. Tabernaemontanus (gest. 1590) hält ein Destillat aus Apfelblüten für das beste Hautpflegemittel. Im 18. Jahrhundert empfahl der Arzt Chomel den Apfel gegen Brustleiden und Hustenreiz. Manche halten noch heute einen Aufguss aus Apfelschalen für ein gutes Herztonikum, und die Engländer sagen: „An apple the day keeps the doctor away.“
Anders ist das beim Apfelmost, der mehr leisten kann als der Apfel. Der Most hilft, Fette abzubauen, indem er sie aufspaltet. Er soll sogar die krebserregenden Stoffe in geräucherten Speisen neutralisieren. Und: „Ein Glas Apfelwein zum Vesper auf dem Acker macht im Gegensatz zum Schluck Bier nicht müde, sondern munter.“ Insbesondere für ältere Menschen ist dieser Most ein hilfreiches Heil- und Kräftigungsmittel.
Vor tausend Jahren allerdings dachten die Ärzte von Salerno anders über den Most: „Most behindert den Harn, doch lockert hurtig den Bauch er. Gern verstopft er die Leber und die Milz und lädt dir den Stein auf.“
Schon der Apfelduft kann Erstaunliches bewirken. Friedrich Schiller hatte bekanntlich immer einen – allerdings leicht angefaulten – Apfel in seiner Schreibtischschublade, dessen Geruch ihn zu höchsten literarischen Leistungen inspirierte. Ähnliches behauptet man von Bratäpfeln, deren Duft Heilkräfte mobilisieren, beruhigen und die innere Unruhe nehmen sollen.
Der Kräuterheiler M. Messegue hält die Rinde des Apfelbaumes für genauso wirksam wie das Chinin. Blätter, Blüten und Knospen seien stark harntreibend. Er habe einen Mann mit diesen Drogen von einer schweren Nierenentzündung geheilt. „Abends einen guten Apfel, und der Schlaf kommt schneller.“ Er zitiert noch einen interessanten Spruch der mittelalterlichen Schule von Salerno, der zahlreiche bekannte Ärzte angehörten:
„Nach der Birne – pipi, nach dem Apfel - kaka.“
Abführend sind vor allem gekochte Äpfel; ansonsten gilt der Apfel als Blutreinigungsmittel, er soll den Körper von Giftstoffen reinigen und sich daher bei Rheuma, Gicht, Leber- und Nierenkrankheiten, Arterienverkalkung, Fettleibigkeit und Hautkrankheiten bewähren. Natürlich darf auch der Hinweis auf Evas Apfel nicht fehlen – die Frucht der Gesundheit muss auch eine Frucht der Schönheit sein.
Der Apfel konnte in der Sympathie-Medizin auch erfolgreich gegen Warzen eingesetzt werden. Ein Apfel wurde geteilt und beide Hälften auf die Warzen gelegt. Danach fügte man den Apfel wieder zusammen und vergrub ihn; war der Apfel verfault, so waren auch die Warzen verschwunden. Soll einem Säufer das Trinken abgewöhnt werden, gibt man ihm einen Apfel, den ein Sterbender in seinen Händen hielt. Wenn aber jemand als trinkfest gelten will, so muss er morgens einen sauren Apfel essen und einen Schluck Wasser darauf trinken.
Abführend sind vor allem gekochte Äpfel; ansonsten gilt der Apfel als Blutreinigungsmittel, er soll den Körper von Giftstoffen reinigen und sich daher bei Rheuma, Gicht, Leber- und Nierenkrankheiten, bei Arterienverkalkung, Fettleibigkeit und Hautkrankheiten bewähren. Natürlich darf auch der Hinweis auf Evas Apfel nicht fehlen – die Frucht der Gesundheit muss auch eine Frucht der Schönheit sein.
Die modernen, wissenschaftlich ausgerichteten Drogenkundler fanden in rohen, unreifen Äpfeln das Propektin, das sie gegen Durchfall, Ernährungsstörungen, bei Hautkrankheiten und besonders auch in der Kinderheilkunde empfehlen. Apfelschalen sind Bestandteil vieler Gesundheitsteemischungen. Amerikanische Forscher konnten nachweisen, dass der Apfel den Menschen bis ins hohe Alter dynamisch erhält. Zum Beweis dafür wird angeführt, dass berühmte Persönlichkeiten wie Napoleon, Bismarck oder Churchill täglich große Mengen an Äpfeln verdrückten, dabei ein beachtliches Alter erreichten und aktiv blieben, wenn man sie ließ.
Die Äpfel der Hesperiden
Im Gegensatz zum Oliven- und Feigenbaum war der Apfelbaum in Europa niemals etwas Exotisches, auch nicht in der ältesten Antike. Die Hellenen und die Trojaner, die „offiziellen“ Ahnen der Römer, hatten ihn auf ihren Wanderzügen überall angetroffen, bevor sie sich in Griechenland, in Kleinasien oder in Italien niederließen. Wie Plinius bezeugt, kannten die Römer des ersten nachchristlichen Jahrhunderts bereits dreißig Apfelsorten; ihre Verwendung als Nahrungsmittel oder in der Medizin war säuberlich differenziert beschrieben. Der Apfel hieß auf lateinisch „malum“, von griechisch „melon“; das Wort stammt aus dem Mittelmeerraum, ist aber nicht griechischen Ursprungs. „Melon“ hatte einen größeren Bedeutungsumfang als „malum“, denn es bezeichnete auch Kleinvieh wie Schafe und Ziegen. Aber beide Wörter, das lateinische wie auch das griechische, wurden für alle exotischen Früchte verwendet, die mehr oder weniger wie Äpfel aussahen, und begleitende Adjektive präzisierten ihre Herkunft. „Melon cydonion“ war die Quitte, die aus Cydonia (heute Khania auf Kreta) kam, und „melon persicum“ hieß der Pfirsich. Der eigentlich in China beheimatete Pfirsichbaum war während des Feldzuges Alexanders des Großen in Persien entdeckt worden, wo man ihn seit langem züchtete. Die Aprikose nannte man „melon armeniacon“, denn obwohl auch die Aprikose aus dem Reich der Mitte stammte, kam der Baum im 1. Jahrhundert n. Chr. von Armenien aus nach Griechenland. „Melon citrion“ war die Zitrone, und „melon medicon“ die Zitronatzitrone. Man hat in den Äpfeln der Hesperiden Orangen oder Zitronen sehen wollen, weil Sophokles sie im 5. Jahrhundert v. Chr. „goldene Äpfel“ nannte. Aber die Griechen lernten die Zitrusfrüchte frühestens im 4. Jahrhundert in Form von Zitronat kennen, die Zitronen erst einige Jahrhunderte später, und weder sie noch die Römer ahnten etwas von der Existenz der Orangen, die in Europa erstmals um das Jahr 1000 auftauchten. „Goldene Äpfel“ ist also keine Bezeichnung für eine konkrete Obstsorte, sondern bezieht sich auf mythische Früchte, die „Früchte der Unsterblichkeit“.
Eben diese mythische Bedeutung haben die Äpfel in der Sage. Herakles hatte schon die zehn Aufgaben erfüllt, die ihm Eurystheus aufgetragen hatte (der aber zwei nicht gelten ließ). Er hatte sich zu ihm nach Tiryns begeben, nachdem das delphische Orakel, das er gefragt hatte, wie er sich von seinen in Raserei begangenen Verbrechen reinigen könne, ihm geraten hatte, in den Dienst dieses Königs von Argolis zu treten und alle Prüfungen auf sich zu nehmen, die er ihm auferlegen würde, seien sie auch noch so schwer; so würde er Unsterblichkeit erlangen. Die elfte dieser Prüfungen musste daher die entscheidende sein, denn im Lauf der zwölften und letzten konnte der Held unbeschadet in die Unterwelt hinabsteigen und seine Dienstbarkeit beenden.
Der Apfelbaum, dessen goldene Früchte Herakles auf Verlangen des Königs Eurystheus herbeischaffen sollte, gehörte Hera, die ihn von der Mutter Erde als Hochzeitsgeschenk bekommen und in einen göttlichen Garten gepflanzt hatte, der sich an den Abhängen des Atlasberges befand. Atlas „beherrschte am Erdenrande das Land und das Meer, das die Fläche den schnaubenden Rossen Sols hinbreitet und Ruhe gewährt den ermüdeten Wagen“, und wachte über diesen Garten; er war auf die Früchte des Apfelbaums – „erglänzend von funkelnden Goldes – sehr stolz, aber weil er damit gestraft war, auf seinen Schultern die „Säulen des Himmels zu tragen (sein Name bedeutet „der Tragende“, hatte Hera seinen Töchtern anbefohlen, den Wunderbaum zu hüten. Deren Mutter, Hesperis, war die Tochter des Hesperos, des Gottes der Abenddämmerung; hinter diesem Gott verbarg sich kein anderer als Hades, der über die Toten herrschte, denn ihre Seelen folgten dem Lauf der Sonne und verschwanden mit ihr im Westen. Die Hesperiden waren drei an der Zahl – Hespere, Aiglis (die „sehr glänzende“) und Erytheis („rote Erde“) -, schöne Frauen, unbekümmert, die mit klangvoller Stimme sangen; Hera aber bemerkte, dass sie ihre goldenen Äpfel plünderten. So befahl sie Ladon, der immerwachen Schlange, ihren Leib in Ringen um den Stamm des Baumes zu winden und jedem Fremden den Zugang zu verwehren. Das Bild der Schlange im Baum erinnert natürlich an die Verführung von Adam und Eva, und der Garten des Atlas an den biblischen Garten Eden. Ladon, eine Schlange oder ein drachenartiges, hundertköpfiges Wesen, war am Anfang der Zeiten geboren worden; man hielt es für den Sohn Typhons und Echidnes, die auch die Eltern anderer Ungeheuer waren, oder des Phorkys und der Keto, die das schäumende, tückische Meer, den Schrecken der Seefahrer verkörperten, oder schließlich (was besser zur Geschichte der Hesperiden passt) für eines der Kinder, die durch Parthenogenese aus Gäa, der Mutter der Erde, die Hera den symbolischen Baum geschenkt hatte, hervorgegangen waren.
Das Unternehmen war um so beschwerlicher, als Hera den Sohn, den Zeus mit der Alkmene gehabt hatte, seit seiner Geburt verfolgte, und zudem wusste Herakles nicht, wo sich der Garten der Hesperiden befand; gewiss war nur, dass er im Westen, in Richtung des Sonnenuntergangs liegen musste. Herakles war sich trotzdem im Unklaren, welchen Weg er einschlagen solle. Er wendete sich zuerst gen Norden, um Nereus zu befragen, den weissagenden Meeresgott, der am Ufer des Eridan wohnte. Die Flussnymphen führten ihn zum schlafenden Gott. Der Held bemächtigte sich seiner, und obgleich Nereus viele verschiedene Gestalten annahm, um ihm zu entfliehen, gelang es Herakles doch, ihm sein Geheimnis zu entreißen und zu erfahren, auf welche Weise man der Äpfel der Hesperiden habhaft werden könne. Nach anderen Autoren suchte Herakles die Auskünfte des Prometheus, den er bei dieser Gelegenheit befreite. Jedenfalls bekam er den Rat, zu einer List zu greifen: er solle die mit unerbittlicher Strenge von Ladon bewachten Äpfel nicht selber pflücken, sondern vielmehr Atlas vorschlagen, er wolle ihn von seiner enormen Bürde befreien, wenn er ihm als Gegenleistung dafür die Äpfel hole. Nur war Atlas einst durch einen Orakelspruch der schicksalhaften Themis gewarnt worden: „Es wird die Zeit kommen, da deine Bäume ihres Goldes beraubt sein werden, und ein Zeussohn wird sich rühmen können, es erbeutet zu haben.“ Trotzdem siegte bei Atlas die Wunschvorstellung, ein paar Augenblicke lang rasten zu können, über das Misstrauen. Aber er fürchtete Ladon. Herakles erlegte das Ungeheuer mit einem Pfeil,
dann hob er die Erdkugel auf seine Schultern – auch dies ein symbolischer Akt, der als wesentliches Element zu seiner Suche gehörte: Ein Held, noch sterblich, nahm den Platz eines Gottes ein; er schulterte die Last der Welt. Der Name „Säulen des Herkules“, der die Meerenge von Gibraltar bezeichnet, hinter der das Unbekannte, die „andere Welt“, begann, erinnerte an dieses Ereignis. Als Atlas mit den drei goldenen Äpfeln zurückkehrte, war er berauscht vom Gefühl der Freiheit. Er schlug Herakles daher vor, er werde sie Eurystheus selbst überbringen, während der Held an seiner Stelle den Globus trage. Diese unvorhergesehene Komplikation meisterte Herakles mit Hilfe einer neuen List. Atlas sollte ihm erlauben, sich wenigstens ein Kissen auf den Kopf zu legen, denn seine Reise werde mehrere Monate dauern, und dazu müsste Atlas noch einmal für eine Minute seine Last übernehmen. Der einfältige Gott ließ sich übertölpeln. Herakles, der Weltkugel ledig, nahm die Äpfel an sich und ging mit einem kleinen ironischen Gruß von dannen.
Setzt man diese Geschichte in Beziehung zu dem, was wir vom kosmischen Baum gesagt haben, der das Himmelsgewölbe stützt und es daran hindert, auf die Menschen zu stürzen – zum Beispiel bei den Kelten und den Germanen -, so wird deutlich, dass der Apfelbaum der Hesperiden ebenfalls ein Weltenbaum ist, und weil er den Himmel trägt, eröffnen seine Früchte den Zugang zur Unsterblichkeit. Da das Wort „melon“ gleichzeitig das Kleinvieh und den Apfel bezeichnete, haben manche griechische Autoren in den Äpfeln der Hesperiden „goldene Schafe“ sehen wollen, die ein Schäfer namens Dragon oder Ladon hütete. Anders gesagt, hätten dann die goldenen Äpfel und das „goldene Vlies“, das in einem Baum hing, die gleiche Bedeutung, und die von Jason geführte Reise der Argonauten – Jason musste sich Prüfungen unterziehen, die ihm der König Äetes auferlegt hatte wie der König Eurystheus dem Herakles – wäre eine Wiederholung der abenteuerlichen Fahrten des Herakles in einer anderen Zeit, mit dem Unterschied, dass Jason, dem die Zauberin Medea zwar half, der aber auch von ihr verzaubert wurde, dem Tod nicht entrinnen konnte.
Herakles zunächst auch nicht, denn nachdem er seine Arbeiten beendet hatte, schied er freiwillig aus dem Leben, um den entsetzlichen Qualen zu entgehen, die ihm das von seiner eifersüchtigen Gemahlin Deianira übersandte Gewand verursachte. Deianira war übrigens ihrerseits von Nessos, der ihr zur Anfertigung dieser Tunika geraten hatte, mit einem angeblichen Liebeszauber hintergangen worden; sie erhängte sich wegen ihrer Gewissensbisse. Nach einem der mörderischen Wutanfälle, die Herakles in seiner Agonie überkamen, und nachdem er die Wahrheit erfahren und Deianira verziehen hatte, blickte er „freudig in die Runde wie ein bekränzter Gast, der von Weinbechern umgeben ist“, und stieg auf den Scheiterhaufen, der aus Eichenzweigen (der Baum des Zeus) und Stämmen männlicher wilder Olivenbäume (ihm selbst geweiht) aufgeschichtet war. In dem Augenblick, da die lodernden Flammen den Körper des Helden erreichten, fielen Blitze vom Himmel, und der Zeussohn entschwand den Blicken der Menschen. Im Olymp empfing ihn sein Vater Zeus, der Hera überredete, ihn durch eine Zeremonie der Wiedergeburt zu adoptieren, indem sie Wehen vortäuschte und ihn unter ihrem Rock hervorzog. Hera betrachtete Herakles von nun an als ihren Sohn und gab ihm die Hand ihrer hübschen Tochter Hebe.
Die Reise des Helden in den äußersten Westen war das notwendige Vorspiel zu seinem Abstieg in die Unterwelt. Dem Weg folgend, den die Seelen beschritten, kam er bis zum Rand des Abgrunds, der sie und die Sonne verschluckte. Herakles aber kehrte heil und gesund von dort zurück und brachte den Talisman der Unsterblichkeit mit, der ihn später in die Lage versetzte, unbesiegbar bis ins Reich des Hades vorzudringen und dann, weil er durch den Tod hindurchgegangen war, in den Rang eines Unsterblichen aufzusteigen. Was war unterdessen aus den goldenen Äpfeln geworden? Als Herakles sie Eurystheus überreichte, gab dieser sie ihm zurück. Er schenkte sie hierauf Athene, die sie in den Garten der Hesperiden zurücktrug, weil es gegen das Gesetz war, dass das Eigentum Heras aus ihren Händen gehe. Die Göttin beklagte den Tod ihres Schützlings Ladon und versetzte ihn mitten unter die Sterne, wo er das Sternbild der Schlange bildet.
Der Apfelbaum als Baumart gehörte also allem Anschein nach Hera, kam jedoch durch Vermittlung Athenes zu ihr zurück. Wir begegnen diesen beiden Göttinnen beim Urteil des Paris wieder, aber in der Geschichte vom Garten des Atlas fehlt die dritte von ihnen – denn es waren drei, wie die Hesperiden -, Aphrodite, und eben dieser huldigte der junge Trojaner mit einem Apfel. Allerdings handelte es sich dabei um einen „Zankapfel“, denn er trug die Inschrift: „der Schönsten“. Eris, die „Zwietracht“, die Tochter der Nacht, hatte ihn im Zorn, weil sie nicht zur Hochzeit des Peleus und der Thetis eingeladen war, zu Boden geworfen, worauf zwischen Hera, Athene und Aphrodite ein erbitterter Wettstreit entstand. Zeus weigerte sich, in diesem absurden Streit Partei zu ergreifen, und berief einen Sterblichen zum Schiedsrichter, einen sehr einfachen Mann, den Schäfer Paris. Nun war aber Paris-Alexander kein anderer als der verlorene Sohn des Priamos, des Königs von Troja; das wussten allerdings nur die Götter. Kurz vor der Geburt des Paris hatte Hekuba, seine Mutter, geträumt, sie bringe ein Holzscheit zur Welt, aus dem zahllose feurige Schlangen hervorkrochen. Sie erwachte und schrie, die Stadt Troja stehe in Flammen. Der Seher Äsakos wurde konsultiert und erklärte: „Das Kind, das demnächst geboren werden soll, wird der Untergang unseres Landes sein. Ich rate dir, es beiseite zu schaffen.“ Einige Tage später präzisierte Äsakos: „Die Trojanerin von königlichem Geblüt, die heute gebiert, muss mit ihrem Kind getötet werden.“ Unglücklicherweise verstand Priamos diese Warnung falsch und seine eigene Schwester Killa töten, die als Folge einer geheimen Verbindung eben einen Sohn geboren hatte. Aber vor Einbruch der Nacht wurde Hekuba von Paris entbunden. Die Seher drangen darauf, dass wenigstens das königliche Kind zu töten sei. Hekuba konnte es jedoch nicht über sich bringen und ließ das Neugeborene auf dem Berg Ida aussetzen, wo eine Bärin es säugte. Das Schicksal nahm nun seinen Lauf, nichts konnte es mehr aufhalten.
Als er sein berühmtes Urteil abgab, kannte Paris das Geheimnis seiner Geburt noch nicht, und seine Eltern glaubten ihn seit langem tot. Der Fortgang der Geschichte ist bekannt. Aphrodite beeindruckte den ebenso naiven wie schönen Jugendlichen, indem sie ihm Helena versprach, die verführerischste aller Griechinnen und Gattin des Menelaos. Paris gab „der Schönsten“ hierauf den Apfel, und als Folge davon entbrannte der Trojanische Krieg. Dabei stand Aphrodite auf der Seite der Trojaner, für die sie eine sehr menschliche Schwäche hegte, denn sie hatte vom Trojaner Anchises einen Sohn, Äneas. Ihre Rivalinnen unterstützten die Achäer.
Was wir hier beachten sollten, ist der Umstand, dass offenbar der Apfelbaum von Hera in den Besitz Aphrodites überging. Der Gattin des Zeus wäre somit nur der Birnbaum geblieben, der ihr ebenfalls geweiht war; es gab eine Hera Apia, von „apion“, „der Birnbaum“, und die Kultfiguren der Göttin waren saus Birnbaumholz geschnitzt, so auch insbesondere das Standbild im Heraion von Mykene, einem ihrer ältesten Heiligtümer. Vielleicht teilte sie diesen Besitz mit Athene, denn im böotischen Theben gab es einen Tempel der Athena Onga, nach dem phönizischen Namen des Birnbaums. Damit ähnelt der Konflikt zwischen den Achäern und den Trojanern dem keltischen „Krieg der Bäume“; in diesem Fall standen sich Birnbaum (Hera und Athene auf Seiten der Achäer) und Apfelbaum (Aphrodite und die Trojaner) gegenüber.
Aus der so folgenschweren Geschichte von Paris, der Aphrodite vor Hera und Athene den Vorzug gab, lernten die Zeitgenossen Homers eine weitere Lektion. Die Hauptursachen des Trojanischen Krieges waren die Begehrlichkeit, die Lüsternheit, die Aphrodite in dem unschuldigen Schäfer zu wecken gewusst, und der Ehebruch, zu dem sie ihn verleitet hatte. Aphrodite, die Göttin der heimlichen Verbindungen und der leidenschaftlichen und blinden Begierde, die es verstand, sich die Menschen gefügig zu machen und sie zu frevelhaftem Tun, ja zum Verbrechen zu verführen, steht in dieser Episode der keuschen Athene und Hera, der Göttin der ehelichen Vereinigung, gegenüber. Die aus dem Orient gekommene Göttin Aphrodite verkörperte alle seine verführerischen Aspekte, aber auch seine Gefahren. Sie war nach Hesiod aus dem schaumigen Samen des Uranos geboren, den sein Sohn Kronos nach einem Inzest entmannt hatte. Aber Uranos war dennoch der Ahne der Götter, die alle einem zugleich ursprünglichen und unvermeidlichen Inzest entstammten, und sie konnten der Kraft, die auch sie gezeugt hatte, nicht widerstehen. Sogar der zum Herrn des Olymp gewordene Sohn des Kronos war den Gesetzen Aphrodites unterworfen; sie verwirrte den Geist des Zeus, täuschte diese vorsichtige Seele und verkuppelte den Gott hinter dem Rücken Heras, seiner Schwester und Gattin, mit sterblichen Frauen.
Um sich zu rächen, ließ Zeus Aphrodite sich leidenschaftlich in einen Sterblichen verlieben, damit sie, selbst nicht mehr gegen solche Neigungen gefeit, nicht mehr imstande wäre, mit ihrem süßen Lächeln auf die Götter herabzublicken und sie mit ihrer Macht zu verspotten, indem sie sie mit den jungen Frauen der Erde zusammenbrachte und sterbliche Söhne zeugen ließ; denn sie würde dieser Macht jetzt selbst anheim fallen. Anchises war der Mann, in den die Göttin sich verliebte. An Schönheit den Unsterblichen gleich, trieb er seine Rinder auf den Gipfel des Ida. Aphrodite erblickte ihn und entbrannte in Liebe zu ihm. Sie nahm nun die Gestalt und das Gesicht eines jungen sterblichen Mädchens an, weil sie befürchtete, Anchises könne, wenn er sie mit eigenen Augen als Göttin sehe, vor Angst wie gelähmt sein, und gab sich als Tochter des Otreus, des Königs von Phrygien, aus. Die List war so erfolgreich, dass der Trojaner erklärte, er wolle sie heiraten. So gelangte ein Sterblicher ins Bett einer Unsterblichen, die ihr Wesen vor ihm verbarg. Als aber beim Erwachen Aphrodite ihre wahre Gestalt annahm, war der Unglückliche entsetzt: „Ich beschwöre auf den Knien, schicke mich nicht erschöpft zu den Menschen zurück. Hab Mitleid mit mir. Denn es gibt kein blühendes Alter mehr für den, der bei Unsterblichen gelegen hat.“ Die Göttin beruhigte ihn und kündigte ihm an, die Frucht ihrer Vereinigung werde ein König sein, dessen Geschlecht sich ohne Ende erneuern werde.
Diese Liebe, zu der die Initiative allein von Aphrodite ausging, erinnert ein wenig an diejenige, die sie seit seiner Geburt für den schönen Adonis empfand, und es ist nicht unmöglich, dass Anchises, dessen Name „der mit Isis lebt“ bedeuten soll, in Wirklichkeit ein Synonym für Adonis ist, den Gott, der von einem Eber entmannt wurde, wie Osiris, der Gatte der Isis, durch seinen Bruder Seth, der auch die Gestalt dieses Tieres angenommen hatte, entmannt wurde.
Jedenfalls war Äneas, dessen Namen die Griechen von dem Adjektiv „ainos“, „schrecklich“, „furchterregend“ ableiten, der Sohn des Anchises und der Aphrodite. In der homerischen Hymne sagt die Göttin zu Anchises über den Sohn, der geboren werden soll, er werde wegen der furchtbaren Leiden, die sie als Strafe dafür habe erdulden müssen, dass sie einen Sterblichen in ihr Bett genommen habe, Äneas heißen. Denn die Liebesbeziehungen, die Aphrodite bei den Sterblichen und selbst bei den Göttern einfädelt, sind immer unstatthaft, verursachen Schuld, zerstören legitime Verbindungen und unterhöhlen die soziale Ordnung. Der Geliebte, zu dem sie sich am stärksten hingezogen fühlt, ist Ares, ihr natürlicher Verbündeter, denn die Begierde, die sie entfacht, kann, wie im Fall des trojanischen Krieges, bis zum blutigen Kampf führen.
Zu guter Letzt wird Äneas nur wegen des Unterganges dieser Stadt zum König, aber weit entfernt von Troas. Nach einer langen Irrfahrt ging Äneas mit seinen Gefährten schließlich am Ufer des Tiber an Land, unterstützte den König Latinus im Kampf gegen die Rutuler, ließ sich endgültig in dem Land nieder und erbaute Lavinium, ehe er Latinus, dessen Tochter Lavinia er geheiratet hatte, auf dem Thron nachfolgte. Silvius, der Gründer des Geschlechts, aus dem Romulus hervorgehen sollte, war der Enkel des Äneas. Rom entstand also unter den Auspizien, nicht nur des Mars, sondern auch der Aphrodite, und mehrere römische Familien rühmten sich, von ihr abzustammen. Zu diesem Geschlecht gehörte Julius Cäsar, und man weiß, dass er aus diesem Umstand einen sozusagen natürlichen Herrschaftsanspruch ableitete, der sich schon aus seiner Herkunft und seinem Erbe ergebe; er sagte auch, er sei ein Nachkomme der ersten legendären Könige Roms. Auch erklärte er gerne, in den Juliern vereinige sich der heilige Charakter der Könige, die über die Menschen herrschen, mit der Heiligkeit der Götter, die selbst die der Könige übertreffe. Die Entführung Helenas hatte den Trojanischen Krieg verursacht; der Raub der Sabinerinnen sicherte, nach einer bewaffneten Auseinandersetzung, die Zukunft einer Stadt, der die Frauen fehlten. Aphrodite, Venus geworden, hatte ihr Ziel erreicht, denn die Römer eroberten als Nachfahren der Trojaner eines Tages Griechenland, ihren Feind, und rächten gewissermaßen die trojanische Niederlage. So weit gingen schließlich die Konsequenzen des Urteils des Paris und der Rolle, die der „Zankapfel“ spielte; wir mussten sie bis zum Ende verfolgen, um die Zusammenhänge aufzuzeigen.
Die Symbolik des Apfels ist also im großen ganzen sehr zweideutig. Der Apfelbaum als Baum der Erkenntnis kann auch blenden; als Lebensbaum ist er auch Todesbaum. Aphrodite geweiht, lässt der Apfel durch seine Form an eine weibliche Brust oder die Wölbung eines Bauches denken; die Vertiefung unten an der Frucht erinnert an einen Nabel; er steht also für die Weiblichkeit. Daher ist der Apfel fast so gefährlich wie die männliche Feige. Festzuhalten ist jedoch, dass die Zuordnungen mitunter austauschbar sind: die Feige gilt gelegentlich als Bild der Vulva; umgekehrt kommt es vor, dass der Apfel in der Mehrzahl die Hoden bezeichnet. Diesen beiden Früchten steht die Olive gegenüber, die weder weiblich noch männlich ist, sondern neutral, geschlechtslos; sie erzeugt „jungfräuliches“ Öl, das wie ihre Beschützerin Athene – das junge Mädchen Pallas – keusch ist.
Der Apfel – die Frucht der Liebe
„Frauenapfel“ war schon immer eine gebräuchliche Bezeichnung für die Brust. Nach einem „Leibdiener der Schönheit“ aus dem 17. Jahrhundert sind Brüste schön, „wenn solche apfelförmig, weiß wie neugefallener Schnee, und so groß seyn, als eine jede mit ihrer Hand bedecken kann, welches dann das rechte Maß dieses schwesterlichen Paares seyn soll. Soviel vom Wohlstand der Brüste.“
In der „Ruhestatt der Liebe“ von Amaranthus heißt es:
„Soll der Marmor deiner Brust,
welchen du mit Fleiß verhüllest,
nicht zum Lieben tragen Lust,
wenn er auf und nieder quillet?
Ach, die Äpfel sind so schöne,
Lisimene!“
Überhaupt stand in der „galanten“ Zeit die Verherrlichung der Brüste, schon immer Inbegriff erotischer Anziehungskraft der Frau, obenan. Sogar ein früher Vorläufer der weiblichen Emanzipation, der Schriftsteller T. G. von Hippel, macht das in seinem Traktat „Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber“ (1792) deutlich:
„Sonst muss ich noch anmerken, dass der größte Reiz des Frauenzimmers im Busen besteht. … Ein nacktes Frauenzimmer wird sich, ob es gleich an anderen Orten noch nötiger wäre, den Busen (weil der Blick ihn zuerst erreicht und sie durch eine Bedeckung der Küste sich vor einer Landung verwahren will) mit den Händen verhalten. Die Natur selbst hat den Busen für den größten Reiz erklärt und als das beste Brodt ans Fenster gelegt.“ Die barocke Vorliebe für schwellende Formen konnte den Apfelbusen nicht übersehen. Hofmann von Hofmannswalden (1617-1679) schrieb:
„Sie sind ein Paradies, in welchem Äpfel reifen,
nach derer süßer Kost jedweder Adam lechzt. …