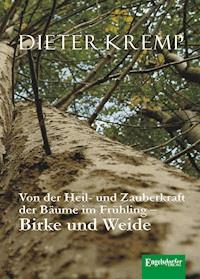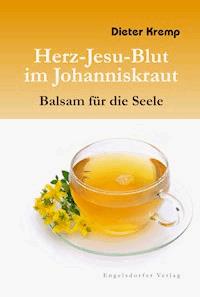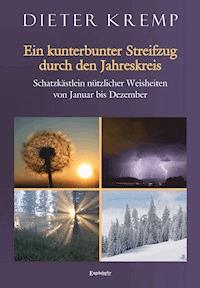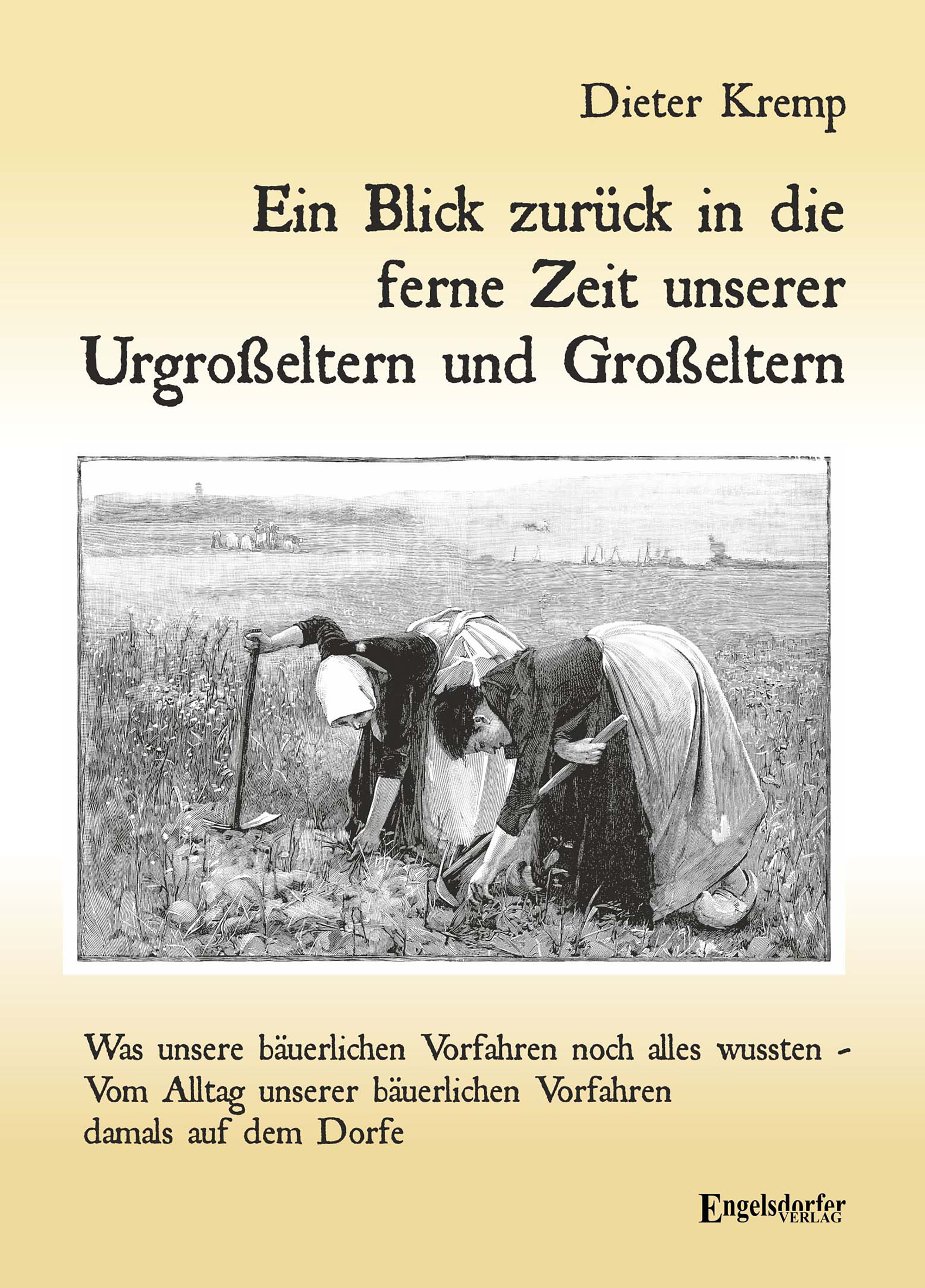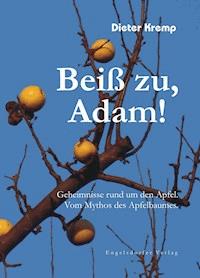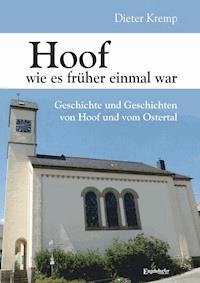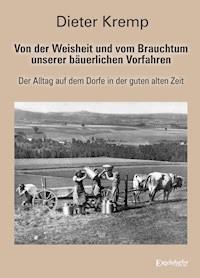
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Erinnerungen an die gute alte Zeit« und an die bäuerliche Vergangenheit unserer Vorfahren hat der mehrfache Autor Dieter Kremp als einen wahren Schatz unserer Ahnen zusammengetragen. Er spricht von der Weisheit und vom alten Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren auf dem Dorf, von unseren Urgroßeltern und Großeltern – so wie es früher einmal war, was alles längst verschwunden ist. Einfühlsam und nachdenklich schildert der Autor das bäuerliche Leben auf dem Dorf und streut dabei viele eigene Erinnerungen aus seiner Kindheit mit ein. Dieter Kremp entführt die Leser in die fast vergessene Welt des Dorfalltags früherer Zeiten. Viele Menschen träumen heute vom »Zurück zur Natur«, vom einfachen Leben auf dem Lande, und sie schwärmen eben von der »guten alten Zeit«, in der die Technik noch nicht das Leben beherrschte. Der Leser erfährt, was unsere Vorfahren auf dem Lande im Haus, im Stall, in der Scheune, auf dem Hof und auf dem Feld Tag für Tag, im Sommer und im Winter, alles leisten mussten und wie sie ihre spärliche Freizeit verbrachten. So war es »damals auf dem Dorfe«. »Einst war der Gartenzaun ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten«, erinnert sich Dieter Kremp. »Hier arbeitete man nicht nur tagsüber, hier wohnte und feierte man auch an lauen Sommerabenden. Am späten Abend nach getaner Arbeit saß man gemütlich unter dem Walnussbaum zusammen, der als Dorfbaum zu jedem Bauernhof gehörte, wohl wissend, dass der Geruch der Walnussblätter Stechmücken vertrieb.« Wer Sinn für das Alte, kernhaft Gute hat, findet in diesem Buch einen unerschöpflichen Begleiter durch das ganze bäuerliche Arbeitsjahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kremp
VON DER WEISHEIT UND VOM BRAUCHTUM UNSERER BÄUERLICHEN VORFAHREN
Der Alltag auf dem Dorfe in der guten alten Zeit
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2016
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelfoto © Tino Hemmann
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Weißt du noch, wie es früher auf dem Dorfe einmal war? Es gibt einen „Garten Eden“, ein Paradies auf Erden, aus dem wir nicht vertrieben werden. Es ist das Paradies der Erinnerungen an unsere Kindheit.
Je älter wir werden, umso stärker tauchen die Erinnerungen an unsere Kindheit in uns auf. Und oft schwelgen wir in längst vergangenen Zeiten – und unstillbare Wehmut lässt uns Tränen vergießen.
Der pensionierte Rektor und bekannte Autor Dieter Kremp schildert in diesem Buch einfühlsam und nachdenklich das bäuerliche Leben in den vierziger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, oft in Anlehnung an seine eigene Familiengeschichte. Der Autor entführt in die fast vergessene Welt des Dorfalltags.
„Einst war der Gartenzaun ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten“, erinnert sich Dieter Kremp. „Hier arbeitete man nicht nur tagsüber, hier wohnte und feierte man an lauen Sommerabenden. Am späten Abend nach getaner Arbeit saß man gemütlich unter dem Walnussbaum zusammen, der als Dorfbaum zu jedem Bauernhof gehörte, wohl wissend, dass der Geruch der Walnussblätter Stechmücken vertrieb.“
Das Buch ist gewidmet meinen Urgroßeltern Magdalena und Konrad Raber, meinen Großeltern Karl und Karoline Neu, Margarethe und Ludwig Kremp, meinen Eltern Bertha und Ludwig Kremp, und als Vermächtnis für unsere Vorfahren meinen Enkelkindern Helena, Joshua und Samuel.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten
Der alte Bauernhof
Hausschlachtungen früher
Wie Großmutter noch Sauerkraut einlegte
Als Großmutter noch den „Laxem“ rührte
Als es noch Eichelkaffee und Bucheckerferien gab
Wenn die Zeit eilt
Spinn- und Strickabende unserer Vorfahren
Als es noch Eisblumen am Fenster gab
Eisblumen am Fenster
Als die Kornmutter noch im Kornfeld wachte
Vom „Korekaschde“ und dem „Kaffeeblech“
Die erste und die letzte Garbe
Gut gedengelt und gesenst
Als es den „Wannerschdaach“ noch gab
Schalmeien am Kuckuckstag
Das Brauchtum des Maisingens
Neue Besen kehren gut – In der Besenbinderstube meines Großvaters
Vom Pflügen, Eggen und Säen unserer bäuerlichen Vorfahren im März
Als die Schulmeister noch bettelarm waren
Selbst gesponnen, selbst gemacht
Das Zimtwaffeleisen meiner „Großel“
Vom „Strohpatt“ und der „Binsegoth“
Von der „Katzenmusik“ bis zum „Leichenimbs“
Als noch das „Heimsje“ auf dem Bauernhof auf der Pirsch war
Der „Pfingstquak“ im Ostertal
Als die Frösche noch quakten
Als die „Kersche“ noch „bockich“ waren
Mit der Schelle unterwegs: „Pass off, de Schitz kommt meddem Stecke“
Vom Großknecht und vom Kleinknecht auf dem Bauernhof
Vom Aberglauben im Ostertal
Von der Bullenzucht früher im Bauerndorf
Der Hahn, der Ritter im Dorf
Als der „Grombierekewwer“ noch von Schulklassen auf den Kartoffelkäfern abgesammelt wurde
Von Bauerntrachten im Dorf
Das alte Bauernhaus
Hausbau und Richtfest
Der Einzug in das neue Haus und die damit verbundenen Bräuche
Gegenstände mit schützenden Eigenschaften im und am Bauernhaus sowie heilige Tiere und Pflanzen
Sitten und Bräuche der Volksgemeinschaft im Wandel eines Jahres
Wie meine Großmutter noch die „schäle Migge“ vertrieb
Von der Heublumenmedizin meiner Urgroßmutter
Als noch Fuhrleute und Kutscher auf den Dorfstraßen unterwegs waren
Allerlei Aberglauben um die Rabenvögel
Als die Dorfstraßen noch gekehrt wurden
„Wo ein Schaf hingeht, da gehen sie alle hin“ - Vom Schafhirt im Bauerndorf
Bauerntracht – Selbstgemacht
Die Rezepte der Bauersfrau, der halben Doktorin
Eigener Herd ist Goldes Wert
Die vielen Berufe der Bauersfrau
Der Bauer- der Patriarch auf dem Hof
Vom krumm und bucklig Schaffen der Bauern
Der Sperling auf dem Dach
„Maikäfer, flieg …“
Maikäfer Summsebrumm
„Er liebt mich, liebt mich nicht …“
Seifenblasen auf der Wiese
Als früher noch die Glühwürmchen in der Johannisnacht leuchteten
Von fratzigen „Rommelboozen“ und Kartoffelfeuern
Drachen tanzten über den Stoppelfeldern
Vom Ostereiersuchen und der Hexennacht
Als noch die „Tratschtante“ im Dorf unterwegs war
Als noch die Kirmes „begraben“ wurde
Das „Kranzheraustanzen“ an der Kirmes
Von Haus und Hof und allem, was sich dort tummelt
Das liebe Vieh auf dem Bauernhof
In der „gudd Stubb“ meiner Urgroßmutter
Jahrmärkte nach der Erntezeit
Was Großvater noch wusste – Wie man Lagerkartoffeln und Obst überwintert
Was Großvater noch wusste – Der Trick mit den Kartoffeln
Wie die Saat, so die Ernte
Vom Aberglauben unserer Vorfahren zum Schutz der Ernte
Als es im Keller noch eine „Wäschkich“ gab
Von der Prügelstrafe und der Backpfeife in der Schule
Wie unsere Vorfahren Donner und Blitz bannten
Von „Bengeln“ und Nüssen
Auf der Ruhebank unterm Walnussbaum
Als das Schneeballwerfen auf den Straßen noch verboten war
Die Bäuerin war auch eine gute Hausmutter
Auf dem Bauernhof ständig auf der Pirsch – die Katze
Wenn der Maulwurf nervt
Kompost war die Sparbüchse für den Bauerngarten
Meine „Großel“ und ihre Barbarazweige
Vor 200 Jahren gab es noch Winterschulen – Die Lehrer waren damals Bauern und Handwerker
Friedhofsordnung früher: Im Leichenzug gehen der Lehrer und die Schuljugend vor der Bahre
Riechkräuter im Bauerngarten
Blumenschmuck im Bauernhaus
Ein Sträußchen Mutterkraut zum Muttertag
Zum Schmunzeln bestimmt: Aus Urgroßvaters Gartenratgeber von 1887
Was Großvater noch wusste: Säen nach dem Blühkalender der Natur
Die Maikönigin tanzte um den Maibrunnen
Maibrunnenfeste mit Frau Holle
Vom Tanz unter dem Maibaum
Auch die „Richtmaie“ beim Hausbau war ein Maibaum
Als meine Schwestern noch Ehelehre, Säuglingslehre und Erziehungslehre in der Schule hatten
Zur Hochzeit pflanzte man einen Apfelbaum
Großmutter und ihr Butterfass
Am Kuckuckstag schnitzte Großvater Rindenflöten für uns
Als es noch eine Landwirtschaftsschule gab
Was Großvater noch wusste: Der erfahrene Pflanzendoktor bei der Arbeit – wie er Ameisen und Maulwurfsgrillen bekämpfte
Der „Pfingstbutz“ holt den Sommer rein
Von Pfingstochsen und Hütejungen
Reges Brauchtum rankte sich um das „Wedihnachtsscheit“
Kulinarische Nachlese der Osterfeiertage unserer Vorfahren
Sympathetische Nützlichkeiten für den Garten von 1858
Großvaters allerliebste Apfel- und Birnensorten
Worüber wir heute schmunzeln
Was Großvater noch wusste: Schneckenfang mit Rhabarberblättern
Vom Hausbau und Richtfest unserer Vorfahren
Bäuerliche Rituale bei der Geburt eins Kindes
Allerlei Aberglauben rund um die Taufe
Alte Sitten und Bräuche rund um den Geburtstag
Der erste Schultag
Hochzeitszeremonien früher
Vom Hochzeitsessen
Tänze bei der Hochzeit
Vom Hochzeitshahn und dem Brautgeschenk
Jung gefreit, selten bereut
Vom Tod und der Beerdigung früher
Die letzte Stunde
Als noch Quecken und Raden im Kornfeld wuchsen
Als noch der „Wetz“ und das „Schessmähl“ im Garten wuchsen
Sympathetische Heilungen unserer bäuerlichen Vorfahren am Vieh
Sympathetische Kunststücke in Bezug auf den Menschen
Großvaters Birkensaft als Frühjahrskur
Sympathetische Nützlichkeiten für Großmutters Bauerngarten
Vom Pflügen, Eggen und Säen unserer bäuerlichen Vorfahren im März
Die Bedeutung der Pflanzen im Volksglauben unserer Vorfahren
Heiliger Baum
Alte mundartlich-bäuerliche Ausdrücke über die Getreidearten - Als noch die Spreu vom Weizen getrennt wurde
Sympathetische Heilungen von Krankheiten am Menschen
Das dörfliche Leben früher und die Dorfgemeinschaft
Die Dorfbewohner früher, ihre Nachbarschaft und ihre Verwandtschaft
Die Hausgemeinschaft früher auf dem Dorf
Der alte Bauernhof
Haus und Hof im alten Bauernhaus
Die Wohnstube im Bauernhaus und die Schlafkammern
Die Nahrung der bäuerlichen Familie
Der Alltag, der Werktag in der bäuerlichen Familie
Sonntag und Festtag bei unseren bäuerlichen Vorfahren
Das religiöse Leben, Fasten und Wallfahren unserer bäuerlichen Ahnen
Vom Aberglauben im Leben unserer bäuerlichen Vorfahren
Der Apfelbaum in magischen Handlungen unserer Vorfahren
Jakobsfeste zu Beginn der Getreideernte
Was Großmutter noch wusste: Säen nach den Zeichen der Natur
Kartoffelfeste und Hahnenwettkämpfe am Gallustag
Wenn Kühe auf der Weide waren
Großvaters Gartentipps fürs Säen, für Gurken und Kartoffeln
Hexerei und Zauber mit dem Johanniskraut
Vor Unterrichtsbeginn mussten die Kinder noch den Stall reinigen
„Schliwwersch Louis“
Getreideernte im Laufe der Zeiten
Erntebräuche – Erntefeste unserer Vorfahren
Als es noch Abtritte und Aborte im Dorf gab
Als es noch Kartoffelferien für die Schulkinder gab
Als die Bauern die Knechte und Mägde noch dingten – Im Ostertal gab es früher auch noch das Weiberdingen
Als es noch Eichelkaffee gab – Großmutters uraltes Rezept
Großvaters Magenwärmer
Vom Brauchen und alten Hausmitteln
Tanzveranstaltungen waren für Schüler verboten
Großvaters Umgangsformen mit den Gartenpflanzen – Vom Gießen der Pflanzen
Bei Großvater geht es jetzt um die Zwiebeln
Rund um den Stammtisch – Ergo bibamus!
Das Birkenreis war die Lebensrute
Die Birke war der Hexenbaum unserer Vorfahren
Sympathetische Kunststücke unserer Vorfahren mit Tieren, in Bezug auf die Natur und mit Speisen und Getränken
Vom Tanzvergnügen früher auf dem Bauerndorf
Bräuche unserer Vorfahren am Hubertustag
. . . und wir schämten uns
Das Schlachtvieh ist vor der Tötung durch Stirnschlag mit Beil oder Keule zu betäuben
Die Hauskobolde unserer bäuerlichen Vorfahren
Familienbräuche im bäuerlichen Leben unserer Vorfahren
Kräht der Hahn auf dem Mist …
Des Bauern Schlankheitskur
Vom Fruchtbarkeitszauber bei der Ernte
Erntedank früher und heute
Ährenrauschen
Was man früher auf dem Lande las
Meine Tante „Lottche-Goth“ und ihre 14 Kinder
Das Bild der Mutter
Harte Arbeit – Frohe Feste
Wenn die Bauern nicht wären …
„Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum …“
Das liebe Vieh des Bauern
Warum der Storch die kleinen Kinder bringt
Vom Zauber der Pflanzen in der Walpurgisnacht
Der Polterabend vor dem Hochzeitsfest
Glöckchen vertreiben die Hochzeitsgeister
Brot – glücksbringendes Hochzeitsessen
Die früheren Arbeiten in Haus, Hof und Feld eines Bauernhofes
Kultstätten im Bauernhaus
Wie die Bauernfamilie früher die Geister und Dämonen abwehrte
Sympathetische Kunststücke, um Ungeziefer, Ratten und Mäuse zu vertreiben
Sympathetische Heilungen und Nützlichkeiten rund um den Wein
Kräuter, die Hexen an ihrem verderblichen Treiben hindern
Mit dem „Quak“ an Pfingsten durch das Dorf
Äpfel durften früher am Christbaum nicht fehlen
Sitten und Brauchtum im Lebenslauf des einzelnen (Kindheit)
Alte Bauerntrachten
Das ländliche Haus – das Bauernhaus früher
Vom Geflügel auf dem Bauernhof
Die magische Funktion des Mobiliars im Bauernhaus
Eine bäuerliche Legende aus Frankreich
Schluss mit dem Floh-Zirkus! Wie Großvater die Erdflöhe im Garten austrickste
Magische Schmuckelemente zum Schutz des Hausrats
In den Winterschulen von einst waren die Lehrer auch Bauern und Handwerker
Altbäuerliche Rituale zum Schutz der Ernte und des Viehs
Sympathetische Nützlichkeiten für den Garten – aus dem Handbüchlein der Sympathie von 1858
Das Bauernhaus in der Tradition: eine Stätte des Brauchtums und des Kults
Von der „Gottlosigkeit“ der Menschen im Ostertal
Großvater ließ der „kalten Sophie“ keine Chance
Aus dem Schultagebuch von 1842: Die Lehrer hatten einen Drang zur Trunkenheit – Die Kinder „schwänzten“ die Schule
Die Reinlichkeit in den Schulen ließ zu wünschen übrig – Abtritte und Pissoire sind besonders zu reinigen
Die alten Bauernhöfe und ihre aufgemalten Zauberzeichen
„Im Märzen der Bauer …“
Wenn Gärtner in den Mond gucken
Als die Kinder noch „Heppelches“ und „Kliggerches“ spielten
Unsere Urahnen aßen bereits Blumen
Das kannten noch unsere Großmütter
Die „vergessene“ Haferwurzel, die weiße Schwester der Schwarzwurzel
Die Süßkartoffel wird auch Batate genannt
Auch die Kerbelrübe ist aus unserem Bauerngarten verschwunden
Topinambur, die „Süßkartoffel“ für Zuckerkranke, kommt wieder in Mode
Früher war die Puffbohne in jedem Bauerngarten zu Hause
Rapontika war für Goethe ein Gourmetgemüse
Auch Pastinak ist heute als Wurzelgemüse fast unbekannt
Goethe liebte die Teltower Rübchen
Als die „Lavendelweiber“ noch unterwegs waren
Balsam für die Seele
Als der Zichorienkaffee noch das Standartgetränk in der Küche war
Völlig vergessen: Der Gute Heinrich als Frühgemüse
Ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten
Einst war der Gartenzaun ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten. Zaunwinden, Vogelwicken und Kapuzinerkressen an den Holzlatten und Pfählen umrankten die Zäune mit ihren Fingern; der Holunderstrauch in der Ecke malte Motive unserer Vorfahren als Schatten in das Gartenbeet. Wenn der Bauer am frühen Morgen in den taufrischen Garten ging, war folgendes das erste was er tat: „Er zog den Hut ab vor dem Holunder“, galt er doch bei unseren Vorfahren als „heiliger Strauch“ und gleichzeitig als lebendige Hausapotheke. Oft stand der Hollerstock dicht am Hausgiebel, weil man glaubte, er könne das Haus vor Blitzschlag schützen. So hatte auf dem Dach auch die Donner- oder Hauswurz ihren Stammplatz, schützte doch auch sie Haus und Scheune vor Blitzschlag.
Dahlien, Astern, Gladiolen und Georginen drängten prunkvoll zwischen dem Gartenzaun, der im Alter oft moosbedeckt war. Stockrosen, Malven, Alant, Eibisch und die Engelwurz eiferten in ihrer bunten Vielfalt und in ihrer majestätischen Größe um die Wette. Über den Gartenzaun schob die Sonnenblume neugierig ihr goldenes Löwenhaupt. Der schönste Zaun im Dorf war der einfache Lattenzaun, vor allem deshalb, weil er dem Pflanzenreichtum keinen Einhalt bot. Hinter dem Gartenzaun begann eine eigene, kleine wundersame Welt der Bauernfamilie. Hier arbeitete man nicht nur tagsüber, hier wohnte und feierte man an lauen Sommerabenden. Jeder Zaun erzählt seine eigene Geschichte.
Die Blumenbegeisterung meiner Großmutter machte am Zaun nicht halt, so dass auch noch der Rand der Dorfstraße mit farbenfrohen Stauden und Edelrosen geziert war. Hier hatte auch die Pfingstrose ihren Stammplatz und in ihrer Nähe auch der lilafarbene Fliederstrauch. In ihrem Reich spielte auch der ambrosianische Duft von Pflanzen eine Rolle. Ein Sträußchen gepresster Duftminzen und Thymian im Gebetbuch sollte mit seinem Aroma während der Sonntagspredigt die Bäuerin wach halten, die ja schon vor dem Kirchgang ein hartes Arbeitspensum hinter sich hatte. Und im Gartenbeet durfte auch das Mutterkraut nicht fehlen, das als „Mottenkraut“ im Kleiderschrank die Motten abwehrte.
Am späten Abend nach getaner Arbeit saß man gemütlich unter dem Walnussbaum, der als Dorfbaum zu jedem Bauernhof gehörte, wohl wissend, dass der Geruch der Walnussblätter Stechmücken vertrieb.
Doch am allerschönsten war an lauen Sommerabenden der Plausch in der Gartenlaube, die früher in keinem Bauerngarten fehlen durfte.
Der alte Bauernhof
Hinter dem Garten am nahen Wiesenhain
stand unser altes Bauernhaus,
wo Efeu und wilder Wein den Gipfel umrankten,
wo Sonnenblumen thronten am Gartenzaun,
Stockrosen und Eibisch im Vorgarten prangten.
Am Abend drang der silberne Mondenschein
durch die gemütliche Laube hinein:
Ein kleines Paradies auf Erden, ein trautes Heim.
Ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten
öffnete den Blick auf Großmutters Garten,
wo schlanke Edelrosen sich zur Pose stellten
und Käfer schwirrten auf moosigen Platten.
Vogelwicken umwanden die alten Pfosten,
mit ihren langen, gebogenen Fingern,
sie drehten ihren Blütenhals nach Osten,
Heidebeeren im Gesträuch der Hecken ringten,
Lavendel in dem Kräuterbeet
seinen Sommerduft ins Hause weht.
Der heilige Hollerstock stand dicht am Giebel
und auf dem Hausdach in den alten Ziegeln,
die Donnerwurz das Haus vor Blitzschlag schützte:
Großvaters Aberglaube, der sich im Sommer nützte.
Im Kräuterbeet das alte Mutterkraut,
es schützte in der Nacht das Kleid vor Motten,
im Kleiderschrank ein Säckchen hing,
das frische Heu stark duftete nach Cumarin,
woraus die Bäurin einen Tee gebraut
und Perlentau drang aus der Gräser Soden.
Hut ab, vor dem Holunder!
Das war die erste Prozedur,
wenn Großvater am frühen Morgen
in die Wunderwelt des Gartens trat,
geheilt von allen finstren Sorgen
für seinen ganzen arbeitsreichen Tag.
Wenn sich die Bäuerin zur Ruhe legte
nach einem schweißerfüllten Tag,
sie in der späten Nacht das Beten pflegte,
wo unter ihrem Kissen der Lavendel lag.
Großmutter war das Heimchen am Herd,
wo Bratäpfel im Winter sprühten
und im Advent die Zimtwaffeln glühten.
Der süße Duft zog durch den ganzen Raum:
Auch heute noch für mich ein Kindheitstraum!
An Weihnachten das Scheitholz brannte,
die heißen Gluten durch die Stube flammten.
Großvater am Kamin schlief ein,
die Müdigkeit zog ihn in den wohlverdienten Schlaf hinein.
Er war der Herr der alten Scheune,
im Stall war es der große Knecht,
die junge Magd die Herrin auf dem Felde:
Zusammen sich erfüllten alle Bauernträume,
ein jeder mit der schweren Arbeit kam zurecht.
Sie waren alle vier im Bauerndorf die Helden.
Der Hahn, er war der Ritter auf dem Hof,
am frühen Morgen er den Bauern weckte,
die große Hühnerschar sich um ihn reckte,
schon ging die schwere Arbeit los.
Am späten Abend nach getaner Arbeit,
saß man gemütlich unterm Walnussbaum,
es war die erste kurze Ruhezeit,
nach vielen Stunden im alten Gartenraum.
Ich höre heute noch die Bäurin rufen,
wenn Mäuse in der Tenne tobten,
zart in der Stimme, sanft im Ton:
„Heimsje komm! Heimsje komm!“
Die Katze war der Wächter auf dem Hof,
sie war die Herrin in der vollen Tenne,
und in der Nacht stets auf der Pirsch,
mit Arien ihrer Miezenklänge
ließ sie im Stall die Winde los,
wenn sie durch Haus und Hofe schlich.
Im Frühjahr war’s der Schwalben Sang,
die in der Scheune ihre Nester bauten,
im Sommer war es Großvaters Sensenklang,
der am frühen Morgen unser Herz erfreute,
wenn auch die Morgenglocken läuten.
Im frühen Herbst die Heimchen in der Stube zirpten,
die Grillen auf dem Ährenfeld,
die letzten Schwalben an den Drähten schwirrten:
die volle Ernte war bestellt.
Das Heimchen am Herd,
das Heimchen im Zimmer,
das Heimsje im Haus!
Die alten Gesichter kleiden sich aus
für ewig und immer.
Wo ist die Zeit geblieben?
Wann kommt sie wieder,
die gute, alte Zeit?
Sie ist von uns geschieden
hernieder in ein Armenhaus.
Wann geh’n die Lichter aus
im alten Bauernhaus?
Großmutter, Mutter, Enkel und Kind,
in einer Stube zusammen sind:
Das war einmal
vor langer Zeit.
Kommt sie zurück geeilt?
Wir haben unsre Zeit gestohlen,
die schwangren Ackerschollen und die Gartenbohlen,
den alten Bauerngarten und das Bauernhaus:
Die Lebenslichter auf dem Dorf –
Sie gehen aus.
Hausschlachtungen früher
Früher waren Hausschlachtungen ein fester Bestandteil des bäuerlichen Jahresablaufes. Traditionell waren November und Dezember die Monate der Schlachtfeste, um genügend Fleisch und Wurst für den Winter zu haben und weil die Lebensmittel in der kälteren Jahreszeit besser haltbar waren. Am Vortag wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Man brauchte Töpfe, Schüsseln, Schürzen, Tücher, Gewürze und Kräuter. Auch die Leitern zum Aufhängen der Schlachthälften durften nicht fehlen.
Am Schlachttag selber wurden viele helfende Hände benötigt, denn Fleisch, Eingeweide und Blut mussten noch im warmen Zustand zu verschiedenen Wurstsorten verarbeitet werden. Leberwurst, Schwartenmagen, Presskopf und Blutwurst fehlten auf keiner Schlachtplatte. Es wurde Fett ausgelassen, eingesalzen, gepökelt und geräuchert. Im ganzen Dorf roch es nach Kesselfleisch und Wurstsuppe.
Nach getaner Arbeit standen die Schweinehälften senkrecht an Leitern gebunden zum Auskühlen an der Hauswand. Hing das Schwein an der Leiter, wurde nach alter Tradition eine Runde Korn ausgeschenkt. Alle Helfer wurden mit Naturalien in Form von Fleisch und Wurst vom frisch geschlachteten Schwein bezahlt.
Hatte man am Kalender einige günstige Tage für die Schlachtung ermittelt, wobei der nächste Neumond den Ausschlag gab, dann bestimmte der bestellte Hausschlachter den genauen Termin und die Stunde, wann alles bereit sein musste. In den Tagen um den Neumond herum durfte nicht geschlachtet werden, man wusste aus alter Erfahrung, dass sich dann das Dauerfleisch nicht gut hielt. Es musste morgens sehr früh geschlachtet werden, um viel Zeit zum Auskühlen zu gewinnen, denn noch am gleichen Tage abends erschien der Schlachter zum zweiten Male, um das Schwein zu zerlegen.
Zu den Vorbereitungen der Schlachtung gehörte es zunächst, dafür zu sorgen, dass das zu schlachtend e Schwein einen Tag lang vorher nicht gefüttert werden durfte, denn das erleichterte sehr die Schlachtarbeiten. Die Hausfrau und die Mägde hatten einen ganzen langen Tag Arbeit, um ordnungsgemäße Vorbereitungen zu treffen. Erfolgte das Schlachten in der Waschküche, so wurde diese zuerst geschrubbt, fehlte es aber an einem passenden Raum oder war die Temperatur im Hause zu warm, so machte man draußen im Hof eine Stelle sauber und bedeckte den Boden mit einer Schütte Roggenstroh als Unterlage beim Schlachten.
Ein Knecht musste dem Schlachter helfen. Er ergreift das Schwein am Sterz und hält es fest, bis der Schlachter den Strick um ein Hinterbein geschlungen hat, so haben die beiden das Schwein in der Gewalt und führen es an den Ort, an dem es geschlachtet wird.
Über die Tötungen gab es ganz früher keine Bestimmungen. Das Schwein wurde auf eine Seite gelegt, Knechte und Schlachter knieten sich darauf, und dann machte der Schlachter mit seinem langen Messer einen Schnitt in die Kehle und durch die Drossel, eine Magd fing das ausströmende Blut mit einer Pfanne auf und schüttete es in einen Topf, in dem es mit einem langstieligen hölzernen Löffel so lange gerührt wurde, bis das Schwein ganz ausgeblutet war. Das Rühren erfolgte deshalb, um Klumpenbildung im Blut zu verhindern. Während der ganzen Prozedur des Schlachtens schrie das Schwein ganz unbändig laut, dass man es weithin hören konnte.
Am späten Abend setzte der Schlachter seine Arbeit fort. Ein Hauklotz auf drei Beinen, ein großer Tisch und eine Reihe großer Töpfe standen in der Waschküche bereit. Die Hausfrau gab nun dem Schlachter Anweisung, wie die Zerteilung erfolgen sollte. Die großen Stücke wie Beine und Speckseiten wurden im Keller im Pökelfass eingesalzen, Rippen-, Nacken- und Bratenstücke wurden zunächst auf dem Fleischboden zum Trocknen einige Tage aufgehängt, dann eingekocht.
Alle Mettwürste und alle im großen Kupferkessel gekochten Leber- und Blutwürste wurden zunächst einige Tage zum Trocknen aufgehängt und dann in der stockdunklen Räucherkammer im Speicher geräuchert. Der Rauch des Backofens wurde zu dieser Zeit dann durch die Räucherkammer geleitet. Manche Stücke blieben hier monatelang hängen, bis sie zum Verbrauch heruntergeholt wurden. Nach zwei Wochen wurden auch die Schinken und die Speckseiten aus dem Pökelfass herausgeholt, abgewaschen, getrocknet und ebenfalls zum Räuchern in der Räucherkammer aufgehängt.
Wie Großmutter noch Sauerkraut einlegte
„Eben geht mit einem Teller
Witwe Bolte in den Keller,
Dass sie von dem Sauer’kohle
Eine Portion sich hole,
Wofür sie besonders schwärmt,
Wenn er wieder aufgewärmt.“
Wie Wilhelm Buschs Darstellung zeigt, war Sauerkraut auch schon früher recht beliebt – und der Oktober mit der weißkrauternte bietet sich wie kein anderer Monat an, einige Portionen für den Eigenbedarf selbst herzustellen. Das Einsalzen von Sauerkraut ist nicht nur eine recht einfache und vergnügliche Arbeit für die private Vorratshaltung, sondern beschert dem winterlichen Küchenzettel eine gesunde Bereicherung.
Sauerkraut entsteht, weil Hefepilze und Milchsäurebakterien im Weißkohl eine Gärung bewirken. Sie wandelt den Großteil der vorhandenen Kohlenhydrate in Milchsäure um. Diese desinfiziert regelrecht den Darm, bekämpft Fäulnisvorgänge und wirkt im Körper ähnlich gesund wie Sauermilch und Joghurt. Dazu kommen noch die Vitamine des roh verzehrten Sauerkrauts- und seine bekannte Bedeutung als Schlankmacher oder Schlank-Erhalter. Am selbst eingelegten Sauerkraut wird besonders Großmutters „Hausmachergeschmack“ gerühmt: Durch kleine Veränderungen in der Würze und bei den Zutaten erhält jedes Kraut seinen unverwechselbaren Geschmack. Sauerkraut mit Kasseler und Bier - ein deftiger Schmaus, der den Deutschen den Spitznamen „die Krauts“ eingebracht hat, aber immer eine genussvolle Mahlzeit verspricht.
Die zum Einlegen von Sauerkraut bestimmten Steintöpfe werden gründlich gescheuert, mit heißem Wasser ausgespült und getrocknet. Feste, frische Weißkrautköpfe werden von der äußeren, unansehnlichen und losen Blättern befreit. Je nach Rezept werden die entsprechenden Zutaten hergerichtet, ein Leintuch wird in klarem Wasser ausgekocht und ein größerer Stein besorgt.
Einmachen: Die gesäuberten Weißkohlköpfe fein hobeln – auf 5 kg Weißkraut ca. 100 g Salz zugeben – das Kraut abwechselnd mit Salz in den vorbereiteten Steintopf stampfen ( mit der Hand, der Faust oder einem Holzstampfer lagenweise so fest einstampfen, dass der Saft jeweils über dem Kohl steht) – am Schluss alles mit dem Tuch abdecken, mit Brett und Stein beschweren – zugedeckt ca. 4 bis 6 Wochen an einem kühlen Ort gären lassen.
Hinweise für Veränderungen: 1. Möglichkeit: auf 5 kg Weißkraut ca. 1 Pfund geviertelte Äpfel oder Apfelscheiben einschichten (Apfelkraut).
2. Möglichkeit: Wacholderbeeren, Lorbeer- oder Weinblätter mit einschichten (Würzkraut). Hinweis: Manche bevorzugen es, Lorbeer und Wacholder erst beim Kochen dazuzugeben, wodurch der Würzgeschmack weniger intensiv wird.
3. Möglichkeit: Eine böhmische Variante für die Herstellung einer größeren Menge ist: Auf 50 Pfund Kraut 250 g Salz, 1 Päckchen Kümmel, 5 Pfund geschälte Zwiebeln mit in das Kraut hobeln; dazu 4 bis 5 Pfund geschälte, entkernte Äpfel in die Achtelstücken lagenweise einschichten (Böhmisches Kraut).
Kontrollen: Spätestens alle zwei Wochen Tuch, Brett und Stein sauber abspülen – falls die Salzlake im Winter das Kraut noch mehr bedeckt, erkaltete Salzlösung nachfüllen (10 g Salz pro Liter Wasser) – das Kraut möglichst nicht mit Metall-, sondern mit Holzgabeln oder Holzlöffeln aus dem Steintopf herausnehmen.
Als Großmutter noch den „Laxem“ rührte
Aber eine weitaus größere Arbeit war das „Auskäären“ (entsteinen) und das „Einschäle“. Da musste alles helfen, was Hände hatte. Da saßen am Abend bis tief in die Nacht hinein alle „Weibsleit“ im Hause auf den „Stühlchen“ und entsteinten die blauen Früchte. Großmutter war die „Chefin“. Aber da halfen auch die Tante und die „bas“ (Cousine), die „Goth“ (Patentante) und die Nachbarin. Da gingen die Hände sowie die Mäuler geschmiert und schnell. Da wurde getratscht und „lawadscht“, geplaudert und „gemait“. So ein paar Zentner Zwetschgen wollten entsteint, Körbe voller Birnen geschält sein. Denn was ist „Latschriehre“ („Laxemrühren“) ohne Witz und Scherz! Mein Großvater gab gerne einen Krug „Süßen“ oder „Bitzler“ aus, neuen „Biere- oder Traubenwein“ zum Besten. Da schaffte es sich noch einmal so leicht, wenn ein bisschen Humor die sonst langweilige Arbeit würzte.
Kaum waren die letzten Körbe van der Reihe, richtete Großmutter schon den Kupfer- oder Emailkessel her, sorgte für gutes Brennmaterial und einen guten „Rührer“. Da herrschte dann Hochbetrieb in der „Worschdkich“ (Wurstküche) oder in der „Wäschkich“ (Waschküche). Die Luft war geschwängert vom Dunst und Musgeruch. Da brotzelte es Tag und Nacht. 24 bis 48 Stunden dauerte die Arbeit des Einkochens. Da musste die brodelnde Masse dauernd gerührt werden, damit das Mus nicht anbrannte. Hier zeigte sich die gute Nachbarschaft, die alte Dorfgemeinschaft allzeit hilfsbereit. Etwas Gutes zu essen und zu trinken gab es, Bohnen- oder Zichorienkaffee und Zwetschgenkuchen gehörte dazu.
In fein gesäuberte und gesüßte „steinerne Hawe“ (Töpfe) wurde der Laxem nun eingetopft und sorgsam verschlossen. Jede Hausfrau hatte eine „Spezialität“ beim Einkochen. Meine Großmutter nahm recht viel Gewürze, Nelken und Ingwer, meine „Tilchegoth“ Mathilde vermengte die Zwetschgen mit Nüssen oder Holunder, die „Annagoth“ mit recht vielen Mostbirnen.
Wir Kinder bekamen am nächsten Morgen eine große „Laxemschmeer“ mit zur Schule. Nach der Pause hatten die meisten einen saftigen braunen „Schnorres“ (Schnurrbart). Die größte Freude der Kinder aber war dann das Auslecken der geleerten Latwergkessel. Da pappten Gesicht und Hände von der süßen „Schmeer“ (Mus, Marmelade).
Laxem heißt auch „Latwerg“ oder „Latwerich“. „Latwerg“ ist eigentlich ein eingedickter Heilsaft, der „geleckt“ wurde. So wurde der „Huf-Lattich“ als Brustsirup eingedickt und „geleckt“.
Als es noch Eichelkaffee und Bucheckerferien gab
Zwei uralte Rezepte, die bei den Großmüttern im Herbst auf dem Küchenplan standen, waren Apfelringe und Eichelkaffee. Die Äpfel wurden in Scheiben geschnitten, die auf einem Backblech ausgelegt und im Backrohr bei niedrigster Wärme leicht angetrocknet wurden. Jetzt wurden die Apfelringe einzeln an einem langen Faden aufgereiht und an der Luft zum Trocknen aufgehängt. Aber nicht in der prallen Sonne! das zerstörte Geschmack und Vitamine. Die getrockneten Apfelringe wurden in Papiertüten verpackt und für den Winter im Vorratsschrank aufbewahrt. Unsere Vorfahren nutzten alles, was die Natur im Herbst hervorbrachte. Selbst die Baumfrüchte des Waldes waren gefragt: Eicheln, Buchecker, Haselnüsse, Hagebutten und Kastanien.
Nur noch den Ältesten ist der Eichelkaffee bekannt. Die Eicheln wurden geschält, das Fruchtinnere klein geschnitten. Es wurde in einer Pfanne ohne Fett braun geröstet. Es durfte nicht anbrennen oder sogar schwarz werden. Die braun gerösteten Teile wurden in einem Mörser zu Pulver zerstoßen. Auf eine Tasse Kaffee kam ein gestrichener Teelöffel Eichelpulver. Kurz aufgekocht, abgeseiht, mit Zimt etwas gewürzt und mit Milch gemischt, war Eichelkaffee ein beliebtes Getränk auf dem Land.
Mein Großvater Ludwig erzählte mir noch von den Schweinehirten auf dem Dorf, die im Spätherbst zur Zeit der Eichelmast die Schweine in den Eichenwald trieben und dort wochenlang hüteten. Eichelmast war wohl das beliebteste Futter für die Schweine.
Aus Rosskastanien stellten unsere Vorfahren Mehl her. Kastanien schmecken bekanntermaßen recht bitter. Und so trieben unsere Vorfahren die Bitterstoffe aus den Rosskastanien heraus: In einem Feuer stark erhitzte Steine wurden in ein Erdloch gelegt. Da hinein schüttete man die Kastanien und deckte sie mit heißer Asche zu. Nach einem Tag waren die Kastanien gegart und wurden mit einem Stein zerstampft. Der Mehlbrei kam in einen engmaschigen Korb, der in einen klaren Bach gestellt wurde. Zwei Tage lang floss das Wasser durch den Korb. Dann wurde das Mehl ausgedrückt. Auch ein Klebstoff steckt in den Kastanien. Buchbinder und Tapezierer haben früher einmal daraus Leim hergestellt. Aus den geschälten Kastanien hat man sogar Seife gewonnen.
Im Krieg und in den Hungerjahren danach hat man sackweise Bucheckern gesammelt. Es gab damals sogar Bucheckerferien, damit Mutter und Kinder gemeinsam die ölhaltigen Früchte sammeln konnten. Buchecker schmecken gut, doch sollte man nicht zu viele davon knabbern. Vorsicht ist geboten, denn roh enthalten sie den giftigen Inhaltsstoff Fagin. Meine Mutter und ich schleppten den vollen Sack mit den Bucheckern zur benachbarten Ölmühle nach Fürth im Ostertal, wo Öl daraus gepresst wurde. Aus 100 Kilogramm Bucheckern gewann man 12 Liter Speiseöl. Das Öl ist nach dem Erhitzen frei von giftigen Stoffen. Meine Mutter hat sich immer übe r den Ölmüller beschwert: „Wir wurden mal wieder beschess („geneppt“).“ So war es wohl auch.
Im Krieg und in den beiden Hungerjahren danach gab es auf dem Dorf auch Kartoffelferien. Zusammen mit den Eltern und Großeltern mussten dann die Kinder bei der Kartoffelernte helfen.
Wenn die Zeit eilt
Die Jahre drehen sich im Kreise,
die Zeit pocht leise.
Immer schneller wird der Schritt,
der ins Alter tritt.
Das Rad der Zeit steht nie still,
weil Gott es so will.
Es dreht sich
unaufhörlich.
Die Uhr tickt,
das Leben strickt
seine irdischen Fäden.
Spinnen gehen auf die Reise
im Herbst des Lebens.
Doch der Winter kommt ganz leise,
unaufhaltsam, nicht vergebens.
Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
zögernd kommt die Zukunft angezogen,
ewig still steht die Vergangenheit:
Herr, es ist Zeit!
Falten, wie Jahresringe im Gesicht,
walten
über das Leben.
Die Zeit ist reif:
Jetzt ist es Pflicht,
eine Antwort zu geben,
denn langsam werden die Hände steif.
Je älter wir werden, um so stärker tauchen die Erinnerungen an unsere Kindheit in uns auf. Und oft schwelgen wir in längst vergangenen Zeiten – und unstillbare Wehmut lässt uns Tränen vergießen.
Spinn- und Strickabende unserer Vorfahren
Dornröschen fiel in einen hundertjährigen Schlaf, nachdem es sich mit der vergifteten Spindel gestochen hatte. „Was ist eine Spindel?“, würde heutzutage ein Kind fragen, dem man das Märchen vom Dornröschen erzählt.
In den Märchen spinnen die Königstöchter, in den Sagen die Göttinnen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gehörte das selbstgesponnene und selbstgewebte Leinen zum hochgeachteten Aussteuerschatz.
Spinn- und Strickabende gehören der Vergangenheit an. Erinnerungen an Spinnstuben und Bratäpfel werden wach. Die Bratäpfel brutzelten auf der heißen Ofenplatte. Aus der schwarzgebrannten Schale tropfte dicker, brauner Saft. Süßer Duft erfüllte den Raum.
Spinnen und Stricken waren die wichtigsten Winterarbeiten der Frauen. Zum ersten Spinnabend traf man sich in der Regel am letzten Donnerstag im November. Das konnte der Katharinentag sein. Die heilige Katharina ist die Patronin der Spinnerinnen.
In manchen Orten war es eine bestimmte Bäuerin, die die Spinnstube abhielt. In anderen Gemeinden wanderten die Spinnerinnen von einem Haus zum anderen. Man sparte in den Dörfern. Kerzen waren teuer, und auch das Petroleum war ein Luxus. Aber wenn man sich abwechselnd in einer Stube zum Spinnen, Singen und Spielen traf, dann konnte man in allen anderen das Licht sparen. Oft bildeten die Mädchen und Frauen der verschiedenen Jahrgänge Spinngruppen, die über die Winterarbeit hinaus zusammenhielten.
Die Spinnstube war auch eine „Erzählstube“. Beim Spinnen des Garns und beim Stricken der dicken Winterstrümpfe erzählten die Frauen Geschichten, Märchen und Sagen und tauschten Neuigkeiten aus. Spinnstubenlieder wurden gesungen.
Meist trafen sich die Frauen am Nachmittag. Sie brachten Spinnrad, Flachs und Netzetopf mit, ein Wassergefäß zum Benetzen der Finger. Sie tranken zuerst Kaffee und aßen Kuchen, spannen dann bis zur Dämmerung. Zu Hause wurden dann Kinder und Vieh versorgt. Mit den Männern kehrten sie in die Spinnstube zurück. Wurst und Brot, Branntwein oder Bier standen als Spätimbiss bereit.
Junge Mädchen schwärmten in den Arbeitspausen auch gern aus, hielten heimlich Umschau nach ihrem Liebsten. Die jungen Burschen durften erst später kommen, brachten Dörrobst und gebackene Süßigkeiten mit.
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Spinnabende nach und nach zu reinen Strickabenden. Warme Pullover, Socken und Strümpfe für den Winter wurden gestrickt.
Was aber hat der alte Bauernspruch „Spinne am Morgen, Kummer und Sorgen. Spinne am Abend, erquickend und labend“ mit der Spinne zu tun? Die Spinne kann gar nichts dafür, dass man ihr solche Sachen nachsagt. Die Bauern meinten einst, wer schon am frühen Morgen mit Flachs – oder Leinspinnen anfangen müsse, der habe Kummer und Sorgen, die es mit den Einnahmen aus dieser Arbeit zu bannen gelte. Am Abend zu spinnen bedeutete aber, dass man es sich gemütlich machen konnte, dass die Spinnerei eigentlich keine Arbeit, keine auf dringenden Gelderwerb gerichtete Beschäftigung war, sondern eine liebevolle Unterhaltung und Entspannung. Man konnte Sorgen und Kummer vergessen, Lieder singen, sich necken und vielleicht spann sich sogar manche Liebe an.
Nostalgische Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“! Kommt sie wieder? Auf jeden Fall ist Stricken wieder zur Mode geworden.
Als es noch Eisblumen am Fenster gab
Wie sich die Zeiten geändert haben! Damals gab es noch keine Zentralheizung. Der Kohleofen brannte in der Küche und in der „gudd Stubb“, wenn Festtage waren. Dann wurde auch mit Scheitholz geschürt. Wenn wir Kinder morgens aufstanden, ging der erste Blick auf die Fenster, um die Eisblumen zu bewundern. Wenn es draußen bitter kalt war, offenbarte sich eine Wunderwelt am Fenster.
Eisblumen am Fenster! Welche Illusionen werden in dem stillen Beschauer geweckt! Er unternimmt eine Traumreise in eine ferne fremdländische Landschaft oder in einen längst versunkenen Urwald aus der Steinkohlenzeit. Vor seinen Augen verschwimmen die zarten Eis- und Schneekristalle. Die mit allerlei Formen und Mustern grauweiß überspielte kalte Glasfläche wird für Minuten zu einem Märchenwald aus Tausendundeiner Nacht. Seltsame Bäume und Sträucher mit bizarren Ästen und knöchernen Zweigen, schwert- und lanzenförmigen Schachtelhalmen, geöffneten Elchblättern, lilienschlanken Blumen in verschiedener Größe und Vielfalt, längst ausgestorbene gefiederte Farnkräuter – und zwischen den wiegenden Lianen sitzen Papageien mit eckigen Schnäbeln: Ein tropisches Bild mitten im Winter, von klirrendem Frost wie von einer künstlerischen Zauberhand auf die Fensterscheiben gemalt.
Und am schönsten ist es abends, wenn das gedämpfte Kerzenlicht warm durch die Fenster in die dunkle Kälte strahlt. Da werden sie lebendig, all die Blumen und Gestalten und tanzen in magischen Spiralen Ringelreihen.
Eisblumen am Fenster
Zarte Kristalle am Fenster schwimmen
in spielenden Mustern grau und weiß.
Bizarre Äste und Zweige klimmen
und lilienschlanke Blumen aus Eis.
Auf wogenden Lianen sitzen Papageien
und tanzen in Spiralen Ringelreihen.
Ein Märchenwald aus Tausendundeiner Nacht
verzaubert die Scheibe in tropischer Pracht.
Mitten im Winter bei klirrender Kält
sich öffnet eine wundersame Welt.
Bei gedämpften Kerzenlicht
schwingt eine Symphonie in Weiß.
Doch ach, die Dunkelheit das Glas zerbricht,
all die Blumen in Frost und Eis!
Als die Kornmutter noch im Kornfeld wachte
Als kleiner Bub habe ich noch miterlebt, wenn zur Erntezeit im August noch de Kornmuhme oder die Kornmutter im Ährenfeld wachte. Es war ein altes Weib mit grauen Haaren, roten Augen und schwarzer Nase, die die Kinder schreckte, wenn sie sich im Kornfeld Blumen pflückten. Das waren vor allem Kornblumen und Mohnblumen, aber auch Kamillen. Beim Pflücken zertraten die Kinder das Getreide. Die Roggenmuhme sollte die kostbaren Garben schützen und als Mittagfrau darüber wachen, wenn die Schnitter ihre Mittagsruhe hielten. So wurde ihr zu Ehren die letzte Garbe als Erntemutter zu einer Figur zusammengebunden, mit Kittel und Schürze verkleidet, möglichst recht dick, weil das Fruchtbarkeit bedeutete.
Zum Winden des Erntekranzes nahmen die Mädchen alles, was Spätsommer und Frühherbst zu bieten hatten: Ähren und Feldblumen, Kräuter und Früchteketten und dazu bunte Papierstreifen, Gold- und Glanzpapier. Die Haferbraut, das Mädchen das die letzte Garbe gebunden hatte, trug den Erntekranz feierlich vor dem Erntezug zum Bauernhof. Bei der Übergabe trug die Haferbraut ein Erntegedicht vor.
Abends war dann der Erntetanz. Schnitterinnen und Schnitter tanzten auf dem Kirmesplatz. Auf dem Tisch stand ein ährengeschmückter Erntekorb, in dem die größten Früchte aus dem Bauerngarten und vom Feld lagen. Zur Suppe und zum Fleisch gab es oft das erste Brot aus dem neuen Getreide, das mit besonderer Ehrfurcht gegessen wurde. Am nächsten Morgen in der Schule wurden Erntelieder gesungen und Erntegedichte vorgetragen.
Vom „Korekaschde“ und dem „Kaffeeblech“
Schöne Erinnerungen habe ich heute noch an die Roggenernte, die früher an Jakobi, dem „Jokkobstag“ (15. Jul) begann. Mit kühnem Schwung mähte der Altbauer den ersten „Gönn“ an. Mit der frischgedengelten Sense, dem „Korereff“, schritt der Schnitter durch das Ährenfeld und andere Mäher folgten. Die goldenen Halme mit den reifen Ähren fielen zu Boden. Die Schnitterinnen in gebückter Haltung – wie immer in ihren hellen Kopftüchern als Schutz gegen die stechende Sonne – nahmen mit den Sicheln die Halme auf, derweil knoteten andere schon die Kornseile. Drei Halmbündel oder „Halmdecken“ ergaben eine Garbe. Diese wurde so fest verschnürt, dass keiner mehr seinen Finger unter das Seil zwängen konnte.
Und dann wurden die Garben zu einem „Korekaschde“ (Kornkasten) zusammengestellt, zehn an der Zahl. In die Mitte wurde der „bock“ gesetzt, die stärkste Garbe, die die acht anderen drum herum zu stützen hatte. Mit kräftigen Handschlägen spreizten sie die Ähren der zehnten Garbe und stülpten sie als „Hut“ darüber, um das „Koreheisje“ (Kornhäuschen) gegen Regen zu schützen.
Die „Korekaschde“ waren für uns Kinder ein beliebtes „Spielhäuschen“. Nach der Arbeit brachte die Bäuerin das „Kaffeeblech“ mit Malzkaffee, der von „Ziggorie“ geschwärzt war. Darauf hatten die Mägde schon ungeduldig gewartet. Die kurze Kaffeepause war das Schönste bei der Kornernte. Wie war das einst mit dem „Zichorienkaffee“, dem Standartgetränk der deutschen Küche? Die Älteren unter uns erinnern sich gerne an „Ziggorie“, wie die Kaffee-Essenz im Volksmund genannt wurde. Unter dem Markennamen „Pfeifer-Diller“ kam er in den Handel, war zusammen mit Kneipp-Malzkaffee stets gefragt. „Ziggorie“ als Kaffeezusatz gab dem Malzkaffee die schwarze Farbe und den Kaffeegeschmack. In einem Kriegskochbuch aus dem Jahre 1722 wird ein Hofgärtner Timme in Thüringen als Erfinder des Zichorienkaffees erwähnt. Friedrich der Große förderte die Verwertung der Zichorienpflanze für Kaffee, daher auch die Bezeichnung „Preußischer Kaffee“. Beim Rösten der zerkleinerten Zichorienwurzeln entwickelt sich ein Öl, das an Kaffee erinnert. Nach dem Erkalten kann man die gerösteten Wurzeln wie Kaffeebohnen verwenden.
Im zweiten Weltkrieg hat meine Urgroßmutter den Zichorienkaffee selbst hergestellt. Dazu sammelte sie die Wurzeln der Kaffeepflanze im Herbst. Sie wurden von ihr zerkleinert, getrocknet und dann geröstet; sie bewahrte sie das ganze Jahr über in Kaffeedosen auf. Damals kannte auf dem Dorf jeder die Pflanze, die als blau blühende Wegwarte an Straßen- und Wegrändern wächst und von Juli bis September blüht. Aber auch in der Volksmedizin hat meine Urgroßmutter die Wegwarte noch verwendet, die sie auch „Wegelagerer“, „Blaue Distel“ und eben „Kaffeewurz“ nannte. Den Tee als Abkochung der Wurzel nahm sie bei Gallenleiden. Aus den frischen Wegwarteblüten stellte sie ein gesundes Kräutergelee her. Dazu ein altes Rezept meiner Urgroßmutter:
Die blauen Blüten werden zerschnitten, zerstoßen und mit drei Teilen Zucker vermischt. Sobald sich der Zucker aufgelöst hat, wird alles durch ein Tuch filtriert und in Honiggläser abgefüllt. Man kann’s kaum glauben, doch es trifft zu: Der rotblättrige, knusprig frisch schmeckende Radicchio stammt von der blaublütigen Wegwarte ab.
Bevor nun das Korn eingefahren werden konnte, musste man eine ganze Woche lang sonnige Tage haben. Sowie der Roggen in „Kaschde“ stand, gingen die Binderinnen bei Tagesanbruch zum Nachharken. Das wurde stets im Tau vor Sonnenaufgang gemacht. Beim Einfahren des Roggens wurde gewartet, bis der Morgentau sich aufgelöst hatte. Dagegen wurde das letzte Fuder erst am späten Abend ins Scheunentor gefahren.
Meine Eltern waren recht arm, sodass sich meine Mutter als „Magd verdingte“, um ein kleines Zubrot für ihre Familie zu verdienen. Sie arbeitete am Nachmittag beim reichsten Bauern des Dorfes; das war „Nauhausersch Peter“. Kaum zu glauben, was sich dann dort ereignete: 1944 kam eine junge Polin als Kriegsdeportierte auf „Nauhausersch“ Bauernhof. Sie musste dort hart arbeiten, aber es gefiel ihr dort. „Perersch“ Bauer hatte ein Auge auf sie geworfen, und zwei Jahre nach Kriegsende wurden beide ein Paar. Es war eine sehr glückliche Ehe, aus der fünf Kinder entsprossen.
Die erste und die letzte Garbe
Kultische Erntefeste sind so alt wie der Ackerbau. In der Bibel ist es Kain, der Ackermann, der „Gott Opfer brachte von den Früchten des Feldes“. Als der Mensch vor drei – oder viertausend Jahren bei uns sesshaft wurde, war dies nur möglich durch Bearbeitung und Bepflanzung der Scholle.
Auch die heidnischen Erntefeste unserer Vorfahren, Kelten und Germanen, schlossen kultische Opfer an Früchten des Feldes für ihre Götter ein: Baldur, der Gott des Lichts, der Frühlingsgott, der Gott der Fruchtbarkeit, stand bei den Germanen in besonderem Ansehen.
Erntefeste wurden in der Zeit, als noch 80 Prozent unserer Bevölkerung auf dem Lande lebte, als jeder Erwachsene und jedes Kind bei der Ernte mit eingespannt wurden, und vor allem eine gute Ernte als gnädiges Geschenk des Himmels betrachtet hat und nicht von einer wissenschaftlich und technisch abgesicherten Landwirtschaft fast als selbstverständlich betrachtet wurde, in allem Überschwang gefeiert: zu Beginn der Ernte, während der Ernte und vor allem nach der Ernte.
Der Auszug aufs Feld geschah am ersten Erntetag meist nach einer Frühmesse, bei der die Erntegeräte gesegnet wurden. Vorm ersten Schlag schlugen die Knechte ein Kreuz über ihrer Sense, oder alle haben sich am Feldrand hingekniet, und die älteste Magd hat für alle das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis gebetet. Auf jeden Fall entließ der Bauer seine Leute mit einem Segensspruch. In manchen Gegenden marschierten die Schnitter und Schnitterinnen von einem Geiger oder Trommler begleitet aufs Feld.
Die erste Garbe steckte am Pferdegeschirr, die später zuerst gedroschen wurde. Zur Einfahrt wurden Wagen, Leute und Pferde, Peitschen und Hüte mit Bändern und Blumen geschmückt; es wurde gesungen, und oft war diese erste Ernte für die Armen des Dorfes oder der Stadt bestimmt.
Die ersten drei Früchte, Ähren, Beeren, Kartoffeln, Obst, hat man über die Schultern geworfen, hat sie in Kreuzform auf den Boden gelegt, oder hat ein Häuflein in bestimmten Baumstümpfen zurückgelassen: Ernte-Aberglaube! Gaben für die Kornmutter oder einen Waldgeist.
Die letzte Garbe spielte eine ebenso bedeutende Rolle wie die erste: unsere Vorväter glaubten, im Korn wohne ein Dämon, ein unberechenbarer Geist, der bald segens-, bald unheilvoll ins Leben der Menschen wirke. Die Schnitter störten ihn natürlich in seiner Ruhe auf, deshalb musste er von einem im Stück gemähten Feldes ins andere fliehen, bis ihm nur noch die letzte Garbe übrigblieb. In und mit ihr war der Korngeist dann endlich gefangen. In anderen Gegenden folgte man der Sitte, die letzten Ähren nicht zu schneiden, sondern stehenzulassen und so zusammenzubinden, dass sie wie ein Wesen mit Leib, Hals und Kopf aussahen.
Die Kornmutter oder Kornmuhme war eigentlich Frau Holle, Wotans Frau, die als altes Weib mit grauen Haaren, roten Augen und schwarzer Nase die Kinder schreckte, die im Kornfeld Blumen pflückten und dabei das Getreide zertraten. Oder sie stellte als Roggenmuhme die Erdmutter dar, die ihre kostbaren Garben schützt oder als Mittagsfrau darüber wacht, dass alle Schnitter ihre Mittagsruhe halten. So wurde ihr zu Ehren die letzte Garbe als Erntemutter zu einer Figur zusammengebunden, mit Kittel und Schürze bekleidet, möglichst recht dick, weil das Fruchtbarkeit bedeutete: Wunsch und Beschwörung zugleich.
Sankt Peter wurde in manchen Gegenden die letzte Garbe geweiht. Man ließ die Halme um eine Birke herum stehen, schmückte den Platz so, wie Petrus den Schnittern und Schnitterinnen später den Himmel schmücken soll, und umtanzte Korn und Baum wie den Maibaum.
Zum Winden des Erntekranzes nahmen die Mädchen alles, was Spätsommer und Frühherbst zu bieten hatte: Ähren und Feldblumen, Kräuter und Früchteketten und dazu bunte Papierstreifen, Gold- und Glanzpapier. Die Haferbraut, das Mädchen, das die letzte Garbe gebunden hatte, trug den Erntekranz feierlich vor dem Erntezug zum Gutshaus. Bei der Übergabe trug die Haferbraut ein Gedicht vor, Gruß, Dank und Segen für die Herrschaft und alle Arbeiter und Arbeiterinnen. Beim Erntetanz gab es bestimmte Regeln. Auf den Gütern begann der allgemeine Tanz nach dem Ehrentanz der Herrschaft, beim Dorffest tanzten Vorarbeiter und erste Schnitterinnen den ersten Ehrentanz, beim Hoferntefest tanzten Bauer und Bäuerin reihum und nacheinander mit den Schnittern und Schnitterinnen. Die große Mahlzeit beim Erntefest begann in den meisten Gegenden mit einem Gebet und einem Segensspruch für alle, die bei der Ernte geholfen hatten. Es gab auf jeden Fall besseres Essen als sonst. Oft wurde schon eine Kostprobe von dem aufgetischt, was gerade geerntet worden war. So stand ein ährengeschmückter Erntekorb auf dem Tisch, in dem die schönsten und größten Früchte aus dem Bauerngarten und vom Feld lagen. Zur Suppe und zum Fleisch gab es oft das erste Brot aus dem neuen Getreide, das mit besonderer Ehrfurcht gegessen wurde.
Gut gedengelt und gesenst
Im Hochsommer ganz früh am Morgen war mein Großvater schon am Sensendengeln. Sein Dengelplatz war unter dem großen Walnussbaum. Beim Schlagen der Sensenblätter – fast im Takt – wurden wir Kinder aus dem Schlag geweckt. Zuerst prüfte Großvater, ob das Sensenblatt noch scharf genug war. „Die Klinge muss so flach wie eine Rasierklinge sein“, sagte mein Großvater. Zuerst drehte er das Sensenblatt mit dem passenden Inbusschlüssel herunter und begann mit dem ersten Arbeitsschritt, dem Vordengeln. Er legte das Sensenblatt mit der Wölbung nach oben auf die Ambossauflage und begann am breiten Ende des Sensenblattes. Zum Dengeln nahm er einen schweren Schlosserhammer, der am stumpfen Ende leicht gewölbt war. Er hielt das Blatt immer gut fest. Beim Vordengeln ragte das Blatt etwa einen Millimeter über die Auflage des Ambosses hinaus. Großvater platzierte einen Schlag dicht neben dem anderen, bis er fast an der Spitze angelangt war. Seine Hammerschläge kamen nur aus dem Handgelenk heraus. Sie schallten weithin ins Dorf hinein.
Dann wurde der zweite und dritte Arbeitsgang mit jeweils leicht verschobenem Sensenblatt durchgeführt und die drei Gänge wiederholt. Mit dem Inbusschlüssel schraubte er das scharfe Blatt wieder fest. Wichtig beim Dengeln war das Wetzen zwischendurch. Dabei fuhr er von beiden Seiten mit der schmalen Seite des nassen Wetzsteins an der Klinge entlang. Nach getaner Arbeit brachte meine Großmutter eine „Butterschmeer“ und schwarzen Zichoriekaffee heraus.
Als es den „Wannerschdaach“ noch gab
Im Ostertal im Saarland spielte früher einmal der „Wannerschdaach“ (Wandertag) eine große Rolle im ländlichen Brauchtum. Der „Wannerschdaach“ war der 27. Dezember, also der Tag nach Weihnachten, im Kirchenjahr der Tag des Apostel und Evangelisten Johannes. An diesem Tag wechselten früher die Knechte und Mägde ihre Stellung auf den Bauernhöfen und verabschiedeten sich mit einem Tanzabend. Es war der „Johannisball“ am Tag nach Weihnachten. In manchen Gegenden bestand früher die weit verbreitete Ehesitte des „Weiberdingete“. Der Ehemann dingte seine Frau am Johannistag für das kommende Jahr, führte sie formvollendet ins Wirtshaus und lud sie zu einem Festessen ein. Sie musste dabei den Wein zahlen, wobei sie damit dem Handel zustimmte und sich symbolisch für weitere zwölf Monate verpflichtete: Sie wurde „gedingt“.
Erklären wir zunächst einmal die Bedeutung der Wörter „Ding“ und „dingen“. Ein „Ding“ (germanisch „thing“) war bei den Germanen ein Ort der Volksversammlung und eine Gerichtsstätte. „Dingen“ bedeutete ursprünglich „zu Dienstleistungen gegen Entgelt verpflichten“ also „in Dienst nehmen“. Vielfach gibt es heute noch alte Flurnamen mit der Bezeichnung „Ding“. Ich selbst habe 1974 auf der Gemarkung Hoof im Ostertal auf der Flur 176 „Auf dem Ding“ gebaut. Hier muss also einst eine Gerichtsstätte gewesen sein.
In den Dörfern des Ostertales war früher einmal der „Wannerschdaach“ für die Bauern, ihre Knechte und Mägde, der wichtigste Tag im Jahr. Wenn ein Bauer eine neue Magd oder einen neuen Knecht dingte, so begann das Dienstverhältnis am Tag nach Weihnachten. Es dauerte in der Regel bis zum 27. Dezember des folgenden Jahres. Wenn beiderseits keine Kündigung erfolgte, so verlängerte sich das Arbeitsverhältnis noch einmal um ein Jahr. Die Ostertaler Bauern gingen wohl beizeiten auf die Suche, um einen neuen Knecht oder eine neue Magd einzustellen. Mit Pferdefuhrwerk, Kutsche, Ochsengespann oder in strengen Wintern mit dem Pferdeschlitten holte der Bauer die neu gedingte Arbeitskraft an deren Wohnort ab. Verkehrsverbindungen in gewohntem Sinne gab es ja schließlich noch keine. Die eingestellten Knechte und Mägde packten ihre wenigen Habseligkeiten ganz einfach in eine Holzkiste.
Die Tage vor dem „Wannerschdaach“ warteten die Dorfbewohner gespannt auf die verschiedenen Neuankömmlinge, die ins Dorf kommen sollten. Mägde und Knechte, die bei ihren Bauern bleiben konnten, kamen allerdings auch nicht ungeschoren davon. Sie mussten der heimischen Dorfjugend Schnaps, Bier und Wein spendieren, wobei gerade der Wein am Johannistag im Hinblick auf das kommende Jahr als segensreich galt. Die neu angekommenen Mägde und Knechte brachten frisches Blut in die Dörfer, fand doch so mancher in den folgenden Jahren hier seinen Ehepartner.
Den „Wannerschdaach“ feiert man auch heute noch im Ostertal, wenn auch in ganz anderer Form. Vereine und Gruppen unternehmen ausgedehnte Wanderungen über die Gemarkungen und die Dörfer. Immerhin haben viele zwischen Weihnachten und Neujahr frei und somit Zeit, die nähere Umgebung auf Schusters Rappen zu erkunden, um dann zum Abschluss des Marsches gemütlich in einer Gastwirtschaft einzukehren.
Schalmeien am Kuckuckstag
Wunderschöne Erinnerungen an meine frühe Kindheit sind mit dem Ruf des Kuckucks verbunden. Bei uns im Dorf war der 15. April der „Kuckuckstag“. Er wurde auf dem Land als Familienwandertag genutzt. Mit meinen Großeltern machte ich einen Waldspaziergang, um den scheuen Waldvogel das erstemal zu hören. Allerlei Aberglaube rankte sich um den ersten Ruf des Kuckucks. Hatten wir kein Geld in der Geldbörse, so blieb man das ganze Jahr über pleite. Wir Kinder aber durften einen Glückspfennig in der Hosentasche tragen. Großvater glaubte daran, so viele Jahre noch zu leben, wie man den Kuckuck rufen hörte. Dabei schnitzte Großvater Schalmeien, Flöten aus Hasel- oder Weidenrinde, die jetzt wieder voll im Saft stand und sich leicht mit dem Taschenmesser abschälen ließ. Mit den Schalmeien ahmten die Kinder den Ruf des Kuckucks nach: „Kuck-kuck, Kuck-kuck …!“ Das erste „Kuckucksbrot“ wurde an diesem Tag im Wald gegessen, die herbsäuerlichen Blätter des Waldsauerklees. Daheim bereitete Großmutter einen erfrischenden Salat aus Sauerklee.
Nachdem wir genug geflötet hatten, pflückten wir die ersten Veilchen im Wald. Als Frühlingssymbol stellte Großmutter einen duftenden Veilchenstrauß in die „gudd Stubb“ („Gute Stube“). Aus den Veilchenblüten stellte sie eine köstliche Frühlingsbowle her.
Zur gleichen Zeit wie der Kuckuck kamen auch die Schwalben aus ihrem Winterquartier im fernen Afrika wieder zurück. Darauf warteten wir immer sehnsüchtig, galten doch die Schwalben auf den Dörfern als Symbol für Gesundheit und ein glückliches Familienleben. Im Stallgebäude unseres benachbarten Bauernhauses nisteten alljährlich um die zwanzig Hausschwalben, unter dem Dachfirst etwa zehn Mehlschwalben. Bei uns unterm Dachfirst nisteten sechs Schwalbenpärchen. Im Frühjahr 1947 blieben die Schwalben bei uns aus. Der Grund war, das die Vögel in dem sehr trockenen Frühling in unserer Nähe keinen feuchten Lehm zum Ausbessern ihrer Nester fanden. Und im gleichen Jahr starb dann meine Urgroßmutter im Alter von 98 Jahren.
Im sommerlichen Schwirrflug der Schwalben über das Dorf konnte mein Großvater das Wetter ablesen. Flogen die Schwalben hoch in der Luft, dann sollte es schönes Wetter geben; „fischten“ die Schwalben über dem Weiher, dann sprach er von Regenwetter. Und da war schon was Wahres dran.
Das Brauchtum des Maisingens
Ich erinnere mich an meine frühe Kindheit, als ich mit meiner Mutter alljährlich am 1. Mai den weiten Weg von Steinbach nach Werschweiler ging, um dort den uralten Brauch des Maisingens mitzuerleben, der noch heute im Dorf gepflegt wird. Mit diesem alten Brauch wird der Frühling eingeläutet und herzlich begrüßt. Schon vier bis fünf Wochen vor dem großen Tag beginnen die ältesten Schulmädchen mit den Vorbereitungen. Mittels „Mund-zu Mundpropaganda“ werden die jüngeren Mädchen zum Einstudieren von Liedern eingeladen. Zwei- bis dreimal pro Woche werden fleißig Frühlingslieder und Maienlieder eingeübt. Von „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an …“ über „Komm lieber Mai und mache …“ und „Alle Vögel sind schon da …“ bis „Der Mai ist gekommen …“ müssen alle Lieder von der ersten bis zur letzten Strophe eingeübt werden.
Zwei Tage vor dem eigentlichen Maisingen am 1. Mai ziehen die ältesten Mädchen mit einer Säge, einem Handkarren und viel guter Laune begleitet, in den nahen Wald. Dort wird ein schöner Birkenbaum – nicht zu groß und nicht zu klein – ausgesucht und gefällt. Auch werden viele Birkenzweige und andere schon belaubte Zweige mit nach Hause gebracht. Diese müssen eingeweicht und am nächsten Tag „abgezogen“ werden. Ein Tag vor dem Singen sammeln die Mädchen des Dorfes eifrig bunte Frühlingsblumen. Mit diesen Blumen und den Zweigen winden die älteren Mädchen kleine Blumenkränze. Jedes Mädchen erhält sein eigenes „maßgeschneidertes“ Kränzchen. Am gleichen Tag wird beim zweitältesten Mädchen der Birkenbaum mit bunten Bändern und Blumen aus Krepppapier geschmückt. Die letzte Nacht vor dem 1. Mai, die Walpurgisnacht („Hexennacht“), verbringen die „Organisatoren“ bei den Kränzchen und dem Maibaum. Große Aufregung und Spannung herrscht am folgenden Morgen. Schon um acht Uhr treffen sich alle Sängerinnen und erhalten als Kopfschmuck die Blumenkränzchen.
An der Spitze des Zuges ist der buntgeschmückte Maibaum. Dahinter gehen viele singende, mit Blumen geschmückte Mädchen, die von Haus zu Haus ziehen, um mit Frühlingsliedern die Leute zu erfreuen. In Eimern, Schüsseln und Körben werden Eier, Margarine, Speck und Geld gesammelt. Gegen Mittag ist der anstrengende Umzug beendet. Alle haben eine große Portion Rührei, Spiegelei oder Speckeier verdient, die beim ältesten Mädchen gegessen werden. Mit dem Gedanken, im nächsten Jahr bestimmt wieder dabei zu sein, endet nach dem schmackhaften Mahl das alljährliche „Maisingen“ der Werschweiler Mädchen.
Neue Besen kehren gut – In der Besenbinderstube meines Großvaters
Unsere Vorfahren kehrten mit Besen („Hexenreisern“) die Winterunholde, bösen Geister und Dämonen aus dem Haus, und der gesellig wachsende Besenginster war im Mittelalter ein wirksamer Schutz gegen Hexerei. Seine harten, zweigähnlichen Stängel wurden auch als Kaminbesen genutzt, wodurch verständlich wird, dass die Hexen nach dem endgültigen Sieg des Frühlingsgottes über die Mächte der Finsternis auf einem Besen reitend das Haus durch den Schornstein verlassen: Hexennacht – Walpurgisnacht.
Einzelne Besenruten lagen früher auf dem Küchenschrank und die Buben hatten einen Heidenrespekt davor. Das war der Schlagbesen des Vaters, der damit den Ungehorsam der Kinder bestrafte. Doch die strafende Rute des Nikolaus war ursprünglich das Reis, das Symbol der Fruchtbarkeit, durch dessen Berührung mitten im Winter die Hoffnung auf das Licht der Sonne wachgerufen wurde: Das Reis war die Lebensrute.
Das früheste geflügelte Wort aus dem deutschen Sprachschatz stammt aus Freidanks „Spruchdichtesammlung“ (um 1230), betitelt „Bescheidenheit“: „Der niuwe beseme kert vil wol, e daz er stoubes werde vol“: „Der neue Besen kehrt sehr wohl, eh’ dass er Staubes werde voll.“ Daraus wurde das sprichwörtlich gebrachte „Neue Besen kehren gut“. Der Besen, das „Zusammengebundene“, war der „Staubsauger“ unserer Vorfahren.
Zu den bäuerlichen Winterarbeiten gehörten früher neben dem Flechten von Körben, Stühlen und Kuchendeckeln und dem Binden von Besen auch das Herrichten des Geschirrs und der Zugseile, das Ausbessern der Wagen und Wagenräder, das Schärfen der Äxte und Beile und das Anspitzen der Bohnenstangen.
Auf den Bauernhöfen standen neben den Obstgärten gewöhnlich an den Grenzen zu den Nachbargrundstücken sogenannte „wilde“ Bäume: Birken zur Erlangung der nötigen Besenreiser, ein paar Weiden für Körbe, Stühle, Mulden, Schippen und Tröge, dazu Eschen, die jährlich geköpft wurden, so dass man die schlanken Zweige binden und zum Trocknen an Zäunen aufrichten konnte. Im Winter wurden sie den Schafen auf die Hilte gegeben. Die Tiere fraßen Blätter, kleine Zweige und die Rinde. Von den dicken Astteilen nagten sie den Bast ab. Mit diesen abgenagten Ästen wurden Zäune repariert und gebaut. Zwei bis drei Eichen standen auf dem Hof. Sie gaben Futter für die umherlaufenden Schweine. Schließlich gab es da noch den Walnussbaum und den Holunderstrauch, letzterer dicht an der Hauswand zur Abwehr von winterlichen Dämonen und Bereitung von heilenden Wintertees.
Ferne Erinnerungen an Groß- und Urgroßvaters Zeiten werden wach. Erinnerungen an die heimelige Atmosphäre in der gemütlich warmen Besenbinderstube: In mehreren Reihen lagen dicke Birkenreiser-Bündel („Birkenhecken“) mit Ruten verschiedener Länge auf den Dielen. Im November wurden die Besenreiser draußen geschnitten, an Ort und Stelle die abstehenden Seitentriebe um die innere Rute aufgedreht und die Nebenästchen am Reiseranfang ausgeputzt. Über Winter wurden die Besenreiser auf dem Speicher getrocknet.
Am besten waren Reiser von sieben – bis achtjährigen Birken, weil sie noch schlanker und biegsamer sind als Ruten von älteren Bäumen . Diese sind meist zu storzig und brechen leichter. In d er Besenbinderstube wurden die Reiser der Länge nach sortiert. In jede Hand kamen sieben lange Ruten, wurden nach unten fest zusammengedreht, über dem Knie mit einem Ring gespannt, die beiden Bündel überkreuzt und zum „Geißfuß“ zusammengesteckt. Weitere Ringe aus Draht oder Seil – sechs bis sieben an der Zahl – wurden nach und nach um die gedrehten und gespannten Reiserbündel gesetzt. In einem der mittleren Ringe steckte man dann kürzere, etwas angespitzte Ruten rundum ein, bis der Besen eine bestimmte Handlichkeit hatte und die Kehrseite „bauschig“ wurde. der Griff wurde „bündig“ geschnitten, noch vorhandene Stielreste glatt abgeschnitten, damit die Finger beim Kehren nicht aufrissen. Zum Schluss wurden die überstehenden Rutenspitzen an der bauschigen Kehrseite des Besens abgeschnitten.
Für die Herstellung der Besenringe haben früher die Besenbinder keinen Draht verwandt – der war zu teuer – sondern „Hassele-Stecke“ (Haselstrauch), die „Scheenstecke“. Die „Hassele“ waren etwa 1,50 m lang und so dick wie Flaschenköpfe. Die „Stecke“ wurden am Ende eingekerbt, von d en Kerben aus die Rinde in ½ cm breiten Riemen (Schalen oder Schienen) abgeschält. Die abgeschälte Rinde war das Flechtmaterial für das Zusammenbinden der Besenreiser.
Jeder Hof hatte früher ein ganzes Sortiment von Besen, zumeist aus Birkenreisern gebunden. Seltener waren Strohbesen, ganz selten Ginsterbesen. Letztere waren kurz und mit einem Stock versehen.
Die Besen fanden eine vielfältige Anwendung. Die Häuser wurden gekehrt, der Stall, der noch ungepflasterte Hof, die Scheune, die Wege, der Misthaufen, Laub im Herbst und Schnee im Winter.
„Nichts wurde unter den Tisch gekehrt“ bei unseren Vorfahren. Doch den „Dorfbesen“ gab es überall. Doch auch diese Zeiten sind längst vergangen: „Damals auf dem Dorf war vieles anders.“
Vom Pflügen, Eggen und Säen unserer bäuerlichen Vorfahren im März
Je nach Witterung begann die Arbeit des Bauern auf dem Feld Anfang/Mitte März. Oft hielt er sich auch an alte Kalendersprüche und Wetterregeln.
Am frühen Morgen wurden Pflug und Egge aus dem „Schuppen“ geholt und der Ochse wurde vorgespannt. Kühe wurden seltener verwendet, um die harte Pflugarbeit zu verrichten, weil der Milchertrag darunter litt. Oder ein Pferdegespann verrichtet die harte Arbeit. Das Pflügen selbst erforderte Kraft und Geschicklichkeit. Der „Pflugheber“, gewöhnlich war es der Bauer selbst oder der Großknecht, musste die Pflughörner richtig niederdrücken, damit das Pflugeisen in der entsprechenden Tiefe weiterging. Knapp hinter dem Pflug gingen die „Hauerinnen“, welche mit ihren Hauen die ausgehobene Erde zerkleinerten und ebneten. War nun der Boden durch den Pflug umgerissen und der Dünger in die Erde eingeackert, kam die Egge dran. Die Egge zerteilte die aus dem Grund gewühlten Schollen, was durch oftmaliges Überfahren erreicht wurde. Dann wurde gesät. Der Bauer in Hemdärmeln trug im Fürtuch den Samen und streute ihn mit voller Hand möglichst gleichmäßig nach links und rechts aus, ein heikles Geschäft, da der Samen weder zu dünn noch zu dicht liegen durfte. Im letzteren Falle nämlich wird das Wachstum gehemmt und erfordert ein späteres Jäten, damit die Halme zu Luft kommen. Um das Wachstum der Aussaat zu fördern, pflegte man die Körner einige Zeit vor dem Säen zu „kalken“, das heißt, man setzte ihnen Kalk mit Wasser gemischt bei.
Auf gleiche Weise wie die Aussaat des Roggens und Weizens ging auch die der Gerste und des Hafers vor sich, wofür man nach alter Gepflogenheit der Benediktustag (21. März) bestimmt war. Überhaupt hatte der Bauer früher fast für jede Fruchtgattung einen bestimmten Tag zur Aussaat. So sollten zum Beispiel die Hülsenfrüchte, die Bohnen und Erbsen, am Karfreitag gesetzt werden, auch Flachs am Karfreitag.
Während der letzten Tage der Karwoche ruhte in der Regel die Feldarbeit. Man brachte die Tage in frommer Trauer und gewissenhaftem Fasten zu, wofür man sich dann am Ostersonntag durch einen lukullischen Schmaus und am Ostermontag und Dienstag durch verschiedene Lustbarkeiten entschädigte.
Nach den Feiertagen kam dann ein weiteres Stück Arbeit, das Bauern und Knecht und die Ochsen richtig schwitzen ließ. Es begann die Bestellung der Kartoffeläcker. Man pflanzte die Erdäpfel, auch Grundbirnen genannt, gewöhnlich auf trockenen Sandboden, der zwar keine so reiche Ausbeute, aber Kartoffeln von vorzüglicher Güte liefert. Das Geschäft des „Setzens“ fiel gewöhnlich den Bäuerinnen und Mägden zu. Die Magd hackte mit der Karst die Grube aus und warf aus dem zu einem Sack gebundenen Tuch die Setzkartoffeln hinein. Durch das Aushauen der folgenden Grube wurde die vorangegangene, schon besetzte, zugeschüttet. Waren zwei Mägde da, so haute die eine und die andere setzte.