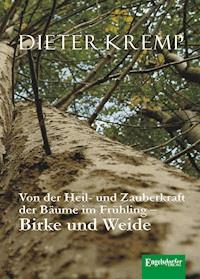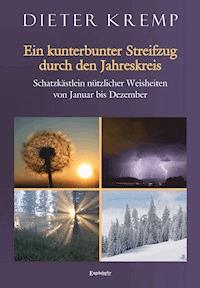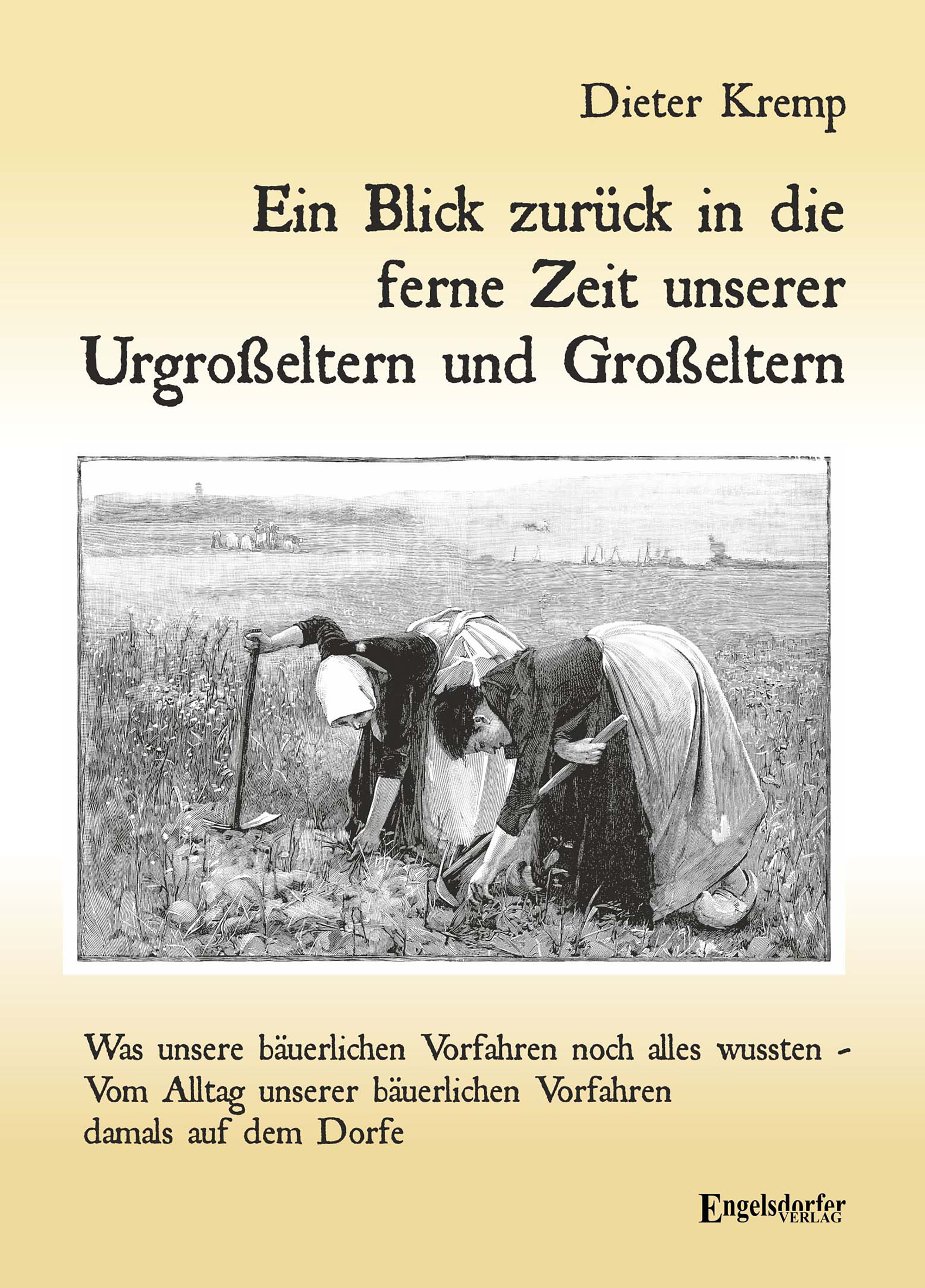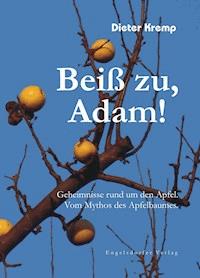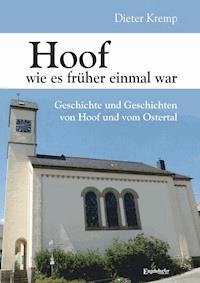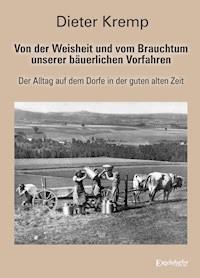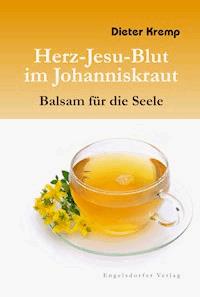
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Keine andere Heilpflanze hat in den letzten 20 Jahren einen solchen Aufschwung erlebt wie das Johanniskraut, das »Herz-Jesu-Kraut« oder Sonnwendkraut unserer Vorfahren. Seine Anwendung als Seelenarznei und »Heilpflanze der Sonne« erstreckt sich vor allem als pflanzliches Antidepressivum bei Angstzuständen und Depressionen, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich und auch klinisch bewiesen ist. Außerdem ist das Johanniskraut ein Tausendsassa zur Behandlung von vielerlei Beschwerden. Über Jahrhunderte hinweg hat das Johanniskraut die Menschen in seinen Bann gezogen. Seit jeher galt diese legendäre Heilpflanze als Sinnbild des Glücks, des Lichtes und stand für die eingefangene Kraft der Sonne – als Balsam für die Seele. Die gelbe Blütenfarbe war schon in der Antike Symbol der aufgehenden Sonne. Schon seit früher Zeit wurde das Johanniskraut mit der Sommersonnenwende verbunden. Die Pflanze steht auch für den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit. Die Sonne hält in den Tagen um Johanni »Hoch-Zeit« mit der Erde, und diese Hochzeit wurde mit zahlreichen Ritualen und Tänzen ausgiebig zelebriert. Auch »Seelentrost« und »Herzenszier« nannten unsere Vorfahren das Johanniskraut, das die heilende Kraft der Sonne offenbarte. Der Autor Dieter Kremp hat die wundersame Heilkraft des Johanniskraut in diesem Buch auch mit Johannes dem Täufer und mit dem Zauber am Johannistag und in der Johannisnacht verbunden, in der das Sonnwendkraut von unseren Vorfahren gegen Hexen und Dämonen rituell eingesetzt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kremp
HERZ-JESU-BLUT IM JOHANNISKRAUT BALSAM FÜR DIE SEELE
Vom Mythos und der wundersamen Heilkraft des Johanniskrautes
Johannes der TäuferVom Zauber in der Johannisnacht
Engelsdorfer VerlagLeipzig2011
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
eISBN: 978-3-86268-390-1
Titelfoto © LianeM - Fotolia.com
Copyright (2011) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
www.engelsdorfer-verlag.de
Das Buch wird gewidmet
meiner Ehefrau Waltrud, meiner Tochter Julia,Schwiegertochter Jutta,meinen Schwestern Ursula und Hildeund allenMännern und Frauen,die die Vornamen Johannes, Johann und Johanna tragen.
Inhalt
Vom Mythos des Johanniskrauts
Die heilkundliche Geschichte des Johanniskrauts von der Antike bis zur heutigen Zeit
Hexerei und Zauber mit dem Johanniskraut
Herz-Jesu-Blut im Johanniskraut
Die Heilkraft der Farbe Rot
Inhaltsstoffe und Wirkung des Johanniskrauts
Pflanzenporträt des Johanniskrauts
Kultivierung und Anbau für die Arzneimittelindustrie
Weitere Mitglieder aus der Familie der Johanniskrautgewächse
Johanniskräuter als Zierpflanzen im Garten
Selbstzubereitete Produkte aus Johanniskraut
Gesund durch Johanniskraut
Teemischungen mit Johanniskraut gegen verschiedene Beschwerden
Anwendungsbeispiele und altbewährte Rezepte rund um das Johanniskraut
Schön gepflegt mit Johanniskraut
Äußerliche Anwendung mit Johanniskraut-Salbe, Johanniskraut-Creme und Johanniskraut-Öl
Das Johanniskraut und seine Heilpartner
Das Johanniskraut in der Homöopathie
Johanniskraut gegen Bronchitis
Johanniskraut gegen Wechseljahrsbeschwerden
Johanniskraut - „ein Aschenputtel feiert seine Auferstehung"
Johanniskraut - Präparate werden immer beliebter
Aus der homöopathischen Hausapotheke mit Hypericum perforatum
Kochen mit Johanniskraut
Rezepte mit Johanniskraut
Johanniskraut – Heilpflanze der Sonne
Inhaltsstoffe und Wirkung des Johanniskrauts
Richtige Dosierung von Johanniskraut bei Depressionen
Johanniskraut und Alter
Nebenwirkungen von Johanniskraut
Johanniskraut beim Burnout-Syndrom
Johanniskraut beim Tinnitus und beim chronischen Schmerzsyndrom
Hyperizin im Johanniskraut, eine natürliche Waffe gegen Alzheimer
Johanniskraut gegen Winterdepressionen
Der Wirkstoff Hyperforin hat Hypericin übertrumpft
Übersicht über die Anwendungsbereiche von Johanniskraut -Präparaten
Das Johanniskraut und seine Geheimnisse
Legenden ranken sich um das Sonnwendkraut
Johanniskraut und Schweregrad der Depression
Johanniskraut – ein pflanzliches Antidepressivum mit klinisch nachgewiesener Wirksamkeit
Räuchern mit Johanniskraut
Johanniskraut- ein Klassiker unter den pflanzlichen Antidepressiva
Johanniskraut und die Sonne
Von Sanct Johanneskraut
Pflanzliche Hilfen bei Angststörungen
Johanniskraut-Präparate gegen Depressionen und Angstzustände
Johanniskräuter im Johannisbuschen
Magie der Zauberkräuter in der Johannisnacht
Johannisgürtel und Teufelsklaue
Pflanzen im Volksglauben am Johannistag
Sagen rund um das Johanniskraut
Die Arnika heißt auch Johannisblume und Johanniswohl
Arnika-Rezepte
Johannes aß die Früchte des Johannisbrotbaumes
Schwarze Johannisbeere – Vitamin-C-Bombe und Rheumamittel
Rote Johannisbeeren erfrischen
Johannes und sein Herzlein Johanna
Märchen vom Johanniskraut
Johannistag – Gedenktag und Geburt Johannes des Täufers
Der Prophet Johannes der Täufer
Johannes der Täufer als getaufter Licht- und Wiedergeburts-Heros
Vom Aberglauben rund um die Taufe
Sitten, Feste und Bräuche am Johannistag
Johannisnacht
Johannistag – der „Tag der Heilkräfte
Johannisfeuer
Der Johannistag als Lostag
Glühwürmchen in der Johannisnacht
Glühwürmchen, blinkende Liebesbotschaften in der Johannisnacht
Das liebestolle Glühwürmchen
Johanniskrone und Johanniskleid
Hansblumen und Johannisbad
Johannistau
Sommersonnwendfeste und Johannisfeuer
Brauchtum und Aberglaube zur Sommernachtsgleiche und am Johannistag
Johanniskuchen und Hexenschaum
Hexensabbat in der Johannisnacht
Johannisnacht, Fest des Feuers und des Wassers
Johannistag, der „Holdertag“
Mittsommernacht und Johannistag in Schweden
Sommersonnenwende – Dank- und Freudenfeste der Kelten
Sommersonnenwende
Johanniregen bringt keinen Segen – Johanniskäfer als Wetterpropheten
Mittsommer – das Fest der Göttin Litha
Der schönste Tag im Jahr – Johanni
Johannisabend
Sonnenwende und Johannistag
Johannistag - In Nordeuropa feiert man Sankt Hans
Die Jungfrau auf dem gläsernen Berg
Vom Mythos des Johanniskrauts
Über Jahrhunderte hinweg hat das Johanniskraut die Menschen in seinen Bann gezogen. Seit jeher galt diese legendäre Heilpflanze als Sinnbild des Glücks, des Lichtes und stand für die eingefangene Kraft der Sonne – ein Balsam für die Seele. Der Fünfstern der gelben Blüten galt als ein Zeichen für die guten Kräfte. Die gelbe Blütenfarbe war schon in der Antike Symbol der Reife und Sinnbild der aufgehenden Sonne.
Schon seit früher Zeit wurde das Johanniskraut mit der Sommersonnenwende verbunden. Das Gewächs erhielt daher nicht nur seinen Namen „Johanniskraut“ und „Sonnwendkraut“, sondern steht auch für den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit. Denn am 21. Juni hat die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, der Tag ist am längsten und die Nacht am kürzesten. Seit Urzeiten feiern die Menschen aller Religionen und Kulturen diesen Tag: die Verbindung des Lichtes mit der Erde, des Geistes mit der Materie. Die Sonne hält „Hoch-Zeit“ mit der Erde, und diese Hochzeit wurde mit zahlreichen Ritualen und Tänzen ausgiebig zelebriert. Mit verschiedenen Tanzfiguren wurde die Bahn der Sonne imitiert, die Mittänzer galten als „Kinder des Lichts“ oder als „Kinder der Sonne“. Junge Männer trugen aus Johanniskraut geflochtene Kränze, um sich vor Unglück, Krankheit, Leid und schlechten Menschen zu schützen. Ein Johanniskrautsträußchen an der Brust getragen, offenbarte die heilende Kraft der Sonne als „Seelentrost“ und „Herzenszier“. Mit Johanniskraut wurden die Altäre geschmückt, als Zeichen tiefer Verbundenheit mit den Lichtkräften. Und es war dann später nicht nur das „Herrgottskraut“, auch das „Herz-Jesu-Blut“ und „Marienblut“.
Die seit Tausenden von Jahren praktizierte Sonnwendfeier konnte auch das Christentum nicht verhindern. Zu sehr fühlten sich die Menschen mit der Sonne verbunden. Daher verschob man einfach den Festtag um drei Tage, und stellte so die Verbindung zum heiligen Johannes her, eine Lösung, die das Christentum akzeptieren konnte.
Dieser Heilige, Johannes der Täufer, ersetzte einen germanischen Gott mit einer tragischen Geschichte. In der germanischen Mythologie gab es einen Gott des Lichtes, Baldur genannt. Dieser wurde von einem leuchtenden Feuer umstrahlt, und sein Gesicht glänzte wie die Sonne. Sein Bruder, der blinde Gott der Zeit, Hödur genannt, verletzte ihn tödlich. Da der heilige Johannes am gleichen Tag geköpft wurde, an dem auch Baldur starb, wurde aus dem Letztgenannten der heilige Johannes.
Zerreibt man die Blüten des Johanniskrautes zwischen den Fingern, tritt ein roter Saft aus. Die rote Farbe wurde mit dem Blut des heiligen Johannes in Verbindung gebracht. Die wie mit Nadeln durchstochen wirkenden Blätter standen früher für die Wunden der Märtyrer und für die Wunden des gekreuzigten Herrn.
Über die Entstehung der Löcher in den Blättern des Johanniskrauts gibt es folgende Legende: Der Teufel war es leid, überall durch Johanniskraut vertrieben zu werden, und beschloss, diese Pflanze zu vernichten. Dazu stach er voller Wut mit einer Nadel Löcher in die Blätter. Da aber Gott diese Heilpflanze unter seine Obhut genommen hatte, war das Werk des Teufels nicht von Erfolg gekrönt. Jedoch sind die Löcher in den Blättern als Beweis für die Richtigkeit der Geschichte heute noch zu sehen!
Aus einer alten Sprüchesammlung:
„Sanct Johanniskraut ist von so großer Krafft, den Teufel und die Hexen zu vertreiben, dahero auch der Teufel aus Bosheit dieses Krautes Blätter mit Nadeln durchsticht.“
Das Johanniskraut galt früher als wundertätig. Der Heilpflanze wurde die Gabe zugesprochen, die Lebenskraft der Sonne aufzutanken und diese an die Menschen weitergeben zu können.
Das Johanniskraut nimmt die Kräfte des Lichts in sich auf und hilft so den Menschen, die es einnehmen, sich dem Licht zu öffnen.
Auch nach der Christianisierung haben sich die Geschichten um das Johanniskraut gehalten und wurden mit neuem Wissen vermischt.
Alle Rituale oder magischen Verwendungen, die uns überliefert wurden, beziehen sich auf die Sonnenkräfte der Heilpflanze, aber auch auf die Fähigkeit, böse Geister abwehren zu können.
Das ganze Mittelalter hindurch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sah man im Johanniskraut eine Pflanze, die Dämonen abwehren sollte.
Da man glaubte, dass der Teufel das Johanniskraut meiden würde, wurde diese Pflanze schon im 16. Jahrhundert „Teufelsflucht“ genannt. Oder auch „Teufelsbanner“ und „Fuga daemonum“.
Viele der volkstümlichen Bezeichnungen für das Johanniskraut(z. B. Hexenkraut, Hexenbanner, Mannsteufel oder Teufelsflucht) resultieren aus dem damaligen Aberglauben.
Während der Hexenverfolgung im Mittelalter mussten die zum Tode verurteilten Frauen einen Saft aus Johanniskraut trinken. Man erhoffte sich, auf diese Weise die Macht der bösen Geister und des Teufels brechen zu können.
Die Farbstoffabsonderung der Pflanze und das markante Aussehen der Blätter erklären ihre Rolle im Aberglauben.
Ein Strauß Johanniskraut in den Stall gehängt, sollte das Vieh vor Heimsuchung durch Dämonen bewahren. Johanniskraut an das Fensterkreuz der Wohnstube gesteckt, sollte böse Geister am Eindringen hindern. Ein Kranz der Heilpflanze auf das Dach eines Bauernhofes gelegt, sollte das Haus vor Blitzschlag schützen. Auf den Herd gestreut, hatte es die Aufgabe, Gewitter zu verscheuchen.
Die Legende erzählt, dass dieser Brauch während eines starken Gewitters entstand, als eine rätselhafte Stimme aus dem Himmel kam:
„Ist denn keine alte Fraue,
die kann pflücken Hartenaue (Johanniskraut),
dass sich das Gewitter staue?“
(überlieferter Vers aus dem Havelland)
Bei den Brandenburgern wurde früher das Innere von Flintenläufen mit rotem Johanniskrautsaft bestrichen. Nur dann, so glaubten die Menschen, würde die Kugel treffsicher ihr Ziel erreichen.
In Island gab es den Brauch, sich am Morgen des Johannistages im Tau zu wälzen. Da man wusste, dass das Kraut am Johannistag die stärkste Heilkraft besitzt, glaubte man durch diese Maßnahme unverwundbar und kräftig zu werden. Der Tau stand für das befruchtete Wasser des Himmels von der Hochzeit des Himmels mit der Erde in der Sonnwendnacht.
In Schlesien wurde der rote Saft, den man im Volksmund auch „Herz-Jesu-Blut“ oder „Marienblut“ nennt, für Liebesorakel verwendet:
„Bist mir gut, gibst mir Blut. Bist mir gram, gibst mir Schlamm.“
In Schwaben zählte das Johanniskraut zu den neun Kräutern, die an Maria Himmelfahrt der Muttergottes geweiht wurden. Die anderen acht Kräuter hießen: Teufelsabbiss, Eberraute, Marienkerze, Gundelrebe, Thymian, Meisterwurz, Liebstöckel und Gartenraute.
Mit Sicherheit hat das Johanniskraut heute etwas von seinem Mythos verloren, denn die Zeiten haben sich geändert. Heute kämpfen die Menschen nicht mehr gegen böse Dämonen oder Hexen, doch wenn die Seele dunkel und schwermütig wird, leistet das Johanniskraut, heute wie eh und je, sehr gute Dienste. Es ermöglicht den Menschen, die heilende Kraft der Sonne in ihr Inneres einströmen zu lassen und so depressive Gedanken zu vertreiben.
Diese wunderschöne Sommerpflanze macht den Menschen – gerade in den Sonnwendtagen um Johanni – die heilende und warme Kraft der Sonne zugänglich und erfreut dadurch die Seele.
Die heilkundliche Geschichte des Johanniskrauts von der Antike bis zur heutigen Zeit
Hippokrates von Kos (um 460 – 377 v. Chr.)
Bereits in der Antike war die heilende Wirkung des Johanniskrauts bekannt. Auch der griechische Arzt Hippokrates beschäftigte sich ausgiebig mit dem Johanniskraut. Er galt damals als „moderner“ Arzt, denn er hatte die Fähigkeit, die Magie der bislang vorherrschenden altorientalischen Medizin durch exakte Beobachtungen der Kranken und genaue Aufzeichnungen verschiedener Krankheitsbilder zu ersetzen.
Zur Linderung von Beschwerden verwendete er hauptsächlich Heilpflanzen. Dem Johanniskraut sprach er lindernde Wirkung bei Erkrankungen der Lunge und die Beschleunigung der Wundheilung zu.
„Lauter und heilig sein Leben wie seine Kunst zu bewahren, in Keuschheit leben und die hohe Kunst auszuüben.“ (Auszug aus dem Hippokratischen Eid, den Studenten an der Schule von Hippokrates nach dem Arztstudium ablegen mussten.)
Dioskurides (um 50 n. Chr.)
Der griechische Arzt Dioskurides, der zur Zeit der Herrschaft der Kaiser Claudius (10 v. Chr. – 54 n. Chr.) und Nero (37 n. Chr. – 68 n. Chr.) lebte, beschrieb in seinem berühmten Werk, einer fünf Bände umfassenden Heilpflanzenlehre („Materia medica“), mehr als 800 Heilpflanzen, darunter auch ausführlich das Johanniskraut. Es sollte hilfreich gegen Ischiasbeschwerden, Blasenschwäche und Brandwunden sein und dazu auch eine menstruationsfördernde Wirkung haben.
„Der Strauch hat eine Blüte wie die Levkoje, welche, zwischen den Fingern gerieben, einen blutähnlichen Saft abgibt, weshalb es auch Androhaimon (Männerblut) heißt.“
Während des Mittelalters und der Renaissance erlangte die Pflanzenheilkunde wieder den Stellenwert, den sie einst in der Antike hatte. Viele Klostergärten wurden zum Anbau von Heilpflanzen genutzt. Die wohl bekannteste Vertreterin dieser Zeit war die Äbtissin und Mystikerin Hildegard von Bingen.
Hildegard von Bingen (1098 – 1179)
Sie trat in das Benediktinerkloster Disibodenberg ein und gründete 1150 das Kloster Rupertsberg in der Nähe von Bingen am Rhein. Dort kultivierte sie im Klostergarten Kräuter und Heilpflanzen und zeichnete ihre Erfahrungen und Beobachtungen für die Nachwelt auf. Viele dieser Heilrezepte haben bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren.
Auch sie hat sich ausführlich mit dem Johanniskraut beschäftigt und sprach der Pflanze eine heilende Wirkung zu.
Albertus Magnus (1193 – 1280)
Der Dominikanermönch und spätere Bischof von Regensburg wurde wegen seiner umfassenden Kenntnissen in den Naturwissenschaften und in der Philosophie auch als „Doctor universalis“ bezeichnet. Nicht nur Botanikern sind seine „Erläuterungen zu Pseudo-Aristoteles“, einem Standartwerk der Heilpflanzenkunde, bekannt. Auch hier wird auf das Johanniskraut, das er wohl als Erster „Seelenkraut“ nannte, eingegangen.
Hieronymus Bock (1498-1554)
Ebenfalls um die Heilpflanzenkunde verdient hat sich Hieronymus Bock gemacht. In seinem 1532 veröffentlichten Buch „Contrafayt Kreuterbuch“, das mit sehr naturnah angefertigten Holzschnitten ausgestattet wurde, schreibt er dem Johanniskraut blutstillende, wundheilende und harntreibende Wirkung zu.
Auch in seinem 1549 erschienenen Werk „New Kreütterbuch von unterscheidt Würchung und Namen der Kreutter, so in Teutschen landen wachsen“ wird ebenfalls ausführlich auf das Johanniskraut eingegangen, schon fasst als ein „Tausendsassa“ beschrieben.
Leonard Fuchs (1501 – 1566)
Dieser weitere Kenner der Heilpflanzenwelt beschrieb die Wirkung von Johanniskraut, im speziellen bei rheumatischen Beschwerden, wie folgt:
„Sein Samen gesotten und vierzig Tage nacheinander getrunken, heilt das Hüftweh.“
Sein Rezept zur Heilung von Wunden lautete:
„Die Blätter mit Samen zerstoßen und übergelegt, heilen den Brand. Die Blätter gedörrt, und zu Pulver zerstoßen in die faulen Schäden und Geschwüre gestreut, heilen dieselbigen.“
Paracelsus (1493 – 1541)
Das Johanniskraut, so heißt es, sei das Lieblingskraut des Arztes und Reformators Theophrastus Bombastus von Hohenheim gewesen, der sich selbst Paracelsus nannte.
Als Sohn einer alten, berühmten schwäbischen Familie im Kanton Schwyz geboren, wurde er schon früh von seinem Vater, selbst Arzt, in Alchemie, Medizin und Chirurgie unterrichtet. Später studierte er Medizin und erhielt in Ferrara, Italien, seinen Doktortitel. Nach seinem Studium unternahm er zahlreiche Reisen und besuchte Ärzte, Alchemisten, Zigeuner und kluge Frauen, von denen er zahlreiche Tipps und Ratschläge erhielt.
Paracelsus stand der damals vorherrschenden Signaturenlehre sehr nahe. Diese Lehre, deren Ursprung in der Antike liegt, beinhaltet den Versuch, die heilende Wirkung von Pflanzen mit dem Auge erkennen zu können. So ordnete man z. B. Pflanzen mit roten Blüten und Früchten der Heilung von Blutkrankheiten zu.
Paracelsus bezeichnete das Johanniskraut als „Nervenkraut“ oder „Sonnenschein für die Seele“.
Der junge Paracelsus war überzeugt, dass „Gott den Menschen mit einem natürlichen Licht ausgestattet habe, das ihn befähigt, die Heilkräfte der Natur zu erkennen.“
Er stellte fest, dass das Johanniskraut durch seine porösen Stellen in den Blättern für die Wundheilung geeignet sei.
Erst im fortgeschrittenen Alter studierte Paracelsus u. a. die Werke des Botanikers Hierolano Francostero (1483 – 1533), der in seinem Buch „De Sympathia et Antipathia rerum liber I“ feststellte, dass sich erst die verschiedenen Inhaltsstoffe, damals „stoffliche Mittler“ genannt, für die Heilwirkung einer Pflanze verantwortlich zeigen.
„Was wir sehen, ist nicht die Arznei, sondern der Corpus, darin sie liegt. Das da sichtbar ist, ist das Äußere, das nicht dazu gehört“, stellte er fest.
Paracelsus glaubte, dass das Johanniskraut eine Art Universalheilmittel sei. In einem seiner Bücher schreibt er über die Heilpflanze:
„Nichts vertreibt die Krankheit als Stärke… So soll man die Arznei in der Kraft suchen, in welcher die Stärke wider das ist, das es gebraucht werden soll. Auf solches folgt nun, dass „perforata“ (Johanniskraut) auch eine solche Stärke hat, die Gott in „perforatam“ gelegt hat. Durch die selbige Stärke treibt sie das Gespenst der Natur hinweg, auch in Heilung der Wunden und Knochenbrüche … Und ist „universalis medicina“ über den großen Menschen.“
In der Renaissance wurden die Inhaltsstoffe einer Heilpflanze als „stoffliche Mittler“ bezeichnet.
Paracelsus war der erste, der das Johanniskraut nicht nur zur Wundheilung, sondern auch bei „tollen Phantasien“, also zur Behandlung von Depressionen verwendete. Dieser Gemütszustand wurde von ihm wie folgt beschrieben:
„… Phantasma, eine Krankheit ohne ein Corpus und Substanz, sondern allein im Geist der Contemplation wird ein anderer Geist geboren, von welchem der Mensch regiert wird.“
Die von Paracelsus festgestellte antidepressive Wirkung des Johanniskrauts konnte ja inzwischen mehrfach medizinisch nachgewiesen werden.
„Gott hat mit diesem Kraut ein Zeichen gesetzt, allein wegen der Geister und tollen Phantasien, die den Menschen zur Verzweiflung bringen.“
Der Arzt empfahl die Verwendung auch bei inneren Eiterungen, Würmern und Quetschungen. Aufzeichnungen belegen, dass Paracelsus das Johanniskraut in Verbindung mit Erkrankungen des Nervensystems bringt, wie z. B. entzündliche Erkrankungen der peripheren Nerven (Rheumatismus, Ischias usw.).
Seine Begeisterung für das Johanniskraut drückte er wie folgt aus:
„Seine Tugend kann gar nicht beschrieben werden, wie groß sie eigentlich ist … Es ist nicht möglich, dass eine bessere Arznei für Wunden in allen Ländern gefunden wird.“
Sebastian Kneipp (1821-1897)
Der bekannte Pfarrer und Naturheiler, ein begeisterter Anhänger der gesunden Lebensweise, beschreibt in seinem 1889 erschienenen Werk „So sollt ihr leben“ ausführlich das Johanniskraut und dessen Anwendungsgebiete:
„Das Johanniskraut führte wegen seiner großen Wirkung wegen früher den Namen Hexenkraut … Dieses Heilkraut übt besonderen Einfluss aus auf Gasbildung, Verstopfung, Leberstauung… Kopfleiden, die von wässerigen Stoffen oder Verschleimungen im Kopfe herrühren, leichte Verschleimungen von Brust und Lunge heilt Tee von Johanniskraut in Bälde… Mütter, denen kleine Bettnässer viel Arbeit und Sorge bereiten, wissen von der stärkenden Wirkung eines solchen Tees manches zu berichten…“
Kneipp erfand auch die Rezeptur zur Herstellung von Johanniskrautöl: „Man setzt frische Blumen mit reinem Oliven- oder Leinöl in verschlossener Flasche für etwa zehn bis vierzehn Tage an die Sonne. Danach entfernt man die Blumen und erneuert sie so oft, bis eine dunkelrote Färbung des Öls erreicht ist.“
In der heutigen Zeit erlebt das Johanniskraut eine Renaissance. 1941 wurde es unter dem Namen „Herba hyperici“ in das Ergänzungsbuch des Deutschen Arzneibuchs eingetragen und fand dadurch erstmalig die Anerkennung der Schulmedizin.
Gerade naturheilkundlich orientierte Ärzte verwerten heute gerne Johanniskraut, u. a. gegen Wechseljahrsbeschwerden bei Frauen und Depressionen im Allgemeinen.
Hexerei und Zauber mit dem Johanniskraut
Nur wenige Kräuter sind im Aberglauben unserer Vorfahren mit so viel Hexerei und Zauberei verbunden wie das „Herrgottswunderkraut“ Johanniskraut. In alter Zeit war das Johanniskraut eine magische Pflanze, eine heilige Pflanze der Kelten und wichtig im Brauchtum und der Mythologie. Man sprach dem Johanniskraut die dämonenvertreibende Kraft der Sonne zu. Johanniskraut, dem Täufer Johannes geweiht, ist das Hexenkraut schlechthin, das natürlich in der Johannisnacht geerntet wurde. Hält man ein Blatt des „Tausendlöcherkrautes“ gegen das Licht, dann sehen die Exkretbehälter wie kleine Löcher aus. Es galt daher vor allem als ein Heilmittel für Stich- und Schussverletzungen. Der Sage nach stammen diese Löcher vom Teufel, der aus Bosheit über die Macht, die dieses Kraut über böse Geister und über ihn selbst besaß, die Blätter mit Nadeln zerstochen haben soll.
Die verschiedenen Bestandteile des Johanniskrautes wurden bei Verbrennungen, Fieber, Blasenbeschwerden und der Wundbehandlung eingesetzt. Als „fuga daemonum“, auch Teufelskraut, Hexenkraut oder Walpurgiskraut, fand es im Mittelalter bei der Teufelsaustreibung Verwendung. Die zu Heilenden litten vermutlich unter depressiven Verstimmungen, die sich in schweren Stimmungsschwankungen äußerten, was seinerzeit als Besessenheit interpretiert wurde.
Die „Blattnerven“ werden als Nervensignatur gedeutet und zerreibt man eine Blüte zwischen den Fingern, so tritt blutroter Saft aus – Signatur für das Heilmittel gegen Blutarmut und Menstruationsbeschwerden (Signaturpflanze). Der Legende nach stand die Pflanze unter dem Kreuz Christi und jede Blüte fing einen Tropfen seines Blutes auf. Einer weiteren Legende nach entstand die Pflanze aus dem Blut Johannes des Täufers. So sind auch die volkstümlichen Bezeichnungen Herz-Jesu-Blut, Herrgottskraut, Blutkraut, Johannisblut, Herrgottsblut, Kreuz-Christi-Blut und Marienblut zu erklären.
Die hohe Bedeutung, die dem Johanniskraut im Volksglauben zukommt, beruht weniger
auf der Legende des Täufers, dessen Geburt ein halbes Jahr vor Christi Geburt angesetzt wird, sondern auf der Tatsache, dass nach alter Auffassung der 24. Juni der Tag der Sonnenwende ist; ihr Fest wurde durch das Johannisfest gleichsam christianisiert.
Wer nach Sonnenuntergang auf das Tüpfel-Johanniskraut tritt, wird auf ein magisches Pferd gerissen, das mit ihm um den Himmel bis zum Sonnenaufgang herumrast, um erst dann den erschöpften Reiter wieder abzuladen. Schon im klassischen Altertum war „Gottes Güte“ ein geschätztes Heilmittel. Dioskurides verwendete es als Arzt n der römischen Armee sehr viel, und auch in germanischen Stämmen war es geläufig. In England heilte man damit Wahnsinn, in Russland gab es Schutz gegen Tollwut, und die Brasilianer kannten es als Gegenmittel bei Schlangenbissen. Johanniskraut wurde immer dann gegeben, wenn es galt Irrsinn zu heilen, vor allem, wenn man annahm, dass der Patient von einem Teufel besessen sei. Sicherlich hat das rote Öl, das beim Zerreiben aus der Pflanze austritt, die Assoziationen zu christlichen Tugenden geweckt, indem es das vergossene Blut Christi symbolisierte und dadurch zu einer Waffe gegen den Teufel wurde. Man sagt, dass am 29. August, dem Tag, an dem Johannes der Täufer enthauptet wurde, blutrote Flecken auf den Blättern des Johanniskrautes erscheinen.
Neben vielen anderen Zauberkräutern ist das Johanniskraut mit seinen vielen Namen und Bedeutungen eines der wichtigsten magischen Kräuter gegen alles Böse und Dämonische: Teufelsmichel, Jagemichel, Jagdteufel, Teufelsbanner, Teufelsflucht, Hexenkraut, Elfenblut, Blitzkraut und Donnerkraut. Diese Pflanze wurde vor allem zur Bekämpfung gegen dunkle Mächte angewendet. In der Chemnitzer Rockenphilosophie aus dem 16. Jahrhundert, einer Sammlung abergläubischer Meinungen, heißt es: „Sankt Johanniskraut ist von so großer Kraft, den Teufel und Hexen zu vertreiben, dass auch der Teufel aus Bosheit des Krautes Blätter mit Nadeln durchsticht.“ Recht geeignet erscheint dem Volk das Kraut in der Johannisnacht als Liebesorakel. So pressen zum Beispiel junge verliebte Mädchen – wobei sie an den Verehrer denken – die Blütenknospen aus und achten darauf, ob der austretende Saft rötlich oder farblos ist. Dabei wird gesprochen: „Ist mir mein Schatz gut, kommt rotes Blut; ist er mir gram, gibt’s nur Scham (Schaum).“ Und in einer alten Handschrift heißt es noch deutlicher: „So einer durch zauberische Liebe von Sinnen gekommen und unsinnig geworden, dem kann man also helfen: „Nehmet Johanniskraut anderthalb Hand voll und siedet dasselbige in drei Maß Wein; davon lasse den Kranken abends trinken.“ Besonders zauberkräftig ist das Johanniskraut, wenn es an seinem „Namenstag“, eben zu Johanni, gesammelt und verwendet wird. Das muss aber Punkt zwölf Uhr mittags erfolgen. In vielen Gegenden wird es auch als Donner- und Blitzkraut verwendet. Als Blitzkraut hängte man das Herz-Jesu-Blut unter das Dach, vor die Tür oder das Scheunentor. Ein alter Volksspruch sagt: „Johanniskraut und Dill, macht’s Gewitter still.“ Auf oder in den Herd geworfen soll es ebenfalls das Gewitter „verscheuchen“. Mit Kränzen aus Johanniskraut schmücken sich die um das Johannisfeuer Tanzenden und werfen nach dem Erlöschen des Feuers die Kränze auf die Dächer der Häuser, damit diese vor Brandschäden verschont bleiben. Um das Gewitter vom Dorf zu vertreiben, hängte man ein Büschel Johanniskraut an die Kirchenglocke.
Johanniskraut soll alles Gift vertreiben und auch alles Gespenst: „Daher auch die alten Weiber sprechen: Johanniskraut und Heid (Heidekraut) tun dem Teufel viel Leid.“ Bestreicht ein Jäger den Lauf seines Gewehres mit dem roten Saft der Pflanze, so besitzt er eine unbedingte Treffsicherheit. Wer dieses Kraut bei sich trug, war auch gegen Kugel, Hieb- und Stichwaffen gefeit; er konnte sogar Freundschaft und Liebe derjenigen erringen, denen er gefallen wollte. Eine alte Schrift traut diesem Kraut noch mehr zu: „Es widersteht mit solcher Macht den Symptomatibus, so aus Zaubereien verursacht, dass kein anderes Gewächs noch andere Art von Medikament, sie seien auch köstlich im Ansehen, als sie immer wollten, gefunden worden, dieses Kraut in solchen Fall übertreffen können.“ Steckte man das Kraut am Johannistag an den Hut, so hatte man dann ein Jahr lang Aussicht auf Glück und Gesundheit. Am Tag der Sommersonnenwende hängte man ein Büschel Johanniskraut in den Kamin, um so Dämonen vom Haus abzuhalten.
Herz-Jesu-Blut im Johanniskraut
Weil das Johanniskraut, das Herz-Jesu-Blut, in den Tagen um Johanni (24. Juni) zu blühen beginnt, trägt es den Namen Johannes des Täufers. Kein anderer Tag war früher auf dem Lande mit soviel Aberglauben verbunden.
Das Johanniskraut (Hypericum perforatum) gehört zur Familie der Hartheugewächse (Hypericaceae) und wird seit Jahrtausenden als Arzneipflanze hoch geschätzt. Die vielen volkstümlichen Bezeichnungen und oft geheimnisvollen Namen deuten auf seine mannigfaltige Verwendung als Heilpflanze hin: Wundkraut, Färbekraut, Sonnenwendkraut, Herz-Jesu-Blut, Marienblut, Johannisblut, Herrgottskraut, Herrgottswunderkraut, Gottesgnadenkraut, Gottesgütekraut, Seelenbalsam, Seelenkraut, Blutkraut, Herrgottsblut, Blütenblut, Jesuwundenkraut, Elfenblut, Sankt Johannes-Blut, Tausendlöcherkraut, Nadellöcherkraut, Seelenwundenkraut, Kreuzblut, Sonnenkraut, Jesuseelenkraut, Liebfrauenbettstroh, Tüpfelhartheu, Hertenau, Harenaue, Tüpfelkraut, Blatttüpfel, Jagemichel, Teufelsbanner, Teufelsflucht, Hexenkraut, Unseres Herrgotts Blutkraut, Blitzbanner, Donnerbanner, Heideblutkraut, Mannskraft, Falscher Wohlgemut, Stolzer Heinrich – um mal einige der wichtigsten Bezeichnungen zu nennen. Der Name „Stolzer Heinrich“ (nicht zu verwechseln mit dem „Guten Heinrich“ im Garten) ist auf die „gewisse“ Heilwirkung zurückzuführen: in Depression getrunken, kann man anschließend wieder als „stolzer Heinrich“ auftreten.
Äußere Merkmale der Pflanze oder Aberglauben standen Pate bei vielen volkstümlichen Bezeichnungen, wie zum Beispiel Hartheu: Wenn man die Stängel der Pflanze trocknen lässt, werden sie sehr hart. Nach dem Trocknungsvorgang erhält man Heu. Der Name Blutkraut wiederum verweist auf den roten Saft der Pflanze, der oft mit Blut in Verbindung gebracht wurde.
Eindeutig geklärt ist hingegen der botanische Name „Hypericum perforatum“. Perforatum bedeutet übersetzt „durchlöchert“ (perforiert) und nimmt damit Bezug auf die vielen punktförmigen „Löcher“ in den Blättern.
Genauer gesagt: An zwei ganz eigentümlichen Merkmalen ist das Echte Johanniskraut leicht zu erkennen: Hält man die Blätter gegen das Licht, so erscheinen viele durchscheinende Punkte, die Öldrüsen. Diese Drüsen lassen die Blätter wie „perforiert“ (durchlöchert) erscheinen. Dunkle Drüsen in den gelben Blüten sind mit dem roten Farbstoff, dem Hypericin, angefüllt. Zerreibt man eine Blüte zwischen den Fingern, so wird die Haut davon dunkelrot („blutrot“) gefärbt. Diesem roten Farbstoff werden besondere Heilkräfte zugeschrieben. Es ist für die Pharmazie der interessanteste und wichtigste Inhaltsstoff im Johanniskraut. Mit seiner Hilfe ist der Organismus in der Lage, Lichtenergie, die Energie der Sonne, aufzunehmen. Es wurde festgestellt, dass nach dem Genuss von Hypericum die Hautschranke für das Licht durchbrochen wird. Hypericin verwandelt das Licht kurzer Wellenlängen (z. B. ultraviolette Sonnenstrahlen) in langwelliges Rot, wie es uns als Infra-Rot-Strahlung bekannt ist, im wesentlichen also Wärme. Dabei wird Energie freigesetzt, die sich am Stoffwechsel der Körperzellen, besonders der Nervenzellen, beteiligt.
Bei hellfarbigen Tieren, bei blonden und rotblonden Menschen kommt es nach innerlicher Gabe von Johanniskraut nicht selten zu Hautreizungen und Hautentzündungen, wenn diese sich über längere Zeit dem Sonnenlicht aussetzen. Volkstümlich bezeichnet man das Johanniskraut als „Seelenarznei“, als „Seelenbalsam“. Gleichsam wie die Sonnenstrahlen unsere Psyche aufzuhellen vermögen, so vermag das auch das Johanniskraut.
Gesammelt werden das blühende Kraut (Herba Hyperici) und die Blätter der Pflanze. Dies geschieht in der Regel zwischen dem 15. Juni und dem 15. August. Die günstigste Tageszeit dafür ist der frühe Morgen. Man sammelt am besten bei zunehmendem Mond, während dieser Konstellation weisen die Inhaltsstoffe des Johanniskrautes die höchste Wirksamkeit auf.
Paracelsus gibt folgende Sammeltipps:
„So soll die Pflanze nach dem Gange des Himmelslaufes genommen werden, so dass dessen Influenz auch wider diese Geister (Depressionen) sei, nämlich am meisten im Mars, im Jupiter und in der Venus, und mitnichten nach dem Monde, sondern wider den Mond, auch nicht nachmittags noch in der Nacht, sondern im Aufgange der Sonne, gegen die Sonne, in aurora, das ist im Morgenrot, oder diluculo, das ist in der Dämmerung des Morgens. Und die ist am besten, die da bei guten anderen Blumen steht oder unter ihnen wächst, und je länger, je besser, je mehr mit Blumen, je besser, und in der Zeit, wenn die Blumen am höchsten sind.“
Beim Sammeln wird das blühende Kraut mit einem scharfen Messer kurz über dem Boden abgeschnitten. Das Erntegut sollte in einem Korb transportiert werden. Zum Trocknen wird das gesammelte Kraut gebündelt und auf einer Schnur aufgereiht. Die Sträuße sollen locker gebunden sein. Ein Strauß getrocknetes Johanniskraut verbreitet einen angenehmen, beruhigenden Duft in der Wohnung.
Getrocknet wird an einem luftigen Ort. Sobald die Heilpflanzen getrocknet sind, werden sie in lichtundurchlässige, verschließbare Glasgefäße gefüllt. Unbedingt vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren! Die Lagerung sollte ein Jahr nicht überschreiten.
Von den vielen Heilanzeigen, die bereits in den alten Kräuterbüchern zu finden sind, haben sich durch neueste Untersuchungen einige Hauptanwendungsgebiete ergeben. Nervenstärkung und Wiederherstellung der inneren Ruhe bei depressiver Stimmungslage, innerer Unruhe und Angstzuständen, entsprechende Wirkung bei Übererregbarkeit und Empfindlichkeit. Andere Anwendungsgebiete sind klimatische Reize, wie z. B. Föhn, Wetterfühligkeit, Depressionszustände im Alter und in den Wechseljahren, Winterdepressionen, krampfartige Magen- und Darmbeschwerden. ´
Eine Wirkung des Johanniskrautes ist allgemein, insbesondere aber bei Depressionden, erst nach einer Anwendungsdauer von zwei bis drei Wochen zu erwarten. Eine kurmäßige Anwendung über einen Zeitraum von drei Monaten ist zu empfehlen. Schädliche Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten. Jedoch sollte während der Einnahme von Johanniskraut möglichst der Aufenthalt in intensiver Sonnenbestrahlung vermieden werden, was insbesondere für blondhaarige Menschen mit weniger Pigmentfarbstoffen in der Haut zu empfehlen ist.
Neben dem roten Farbstoff Hypericin enthält das Johanniskraut noch andere Wirkstoffe, die weitere Anwendungsgebiete ermöglichen. Johanniskraut fördert die Wundheilung. Damit ist neben der innerlichen auch die äußerliche Anwendung zu begründen, vor allem bei Hautverletzungen, Verbrennungen, Brandwunden, Schürfwunden. Diese Wundheilung wurde schon im Mittelalter erkannt.
Inhaltsstoffe: Johanniskraut enthält u. a. ca. 0,1 % rot-fluoreszierende Farbstoffe Hyperizin und Pseudo-Hyperizin, ca. 10 % Gerbstoffe, Hyperforin, Flavonoide, Glykoside, Mineralstoffe und ätherisches Öl. In den Inhaltsstoffen des Johanniskrautes konnten auch antibiotisch wirkende Substanzen nachgewiesen werden.
Die Substanz Hyperizin macht den menschlichen Körper für Sonnenlicht besonders empfindlich. Der Mediziner spricht von einer Sensibilisierung gegenüber Sonnenstrahlen und bezeichnet diesen Vorgang als Photosensibilisierung.
Aufmerksam wurde man auf diese Photosensibilisierung durch Hautentzündungen, die bei Kühen aufgetreten sind. Diese Tiere grasten auf Weiden, auf denen reichlich Johanniskraut wuchs. Da sie sich zusätzlich den ganzen Sommer im Freien aufhielten, traten nach einiger Zeit zuerst Hautreizungen, später Entzündungen auf.
Es gibt seit einiger Zeit auch Johanniskraut im Garten, das aus der Wildform gezüchtet wurde. Es ist in jedem Garten und Vorgarten ein sonniger Blickfang. Wegen seiner großen, goldgelben Blüten macht es sich besonders gut in einem Blumenbeet oder in einem Kräutergarten.
Weil die Blüten selbst wie kleine Sonnen aussehen, liebt das Gewächs sonnige Plätze. Der Boden sollte kalkhaltig und trocken sein.
Auch die Vermehrung der Pflanze ist einfach und unkompliziert. Sie ist entweder als Samen oder als fertige Pflanze in gut sortierten Gärtnereien erhältlich. Der Samen wird von März bis Anfang Mai im Frühbeet ausgesät. Die jungen Pflänzchen werden dann in einem Abstand von ca. 30 cm in das Beet gepflanzt.
Eine weitere Möglichkeit ist das Setzen von Wildpflanzen. Hier sollte man sich allerdings sicher sein, echtes Johanniskraut zu pflanzen und nicht einen anderen Vertreter dieser Pflanzengattung.
Ist im Kräutergarten bereits Johanniskraut vorhanden, können diese Pflanzen durch Teilung der weitverzweigten Wurzelstöcke problemlos vermehrt werden. Für medizinische Zwecke wird nur das Tüpfelhartheu, das Echte Johanniskraut, verwendet. Es wird heute zu medizinischen Zwecken feldmäßig angebaut.
Auch für Balkonkästen ist das Echte Johanniskraut ein dekorativer Blickfang.
Die Heilkraft der Farbe Rot
Inhaltsstoffe und Wirkung des Johanniskrauts
Das Johanniskraut verfügt über viele wichtige Inhaltsstoffe, die für die große Heilwirkung verantwortlich sind und die das Tüpfelhartheu berühmt gemacht haben. Der wichtigste Wirkstoff ist das Hyperizin, ihm wird u. a. die antidepressive Wirkung des Krautes zugeschrieben. Dieser Stoff gilt als „Leitsubstanz“ des Johanniskrautes. Johanniskrautblüten enthalten bis zu 0,3 Prozent des Inhaltsstoffes Hyperizin. Damit deutlich wird, was Hyperizin im Gehirn bewirkt, muss man die dort stattfindenden Abläufe genauer betrachten. Im Gehirn werden bestimmte Reize von einer Gehirnzelle zur anderen übertragen. Dabei wird ein Stoff, Dopamin genannt, ausgeschüttet. Eine weitere nahe gelegene Zelle überprüft diesen Stoff, liest sozusagen seine Botschaft und nimmt diesen auf. Damit ist auch diese Zelle aktiviert usw. Erwähnt werden muss noch, dass Dopamin eine erregungshemmende Wirkung aufweist. Dopamin wird im Gehirn zu Noradrenalin umgewandelt, was wiederum euphorisierend wirkt. Ist nun die normalerweise harmonisch verlaufende Umwandlung der beiden Stoffe gestört, verspürt man eine innere Unruhe oder gerät in depressive Stimmungen. Das ist dann der Fall, wenn das Gehirn zu wenig Dopamin hat und somit die Erregung der Gehirnzellen nicht mehr richtig funktioniert. Schwere Funktionsstörungen können schwere Erkrankungen, wie z.. B. Schizophrenie verursachen.
Dopamin wirkt erregungshemmend, Noradrenalin hingegen erregungsfördernd.
Hyperizin ist für die Regulierung von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn zuständig. Es hat die Fähigkeit, zu veranlassen, dass weniger Dopamin in Noradrenalin umgewandelt wird. Damit gibt es im Gehirn weniger Noradrenalin, also weniger von dem erregungsfördernd wirkenden und mehr von dem beruhigenden Stoff. Das Resultat ist Ausgeglichenheit und innere Ruhe, eben seelisches Wohlbefinden.
Aber Hyperizin kann noch viel mehr: Es hat die Fähigkeit, die Wirkung des Lichts auf die Zirbeldrüse zu verstärken. Diese an der Gehirnbasis gelegene Drüse produziert etliche wichtige Hormone und ist vermutlich das zentrale Regelorgan für die innere Zeitsteuerung. Hyperizin stimuliert die Zirbeldrüse positiv und beugt zusätzlich Hormonstörungen vor.
Im speziellen sorgt es dafür, dass bei Tag weniger und bei Nacht mehr Melatonin, ein neurosekretorisches Hormon der Zirbeldrüse, ausgeschüttet wird. Dieses Hormon ist u. a. für die Aktivität am Tag und für den Schlaf während der Nachtstunden mitverantwortlich. Es wurde 1958 entdeckt und kann seit 1960 sogar chemisch hergestellt werden.
Während der grauen, meist sonnenlosen Winterzeit fühlt man sich oft müde, lustlos und abgespannt. Ganz anders ist das im Sommer, wenn die Sonne scheint. Während dieser Zeit hat man das Gefühl, Bäume ausreißen zu können, und die tägliche Arbeit geht einem leichter von der Hand. Wie Forschungen ergeben haben, hängen diese verschiedenen Stimmungslagen eng mit dem Einfluss des Lichts zusammen. Bekommt die Zirbeldrüse nicht genug Licht, produziert sie mehr von diesem stimmungssenkenden Hormon Melatonin.
Wenn die Zirbeldrüse zu wenig Licht bekommt, löst das depressive Stimmungen aus.
Das passiert normalerweise nur in der Nacht während des Schlafes. Ist es aber auch am Tag relativ dunkel, lässt die Produktion von Melatonin nicht nach. Das Resultat dieser gestörten Produktion ist unerfreulich: Man wird von Müdigkeit am Tag, Lustlosigkeit und depressiven Gedanken geplagt und kann nachts nicht durchschlafen oder leidet unter Einschlafstörungen. In der Zirbeldrüse wird das stimmungssenkende Hormon Melatonin produziert.
Damit Hyperizin seine volle Wirkung entfalten kann, braucht es Licht. Daher soll man auch im Winter einen Spaziergang an der frischen Luft unternehmen. Und dabei hilft dann auch die Johanniskrautbehandlung. Der Inhaltsstoff Hyperizin kann seine volle Wirkung nur entfalten, wenn er genügend Licht bekommt.
Ein weiterer wichtiger Inhaltsstoff des Johanniskrauts sind die ätherischen Öle. Heilpflanzen, die ätherische Öle wie das Johanniskraut enthalten, werden als aromatische Pflanzen bezeichnet. Eingenommen zeigen die ätherischen Öle des Johanniskrauts u. a. eine entwässernde und die Nerven beruhigende Wirkung. Äußerlich angewendet wirken sie schmerzlindernd, entzündungshemmend und bakterientötend.
Johanniskraut weist auch einen sehr hohen Gehalt an Gerbstoffen auf. Gerbstoffe steigern die Widerstandskraft der Haut und senken die Reizempfindlichkeit. Außerdem fördern sie die Durchblutung des Herzmuskels und stärken dadurch das Herz. Ferner sind sie vorzüglich zur Heilung von Magen-Darm- Erkrankungen wie z. B. Durchfall geeignet.
Auch der Wirkstoff Hyperforin ist im Johanniskraut enthalten, der eine entzündungshemmende Eigenschaft besitzt. Hyperforin ist aber hochempfindlich und nur in der frischen Pflanze vorhanden. Johanniskrauttee aus getrockneten Blüten enthält so gut wie kein Hyperforin. Zur Behandlung von Hautentzündungen oder Hautunreinheiten sollte man deshalb frisch zubereitetes Johanniskrautöl aus frischen Blüten verwenden.
Auch Flavonoide sind als Wirkstoff im Johanniskraut enthalten. Ihre Farbe gab dieser Substanz den Namen. Das lateinische Wort „flavus“ heißt übersetzt „gelb“. Es handelt sich um gelbe Pflanzenpigmente, die in Extrakten – häufig zusammen mit Ascorbinsäure – zu finden sind.
Die Flavonoide im Johanniskraut zeigen ein breites Spektrum an Heilwirkung. Sie helfen u. a. bei der Aktivierung körpereigener Abwehrkräfte, sind an verschiedenen Vorgängen in den Zellen beteiligt, stärken das Herz und haben eine krampflösende Wirkung.
Die Flavonoide im Johanniskraut sind dafür verantwortlich, dass die Arbeit des Neurotransmitters Serotonin im Gehirn gefördert wird. Serotonin ist mit für positive Stimmungen verantwortlich. Daher bezeichnet man es oft als Glückshormon. Es steigert das Wohlbefinden.
Bestimmte Flavonoide im Johanniskraut wirken auch angstmindernd und beruhigend. Ihre beruhigende Wirkung auf die Nerven drückt sich auch in verbesserter Schlafqualität aus.
Auch Glykoside sind im Johanniskraut enthalten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil vieler Herzmittel.
Bei der Dickdarmkrebsvorsorge übernimmt das Johanniskraut eine wichtige Rolle, da es krebsfördernde Substanzen in ihrem Wachstum hemmt.
Wer unter Händezittern, Zähneknirschen während der Nacht oder vermehrter Schweißbildung leidet, sollte sich von der beruhigenden Wirkung des Johanniskrauts überzeugen lassen.
Jede Krankheit hat eine Ursache. Diese liegt häufig im seelischen Bereich. Naturheilkundlich orientierte Ärzte und Heilpraktiker kennen die starke Wirkung der Seele auf die Krankheiten. Sie versuchen bei einem Therapievorschlag nicht nur auf den kranken Körper, sondern auch auf die kranke Seele einzugehen.
Das erkannte schon Paracelsus. Zu den ältesten Heilmethoden zählt die Verwendung von Farben. Die Farben der Pflanzen z. B. wurden schon immer als Mittel eingesetzt, die Kräfte im Körper des Menschen zu reaktivieren. Die Farbtherapie basiert auf der Erkenntnis, dass die Ursache einer Erkrankung in der gestörten Harmonie zwischen Körper und Seele liegt. Farbschwingungen von bestimmten Farben sollen die Eigenschwingung des kranken Körpers wieder aktivieren und so den Heilungsprozess beschleunigen.
Die Farbe Rot hat schon immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Rot war die Farbe der Kaiser und war z. B. als Kleidungsfarbe, dem Volk verboten zu tragen. Rot zeigt Signalwirkung, denken wir nur an die roten Autos der Feuerwehr. Rot ist der Lebenssaft, das Blut, ohne das wir nicht lebensfähig wären. Rot ist aber auch der Saft, den man beim Zerreiben des Johanniskrautes erhält. Deshalb wurden dem Johanniskraut schon immer mystische Kräfte nachgesagt.
Heute wissen wir natürlich um die wertvollen Inhaltsstoffe des Krautes und lassen uns von dem mythischen Glauben nicht mehr beeindrucken. Dennoch bleibt festzuhalten, dass z. B. Johanniskrauttee nicht nur wegen der Wirkstoffe heilend wirkt, sondern auch wegen seiner herrlich blutroten Farbe.
Die Augen empfinden dieses Rot als angenehm und geben diesen positiven Eindruck an unsere Seele weiter. Hätte Johanniskrauttee eine aschgraue oder braune Farbe, würde dieser zusätzliche Heilungsaspekt, der nicht unterschätzt werden soll, wegfallen. Farbtherapeuten sagen dem Johanniskrauttee deshalb eine größere Wirkung nach als den Dragees.
Die schöne rote Farbe des Johanniskrauttees ist Balsam für die Seele.
Man wird zwar mit dem Genuss von Johanniskraut innerlich ausgeglichener und ruhiger, wird aber deshalb nicht handlungsunfähig. Ganz im Gegenteil! Man wird aktiver, nur die Art, wie man die Aktivitäten in Angriff nimmt, hat sich geändert. Nicht kopfloses, nervöses Handeln steht jetzt im Vordergrund, sondern gezieltes Vorgehen in aller Ruhe.
Als natürliche Alternative zu chemischen Psychopharmaka wird das Johanniskraut erfolgreich zur Behandlung u. a. von depressiven Zuständen verwendet, da seine Inhaltsstoffe sich normalisierend auf die gestörten Energieströme im Gehirn auswirken. Die Wirkung kann mit der von Transquilizern verglichen werden, jedoch besteht beim Johanniskraut nicht die Gefahr der Gewöhnung. Johanniskraut gilt zu Recht als sehr gutes pflanzliches Antidepressivum.