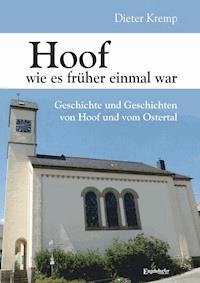Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Geschichten, Mythen und Wissenswertes rund um das Jahr hat der mehrfache Autor Dieter Kremp in diesem Buch als einen wahren Schatz zusammengetragen. Schon beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses glaubt man den verführerischen Duft der Flora in der Nase zu haben, das Summen von Maikäfern zu hören und den Geschmack von süßen Kirschen im Mund zu spüren. Rund um das Jahr ranken sich schon seit Jahrhunderten zahlreiche Mythen, Gebräuche und Feste, deren Herkunft und Bedeutung in diesem Buch kurzweilig erklärt werden. In gewisser Weise waren unsere Vorfahren sehr reich. Sie besaßen einen Schatz an Poesie und gesammelter Erfahrung: Hochwirksame Hausmittel wurden von Generation zu Generation überliefert; Rezepte aus alter Zeit gingen von Hand zu Hand; bei Saat und Ernte konnte man sich auf die bewährten bäuerlichen Wetterregeln verlassen; das Gemüt wärmte man an köstlichen Kalendergeschichten. Wer Sinn für das Alte, kernhaft Gute hat, findet in diesem Buch einen unerschöpflichen Begleiter durch das ganze Jahr. Das Buch ist gewürzt mit gedankenlyrischen Gedichten des Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kremp
EIN KUNTERBUNTER STREIFZUG DURCH DEN JAHRESKREIS
Schatzkästlein nützlicher Weisheiten von Januar bis Dezember
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2016
Das Buch wird gewidmet
meiner Ehefrau Waltrud,
meiner Tochter Julia,
meiner Schwiegertochter Jutta,
meinem Sohn Stefan,
meinem Schwiegersohn Dieter,
meiner Schwester Ursula
und meinen Enkelkindern Helena, Joshua und Samuel.
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Coverfotos: Vier Jahreszeiten © swa182 (Fotolia)
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
Inhalt
(kursiv: Gedichte)
Cover
Titel
Widmung
Impressum
Januar
An der Schwelle des Jahres
Zeit und Raum
Als es noch Eisblumen am Fenster gab
Eisblumen am Fenster
Vom Hartung bis zum Wolfsmond
„Januar kalt, das gefallt!“
Glücksbringer für das Jahr
Der Hecht im Karpfenteich
Der heilige Antonius und das Schwein
Das Hohelied von Weihrauch und Myrrhe
Die drei Weisen aus dem Morgenland besuchen das Jesuskindlein im Krippenstall zu Bethlehem
Die Sieben – eine Zahl, die es in sich hat
Viel Lärm am Dreikönigstag
Ergo bibamus!
Der Januar, der härteste Monat des Jahres
Wenn die Nase trieft und die Augen tränen
Spinn- und Strickabende unserer Vorfahren
Neue Besen kehren gut
Februar
Der Hornung, der „Bastard“ unter den Monaten
Eine schwingende Symphonie in Weiß
Die Juwelen des Winters haben viele Gesichter
Die Tage werden wieder länger
Lichtmess, das Spinnen vergess!
Hochzeit an Sankt Dorothee
Der Valentinstag: Das Fest der Jugend
Hochzeit an Sankt Valentin
Von der Dunkelheit zum Licht
Mattheis bricht das Eis
Wintermärchen
„Kopf ab“ war kein Todesurteil
Neue Besen kehren gut
Zaubernüsse bringen Farbe in den winterlichen Garten
Schneebeeren im Winter, die „Knallerbsen“ der Kinder
Ein Krokus kommt selten allein
Der Schritt ins Leben
März
Nun will der Lenz uns grüßen
Der März, der dritte Monat des Jahres
Die Knospen sprießen
„Im Märzen der Bauer …“
Wenn Gärtner in den Mond gucken
Der Frühling hält sich nicht an den Kalender
Was die Stunde geschlagen hat
Wenn Frösche quaken
Der Gregoriustag: Als die Schulmeister noch bettelarm waren
Flora bringt den Frühling zurück
Duftende Mädchenschönheiten im März
Vögel als Wetteransager im Frühling
Von der Vogelsprache und vom Vogelsang
Das Vogelkonzert
Vom lästigen Flug der fliegenden Pollen
Frühlingsblumen als Wetterpropheten
Birkensaft zur Frühjahrskur
Wo Schlüssel an den Zweigen hängen
April
Natur kann heilen
Eine Kur für die Seele
Frühlingsrausch
Der Launing, der 4. Monat des Jahres
April, April...
Der heilige Hugo hat es in sich
Aprile-Grille am 1. April: Bauernregeln und ihre Scherze
Die Schwalbe, Glücksbringer im Frühling
Schalmeien am Kuckuckstag
Auch der Storch ist ein Frühlingsbote
Gegen Warzen ist ein Kraut gewachsen
Wenn der Baum stirbt, dann stirbt auch der Mensch
Fliederduft und Flötenspiel
Wenn der Ginster flammt
Von heidnischem Brauchtum in der Osterzeit
Ostern – wenn die Glocken nach Rom fliegen
Ostern – Frühlingsfest für eine Göttin
Die Osterkerze
Narzissen, poetische Düfte an Ostern
Vom Zauber der Pflanzen in der Walpurgisnacht
Mai
Mai – Der Wonnemonat
Der Mai ist gekommen
Hymne an den Mai
Fruchtbarkeitsbräuche im Wonnemond Mai
Ein Paar in einer Frühlingsnacht
Du bist wie eine Blume
Von den Liebesdüften der Blumen
Waldmeister und Maibowle
Madonnenlilien zum Muttertag
Das Bild der Mutter
Ein Sträußchen Mutterkraut zum Muttertag
Maiglöckchen, ein Herzmittel der Natur
Die Königskerze, der „Himmelsbrand“ der Jungfrau Maria
Unter dem blühenden Kirschbaum laden schöne Elfen zum Tanz
Die Pflanzen als Hochzeits- und Liebessymbole
Jung gefreit, selten bereut – die „Jahres-Hochzeiten“
Maria durch den Dornwald ging
Maibäume für die Verliebten
Auch die „Richtmaie“ beim Hausbau ist ein Maibaum
„Maikäfer, flieg …“
Mairegen bringt Segen
Schneeflocken im Mai
Die „gestrengen Herrn“ und die kalte Sophie
Wenn Blütenträume platzen
Pfingstregen kommt ungelegen – Bauernregeln
Juni
Mittsommertage
Wetterregeln rund um die Sonne
Schafskälte und Johannisflut
Glühwürmchen am Johannistag
Von Siebenschläfern und Johanniskäfern im Rosenmond Juni
Heublumen-Medizin: Als das Heu noch nach Waldmeister duftete
Der Tag der sieben Brüder
Sommerkonzert in der Wiese – Wenn Heuschrecken musizieren
„Röslein auf der Heide …“
Herz-Jesu-Blut im Johanniskraut
Hexerei und Zauber mit dem Johanniskraut
Sitten, Feste und Bräuche am Johannistag
Himmelfahrtskränzchen und Bauernpelz
Prozessionen an Fronleichnam
Der „Pfingstquak“ im Ostertal
Die Pfingstrose, ambrosianischer Duftspender im Bauerngarten
Der Tag der Apostel Petrus und Paulus
Die Wegwarte, eine Sonnwendbraut
Zauberhafte Linden
Lindentraum
Holunder – Frau Holle stand Pate
Lichtlein auf der Wiese
Seifenblasen auf der Wiese
Juli
Die Hundstage im Honigmond Juli
Wenn es donnert und blitzt
Donner und Doria
Die Donnerwurz bannt Gewitter
Legenden ranken sich um die heilige Margarethe
Sitten, Feste und Bräuche am Margarethentag
Bauernregeln am Margarethentag
Margarethe, Patronin der Gebärenden und bei schwerer Geburt
Die „Perle“ Margerite, das Liebesorakel unserer Vorfahren
Sankt Jakob: Die Ernte beginnt
Rosmarin wärmt Herz und Gemüt
Lavendel, Balsam für die Nerven
Balsam für die Seele
Schwärmer in der Sommernacht
25. Juli: Der Tag des heiligen Christophorus
Aromatisch wie die Nymphe Minthe
Als die „Kersche“ noch „bockich“ waren
Ein Anna-Strauß aus roten Nelken und roten Rosen
Wenn Bienenmännchen lieben
Baldrian lockt Katzen an
August
Wenn es reift im Ernting
Ährenrauschen
Des Sommers schönste Tage
Allerlei Aberglauben im Monat August
Im Sternkreiszeichen des Löwen
Kräuterbüschel an Maria Himmelfahrt
Die Wurzeln der Kräuterweihe in vorchristlicher Zeit
Die Heilkraft der Kräuter an Maria Himmelfahrt – ein Gottesgeschenk
Wo der Barthel den Most holt
Die erste und die letzte Garbe
Die Kornblume ist aus dem Getreidefeld verschwunden
Der Duft von Getreidefeldern erfüllt die Luft
Ährengold
Wogende Getreidefelder – die Erntezeit beginnt
Vom „Korekaschde“ und dem „Kaffeeblech“
Bauernregeln rund um die Ernte
Von der Sichelhenke auf dem Erntefest
Erntefeste - Erntebräuche
Allerlei Aberglauben zum Schutz der Ernte
Was der August nicht kocht
Im August weint der Himmel Laurentiustränen
Sitten, Feste und Bräuche am Laurentiustag
Von Sternschnuppen und Heilkräutern im August
Wenn der Frauenmantel seine Tränen vergießt
September
Wenn Sonne und Sommer scheiden
Im Sternbild der Jungfrau
Wenn Spinnen auf die Reise gehen
Und der Herbstwind küsst die Herbstzeitlosen
An Mariä Geburt fliegen die Schwalben furt
Jagdfrühstück am Tag des heiligen Eustachius
Tag- und Nachtgleiche am Tag des Evangelisten Matthäus
Sankt Michael, der „Mai des Herbstes“
Eicheln als Wetterpropheten
Wer holt die Kastanien aus dem Feuer?
Schwarzbraun ist die Haselnuss
Von Bengeln und Nüssen
Die purpurrote Jungfernrebe
Spinnen im Altweibersommer
Morgentau und Perlenglanz
Der Fliegenpilz enthüllt die Zukunft
Als es noch nach „Quetschemus“ roch
Die Frucht des Paradieses
Südamerikanische Hysterie um die goldene Knolle
Bauernregeln rund um die Spinnen
Die Goldrute, eine Rute aus purem Gold
Oktober
Gedämpfter Abschied
Der Gilbhart, der zehnte Monat des Jahres
Goldener Oktober mit Feen in silbergrauen Haaren
Altweibersommer, die fünfte Jahreszeit
In Großmutters Spinnstube
Von der Zauberkraft des Herbstes
Im Tierkreiszeichen der Waage
Wenn es reift im Gilbhart
Des Herbstes Reife
Segensreicher Oktober
Gedanken zu Erntedank
Dank für das tägliche Brot
Kartoffelfeste am St. Gallus - Tag
Kartoffelfeuer an Sankt Lukas
Von „Bengeln“ und Nüssen
Sitten, Feste und Bräuche am Simons- und Judastag
Der Schuh auf dem Birnbaum
Der Apfel – die Frucht der Liebe
Adam und Eva – der Apfel des Paradieses
Der heilige Franz von Assisi und der Welttierschutztag
Halloween, die Nacht der finsteren Geister
Der Kürbis hat es in sich
Drachen tanzten über den Stoppelfeldern
Von der Grundbirne bis zum Erdapfel, von Pommes de terre bis zur Kartoffel
Kirchweihfeste im Oktober
Der Rosenkranzmonat Oktober
Weinfeste im Weinmonat Oktober
November
November, der elfte Monat des Jahres
Sternbild: im Tierkreiszeichen des Skorpions
Wenn die Nebel fallen
Wenn die Blätter fallen
Im Grauen erstarrt
Rabenvögel im November
Novemberstimmung
Wenn Bäume Trauer tragen
„Jägerlatein“ am Hubertustag
Sitten, Feste und Bräuche am Hubertustag
Ander Wind, ander Wetter
Gestecke im Herbst
Der heilige Martin und die Gans
Der Tod ist groß
Brauchtum an Allerheiligen
Allerseelentag im Volksglauben
Allerseelen – Totensonntag
Totensonntag
Pflanzen als Symbol für Tod und Trauer
Vom Kirchhof zum Friedhof
Totenstille
Die Legende vom Sensenmann
Die Zypresse, der Baum des Todes und Symbol der ewigen Trauer
Dezember
Licht im Advent
Der „Wolfsmond“, der zwölfte Monat des Jahres
Im Sternbild des Schützen
Kerzen im Advent
Advent
Großmutters Zimtwaffeleisen
Das Christkind kommt selten in Weiß
Mit Barbarazweigen den Winter überlisten
Sitten, Feste und Bräuche am Barbaratag – Vielliebchenspiel an Sankt Barbara
Orakeltage in der Weihnachtszeit
Nikolaus kommt ins Haus
Sitten, Feste und Bräuche am Nikolaustag
Vögel sagen das Wetter im Winter voraus
Sitten, Feste und Bräuche am Tag der heiligen Luzia
Der „Tannenbaum“ an Weihnachten ist eine Fichte
Glocken mit heiligem Klang
„Es ist ein Ros’ entsprungen …“
Geweihte Nacht
Bauernregeln an Weihnachten und Heiligabend
Der „Weihnachtsstern“ ist keine Blüte
Hausschlachtungen früher
Zwischen den Jahren
Alte Bräuche in der „Stillen Zeit“ - Weihnachten – Jul
Das Liebesorakel in der Silvesternacht
Wandel der Zeit
Ausgeprägte Singularitäten im Kreislauf des Jahres
Leseempfehlungen
JANUAR
AN DER SCHWELLE DES JAHRES
Der Januar, von unseren Vorfahren auch Hartung oder Jänner genannt, hat seinen Namen von dem altrömischen Morgengott Janus, der an der Schwelle des Jahres in Vergangenheit und Zukunft, rückwärts und vorwärts sieht. Sprichwörtlich ist der „Januskopf“, dessen Augen nichts entgeht. Janus ist gleichzeitig der Gott der Zeit, der die Tage im Kalender für das kommende Jahr schon längst auf das genaueste gezählt hat. Die Römer überließen sich ganz seiner guten Vorsehung. Kelten und Germanen huldigten ehrfurchtsvoll alten Baumpatriarchen, in denen sie die Götter der Zeit vermuteten. Ein Stammquerschnitt erzählt die Lebensgeschichte eines Baumes: Die Jahresringe sind so aufschlussreich wie die Falten im Gesicht eines alten Menschen.
Bäume strahlen zu jeder Jahreszeit durch ihren ästhetischen Reiz eine besondere, eine gefühlvolle Faszination aus. Jetzt, mitten im Winter, enthüllen sie ihr Gesicht und lassen die Spuren des Alters deutlich durch ihre knorrigen Äste erkennen. Da scheint unsere Verbundenheit zum Baum besonders tief zu sein.
Mit dem Alter des Baumes wächst die Verwurzelung, wächst die Freundschaft des Menschen zu ihm. Je älter ein Baum ist, um so wertvoller und größer wird er. Je tiefer seine Wurzeln reichen, um so standhafter widersteht er Stürmen. Je dichter seine Äste sind, um so sicherer bietet er Schutz. Je stärker sein Stamm ist, um so mehr verkraftet er das Anlehnen. Je höher seine Krone ist, um so einladender wirkt sein deckender Schatten.
Wir haben heute vielfach den Glauben an die Geborgenheit verloren. Wir sollten im neuen Jahr wieder mehr Zeit haben für uns selbst und andere. Nichts ist in unserem hektischen und stressgeplagtem Dasein so kostbar wie die Zeit, die leider zu schnell verrinnt. Unsere Dichter und Denker haben die „Zeit“ klangvoll in Versen und Sprüchen gekleidet:
„Pflück’ dankbar jeden gottgeschenkten Tag, mit Segen füll’ die unschätzbare Stunde, benutze klug die flüchtige Sekunde“. „Ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts“, sagt Gottfried Keller.
Wir sind Wanderer. Ein jeder Schritt ist die Überwindung des Vergangenen, eine Eroberung des Jetzt und ein Hineinschreiten in die Zukunft. Die Sprüche von Konfuzius, von deutschen Dichtern vielfach abgewandelt, auch von Schiller, zeigen uns in die gleiche Richtung: „Dreifach ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, ewig still steht die Vergangenheit.“
Jedes neue Jahr schüttet uns – wenn wir nur fest daran glauben – eine Fülle farbenfroher Blumen und Blüten ins Leben. Der Geber ist die Natur, vielfach geschunden und bedrängt, vernachlässigt und zerstört. Vieles sagt uns die Natur gleichermaßen mit Blumen: mit der kleinen Blüte am Wegesrand, der stolzen Rose im Garten, dem Blütenzauber an Sträuchern und Bäumen, auf Hecken und Wiesen. So wird jeder Monat und jedes Jahr zu einem Blumenstrauß, den uns die Festzeiten stecken und binden. Jeder Monat hat nicht nur in der Natur seine ihm eigene Blütenpracht – auch im Kalender sein ihm eigenes Programm: Hoffnung und Erwartung im Advent, Einkehr und Vorfreude in der Fastenzeit, Jubel und Freude an Ostern und Pfingsten. Alles wird für uns zu Auftrag und Sendung, findet seinen festlichen Rahmen im Pfingstfest: die Zeit der Rosen ist gekommen.
Das Goldgelb und die Erdfarben des Herbstes laden uns zu Dankbarkeit und Freude ein, die in vielen Volksfesten und Erntedankfeiern in viel Brauchtum, in Umzügen und Tradition zum Ausdruck kommen. Überall spielen Blumen, Zweige und Blätter eine Rolle; sie werden für uns zum Dolmetscher, der uns im farbenprächtigen oder kunstvoll gesteckten Bild zu einer Familie verbindet: „Nur die guten Erinnerungen gibt uns Gott auf den Weg, damit wir im Winter Blumen haben“ (Alexandra von Pipal).
Das vor uns liegende Jahr, an dessen Schwelle wir gedankenvoll innehalten, möchte alles mit Blumen sagen: mit kleinen, unscheinbaren, aber sorgfältig gesteckten. Möge der wohltuende Duft uns Freude bereiten: „Gib jedem Tag einen Tropfen Freude, dann wird das Jahr einen Becher mit Blumen bereithalten“ (Aischylos).
Auf dem Weg von vorgestern nach übermorgen lagere ich unter dem Schatten meines Lebensbaumes für einen Bruchteil meiner Zeit.
Zeit und Raum
Sklaven des Tyrannen Zeit,
jeder Stunde dienstbereit
ist der Mensch.
Despotisch ist sein Selbst gefesselt,
auf engstem Raume eingekesselt
sein freier Wille.
Über tief gefurchte Schwellen
seiner Seelenrhythmen Wellen
rinnt die Zeit.
Alles wird im Strom Bewegung,
immerfort die Kreise drehn,
doch der Pendel bringt Zerstörung,
und die Zeiger bleiben stehn.
Nun, o Mensch, hast du dein Gut!
Allen Schweiß hast du gegeben,
auch der letzte Tropfen Blut
musste weichen deinem Streben.
(Dieter Kremp)
ALS ES NOCH EISBLUMEN AM FENSTER GAB
Wie sich die Zeiten geändert haben! Damals gab es noch keine Zentralheizung. Der Kohleofen brannte in der Küche und in der guten Stube, wenn Feiertage waren. Dann wurde auch mit Scheitholz geschürt. Wenn wir Kinder früh morgens aufstanden, ging der erste Blick auf die Fenster, um die Eisblumen zu bewundern. Wenn es draußen bitter kalt war, offenbarte sich eine Wunderwelt am Fenster.
Eisblumen am Fenster! Welche Illusionen werden in dem stillen Beschauer geweckt! Er unternimmt eine Traumreise in eine ferne fremdländische Landschaft, in eine exotische Welt oder in einen längst versunkenen Urwald aus der Steinkohlenzeit. Vor seinen Augen verschwimmen die zarten Eis- und Schneekristalle. Die mit allerlei Formen und Mustern grauweiß überspielte kalte Glasfläche wird für Minuten zu einem Märchenwald aus Tausendundeinernacht. Seltsame Bäume und Sträucher mit bizarren Ästen und knöchernen Zweigen, schwert- und lanzenförmigen Schachtelhalmen, geöffneten Elchgeweihen, lilienschlanken Blumen in verschiedener Größe und Vielfalt, längst ausgestorbene gefiederte Farnkräuter – und zwischen den wiegenden Lianen sitzen Papageien mit eckigen Schnäbeln: Ein tropisches Bild mitten im Winter, vom klirrenden Frost wie von einer künstlerischen Zauberhand auf die Fensterscheiben gemalt.
Und am schönsten ist es abends, wenn das gedämpfte Kerzenlicht warm durch die Fenster in die dunkle Kälte strahlt. Da werden sie lebendig, all die Blumen, Feen und Gestalten und tanzen in magischen Spiralen Ringelreihen.
Eisblumen am Fenster
Zarte Kristalle am Fenster schwimmen
in spielenden Mustern grau und weiß.
Bizarre Äste und Zweige klimmen
und lilienschlanke Blumen aus Eis.
Auf wogenden Lianen sitzen Papageien
und tanzen in Spiralen Ringelreihen.
Ein Märchenwald aus Tausendundeinerrnacht
verzaubert die Scheibe in tropischer Pracht.
Mitten im Winter bei klirrender Kält
sich öffnet eine wundersame Welt.
Bei gedämpftem Kerzenlicht
schwingt eine Symphonie in Weiß.
Doch ach! Die Dunkelheit das Glas zerbricht,
all die Blumen in Frost und Eis.
(Dieter Kremp)
VOM HARTUNG BIS ZUM WOLFSMOND
Der altrömische Gott Janus, der Beschützer des Hauses, öffnet im Gregorianischen Kalender die „Tür des Jahres“. Mit seinem Doppelgesicht schaut Janus zugleich nach drinnen und draußen, hütet den Eingang und den Ausgang. Janus wird mit einem Schlüssel und einem Pförtnerstab als Beigaben sowie mit einem jungen und einem alten Gesicht dargestellt. Das alte Gesicht blickt zurück in die Vergangenheit, das junge Gesicht in die Zukunft.
Unsere Monate tragen Namen lateinischen Ursprungs. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren vornehmlich auf dem Land auch noch altdeutsche Monatsnamen gebräuchlich, die zum großen Teil auf Karl den Großen zurückgehen. In oberdeutschen Mundarten, namentlich in Gebirgsgegenden Österreichs, sind auch heute noch alte deutsche Monatsnamen im Gebrauch.
Jänner oder Jenner heißt der Januar. Auch Hartung wird er genannt, weil er von all seinen Brüdern die härteste Kälte mitbringt. Eis- oder Schneemond und „Tür des Jahres“ waren andere volkstümliche Bezeichnungen.
Der Februar hieß früher Hornung. Dieser alte, einheimische Name hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, dass sich das Vieh in diesem Monat hörnt, wie die Bezeichnung gelegentlich gedeutet wird. „Hornung“ ist eigentlich ein anderes Wort für „Bastard“. Im übertragenen Sinne bedeutet dies für den Februar so viel wie „der an Tagen zu kurz Gekommene“, hat er doch nur 28 oder 29 Tage. Weitere Bezeichnungen beziehen sich auf das Wetter und auf weltliche und kirchliche Festtage: Taumond, Schmelzmond, Narren- und Lichtmessmonat. Schließlich heißt der Monat in Österreich heute noch Feber. Er war im altrömischen Kalender der letzte Monat des Jahres und galt deshalb als Sühne- und Reinigungsmonat.
Der März hat seinen Namen vom römischen Kriegsgott Mars. „Martius“, der Marsmonat, eröffnete bis zur Kalenderreform das römische Jahr mit verschiedenen Opferfesten. Die alten deutschen Namen „Lenzing“ oder „Lenzmond“ bedeuten nichts anderes als „Frühling“. Das Wort „Lenz“ kommt von „lang“: Die Tage werden wieder länger.
Das lateinische Wort „aperire“ (= öffnen) gab dem April seinen Namen. Die Knospen öffnen sich, die Natur erblüht. Der wetterwendische, launische April trägt die altdeutschen Namen „Launing“ und „Wandelmond“, letztere Bezeichnung vielleicht auch deshalb, weil sich die Natur verwandelt. Der Ausdruck „Grasmond“ kommt von den grünen Wiesen, die ab 1. April für die Dorfbewohner „gesperrt“ waren. Ostermonat heißt er auch, weil in der Regel der Jahre im April Ostern gefeiert wird.
Der „Wonnemonat“ Mai hat vermutlich seinen Namen von der griechischrömischen Wachstumsgöttin Maja. Im „Weidemond“ wurde früher das Vieh aus dem Stall auf Wiesen und Almen getrieben. Die Ungenauigkeiten in der Umgangssprache haben dann später aus diesem „Winni-“ oder „Wunnimond“ großzügig den bekannten „Wonnemonat“ entstehen lassen. Unter diesem Namen wurde der Mai der Monat der Liebe und der Liebenden. So wurde er auch zum „Hochzeitsmond“. Frommen Christen gilt der Mai als „Marienmonat“ und Gärtnern als „Blumenmonat“.
Juno, die römische Göttin der Jugend, gab dem Juni ihren Namen. Ihr, der Gemahlin des Göttervaters Jupiter, war er geweiht. Sie wurde nicht nur als Beschützerin der Ehe und der Hochzeit angesehen, sondern auch als Beistand während der Geburt. Der Juni heißt volkstümlich auch „Rosenmond“, beginnt doch um die Monatsmitte die „Königin der Blumen“ zu blühen. „Johannismond“ heißt er, weil um „Johanni“ (24. Juni) die Tage am längsten sind. Der altdeutsche Namen aber war „Brachert“ oder „Brachmond“. In der alten Dreifelderwirtschaft unserer Vorfahren wurde im Juni mit der Bearbeitung des dritten, brach und ungenutzt liegenden Feldes begonnen.
Im Juli denkt der Landwirt an die Ernte. Darauf gehen die alten deutschen Namen „Heumond“, „Heuet“ oder „Heuert“ zurück. Die volkstümlichen Bezeichnungen „Bärenmond“ und „Honigmond“ sind leicht zu erklären: Im Juli hielten sich der Fleiß der Bienen und der genießerische Raub der Bären wohl in etwa die Waage, jedenfalls als es noch genug Wildbienen und Bären gab. Schließlich belegte der erste Kalenderreformator Julius Cäsar den 7. Monat mit seinem Namen.
Hinter Julius Cäsar wollte auch Kaiser Augustus nicht zurückstehen, der in „seinem Monat August“ angeblich viel Glück hatte. Der August ist die herkömmliche Zeit der Getreideernte. Daraus lassen sich die alten deutschen Namen leicht ableiten: „Ernting“, „Erntemond“, „Ährenmond“, „Sicheling“ und „Sichelmond“. Letztere Namen verweisen auf das frühere Abmähen des Getreides mit der Sichel.
Weil im September der Sommer scheidet, hieß der Monat früher „Scheiding“. Karl der Große hieß ihn „Herbstmond“ oder „Holzmond“, weil man wieder zu fällen begann.
„Weinmond“ hieß der Oktober wegen der Weinlese, die in ihm ihren Höhepunkt hat. Weil das Laub im Oktober gelb wird (zu gilben beginnt), trug der Monat den schönen Namen „Gilbhart“. Im Oktober waren früher die Dachsjagd, so hieß der Monat bei den Jägern „Dachsmond“. Dankbare und fromme Leute bezeichneten ihn als „Kirchweihmond“, wobei sie wohl auch ein wenig an das Erntedankfest dachten.
Seine alten deutschen Namen „Nebelung“, „Nebelmond“ oder auch „Windmond“ drücken das triste Wetter im November aus. Das Sterben und Vergehen in der Natur, nicht die kirchlichen Feste, ließen den November zum „Totenmonat“ werden. In vielen Gegenden begann am 11. November die Schlachtzeit. Schlachtfeste und Spinnabende waren eine willkommene Abwechslung in der nun beginnenden dunklen Vorwinterzeit. So hieß der November auch „Schlachtmond“ und „Spinnmond“.
„JANUAR KALT, DAS GEFALLT!“
„Januar warm, dass Gott erbarm!“ sagen die Bauern, wenn die Sonne den Schnee wegtaut und sich zum Jahresanfang erstes zartes Grün in Feld und Wald zeigt.
Für sie gilt die Regel, mit der dieses Kapitel überschrieben ist: „Januar kalt, das gefallt!“ Die Bauern wissen, dass der Schnee die Saaten vor dem Frost schützt, dass er geraten lässt, was der Bauer im Herbst säte: „Januar muss vor Kälte knacken, wenn die Ernte soll gut sacken.“
Der Januar ist in unseren Breiten der einzige Monat, wo man nicht auf dem Feld arbeitet. Trotzdem hat der Bauer noch viel zu richten: „Im Januar sieht man lieber den Wolf als einen Bauern in Hemdsärmeln.“
Der Wolf, der sich noch vor hundert Jahren in manchen Gegenden Mitteleuropas im frostigen Monat Januar bis an die Gehöfte heranschlich, war bei der Landbevölkerung sehr gefürchtet. Anscheinend hatte aber jeder mehr Angst vor dem Bauern, der sich im Haus auf die faule Haut legte.
„Fährt der Bauer im Januar Schlitten, muss er im Herbst um Sä-Frucht bitten.“ Wer in den Sommer- und Herbstmonaten nicht genügend Vorrat gesammelt hat, der kann leicht zum Hungerleider werden. Denn der Januar war von jeher der Monat, der für die Landbevölkerung zum teuersten wurde: „Der Jänner – ist ein Holzverbrenner.“ „Januar – macht die Butter rar.“
Am meisten schätzt man einen sonnigen Januar, der mit Eis, Frost und einer schützenden Schneedecke einhergeht. „Ist der Januar hell und weiß, kommt der Frühling ohne Eis, wird der Sommer sicher heiß.“
„Der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen.“ „Die Erde muss ihr Betttuch haben, soll sie der Winterschlummer laben.“ „Ein kalter Januar – bringt ein gutes Jahr.“ „Ist der Januar frostig und kalt, lockt uns bald der grüne Wald.“ „Eis und Schnee im Januar – künden ein gesegnet Jahr.“
Die Winterluft – das weiß der Bauer – ist für ihn auch ein Lebenselixier. Wenn er sich warm anzieht, nimmt er so leicht keinen Schaden. Ist aber der erste Monat des Jahres warm und regenreich, und legt sich der Nebel auf die Landschaft, so gibt es allenthalben Kranke. Da man früher noch keine Antibiotika kannte, starben im ersten Teil des Jahres sehr viele Menschen an Lungenentzündung oder auch nur an Erkältungen, die heute im Beruf kaum noch als Krankheitsgrund gelten.
„Winter weich – Kirchhof reich.“ Aber wärmeres Wetter mit Niederschlägen im Januar wirft auch Schatten auf die nächsten Monate: „Nebel im Januar – bringen ein nasses Frühjahr.“ „Ein Jahr, das schlecht will sein, stellt sich schwimmend ein.“ „Regen im Januar – bringt der Saat Gefahr.“ „Viel Regen, wenig Schnee tut Äckern und Bäumen weh.“ „Lässt der Januar Wasser fallen, lässt der Lenz es gefrieren.“ „Soviel Tropfen im Januar, soviel Schnee im Mai.“ „Ist der Januar feucht und lau, wird das Frühjahr trocken und rau.“ „Ein Januar wie März, ist dem Bauer ein schlechter Scherz.“
Und zusammenfassend fluchte ein Kalendermacher: „Hat der Januar viel Regen, bringt’s den Früchten keinen Segen, nur die Gottesäcker werden gedüngt, wenn er viel Regen bringt.“ Reichlicher Schnee im Januar macht dem Bauern viel Freude: „Januar Schnee zuhauf – Bauer halt den Sack auf.“ „Reichlich Schnee im Januar, macht Dung fürs ganze Jahr.“
Außer dem Wolf beobachtete man auch andere Tiere und ihr Verhalten: „Wenn der Maulwurf wirft im Januar, währt der Winter bis zum Mai wohl gar.“ „Je näher die Hasen dem Dorfe rücken, desto ärger sind des Eismonds Tücken.“ „Tanzen im Januar die Mucken, muss der Bauer nach dem Futter gucken.“ „Wenn die Mücken spielen im Januar, so sind die Schafe in großer Gefahr.“
Und über die Pflanzen und ihr weiteres Gedeihen wusste man: „Wächst das Gras im Januar, wächst es schlecht das ganze Jahr; wächst die Frucht auf dem Feld, wird sie teuer in aller Welt.“
Wenn aber die Flüsse, Seen und Teiche zugefroren waren, dann litt man später keine Not: „Ist im Januar dick das Eis, gibt’s im Mai ein üppig Reis.“ „Sind im Januar die Flüsse klein, gibt’s im Herbst einen guten Wein.“
GLÜCKSBRINGER FÜR DAS JAHR
„Scherben bringen Glück“, nicht nur dem jungen Paar am Polterabend, auch dem Haus und seinen Bewohnern am Morgen des Neujahrstages. Unsere Vorfahren glaubten, mit dem Gepolter und Geklapper zerschellender Krüge und Töpfe die bösen Geister fortscheuchen zu können. Doch müssen die Scherben aus Steingut, Ton oder Porzellan bestehen, in keinem Falle dürfen es Glasscherben sein, denn die bringen Unglück.
Glas ist das Symbol für Glück, und gerade das soll in der künftigen Ehe heil bleiben. Doch „Glück und Glas, wie leicht bricht das“. Und wehe, wenn gar ein Spiegel am Neujahrstag zerbricht! Der soll sieben Jahre lang „sein Glück nicht finden“.
Das Glück ist blind und schon gar nicht vollkommen. „Jeder ist seines Glückes Schmied“: Das Hufeisen, an der Schwelle des Jahres geschmiedet, verheißt seinem Besitzer ein Jahr lang Geborgenheit und Schutz.
Wer seinem Glück hinterherläuft, ist selbst schuld daran, wenn er am Ende des Jahres vor einem Scherbenhaufen steht. „Dem Glücklichen schlägt keine Stunde“: Dieser Spruch bezieht sich auf das „Glück in der Liebe“, nicht auf das „Glück im Spiel“.
Das neue Jahr ist immer mit großen Hoffnungen und Erwartungen begrüßt worden. Alter Aberglaube aus vorchristlicher Zeit und frommer Glaube haben sich am Jahresanfang so durchdrungen, dass der jeweilige Ursprung oft in Vergessenheit geraten ist. So hat man das neue Jahr in Gesellschaft begrüßt, weil man dich durch die Gemeinschaft des geschlossenen Kreises vor den dämonischen Mächten sicherer gefühlt hat. Ring und Kranz sind magische Zeichen für den geschlossenen Kreis. Sie verstärken die schützende Wirkung und sind Garanten für dauerndes Glück.
Der guten Vorbedeutung wegen wünscht man sich am Neujahrstag Glück und möchte selber möglichst viele Glückwünsche bekommen. Glückszeichen gibt es viele: Marienkäfer und Glücksschwein, das vierblättrige Kleeblatt und der Lorbeerzweig, Rosmarin und Myrtenkranz, Glücksei und Hufeisen, Schornsteinfeger und Glückspfennig, Herz und Ring, Holzschuhe uns Sternkreiszeichen, Sonnenrad, Efeu, Mistel, Lebensbaum und glückbringende Ammoniten.
Der Holzschuh symbolisierte lange Zeit hindurch eheliches Glück und Fruchtbarkeit. Er tauchte deshalb häufig bei den Riten der Brautwerbung auf. Heute ist der tiefere Sinn dieses Brauchs verlorengegangen. Man verwendet Holzschuhe als rustikales Schmuckelement in Neubauten und in Vorgärten. Das Rad ist seit den frühesten Zeiten der Menschheit ein in allen Kulturen anerkanntes Sonnensymbol. Das Sonnenrad symbolisierte in der Zeit der Wintersonnenwende den Sieg des Lichts über die Mächte der Dunkelheit.
Findet man ein Hufeisen, so bringt das Glück. Schon die Römer hegten diesen Glauben. Man trug es bei sich, nagelte es über die Eingangstür, über den Kaminsims oder über das Scheunentor. Der Kult um das Hufeisen liegt wohl darin begründet, dass Eisen als Metall ursprünglich sehr kostbar war. Das Hufeisen als Glückssymbol weist aber auch auf das Hufeisen von Wotans Pferd aus der Wilden Jagd. Ebenso erinnert das Glücksschwein an den wilden Eber, dass heilige Tier der germanischen Götter. Der Marienkäfer (Siebenpunkt) soll besonders Kindern Glück bringen. Er weist auf die magische Glückszahl Sieben hin. Das Herz war stets ein glückbringendes Symbol und Zeichen der Treue zu Mensch, Haus und Hof. Das Ei galt in allen Kulturen als Sinnbild für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt.
Rosmarin und Myrte mit ihren immergrünen Blättern sind Pflanzen, die Segen und Lebenskraft verheißen. Als Hochzeitspflanzen tauchen sie schon bei den Griechen auf. Im Brautkranz verbunden, bedeuten sie ein ewiges Eheglück. Beide Pflanzen waren der Aphrodite heilig, später der germanischen Göttin Hulda. Sie sind auch Symbole der heiligen Liebe.
Storch und Schwalbe zählen überall als Symbole für Wohlergehen, Glück und Erfolg in Haus und Hof. Ihre regelmäßige Rückkehr im Frühjahr, ihre Treue zum Nest mögen der Grund für diese Vorstellung sein. Sie sind die vom Volk verehrten Tiere schlechthin. Man schützt sie und hilft ihnen, sich am oder auf dem Haus niederzulassen. Storch und Schwalbe symbolisieren die soziale Eintracht, die Dauerhaftigkeit der Beziehung des Ehepaares.
Glück sollen auch die Münzen bringen, die wir in den Brunnen werfen. Das wissen wir von den Münzen im Trevi-Brunnen von Rom, die uns wieder in die Ewige Stadt zurückkehren lassen. Auch das ursprünglich römische Amulett und der arabische Talisman werden gern in Form von Münzen als schützende Gegenstände am Körper getragen. Es ist nicht so sehr das kostbare, metallische Erz, dem nach der Vorstellung unserer Vorfahren Zauberkraft innewohnt, es ist vielmehr die Rundheit und das Glitzern des Metalls, worin die lichtspendende Sonne, die Geborgenheit und Leben verheißt, gesehen wurde.
DER HECHT IM KARPFENTEICH
Ursprünglich sollte er nur als Lückenbüßer dienen, als Fleischersatz in Zeiten strenger mittelalterlicher Fastengebote. Doch schon bald wurde der Karpfen, den man auch „Klosterfisch“ nannte, weil Mönche ihn in Teichen züchteten, zum appetitlichen Mittelpunkt des Silvesteressens.
Zum Jahresende nahm man gerne Speisen zu sich, die – wie der Karpfen -Fruchtbarkeit und Leben symbolisierten. Auch heute noch kommt in Millionen deutscher Haushalte an diesem Festtag Karpfen auf den Tisch – am liebsten „blau“, zuweilen auch gebacken.
Bei soviel Tradition entwickelte sich um den Karpfen eine Fülle von Bräuchen und abergläubischen Praktiken: Glück und Segen im neuen Jahr sollten die Schuppen des gegessenen Karpfens bringen. Deshalb streute man sie im ganzen Haus umher. Wer vom Glück in erster Linie Geldsegen erwartete, trug solche Schuppen stets bei sich.
Es hieß, dass ihm dann das Geld nie ausginge. Noch heute hofft ja so mancher Anhänger dieses harmlosen Aberglaubens, mit Hilfe der Glücksschuppe in seinem Portemonnaie einen größeren Lottogewinn machen zu können.
Neben der uralten Fruchtbarkeitssymbolik des Fisches, von der man wahrscheinlich die Hoffnung auf eine wundersame Vermehrung des Geldes ableitete, dürfte auch die an Münzen erinnernde Form der silbrig glänzenden Schuppen zur Entstehung dieser Sitte beigetragen haben.
Heutzutage sind dem großzügigen Verstreuen von Karpfenschuppen allerdings Grenzen gesetzt. Denn der im Handel hauptsächlich angebotene Spiegelkarpfen ist nahezu „nackt“. Die Schuppen haben ihm findige Mönche schon vor langer Zeit „weggezüchtet“. Seine kurze, hochrückige Form ist ebenfalls ein Zuchterfolg der Klosterbrüder von einst. Der Grund dafür soll eine kuriose Fastenregel gewesen sein, die angeblich vorschrieb, dass der Fisch nicht über den Tellerrand ragen durfte.
Viel Wundersames wusste der Volksmund über andere Körperteile des Karpfens zu berichten. In Österreich heißt es noch heute, dass alles in Erfüllung geht, was man sich wünscht, wenn man die Blase des verspeisten Karpfens mit einem Knall zum Platzen bringt.
Der außerordentlich körnerreiche Rogen (Eier) dieses Speisefisches – ein zwei Kilogramm schweres Karpfenweibchen trägt bis zu fünf Millionen Eier – hat ebenfalls eine Symbolik: Zu Silvester gegessen, bringt er Glück und Geld getreu dem Spruch „So viel Körner, so viel Gold“. Glück soll auch der sogenannte „Karpfenstein“ bringen, ein dreieckiges Knöchelchen im Kopf des Fisches. Wer es auf seinem Teller findet, soll mit einem sehr erfolgreichen neuen Jahr rechnen können.
Dass ein solches symbolbeladenes Tier auch in der Volksmedizin seinen Stammplatz hatte, versteht sich von selbst. Getrocknete und pulverisierte Teile des Karpfens waren beliebte Heilmittel gegen alle möglichen Leiden. Besonders der geheimnisvolle „Karpfenstein“ hatte es den Menschen früher angetan. Man verwendete ihn vor allem zur Behandlung von Epilepsie, Schlaganfall und Gallenkolik.
Und „Hand aufs Herz“: Wenn wir heute an Silvester einen Karpfen essen, denken wir nicht daran, im neuen Jahr „der Hecht im Karpfenteich“ zu sein?
DER HEILIGE ANTONIUS UND DAS SCHWEIN
Der „wilde Eber“ der Germanen wurde zu unserem Glücksschwein. Dazu trug auch der heilige Antonius bei, der auf Darstellungen seinen schützenden Mantel um die Schweine legt. Am 17. Januar feiern wir seinen Namenstag.
Der heilige Antonius ist der Patron der Ritter, Haustiere und Schweine, der Metzger, Schweinehirten und ein mächtiger Helfer gegen Viehseuchen. Er wird besonders in den Alpenländern, in Frankreich und Italien verehrt. Die gefürchtete Schweinepest war bei unseren Vorfahren als „Antonius-Seuche“ bekannt und konnte nur geheilt werden, wenn der greise Mönchsvater sein „Antoniuskreuz“, das er als Krücke trug, über den Kopf des Schweines hielt.
Doch würde sich der Patron der Hausschweine im Grabe umdrehen, würde er erfahren, dass es heute keine „glücklichen Schweine“ mehr gibt. Von allen Haustieren erleidet das Mastvieh Schwein die größten Qualen in den fleischverarbeitenden Betrieben. Die gentechnische Manipulation am Hausschwein führte zu schnellwachsenden Monstern ohne Ringelschwanz, Borsten, Ohren, Schnauze und Augen. „Glücksschweine“ gibt es nicht mehr: wer soll da noch „Schwein haben“? Und wenn jetzt gar der „EU-Eber“ den Deutschen aufgetischt wird, riecht das Fleisch nicht mehr nach „Schwein“, sondern nach „Pissoir“.
Antonius begründete um 320 n. Chr. die bis dahin unbekannte Lebensform der Einsiedlergemeinde, aus der dann später die erste Mönchsgemeinde wurde. Antonius hat auch die „Angelica“, das Mönchsgewand, eingeführt. Der greise Mönchsvater starb im Alter von 105 Jahren und erhielt nach seinem Tode den Beinamen „der Große“.
Ein französischer Adeliger, dessen Sohn durch Reliquien des Antonius von einer Seuche geheilt wurde, gründete 1095 den Antoniterorden. Albert von Bayern stiftete 1382 den Antonius-Ritter-Orden, woraufhin der heilige Antonius zum Patron und Vorbild des Ritterstandes wurde. Viele Burgen und Kapellen wurden ihm geweiht.
Eine hübsche Geschichte gibt es auch zum sogenannten „Antonius-Schwein“ . Die Antoniter durften für die Krankenpflege ihre Schweine frei weiden lassen. Als Kennzeichen trugen sie ein Glöckchen, so dass kein Tier im Eichenwald verlorenging. Immer am 17. Januar wurde ein Schwein geschlachtet, sein Fleisch nach der Segnung an die Armen verschenkt.
Das Thema „Schweinezucht“ war früher im ländlichen Bereich in den Dorfschulen Unterrichtsstoff. Noch früher wurden die Schweine ausschließlich mit gekochten Kartoffeln gemästet. Das waren die „Saugrumbeere“, die bei der Kartoffelernte als kleine und zerhackte Kartoffeln in besondere Körbe kamen. „In die Mast treiben“ war eine andere Methode, die Schweine zu mästen. Dafür standen auf dem Dorf die Schweinehirten zur Verfügung. Diese trieben die Schweine in die Eichenwälder. Der Speck von in der Eichelmast fett gewordenen Schweinen soll sehr fest und schmackhaft gewesen sein. Der Beruf des Schweinehirten war geachtet.
Ein „Glücksschwein“, gerne als „Sparschweinchen“ aufgestellt, erinnert an den wilden Eber, das Opfertier der Germanen. Durch seine Opferung sollten die Götter milder gestimmt werden. Vielleicht bedeutete es aber auch ein besonderes Jagdglück, ein derart wildes Ungetüm zu erbeuten. Auch im Hochzeitsessen spielte das Schwein früher auf dem Lande eine besondere Rolle. Es war gewissermaßen das Opfer, das man bei der Hochzeit brachte. Deshalb eröffnete ein Schweinskopf, ursprünglich mit einem Rosmarinstängel im Maul, später mit einer Zitrone oder Rose, das Hochzeitsessen. Dieses erste Gericht wurde feierlich von einer Jungfrau aufgetragen. In anderen deutschen Gegenden tischte man als erstes Hochzeitsessen ein gebratenes Spanferkel auf, das eine Blume, einen Zweig Rosmarin oder auch Immergrün unter dem Ringelschwänzchen trug. Das Schwänzchen war für die Braut reserviert, war es doch ein Symbol der Fruchtbarkeit.
DAS HOHELIED VON WEIHRAUCH UND MYRRHE
„Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar“ (Mt. 2, 11).
So spricht die Bibel von Weihrauch und Myrrhe, den wertvollsten und beliebtesten Duftharzen, die neben anderen wohlriechenden Kräutern die kostbarsten Handelsgüter im Orient zur Zeit der Geburt des Herrn waren. Ursprünglich waren sie nur Königen vorbehalten. So waren Weihrauch und Myrrhe jene Geschenke, die die „Drei Weisen aus dem Morgenland“ dem „neugeborenen König der Juden“ brachten.
Duftende Kräuter wurden in der antiken Welt täglich zur Herstellung von Parfümen, Kosmetika, Gewürzen und Medikamenten gebraucht. Schon die Phönizier brachten sie über die berühmte Gewürzroute nach Südarabien und von ostafrikanischen Häfen aus nach Ägypten und nach Israel. Karawanen transportierten die begehrte Handelsware auf langen Wüstenreisen zu ihren Bestimmungsorten. Aus den „Weisen aus dem Morgenland“, von deren Reise hinter dem Stern her die Bibel erzählt, machte die Kirche die „Heiligen Drei Könige“. Der weiten, beschwerlichen Reise wegen, die sie vom Morgenland nach Bethlehem führte, wurden sie auch zu den Schutzpatronen der Reisenden.
Als sie dann beim Essen saßen und aufblickten, sahen sie, dass gerade eine Karawane von Ismaelitern aus Gillad kam. Ihre Kamele waren mit Tragahant, Mastix und Ladanum beladen. Sie waren unterwegs nach Ägypten (Gen. 37, 25). An diese Händler von Spezereien wurde Josef nach Ägypten verkauft.
Die frühe Verwendung dieser aromatischen Pflanzen wird durch die Tatsache bestätigt, dass bei der Öffnung von Pharaonengräbern im Jahre 1884 etwa 3000 Jahre nach der Bestattung immer noch der angenehme Geruch von Weihrauch und Myrrhe wahrnehmbar war. Wahrscheinlich spielte bei der Einbalsamierung der Leichen auch die antiseptische Wirkung der wohlriechenden Kräuter eine Rolle. Der Evangelist Johannes spricht von einer Mischung aus Myrrhe, Aloe und Weihrauch zum Tränken der leinenen Tücher, in die der Leichnam Jesu eingehüllt wurde.
Eines der Sieben Weltwunder, die „Hängenden Gärten“ in Babylon, war bekannt wegen seiner starken Blumendüfte. Myrrhen- und Weihrauchsträucher mit ihren knorrigen Ästen und den ätherischen Harzen, die in Form kleiner Tropfen aus der Rinde ausgeschieden werden, waren auch Charakterpflanzen im „Paradies“, im „Garten Eden“, in dem Land zwischen Euphrat und Tigris, in dem „Milch und Honig flossen“.
Salben aus Milch und Honig, aus Myrrhen- und Weihrauchöl wurden als kosmetische Gesichtspackungen im alten Ägypten verwandt. Auch Kleopatra hatte die Schönheit ihrer Haut den heiligen Ölen zu verdanken. Ovid, der römische Dichter der Liebe, pries in seiner „Liebespoesie über die Gesichtspflege der Frauen“ die betörenden Düfte von Rosen- und Narzissenöl und die sinnerregenden aromatischen Substanzen der Myrrhe.
Das „Hohelied Salomos“ beschreibt an vielen Stellen Duftstoffe der biblischen Zeit: „Ich stand auf, um zu öffnen meinem Freunde die Hand an den Griffen des Riegels. Da troffen meine Hände von Myrrhe, von flüssiger Myrrhe meine Finger.“ Oder es heißt: „Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Weihrauch wächst. Seine Lippen sind die Lilien, die von fließender Myrrhe triefen.“ „Du bist gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zypernblumen mit Narden, Lilien und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen Wassers, das vom Libanon fließt“, preist das „Hohelied“ die Liebe.
Die Juden begannen ihren Auszug aus Ägypten vielleicht um 1240 vor Christus. Für ihren Weg in das Gelobte Land brauchten sie etwa vierzig Jahre. Kurz nach ihrem Aufbruch erhielt Moses vom Herrn auch eine Anweisung zur Herstellung eines heiligen Öls und eines heiligen Räucherwerks: „Nimm dir Spezerei: Balsam, Galbanaum, Myrrhe und reinen Weihrauch, von einem soviel wie vom andern, und manche Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen, rein, zum heiligen Gebrauch.“ Dieses Räucherwerk war nur zum Gebrauch bei religiösen Zeremonien gedacht.
Die Verdunstung von ätherischen Ölen an der Oberfläche von Pflanzen wird heute als ein Abwehrmechanismus gegen die Infektion durch Bakterien und Pilze angesehen. Aromatische Pflanzen besäßen demnach eine schützende Aura aus Wohlgeruch. Kann es nicht sein, dass die Pflanzen durch den Duft, den sie verströmen, miteinander in Verbindung treten und einander in einer Weise wahrnehmen, die viel wunderbarer ist als das Mittel der menschlichen Sprache, die nur selten voller Zärtlichkeit und Duft ist – außer vielleicht bei liebenden?
DIE DREI WEISEN AUS DEM MORGENLAND BESUCHEN DAS JESUSKINDLEIN IM KRIPPENSTALL ZU BETHLEHEM
(Märchen von Dieter Kremp)
Die drei Weisen aus dem Morgenland waren schon seit Wochen an der Himmelsstraße unterwegs auf der Suche nach dem Krippenstall in Bethlehem. Es hatte sich überall im Heiligen Land herumgesprochen, dass in Bethlehem das Jesuskindlein im Krippenstall geboren wurde. Und die drei Weisen wollten unbedingt dorthin, um das Christuskindlein zu bescheren.
Aber sie waren auf ihren weiten Reisen unterwegs nicht allein, waren sie doch von Beruf aus alle drei Hirten, die überall ihre Schäfchen dabei hatten, wenn sie auf Reisen waren. Und hier am Himmelszelt weideten die Schäfchen auf der weiten Himmelsflur und ließen sich das saftige himmlische Gras und den Klee gut schmecken.
Doch schon seit Tagen irrten sie mit ihren Schäfchen hin und her und fanden den Weg nicht über die Himmelsstraße hinunter auf die Erde nach Bethlehem.
Und es war höchste Zeit, um dem neugeborenen Wiegenkind zur Geburt ihre Geschenke zu geben. Außerdem waren ja Maria und Josef, die Eltern des Jesuskindes, auch gute Bekannte der Hirten. Und Heiligabend, der Tag der Geburt des heiligen Christuskindes, war schon lange vorbei.
Nun flog gerade die Schneefee Frau Holle mit ihren Wolkenschäfchen an der Himmelsstraße vorbei und winkte den Hirten zu. Sie hielt mit ihrer Schäfchenherde kurz an und fragte ihre Hirtenfreunde: „Wohin wollt ihr? Habt ihr euch auf der Himmelsflur mit euren Schafen verirrt?“
„Ja, wir suchen den richtigen Weg nach Bethlehem, doch immer wieder sind wir auf der falschen Straße. Hier stehen ja auch keine Hinweisschilder.“
„Dann passt mal gut auf! Der heilige Sankt Petrus dort oben an der Himmelspforte ist ja ein naher Verwandter der Heiligen Familie. Der kann euch bestimmt helfen.“
In dem Augenblick sperrte der heilige Petrus mit seinem Himmelsschlüssel gerade das Tor zum Paradies auf und ließ die himmlischen Heerscharen heraus. Unter ihnen waren auch die Engel, die Boten Gottes auf Erden, die auch das Jesuskind in Bethlehem besuchen wollten.
Die Engel waren gut befreundet mit den drei Weisen aus dem Morgenland und waren gerne bereit, die Hirten mit ihren Schäfchen auf ihrem Weg zur Erdenstadt Bethlehem zu begleiten. Damit das alles etwas schneller vonstattenging, klebten sie den Hirten und ihren Schäfchen Engelsflügel an. Und so flogen sie in Windeseile alle zusammen durch die himmlischen Lüfte und kamen schon nach wenigen Minuten heil und gesund am Krippenstall zu Bethlehem an.
Hier war Hochbetrieb, denn alle Engel, alle Heiligen und die Kinder aus Bethlehem waren gekommen, um das Jesuskindlein zu bescheren. Vor dem Eingang zum Krippenstall stand ein großer Esel, der die zahlreichen Besucher herzlich willkommen hieß. Und der zottige Esel rief laut: „Iah, iah, iah! Willkommen hier im Stall, im Krippensaal! Iah, iah, iah!“
Bevor die Hirten nun in den Krippenstall eintraten, ließen sie ihre Schäfchen in der Nähe des Stalles auf einer Weide grasen. Eines aber unter ihnen, das Lämmchen Petra, das Schönste von allen, das ein ganz besonders weiches Fell hatte, nahmen sie mit in den Stall zu Bethlehem. Obwohl ja das Jesuskindlein noch ein kleines Baby war, lächelte es mit strahlenden Äuglein das Schäfchen Petra sanft an.
Und Petra hatte auch Spaß am Kindlein, schnüffelte sogleich im Wiegenbettchen und das Jesusbaby streichelte ganz zart sein weiches, wolliges Fell.
Nun nestelten die drei Weisen in ihren Hirtentaschen herum und holten die Geschenke für die Heilige Familie heraus. Das Christuskindlein erhielt eine Menge Goldkügelchen, weil es eben ein liebes, goldiges Kindlein war. Und dazu natürlich noch ein Plüschschäfchen zum Kuscheln im Bettchen. Als dann viele Jahre später das Jesuskindlein erwachsen war, und als Heiland im Heiligen Land unterwegs war, verschenkte er die Goldperlen an arme Waisenkinder.
Maria und Josef erhielten von den Weisen aus dem Morgenland wohl duftende Heilkräuter, Weihrauch und Myrrhe, die Josef gleich im Stall räucherte: ein heilsamer, aromatischer Duft durchströmte den ganzen Raum. Und wenn dann später das Marienkindlein im Winter eine fieberhafte Erkältung hatte, kochte Maria daraus einen heilenden Kräutertee, den das Kindlein trank. Und alsbald war das Jesuskindchen wieder kerngesund.
Nun aber hatte die Muttergottes, die heilige Jungfrau Maria, noch eine große Bitte an die drei Weisen aus dem Morgenland. „Hört mal bitte gut zu! Nächste Woche ist wieder ein christlicher Feiertag auf Erden. An diesem Tag zieht ihr mit euren Schäfchen durch die Straßen von Bethlehem, geht von Haus zu Haus, und sammelt Geldspenden für arme Kinder.“
Und Josef ergänzte die Worte seiner heiligen Jungfrau Maria und sagte: „Unser lieber Herrgott da droben im Himmel wird euch in drei heilige Könige verwandeln, und dieser Tag, es ist auf Erden der 6. Januar, erhält dann den Namen „Dreikönigstag“. Ihr Drei seid dann die „Heiligen Drei Könige“ mit den Namen Caspar, Melchior und Balthasar.“
Ach, wie stolz waren jetzt die drei Weisen aus dem Morgenland! Sie waren keine Hirten mehr, sondern richtige Könige.
Und später fand jeder von ihnen auch seine Königin und alle drei wohnten in Bethlehem zusammen in einem Königsschloss.
Und als das Jesuskind zu einem Knaben herangewachsen war, besuchte es hin und wieder seine drei Patenonkel im Königsschloss.
Als dann einige Tage später das erste „Dreikönigsfest“ auf Erden war, zogen die Heiligen Drei Könige durch die Straßen in Bethlehem. Einer von ihnen, es war der Melchior, malte sein Gesicht mit schwarzer Farbe an: Er war unter den Heiligen Drei Königen der „schwarze Mohr“. In der einen Hand trugen sie einen langen Stab mit einem Laternenlicht, in der anderen Hand hatten sie ein Stück weiße Kreide. Und auf ihren Pelzmützen leuchtete ein goldener Stern, der eben wie eine goldene Königskrone aussah.
Sie zogen von Haus zu Haus, stampften durch den hohen Schnee, klopften an die Türen und schrieben mit der weißen Kreide die Anfangsbuchstaben ihrer Namen auf die Türschwelle: C + M + B, Caspar, Melchior und Balthasar.
Und überall sagten sie ihren Segensspruch auf, den die heilige Jungfrau Maria ihnen geschrieben und gedichtet hatte:
„Heute ist Dreikönigsfest,
wir wünschen euch das allerbest.
Wir bringen Glück in euer Haus,
wie der heilige Nikolaus.
Wir bitten euch um milde Gaben,
dass arme Kinder Essen haben.“
Die „Sternsinger“, so nannte man auch die Heiligen Drei Könige; sie zogen weiter von Haus zu Haus und überall erhielten sie eine Geldspende. So kam eine stolze Summe zusammen, die sie dann später an arme und kranke Kinder verteilten.
Und auch heute noch, und das schon seit 2000 Jahren, ziehen die Heiligen Drei Könige, als Sternsinger verkleidet, durch die Dörfer und Städte. Und ihre Schäfchen weiden noch immer auf der Himmelsflur, behütet und beschützt vom silbernen Mond.
DIE SIEBEN – EINE ZAHL, DIE ES IN SICH HAT
Die mystische Zahl Sieben spielte in der Vorstellungswelt unserer Vorfahren eine große Rolle. Der Glaube, dass nach sieben Jahren gleiches Wetter wiederkehre, war im Mittelalter weit verbreitet. Es war aber nicht nur Aberglaube, der zu dieser Meinung führte, sondern auch die Wettererfahrung dieser Zeit: Alle sieben Jahre war ein Flohjahr, alle sieben Jahre ein Raupenjahr, alle sieben Jahre ein Käferjahr und alle sieben Jahre ein Krankenjahr.
1991 war ein „Blattlausjahr“ und demzufolge gab es auch eine Massenvermehrung ihrer natürlichen Feinde, der Marienkäfer. Es mag Zufall sein, dass auch der Sommer 1984 ein „Blattlaussommer“ war. Heute wissen wir, dass bestimmte Forstschädlinge zu Waldverwüstern werden, wenn es eine massenhafte Vermehrung gibt, die im Laufe mehrerer Jahre periodisch auf- und abschwillt. In Monokulturen vermehren sich die Schädlinge bei dem reichlich vorhandenen Futter und bei günstiger Witterung von Jahr zu Jahr: wahre Schädlingsheere wachsen heran. Sie fressen schließlich den Forst über viele tausend Hektar kahl. Haben die Raupen dann ihre Nahrungsquelle vernichtet, müssen sie zugrunde gehen, und die Plage hört ganz plötzlich auf.
Auch die mit jeder Massenvermehrung eines Schädlings einhergehende Zunahme seiner Vertilger trägt zum Rückgang des Übels bei. Die endgültige Vernichtung der Schädlingsmassen geschieht vielfach durch parasitische Seuchen. Dieses regelmäßige Auf- und Abschwellen von Schädlingsheeren in rhythmischen Zeitabständen wurde auch schon von unseren Vorfahren beobachtet. Oft musste dabei die biblische Zahl Sieben herhalten, gab es doch im alten Ägypten die „sieben fetten und sieben mageren Jahre“.
Die Lektüre der Landbevölkerung in früheren Jahrhunderten bestand neben der Bibel aus Kalendern, die mit allerlei Tipps und Traktätchen angereichert waren. Diese Prognostiken und Bauernregeln, oft in Verse gekleidet, waren sehr beliebt. Den größten Erfolg aber hatte, bis in unsere Tage hinein, der sogenannte „Hundertjährige Kalender“ von Dr. Maurizius Knauer, Abt im Kloster Langheim bei Kulmbach. Als Kind seiner Zeit in dem damaligen astrologischen Geist befangen, brachte er den jährlichen Planetenwechsel mit dem Wetterwechsel in Verbindung. Er ging davon aus, dass die sieben damals bekannten beweglichen Himmelskörper der Reihe nach die Witterung eines Jahres bestimmen würden. Es genügten ihm sieben Jahre Wetterbeobachtung (1652 bis 1659), um einen „beständfigen, siebenjährigen“ Kalender aufzuschreiben.
Sonne, Venus, Merkur, Mond, Saturn, Jupiter und Mars wurden als Planeten gezählt, und in genau dieser Reihenfolge sollte jeder das Wetter eines Jahres bestimmen. Nach sieben Jahren kam stets derselbe Planet an die Reihe und sollte wieder das gleiche Wetter bringen. Ein geschäftstüchtiger thüringischer Arzt hat vierzig Jahre später den siebenjährigen Kalender des Abtes Maurizius in einen „hundertjährigen“ Kalender umgearbeitet, weil sich ein solcher besser verkaufen ließ.
Venusjahre sollen danach „feucht und warm“ sein. Das stimmte für die Jahre 1983 und 1990 nur zum Teil: Beide waren sehr warm, aber trocken, wobei der Sommer 1983 einer der schönsten Sommer des Jahrhunderts war. In einem Merkurjahr soll es „sehr veränderlich und unbeständig, kalt und trocken“ sein. Das Merkurjahr 1991 war ein extrem trockenes Jahr, kalt im Frühjahr und im Juni, aber extrem heiß im Sommer. Das Mondjahr 1985 war kühl und nass, so wie es nach dem siebenjährigen Planetenkalender sein soll: „Kalt und feucht, doch etwas wenig warm dabei.“ 1993 war ein Saturnjahr, was „eine kalte Natur und etwas wenig trocken“ verhieß.
„Mit dem Mond muss man gut Freund sein“, meinte Goethe, denn so mancher hat seine Schlafprobleme bei Vollmond, was von der Wissenschaft nicht mehr geleugnet wird. Und helle Mondnächte haben unsere Dichter und Denker inspiriert, unvergängliche Lyrik zu schreiben.
Die Anthroposophen sind übrigens davon überzeugt, dass der Mond besondere Einflüsse auf das Keimen, Wachsen und Reifen unserer Kulturpflanzen ausübt. So werden eigene Saat- und Erntekalender herausgegeben.
Die gute und die böse Sieben sind Zahlen, die es in sich haben. Die Sieben hat schon im grauen Altertum in den Geistern gespukt. In sieben Tagen schuf Gott die Welt. Sieben Erzengel umkreisen Gottes Thron. Es gibt sieben Todsünden, sieben Schmerzen und Freuden Mariens. Sieben Wochen dauert die Fastenzeit, Pfingsten liegt sieben Wochen nach Ostern. Die Kirche kennt sieben Sakramente. Den sieben Todsünden stehen sieben Werke der Barmherzigkeit gegenüber. Sieben Kreuzesworte des Erlösers werden aufgezählt, sieben Bitten des Vaterunsers.
Auch im Märchen kehrt die Sieben wieder: Die sieben Berge, die sieben Zwerge, die sieben Geißlein, die sieben Schwaben, die sieben Raben, die Siebenmeilenstiefel. Selbst in Kinderreimen findet sich die Sieben an erster Stelle: „Wer will schöne Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen.“ – Oder die Frage: „Hast du seine sieben Sachen zusammen?“ Wenn es am Siebenschläfertag regnet, soll es sieben Wochen lang regnen.
Rom wurde auf sieben Hügeln erbaut, am Rhein ragt das Siebengebirge auf, obwohl es weit mehr Hügel hat. Geheimnisvolles steht im Buch mit sieben Siegeln. Das Haus der göttlichen Weisheit hat sieben Säulen, ein Hauptstück religiösen Kults war der siebenarmige Leuchter.
Sieben Winde und Meere kannte die Antike, die Griechen sieben Weltreiche, sieben Köpfe der Hydra und sieben Weltwunder. „Sieben kommen durch die Welt“ und „sieben auf einen Streich“ heißt es in Sprichwörtern, und Verliebte fühlen sich „im siebten Himmel“.
VIEL LÄRM AM DREIKÖNIGSTAG
Dreikönigstag! Fest der Erscheinung des Herrn. Es ist das dritte Hochfest der Weihnachtszeit. Es ist auch das Dreikönigsfest, das Fest der drei Weisen aus dem Morgenland, von deren Reise hinter dem Stern her das Evangelium dieses Tages erzählt. Die drei Magier, Kaspar, Melchior und Balthasar, haben die weite Reise vom Morgenland nach Bethlehem unternommen. So wurden sie die Schutzpatrone der Reisenden. Die Wirtshäuser „Zur Krone“, „Zum Stern“, „Zum Mohren“ oder „Zu den drei Königen“ kündigen von ihrer Reise.
Im Mittelalter entwickelten sich in Kirchen und Klöstern die Dreikönigsspiele. Aus ihnen entstand später das Sternsingen, das in allen katholischen Gegenden Deutschlands und Österreichs verrbreitet ist. Am Vorabend des 6. Januars ziehen die Kinder durchs Dorf, verkleidet als Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie tragen den großen goldenen Stern am langen Stecken. Sie singen vor den Häusern ihr Sternsingerlied. Zum Lohn erhalten sie Weihnachtsgebäck, Obst und Geld. Manchmal ist mit dem Sternsingerlied auch ein kleines Spiel verbunden, das sich auf die Geschichte der heiligen Drei Könige bezieht. Heute sammeln die Kinder oft für wohltätige Zwecke.
Die Überlieferung schreibt den Heiligen Drei Königen starke Schutzkräfte zu. Sie sollen Schicksalsschläge und alles Böse von Mensch, Haus und Vieh abhalten. Deshalb schrieb früher der Hausvater die Anfangsbuchstaben der Namen der drei Weisen über die Tür und setzte drei Kreuze und die Jahreszahl dazu. Heute tun das die Sternsinger. Die drei Buchstaben CMB können auch anders gedeutet werden. Sie bedeuten für den frommen Christen: Christus mansionem benedicet, Christus möge mein Haus beschützen.
Der Dreikönigstag, an dem bis ins Mittelalter hinein das neue Jahr begonnen hat, kennt auch Orakelsprüche. An Dreikönig kann man das Wetter des beginnenden Jahres ablesen. Man legt zwölf Weizenkörner auf den Ofen; jedes symbolisiert einen Monat. Die Körner, die am weitesten fortspringen, deuten auf Monate voll Glück, Gesundheit und gute Ernte.
Der Dreikönigstag beendet die zwölf Rauhnächte, in den nach dem Volksglauben Geister und Gespenster ihr Unwesen treiben. Aber so ganz war man nicht davon überzeugt, dass nun der Spuk vorbei sei, den nicht nur imaginäre Bösewichte in diesen zwölf Nächten trieben, sondern auch maskierte Burschen. Vielfach wurden den Geistern auch Speisen hingestellt, damit sie gesättigt davonziehen konnten. In Oberbayern und in Tirol stellte man für die Frau Perchta, eine der norddeutschen Frau Holle ähnliche Gestalt, Essen vors Fenster oder legte Nudeln für sie aufs Dach. Und vor dem Schlafengehen durften auf dem Tisch ein Krug Wasser und Brot nicht fehlen. Wer so handelte, dem half Frau Perchta das ganze Jahr über. Wer aber am Dreikönigstag nicht an die Perchta dachte, dem würde sie – so glaubte man – übel mitspielen.
Natürlich muss am Dreikönigstag überall viel Lärm gemacht werden, damit auch die letzten bösen Geister Haus und Hof verlassen. Übrigens, wer am Dreikönigstag noch Äpfel von der letzten Ernte aufbewahrt, der hat sie zu lange gelagert: „Heilige Drei Könige hochgeboren – da haben die Äpfel den Geschmack verloren.“
Als Wetterregeln galten diese:
„Ist Dreikönig hell und klar, gibt’s viel Wein in diesem Jahr.“ „Ist bis Dreikönig kein Winter – folgt keiner mehr dahinter.“ „Wie’s Wetter sich bis Dreikönig hält, so ist das nächste Jahr bestellt.“ „Heilig Dreikönig sonnig und still – Winter vor Ostern nicht weichen will.“ „Regen an Dreikönig – doppelte Keime, aber nur halbe Frucht in die Scheune.“ „Dreikönigstag sind die Feste vorbei – Mariä Verkündigung bringt neue herbei.“ „Dreikönig mit der Hack steckt Weihnachten in den Sack.“
Eigentlich handelte es sich beim Perchtenlauf um einen Fruchtbarkeitszauber der wetterabhängigen Landbevölkerung. Nebenbei konnte er dann gleich mit seinem Getöse wohl auch noch unliebsame Geister austreiben. Sicherlich haben die Burschen immer ihre besondere Freude daran gehabt, andere – und besonders junge Mädchen – zu erschrecken.
ERGO BIBAMUS!
Sie sind wieder „in“ – die Stammtische in den kleinen Städten und Dörfern. Allabendlich trinkt man hier sein „Helles“, spielt Skat, philosophiert im kleinen über die große Politik, über lokale Besonderheiten und bevorstehende Ereignisse.
Der Stammtisch ist wie eine Zeitungsredaktion – hier laufen laufend Meldungen ein. Er ist das „Kaffeekränzchen“ der Männer – man sollte dies nur zugeben.
Der alte Stammtisch hat seine eigene Philosophie. Er ist eine der philanthropischsten Erfindungen der zivilisierten Menschheit. Böse Zungen lästern über ihn und wünschen seine „Biertischpolitik“ zum Teufel.
Es gibt kaum einen von uns, der nicht gelegentlich an einem Stammtisch wenigstens mal gastweise zu finden war. Er übte eine magische Kraft auf die Dichter und Denker unseres Volkes aus. So hat Goethe denn geselligen Umtrunk besungen: „Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun, drum, Brüderchen, ergo bibamus (lat: also lasst uns trinken!)“ Oder Schiller bittet an der Tafelrunde: „Brüder, fliegt von eurem Sitze, wenn der volle Becher kreist, lasst den Schaum zum Himmel spritzen: Dieses Glas dem guten Geist!“
Sind wir froh, dass der Stammtisch als Souvenir der gutbürgerlichen alten Zeit in unserer hektischen Welt weiterlebt!
DER JANUAR, DER HÄRTESTE MONAT DES JAHRES
Januar, der erste Monat des Jahres mit 31 Tagen, hat seinen Namen von dem altrömischen Gott Janus. Die Römer sahen ihn als Schützer des Hauses an. Er war der Gott der Tür und des Torbogens. Mit einem Doppelgesicht schaute Janus zugleich nach drinnen und draußen, hütete den Eingang und den Ausgang. Später entwickelte Janus sich allgemein zum Gott des Anfangs. Er wurde am Gebetsbeginn angerufen, und seine heiligen Zeiten waren die ersten Stunden des Tages, die ersten Monatstage und der erste Monat des Jahres.
Janus wird mit einem Schlüssel und einem Pförtnerstab als Beigaben sowie mit einem jungen und einem alten Gesicht dargestellt. Das alte Gesicht blickt in die Vergangenheit, das junge in die Zukunft. Gerade zum Jahreswechsel kann das als Symbol gelten, nachdenklich zurückzuschauen und zugleich voll Hoffnung vorwärts auf alle kommenden Tage zu blicken.
Eine andere Bezeichnung für den Monat ist Jänner oder Jenner. Sie wurde bis ins 18. Jahrhundert verwendet. Heute ist sie nur noch in oberdeutschen Mundarten gebräuchlich, besonders in Österreich und in der Schweiz. Alle älteren deutschen Namen wie Eis-, Schnee- oder Wintermonat zeigen ebenso wie das altdeutsche Wort Hartung, dass der Januar in unseren Gegenden eine harte, eiskalte und bittere Winterzeit bringt. Der Hartung ist der härteste Monat des Jahres. Auch die meisten Bauernregeln, alte Erfahrungen des Volkes mit dem Wetter, verlangen vom Januar viel Schnee und klirrende Kälte. Nur so, meinen sie, kann das Jahr gelingen und ein rechter Sommer Einzug halten.
So wie der doppelsichtige Janus mit seinem Gesicht in die Vergangenheit und mit dem anderen in die Zukunft schaut, so steht der Januar als Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Daher wurde er einst auch als „Tür des Jahres“ bezeichnet. Schneemond oder Eismond, aber auch Hartung, weil der Januar der „härteste“ Monat des Jahres ist, sind alte Bezeichnungen für den ersten Monat des Jahres. Folglich erscheinen auch Schneemänner, Schneeflocken und Eiskristalle als Symbole für den oftmals kältesten Monat des Jahres.
Zieht man den Hundertjährigen Kalender zu Rate, dann soll es im Januar zunächst „so kalt wie Ende Dezember“ bleiben. Nachdem sich dann für den 7. Januar Schneefall ankündigt, ist vom 8. Bis 15. Des Monats mit Kälte zu rechnen, die anschließend von einer „linden“ Phase mit Schnee und Regen abgelöst wird. Erst nach dem 23. Januar – so heißt es weiter – wird es wieder kälter. Allerdings ist für den 30. Januar erneut mit eher milder Witterung zu rechnen.
Altem Volksglauben zufolge gilt jedenfalls: „Je frostiger der Jänner, je freundlicher das ganze Jahr.“ Klirrende Kälte sah auch der Bauer vergangener Tage besonders gern. Für ihn galt die Faustregel: „Werden die Tage länger, wird der Winter strenger.“ Die Erklärung dafür lag auf der Hand: „Der Januar muss vor Kälte knacken, wenn die Ernte gut soll sacken“ oder „Der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen.“ Darüber hinaus hieß es: „Januar hart und rau, nützet dem Getreidebau“ und „knarrt der Jänner Eis und Schnee, gibt’s zur Ernt’ viel Korn und Klee.“ Auch die Menge der weißen Pracht war einst von großer Bedeutung. „Schnee zu Hauf“, sagte dem Bauern, „hält den Sack weit auf“ und gewährleistete schon im Januar „Dung für das ganze weitere Jahr.“
Ein milder Januar rief immer Entsetzen hervor: „Januar warm – dass Gott erbarm!“ „Gibt es im Jänner gar viel Mückentanz, verdirbt die Futterernte ganz“, denn „wächst auch das Korn im Januar, wird es auf dem Markte rar“ und auch das Gras, das schon zu Jahresbeginn wächst, „ist im Sommer in Gefahr.“
Auch Regenwetter war genauso unbeliebt: „Viel Regen ohne Schnee, tut Bäumen, Bergen und Tälern weh.“ Mit einem lachenden und weinenden Auge hörte man in früheren Zeiten das Donnergrollen. Einerseits hieß es: „Wenn’s im Januar donnert über dem Feld, kommt später doch noch sehr große Kält“ und andererseits hoffte man darauf, dass des „Jänners Groll machet Kist und Fässer voll.“
Für die Weinbauern war einst das Wetter am Dreikönigstag (6. Januar) von Bedeutung: „Ist es an diesem Tag hell und klar, gibt’s viel Wein in diesem Jahr.“ Allerdings bedeutete ein Dreikönigstag „sonnig und still“, dass der „Winter vor Ostern nicht weichen will.“
Die Obstbauern warteten auf das letzte Drittel des Januars: „Wenn Agnes (21. Januar) und Vinzenz (22. Januar) kommen, wird neuer Saft im Baum vernommen.“
WENN DIE NASE TRIEFT UND DIE AUGEN TRÄNEN
„Drei Tage kommt er, drei Tage steht er, drei Tage geht er.“ Wer? Der Schnupfen, der zwar sehr lästig ist und das Wohlbefinden beeinträchtigt, in der Regel aber von kurzer Dauer ist. Durch ein Kitzeln in der Nase kündigt er sich gerne an. Mag das Kitzeln auch noch angenehm sein, das heftige Niesen ist es nicht mehr. Das ist zwar sprichwörtlich gesund, doch nur für den Absender, nicht für den Empfänger. Die in kleine Schleimtröpfchen vermummten Viren suchen sich neue Opfer. Von allein nicht lebensfähig – wie Köpfe ohne Körper – müssen sie sich fremdes Leben borgen. Rätselhaft: Die primitivsten Wesen der Erde sind fähig, das höchstentwickelte zu ihrem Sklaven zu machen.
300 verschiedene Viren sind als Erreger von Erkältungskrankheiten bekannt, die als „grippale Infekte“ gelten, doch mit der echten Grippe (Influenza) nur wenig gemeinsam haben. Und 100 Virusarten können einen Schnupfen erzeugen. Man kann also sicher sein, mit jeder neuen Laufnase einen anderen Erreger zu Gast zu haben.
Tröpfcheninfektion nennen es die Mediziner, wenn die Schnupfenviren beim Niesen, Husten, Räuspern oder Sprechen übertragen werden. Und zwei Meter sind keine unüberbrückbare Distanz.