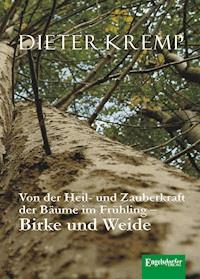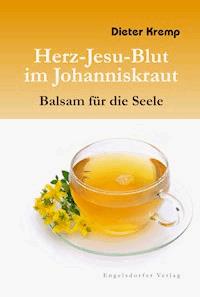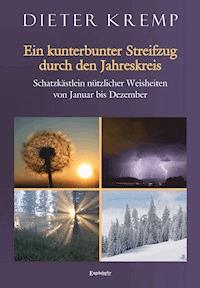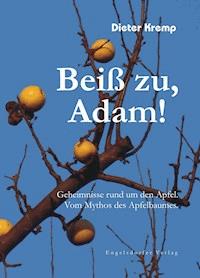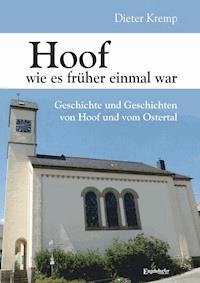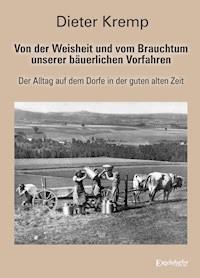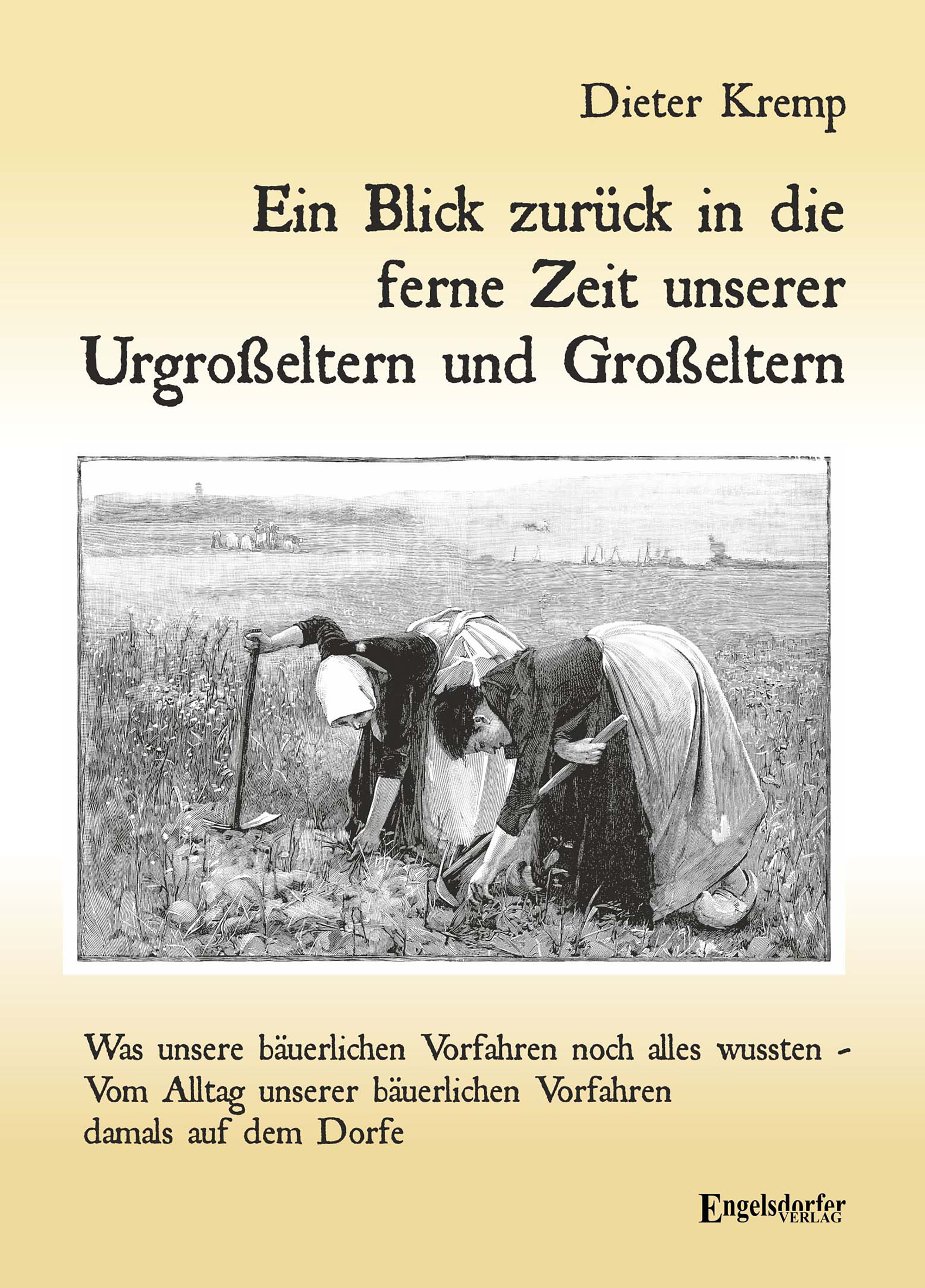
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der pensionierte Rektor und bekannte Autor Dieter Kremp schildert in seinem 84. Buch einfühlsam und nachdenklich das bäuerliche Leben seiner Vorfahren vom Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, also über einhundert Jahre Vergangenheit. Oft erzählt er in Anlehnung an seine eigene Familiengeschichte. Noch in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts versammelte sich die Hausgemeinschaft im Winter in der Wohnstube, bei uns im Dorf als »gute Stube« bezeichnet. Sie war einst der größte und neben der Küche der einzig beheizte Raum im Haus. Um den mit Scheitholz im Winter beheizten Ofen, waren an der Decke Holzstangen angebracht, an denen nasse Kleidungsstücke getrocknet wurden. Es gab noch kein elektrisches Licht. In der Weihnachtszeit brannten Kerzen oder Petroleumlampen, die jedoch recht teuer waren. Wer für die Arbeit Licht brauchte, setzte sich an den Tisch in der Fensterecke, an dem auch die Kinder ihre Hausaufgaben erledigten und spielten. Die kleine Bank in der Ofenecke war den Alten vorbehalten. Dort schmorte Großvater allabendlich sein Pfeifchen. Auf dem mit Kohle oder Scheitholz geschürten Ofen, brutzelten im Winter Äpfel auf der Ofenplatte, die einen feinen Duft in der Stube verströmten. Wer Sinn für das Alte hat, das kernhaft Gute, findet in diesem Buch einen unerschöpflichen Begleiter durch das ganze bäuerliche Arbeitsjahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kremp
EIN BLICK ZURÜCK IN DIE FERNEZEIT UNSERER URGROßELTERN UND GROßELTERN
Was unsere bäuerlichen Vorfahren noch alles wussten – Vom Alltag unserer bäuerlichen Vorfahren damals auf dem Dorfe
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2020
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/DE/Home/home_node.html abrufbar.
Copyright (2020) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Coverbilder © Erica Guilane-Nachez [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Das Buch ist gewidmet meinen Urgroßeltern Magdalena und Konrad Raber, meinen Großeltern Margarethe und Ludwig Kremp, Karl und Karoline Neu, meinen Eltern Bertha und Ludwig Kremp, meinen Schwestern Hilde und Ursula, meiner Ehefrau Waltrud, meinen Kindern Julia und Stefan und als Vermächtnis für unsere Vorfahren meinen Enkelkindern Helena, Joshua und Samuel.
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Gedichte
Wenn die Zeit eilt
Vorspann
Vorbetrachtung: Erinnerungen an unsere Kindheit, an unsere Ahnen und Vorahnen
In Großmutters Spinnstube
Selbst gesponnen, selbst gemacht
Neue Besen kehren gut – In der Besenbinderstube meines Urgroßvaters
Das Zimtwaffeleisen meiner „Großel“
Vom Schlachtfest in der Adventszeit
Hausschlachtungen früher
Als Großmutter noch den „Laxem“ rührte
Als es noch Eichelkaffee und Bucheckerferien gab
Wie Großmutter noch Sauerkraut einlegte
Ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten
Der alte Bauernhof
Von der Heublumenmedizin meiner Urgroßmutter – Als das Heu noch nach Waldmeister duftete
Als es im Keller noch eine Waschküche gab und wir Kinder noch „Dokterches“ spielten
In der „gudd Stubb“ meiner Urgroßmutter – Als es noch Eisblumen am Fenster gab
Wie meine Großmutter noch die „schäle Migge“ vertrieb
Sitten und Bräuche der Volksgemeinschaft unserer Vorfahren im Wandel eines Jahres
Vom „Korekaschde“ und dem „Kaffeeblech“
Gut gedengelt und gesenst
Von Bengeln und Nüssen
Von fratzigen „Rommelboozen“ und Kartoffelfeuern
Von Bauerntrachten früher im Dorf
Alte Trachten und Neuzeit
Das alte Bauernhaus
Das Haus des Bergmannsbauern
Vom Großknecht und vom Kleinknecht auf dem Bauernhof
Als noch Fuhrleute und Kutscher auf den Dorfstraßen unterwegs waren
„Maikäfer, flieg …“ – Wo sind die Maikäfer geblieben?
Als die Dorfstraßen noch gekehrt wurden
„Wo ein Schaf hingeht, da gehen sie alle hin“ – Vom Schafhirt im Bauerndorf
Als noch Quecken und Raden im Kornfeld wuchsen
Vom Weizenkranz und vom Haferkranz
In der Wohnstube im Winter
Sitten und Bräuche im Lebenslauf des einzelnen
Schilderungen einzelner Sitten und Bräuche früher auf dem Dorf
Kirmesbräuche früher auf dem Dorf: Der Kirmesstrauß, das Kranzheraustanzen und das Kirmes-Begraben
Von den Strickabenden in früheren Zeiten
Als noch das „Heimsje“ auf dem Bauernhof auf der Pirsch war
Die Dorfbewohner in früheren Zeiten
Die Hausgemeinschaft früher auf dem Dorf
Der Herd, der Mittelpunkt des Hauses
Als es in den Bauerndörfern noch den „Wannerschdaach“ gab
Mit der Schelle unterwegs: „Pass off, de Schitz kommt meddem Stecke“
Als es im Dorf noch einen „Bockstall“ gab
Von der „Katzenmusik“ bis zum „Leichenimbs“
Von der Nahrung der bäuerlichen Familie auf dem Bauernhof
Vom Alltag und vom Werktag früher auf dem Bauernhof
Der Sonntag und der Feiertag im bäuerlichen Dorfleben früherer Zeiten
Von den Arbeiten in Haus, Hof und Feld in früheren Zeiten in einem Bauernhof
Das religiöse Leben früher auf dem Bauerndorf
Als der Zichorienkaffee noch das Standartgetränk in der Küche war
Vom Aberglauben unserer Vorfahren
Vom armen Dorfschulmeister in früheren Zeiten: Die zehn Gebote für den Lehrer von 1872
Als die Schulmeister noch bettelarm waren
Der arme Lehrer war eine Respektperson im Dorf
Vom „Strohpatt“ und der „Binsegoth“
Als noch die „Tratschtante“ im Dorf unterwegs war
Als die Dorfstraßen noch gekehrt wurden
Als noch die Kornmutter im Kornfeld wachte
Als es noch Eisblumen am Fenster gab
Eisblumen am Fenster
Großmutter und ihr Butterfass
Drachen tanzten über den Stoppelfeldern
Vater trank im Krieg sein braunes „Fliegerbier“, wir Kinder unser „Klickerwasser“
Vom Hausbau und vom Richtfest
Der Einzug in das neue Haus und die damit verbundenen Bräuche
Als es noch einen Plumpsklo auf dem Dorf und einen Nachttopf unterm Bett gab
Als wir noch mit der Schulklasse den Kartoffelkäfer suchten
Vom Ostereiersuchen und von der Hexennacht
Kompost war die „Sparbüchse des Hobbygärtners“
Die Bäuerin war auch eine gute Hausmutter
Das dörfliche Leben früher und die Dorfgemeinschaft
Die Dorfbewohner früher, ihre Nachbarschaft und ihre Verwandtschaft
„Schliwwersch Louis“
Die Dorflinde als Mittelpunkt des Dorflebens – „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum …“
Kultstätten im Bauernhaus
Die früheren Berufsbezeichnungen wurden die Nachnamen unserer Vorfahren
Althergebrachte Begriffe aus den Gemarkungen der Dörfer
Wenn es donnert und blitzt
Jung gefreit, selten bereut
Meine Tante „Lottche – Goth“ und ihre 14 Kinder
Als früher noch die Glühwürmchen in der Johannisnacht leuchteten
Als die Frösche noch quakten – Froschkonzerte gehören der Vergangenheit an
Bäuerliche Rituale bei der Geburt eines Kindes
Allerlei Aberglauben rund um die Taufe
Alte Sitten und Bräuche rund um den Geburtstag
Als die „Kersche“ noch „bockich“ waren
Als die „Lavendelweiber“ noch unterwegs waren
Balsam für die Seele
Warum der Storch die kleinen Kinder bringt
Familienbräuche im bäuerlichen Leben unserer Vorfahren
Die Hauskobolde unserer bäuerlichen Vorfahren
Früher hatte jedes Dorf einen Anger und eine Allmende und Orte germanischer Herkunft auch eine Thingstätte
Von der abenteuerlichen Geschichte des Glockenläutens
Der Polterabend vor dem Hochzeitsfest
Vor 200 Jahren gab es noch Winterschulen
Friedhofsordnung früher: Im Leichenzug gehen der Lehrer und die Schuljugend vor der Bahre
Blumenschmuck früher im Bauernhaus
Als es noch eine Muhme und einen Oheim gab
„Kuck – kuck, Kuck – kuck, ruft’s aus dem Wald …“
„Er liebt mich, liebt mich nicht …“
Verlobung und Hochzeit früher – ist jemand gestorben, dann stellt man die Uhr ab
Ein Sträußchen Mutterkraut zum Muttertag
Früher waren auf dem Land auch noch altdeutsche Monatsnamen gebräuchlich
Pflanzen als Hochzeits- und Liebessymbole unserer bäuerlichen Vorfahren
Allerlei Sitten und Bräuche am Jakobstag zum Beginn der Ernte
Woher kommen die Namen unserer Wochentage?
Zum Schmunzeln bestimmt: Aus Urgroßvaters Gartenratgeber von 1877
Was Großvater noch wusste: Säen nach dem Blühkalender der Natur
Vom Brauch, einen Maibaum als Symbol der Fruchtbarkeit im Dorf aufzustellen
Früher gab es Maibrunnenfeste mit Frau Holle
Von Bastards, Bankerts und Bengels früher auf dem Dorf
Von Scherzliedern und Spottnamen früher auf dem Dorfe
Kinderspiele an Ostern
Die Mädchen spielten früher gerne „Blinde Kuh“, die Buben „Räuber und Schandarm“
Vor Unterrichtsbeginn mussten die Kinder noch den Stall reinigen
Hunde mussten einen Maulkorb tragen
Der Aberglaube spielte im Ostertal eine große Rolle
Als es noch Abtritte und Aborte im Dorf gab
Von der „Gottlosigkeit“ der Menschen im Ostertal
Der Lehrer musste im Dorf die Viehzählung durchführen
Die Einrichtung der bäuerlichen Häuser in früheren Zeiten
Haus und Hof im alten Bauernhaus
Der Apfelbaum in magischen Handlungen unserer Vorfahren
Kartoffelfeste und Hahnenwettkämpfe am Gallustag
Getreideernte im Lauf der Zeiten
Vom Tanzvergnügen früher auf dem Bauerndorf
Kräht der Hahn auf dem Mist
Des Bauern Schlankheitskur
Was man früher auf dem Lande las
Von der Prügelstrafe und der Backpfeife früher in der Schule
Großvaters alter Gartenzaun
Mit der Schmalzschmeer früher am Fetten Donnerstag in die Fastenzeit
Abwehrmittel und Schutzhandlungen unserer bäuerlichen Vorfahren
Was Großvater noch alles wusste: Uralte Gartentipps neu ausgegraben
Als meine Schwestern noch Ehelehre, Säuglingslehre und Erziehungslehre in der Schule hatten
Von Knechten und Mägden, vom Gesinde früher auf dem Bauernhof
Das Zimtwaffeleisen meiner „Großel“
Der Bauernhof früher
Von der Sichel und der Sense
Wie die Bauernfamilie früher die Geister und Dämonen abwehrte
Vom krumm und bucklig Schaffen der Bauern
Der Bauer, der Patriarch auf dem Hof
Die vielen Berufe der Bauersfrau – Die Rezepte der halben Doktorin
Die Winzer hatten einen Sterbewein
Die Kinder freuten sich früher auf den ersten Schnee
Von Scherzliedern und Spottnamen früher auf dem Dorf
Altbewährte Kinderspiele unserer Großeltern
Mit dem „Quak“ an Pfingsten durch das Dorf
Äpfel durften früher am Christbaum nicht fehlen
Allerlei Aberglauben unserer Großeltern früher um die Rabenvögel
Vom Geflügel früher auf dem Bauernhof
Das Ländliche Haus – das Bauernhaus früher
Die Ziege war früher die „Bergmannskuh“, die „Kuh des kleinen Mannes“
Das kannten unsere Großmütter noch: Alte Gemüsesorten, die längst in Vergessenheit geraten sind
Die Süßkartoffel wird auch Batate genannt
Auch die Kerbelrübe ist aus unserem Bauerngarten verschwunden
Topinambur, die „Süßkartoffel“ für Zuckerkranke, kommt wieder in Mode
Früher war die Puffbohne in jedem Bauerngarten zu Hause
Rapontika war für Goethe ein Gourmetgemüse
Auch Pastinak ist heute als Wurzelgemüse fast unbekannt
Goethe liebte die Teltower Rübchen
Großmutters Bratäpfel duften im Advent
Die neue Magd kam nach Weihnachten
Hausmacherwurst und Johanniswein am 27. Dezember
Reges Brauchtum rankte sich um das „Weihnachtsscheit“
Als die Burschen früher noch auf die „Freierei“ gingen und auf „Freiersfüßen“ wandelten
Unsere Großeltern überlisteten den Winter mit Barbarazweigen
… und wir schämten uns
Die Knechte und Mägde auf dem Bauernhof in früheren Zeiten
Knecht und Magd: Berufe, die es nicht mehr gibt
Heute völlig vergessen: Der Gute Heinrich als Frühgemüse
Mit den Bauernhöfen sind die Schwalben untrennbar verbunden
„Er liebt mich, liebt mich nicht …“
Riechkräuter im Bauerngarten
Haus und Hof im alten Bauernhaus
Die Wohnstube im Bauernhaus und die Schlafkammern
Als es noch Eichelkaffee gab – Großmutters uraltes Rezept
Auf jedem Bauernhof stand früher ein Walnussbaum
Die Rosskastanie, ein typischer Dorfbaum in früheren Zeiten
Allerlei Aberglauben unserer bäuerlichen Vorfahren zum Schutz der Ernte
Als es noch nach „Quetschemus“ roch
Wie früher die Wäsche gewaschen wurde
Vom Arbeitsalltag der Bauern und Bäuerinnen in früheren Zeiten
Kartoffelfeste feierte man früher am St.-Gallus-Tag
Kirchweihfeste im Oktober
Der Hirte spielte früher im bäuerlichen Dorfleben eine große Rolle
Familienbräuche im bäuerlichen Leben unserer Vorfahren
Kräht der Hahn auf dem Mist
Altbäuerliche Rituale zum Schutz der Ernte und des Viehs
Das Bauernhaus in der Tradition: eine Stätte des Brauchtums und Kults
Die alten Bauernhöfe und ihre aufgemalten Zauberzeichen
Die Bauernhochzeit in früheren Zeiten
Magische Schmuckelemente zum Schutz des bäuerlichen Hausrats
Tiere als Glücksbringer und Unglücksbringer im Aberglauben unserer bäuerlichen Vorfahren
Die Bedeutung der Pflanzen im Volksglauben unserer bäuerlichen Vorfahren
Die Winterschullehrer wurden früher von der Gemeinde wie ein Knecht gedungen
Eigentlich heißt er „Öhrwurm“, der Ohrwurm
Die Pfingstrose, ambrosischer Duftspender im Bauerngarten
Schwarzbraun ist die Haselnuss
Von der Schweinezucht früher auf dem Bauerndorf
Was Großvater noch wusste: Säen nach dem Blühkalender der Natur
Der letzte Erntewagen fuhr geschmückt durch das Dorf in den Hof ein
Erntefeste – Erntebräuche in früheren Zeiten
Kompost war die „Sparbüchse des Hobbygärtners“
Hölzerne Tore zu wundersamen Welten
Aus dem Kirchhof unserer Vorfahren wurde später der Friedhof
Alte Sitten und Bräuche in früheren Zeiten in Hoof und im Ostertal, die heute fast alle ausgestorben sind
Als das Korbflechten noch ein Handwerk war
Drillinge am Muttertag – Eine Sensation im damaligen Saargebiet
Altbewährte Kinderspiele unserer Großeltern
Unsere Urgroßeltern hatten noch kein elektrisches Licht
Von den Tieren früher auf dem Bauernhof
Großvater und der Kuckuckstag der Kinder
Von den Frühjahrsarbeiten unserer bäuerlichen Vorfahren im März
Kinderspiele von früheren Zeiten
Vom Drachensteigen – Der Feldschütz und die „bösen“ Buben
Literaturhinweise
Wenn die Zeit eilt
Die Jahre drehen sich im Kreise,
die Zeit pocht leise.
Immer schneller wird der Schritt,
der ins Alter tritt.
Das Rad der Zeit steht nie still,
weil Gott es so will.
Es dreht sich
unaufhörlich.
Die Uhr tickt,
das Leben strickt
seine irdischen Fäden.
Spinnen gehen auf die Reise
im Herbst des Lebens.
Doch der Winter kommt ganz leise,
unaufhaltsam, nicht vergebens.
Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
zögernd kommt die Zukunft angezogen,
ewig still steht die Vergangenheit:
Herr, es ist Zeit!
Falten, wie Jahresringe im Gesicht,
walten
über das Leben.
Die Zeit ist reif:
Jetzt ist es Pflicht,
eine Antwort zu geben,
denn langsam werden die Hände steif.
Je älter wir werden, umso stärker tauchen die Erinnerungen an unsere Kindheit in uns auf. Und oft schwelgen wir in längst vergangenen Zeiten – und unstillbare Wehmut lässt uns Tränen vergießen.
VORSPANN
Weißt du noch, wie es früher auf dem Dorfe einmal war? Es gibt einen „Garten Eden“, ein Paradies auf Erden, aus dem wir nicht vertrieben werden. Es ist das Paradies der Erinnerungen an unsere Kindheit, der Erinnerungen an unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern auf dem Dorf.
Je älter wir werden, umso stärker tauchen die Erinnerungen an unsere Kindheit in uns auf. Und oft schwelgen wir im Alter in längst vergangenen Zeiten – und unstillbare Wehmut lässt uns Tränen vergießen.
Der pensionierte Rektor und bekannte Autor Dieter Kremp schildert in diesem Buch einfühlsam und nachdenklich das bäuerliche Leben seiner Vorfahren von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts, was teilweise schon über hundert Jahre der Vergangenheit angehört, oft in Anlehnung an seine eigene Familiengeschichte. Der Autor entführt in die fast vergessene Welt des Dorfalltags früherer Zeiten.
„Einst war der Gartenzaun ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten“, erinnert sich Dieter Kremp. „Hier arbeitete man nicht nur tagsüber, hier wohnte und feierte man auch an lauen Sommerabenden in der Gartenlaube. Am späten Abend nach getaner Arbeit saß man gemütlich unter dem Walnussbaum auf der Ruhebank zusammen, der als Dorfbaum zu jedem Bauernhof gehörte, wohl wissend, dass der Geruch der Walnussblätter Stechmücken vertrieb. Und Großvater schmorte seine Pfeife dazu.“
VORBETRACHTUNG: ERINNERUNGEN AN UNSERE KINDHEIT, AN UNSERE AHNEN UND VORAHNEN
Wehmutsvoll sind die Erinnerungen an ganz frühe Zeiten, als unsere Großeltern und Urgroßeltern uns Kinder noch behüteten. Damals spielten die Kinder den ganzen Tag über, draußen und drinnen, wenn sie nicht in der Schule waren. Und der damals noch arme Dorfschulmeister, die Respektperson auf dem Dorf, hatte oft mehr als hundert Schüler in einer Klasse. Für uns Kinder waren es aufregende Spiele; kein Baum war zu hoch, um von den Kindern erklettert zu werden. Das Baumhaus gehörte früher fast zu jedem Garten, zumindest dann, wenn die Kinder schon schulreif waren.
Vor hundert Jahren gab es noch kein Fernsehen, keinen Computer, kein Smartphone und keine Playstation. Und im Haus gab es noch kein Telefon – viel später erst gab es ein Telefonhäuschen in der Dorfmitte. Ich erinnere mich an die ersten Fernsehsendungen am Abend, die Anfang der 1950er Jahre ausgestrahlt wurden. Und wenn es dann schon einen Fernsehapparat im Saal eines Dorfgasthauses gab, dann war am Samstagabend der Saal „gerammelt“ voll. So wie es vier Jahre später war, als 1954 das Endspiel der Fußball-WM Deutschland gegen Ungarn übertragen wurde. Und daheim gab es noch kein Fernsehen.
Es gab ganz früher ja auch noch kein Radio, erst später dann im Krieg einen „Volksempfänger“, der alle halbe Stunde Nazipropaganda bekanntgab. Und als wir noch kleine Kinder waren, liefen wir an Samstagen und Sonntagen kilometweit in das nächste Dorf, wo schon ein Kino war. Und noch heute erinnern wir uns an die damaligen Filme in den 50er Jahren, wenn wir Kinder uns „Dick und Doof“, „Zorro“ und „Tarzan“ anschauten.
Und Anfang der 50er Jahre fuhren dann die ersten Deutschen in den Urlaub nach Italien und ließen sich von dem unvergesslichen Lied von Rudi Schurecke anlocken: „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt…“
Noch in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts versammelte sich die Hausgemeinschaft im Winter in der Wohnstube, bei uns im Dorf als „gute Stube“ bezeichnet. Sie war der größte und außer der Küche der einzige beheizte Raum im Haus. Um den mit Scheitholz im Winter geheizten Ofen waren an der Decke Holzstangen angebracht, an denen nasse Kleidungsstücke getrocknet wurden. Es gab noch kein elektrisches Licht. In der Weihnachtszeit brannten Kerzen und ansonsten im Winter Petroleumlampen, doch das war recht teuer. Wer zu seiner Arbeit Licht brauchte, setzte sich an den Tisch in der Fensterecke, wo auch die Kinder ihre Hausaufgaben und ihre Spiele machten. Die kleine Bank in der Ofenecke war den Alten vorbehalten, wo Großvater allabendlich sein Pfeifchen schmorte. Stühle gab es recht wenige, sie wurden meist nur für Besucher herangerückt. In katholischen Familien war in der Fensterecke der Herrgottswinkel angebracht, von Heiligenbildern umgeben.
Vor dem elektrischen Licht bestand die Beleuchtung auch aus Kienspänen, aus Talg- und Öllampen sowie aus Kerzen. Petroleumlampen verbreiteten sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts und wurden auf dem Land erst spät vom elektrischen Licht abgelöst.
Auf dem mit Kohle oder Scheitholz geschürten Ofen brutzelten im Winter Äpfel auf der Ofenplatte, die einen feinen Duft in die Stube strömten.
Wie sich die Zeiten geändert haben! Damals gab es ja noch keine Zentralheizung. Wenn wir Kinder frühmorgens aufstanden, ging der erste Blick auf die Fenster, um die Eisblumen zu bewundern. Wenn es draußen im Winter bitterkalt war, offenbarte sich eine Wunderwelt am Fenster.
Eisblumen am Fenster! Welche Illusionen wurden in dem stillen Betrachter geweckt! Er unternahm eine Traumreise in eine ferne fremdländische Landschaft oder in einen längst versunkenen Urwald aus der Steinkohlenzeit. Die mit allerlei Formen und Mustern grauweiß überspielte kalte Glasfläche wurde für Minuten zu einem Märchenwald aus Tausendundeiner Nacht. Ein tropisches Bild mitten im Winter, von klirrendem Frost wie von einer künstlerischen Zauberhand auf die Fensterscheiben gemalt.
Als einziges Spielgerät für die Jungen gab es das Schaukelpferd, das Großvater selbst für die Kinder gebastelt hatte. Die Mädchen hatten damals schon ihre erste Puppenstube.
Die Dorfstraßen waren ja noch nicht geteert, auf denen vor allem die Buben spielten. Autos gab es ja noch nicht. Nur ab und zu fuhr mal ein Pferdefuhrwerk durch die Straßen oder ein Ochsengespann, nur ganz selten mal in der kalten Jahreszeit, ansonsten in der Zeit vom Frühjahr bis in den Herbst.
Hunde und Katzen gab es fast in jedem Haus, nicht nur als Spielgefährten für die Kinder, sondern um auch die Mäuse und Ratten aus der Scheune zu jagen. Und versteckt irgendwo im Kleiderschrank oder sonst wo war das „Doktorbuch“ der Eltern, das ja in jener Zeit für die Kinder noch „streng verboten“ war. Doch waren die Eltern und Großeltern mal außer Haus, so fanden es die Kinder und „schnüffelten“ darin.
Großeltern, Eltern, Kinder, Verwandte und Dienstboten bildeten früher auf dem Dorf die Hausgemeinschaft. Und manchmal waren es auch noch die Urgroßeltern, die zur Hausgemeinschaft gehörten. Es waren also in der Regel drei oder sogar vier Generationen. Sie lebten und arbeiteten als eine Großfamilie unter einem Dach und im Winter waren alle in der beheizten Stube in die verschiedenen Kinderspiele eingebunden.
IN GROßMUTTERS SPINNSTUBE
Dornröschen fiel in einen hundertjährigen Schlaf, nachdem es sich mit der vergifteten Spindel gestochen hatte: „Was ist eine Spindel“?, würde heutzutage ein Kind fragen, dem man das Märchen vom Dornröschen erzählt.
In den Märchen spinnen die Königskinder, in den Sagen die Göttinnen und Nornen. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte das selbstgesponnene und selbstgewebte Leinen zum hochgeachteten Aussteuerschatz.
Spinn- und Strickabende gehören der Vergangenheit an. Erinnerungen an Spinnstuben und Bratäpfel werden wach. Die Bratäpfel brutzelten auf der heißen Ofenplatte. Aus der schwarz gebrannten Schale tropfte dicker, brauner Saft. Süßer Duft erfüllte den Raum. Ein Scheitholz brannte im Kamin: Eine heimelige Atmosphäre.
Spinnen und Stricken waren die wichtigsten Winterarbeiten der Frauen. Zum ersten Spinnabend traf man sich in der Regel am vorletzten Donnerstag im November. Das konnte der Katharinentag sein. Die heilige Katharina ist die Patronin der Spinnerinnen.
In manchen Orten war es eine bestimmte Bäuerin, die die Spinnstube abhielt. In anderen Gemeinden wanderten die Spinnerinnen von einem Haus zum anderen. Man sparte in den Dörfern. Kerzen waren teuer und auch das Petroleum war ein Luxus. Aber wenn man sich abwechselnd in einer Stube zum Spinnen, Singen und Spielen traf, dann konnte man in allen anderen das Licht sparen. Oft bildeten die Mädchen und Frauen der verschiedenen Jahrgänge Spinngruppen, die über die Winterarbeit hinaus zusammenhielten.
Die Spinnstube war auch eine „Erzählstube“. Beim Spinnen des Garns und beim Stricken der dicken Winterstrümpfe erzählten die Frauen Geschichten, Märchen und Sagen und tauschten Neuigkeiten aus. Die „Tratsch –Tante“ des Dorfes war ein gern gesehener Gast, wusste sie doch alles, was im Dorf passiert war. Spinnstubenlieder wurden gesungen.
Meist trafen sich die Frauen am Nachmittag. Sie brachten Spinnrad, Flachs und Netzetopf mit, ein Wassergefäß zum Benetzen der Finger. Sie tranken zuerst Kaffee, das war noch Zichorien-Kaffee, aus den Wurzeln der Wegwarte geröstet, und aßen Kuchen, spannen dann bis zur Dämmerung. Zu Hause wurden dann Kinder und Vieh versorgt. Mit den Männern kehrten sie am Abend in die Spinnstube zurück. Wurst und Brot, Branntwein oder Bier standen als Spätimbiss bereit.
Junge Mädchen schwärmten in den Arbeitspausen auch gern aus, hielten heimlich Umschau nach ihrem Liebsten. Die jungen Burschen durften erst später kommen, brachten Dörrobst und gebackene Süßigkeiten mit.
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Spinnabende nach und nach zu reinen Strickabenden. Warme Pullover, Socken und Strümpfe für den Winter wurden gestrickt.
Was aber hat der alte Bauernspruch „Spinne am Morgen, Kummer und Sorgen. Spinne am Abend, erquickend und labend“ mit der Spinne zu tun? Die Spinne kann gar nichts dafür, dass man ihr solche Sachen nachsagt. Die Bauern meinten einst, wer schon am frühen Morgen mit Flachs- oder Leinspinnen anfangen müsse, der habe Kummer und Sorgen, die es mit den Einnahmen aus dieser Arbeit zu bannen gelte. Am Abend zu spinnen bedeutete aber, dass man es sich gemütlich machen konnte, dass die Spinnerei eigentlich keine Arbeit, keine auf dringenden Gelderwerb gerichtete Beschäftigung war, sondern eine liebevolle Unterhaltung und Entspannung vom bäuerlichen Alltag. Man konnte Sorgen und Kummer vergessen, Lieder singen, sich necken und vielleicht spann sich sogar manche Liebe an.
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Spinnabende nach und nach zu reinen Strickabenden. Die Schneider im Dorf waren hoch geachtet, denn Leinenzeug wurde vielerorts getragen. Da hatten die Schneider vollauf zu tun, denn Nähmaschinen gab es ja fast noch nicht. Kamisol (Jacke), Hose, Brusttuch (Weste) und Gamaschen wurden genäht. Zu diesem Zwecke wurde ungebleichtes Leinen zur Färbe gebracht. In manchen Dörfern gibt es heute noch Gewannbezeichnungen (Bannnamen), wie z. B. „Flachskaut“ oder „Leinkaut“, die an den Anbau der Bauern von Flachs erinnern.
Nostalgische Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“! Kommt sie wieder? Auf jeden Fall ist Stricken wieder zur Mode geworden.
SELBST GESPONNEN, SELBST GEMACHT
„Selbst gesponnen und selbst gemacht ist die beste Bauerntracht“, lautet ein altes Sprichwort. Die Spinnräder kamen schon frühzeitig im Herbst nach der Ernte in Betrieb. In einem Bauernhaus waren so fünf bis sieben Stück vorhanden neben zwei oder auch drei Haspeln.
Die Mägde spannen schon Ende Oktober nach dem Essen bis zehn Uhr abends, obwohl noch keine Zeit aufgegeben war. Am anderen Morgen wurden die Rollen von der Hausfrau (Bäuerin) gehaspelt, um nachzusehen, ob sie auch fleißig gesponnen hatten. Später, wenn dann die Herbstfrüchteeingeerntet waren, vereinigten sich die Mägde zur Spinnergruppe. Es bildeten sich im Dorf mehrere Truppen. Die Kinder, so ab dem 8. Lebensjahr, waren die jüngste Truppe. Jungen und Mädchen gingen für sich. Die Töchter von den Bauernhöfen, obwohl sie auch Magdstelle einnahmen, bildeten auch eine Gruppe.
Gesponnen wurde von Martini bis ins Frühjahr hinein, mit Ausnahme des Sonnabends, wenn Roggen gedroschen wurde. Vormittags saßen alle mit ihrem Spinnrad allein. Nach Mittag wusste aber jede Spinnerin, wo die Zusammenkunft war.
Solch ein Spinnkreis bestand gewöhnlich aus lauter jungen Mädchen. Der Kleinknecht, sobald er nach dem Abendessen das Futter für die Kühe für den nächsten Tag geschnitten hatte, saß an der Türseite des Ofens und schnarchte. Die Mutter des Hauses, die Bauersfrau, mit ihren Kindern hatte ihren Platz an der anderen Seite des Ofens vor dem Kanapee. Der Vater, der Bauersmann, im Kanapee, machte seine selbst gedrehten Zigarren, wenn er es nicht vorzog, an solchen Spinnabenden seinen Nachbarn oder vertrauten Freund zu besuchen.
In solch einem Kreis von Spinnerinnen, der nicht selten aus acht, auch zwölf Personen bestand – wurden drollige Hexen- und Spukgeschichten erzählt. Es wurden auch alle Neuigkeiten im Dorf ausgetratscht. Um die Wachsamkeit hochzuhalten, sang man zwischendurch Lieder. Auch Rätsel und Wörterspiele wurden gemacht. Je geräuschvoller es dabei herging, desto flotter ging das Spinnen vonstatten.
Im Winter, Punkt acht Uhr, ging der Spinnkreis hinaus auf die Diele. Dann spielte die Truppe auch mal Blindekuh. Es wurde auch getanzt, indem sie sich die lustigsten Weisen dazu sangen. Es fehlte dann nicht an Beteiligungen von Knechten aus dem Ort. Wo am Abend der Spinntrupp war, wusste jeder Bursche.
Nach einer halben Stunde kamen alle wieder hereingestürzt und setzten sich hinter ihr Rad. Sie sahen sich dann gegenseitig auf die Rolle, wie viel wohl jeder gesponnen hatte. Um zehn Uhr nahm jede ihr Spinnrad unter den Arm und ging nach Hause. Zu Hause wurden dann noch die Rollen gehaspelt, und da stellte sich dann der Abendfleiß heraus.
Im Winter wurde schon nachmittags gesponnen. Wenn die Männer nach Holzfahren oder Dreschen Feierabend machten und die Knechte noch ihre Abendarbeit verrichteten, kamen die Mägde mit ihren Garnrollen ins Haus, um ihrerseits ihre Nebenarbeiten zu machen. Nach dem Essen haspelten sie ihre Rollen, und dann ging es wieder zur Versammlung.
War ein armes Mädchen, das keine gute Anlage zum Spinnen hatte, so töricht und ließ beim Haspeln Fäden am Gebinde fehlen – man bezeichnete solches als „falsches Garn haspeln“ – dann war es eine tiefe Schmach für sie.
Ohne Flachs konnte auf dem Lande keine Familie bestehen. Auch in den Tagelöhnerfamilien spannen Mann, Frau und Kinder. Sie hatten ja ihren eigenen Flachs geerntet. Dafür mussten sie in der Ernte helfen. Man sah sie nicht anders zum Kaufmann gehen als mit ein paar Stück Garn in der Hand, wofür Kaffee, Öl oder Salz eingetauscht wurde. Auch ihre Kleidung bestand aus Selbstgesponnenem und war selbst gemacht.
NEUE BESEN KEHREN GUT – IN DER BESENBINDERSTUBE MEINES URGROßVATERS
Unsere Vorfahren kehrten mit Besen („Hexenreisern“) die Winterunholde, bösen Geister und Dämonen aus dem Haus, und der gesellig wachsende Besenginster war im Mittelalter ein wirksamer Schutz gegen Hexerei. Seine harten, zweigähnlichen Stängel wurden auch als Kaminbesen genutzt, wodurch verständlich wird, dass die Hexen nach dem endgültigen Sieg des Frühlingsgottes über die Mächte der Finsternis auf einem Besen reitend das Haus durch den Schornstein verlassen: Hexennacht – Walpurgisnacht.
Einzelne Besenruten lagen früher auf dem Küchenschrank und die Buben hatten einen Heidenrespekt davor. Das war der Schlagbesen des Vaters, der damit den Ungehorsam der Kinder bestrafte. Doch die strafende Rute des Nikolaus war ursprünglich das Reis, das Symbol der Fruchtbarkeit, durch dessen Berührung mitten im Winter die Hoffnung auf das Licht der Sonne wachgerufen wurde: Das Reis war die Lebensrute.
Das früheste geflügelte Wort aus dem deutschen Sprachschatz stammt aus Freidanks „Spruchdichtesammlung“ (um 1250), betitelt „Bescheidenheit“: „Der niuwe beseme kert vil wol, e daz er stoubes werde vol“: „Der neue Besen kehrt sehr wohl, eh’ dass er Staubes werde voll.“ Daraus wurde das sprichwörtlich gebrauchte „Neue Besen kehren gut“. Der Besen, das „Zusammengebundene“, war der „Staubsauger“ unserer Vorfahren.
Zu den bäuerlich Winterarbeiten gehörten früher neben Flechten von Körben, Stühlen und Kuchendeckeln und dem Binden von Besen auch das Herrichten des Geschirrs und der Zugseile, das Ausbessern der Wagen und Wagenräder, das Schärfen der Äxte und Beile und das Anspitzen der Bohnenstangen.
Auf den Bauernhöfen standen neben den Obstgärten gewöhnlich an den Grenzen zu den Nachbargrundstücken sogenannte „wilde“ Bäume: Birken zur Erlangung der nötigen Besenreiser, ein paar Weiden für Körbe, Stühle, Mulden, Schippen und Tröge, dazu Eschen, die jährlich geköpft wurden, so dass man die schlanken Zweige binden und zum Trocknen an Zäunen aufrichten konnte. Im Winter wurden sie den Schafen auf die Hilte gegeben. Die Tiere fraßen Blätter, kleine Zweige und die Rinde. Von den dicken Astteilen nagten sie den Bast ab. Mit diesen abgenagten Ästen wurden Zäune repariert und gebaut. Zwei bis drei Eichen standen auf dem Hof. Sie gaben Futter für die umherlaufenden Schweine. Schließlich gab es da noch den Walnussbaum und den Holunderstrauch, letzterer dicht an der Hauswand zur Abwehr von winterlichen Dämonen und Bereitung von heilenden Wintertees.
Ferne Erinnerungen an Groß- und Urgroßvaters Zeiten werden wach. Erinnerungen an die heimelige Atmosphäre in der gemütlich warmen Besenbinderstube: In mehreren Reihen lagen dicke Birkenreiser-Bündel („Birkenhecken“) mit Ruten verschiedener Länge auf den Dielen. Im November wurden die Besenreiser draußen geschnitten, an Ort und Stelle die abstehenden Seitentriebe um die innere Rute aufgedreht und die Nebenästchen am Reiseranfang ausgeputzt. Über Winter wurden die Besenreiser auf dem Speicher getrocknet. Am besten waren Reiser von sieben- bis achtjährigen Birken, weil sie noch schlanker und biegsamer sind als Ruten von älteren Bäumen. Diese sind meist zu storzig und brechen leichter. In der Besenbinderstube wurden die Reiser der Länge nach sortiert. In jede Hand kamen sieben lange Ruten, wurden nach unten fest zusammengedreht, über dem Knie mit einem Ring gespannt, die beiden Bündeln überkreuzt und zum „Geißfuß“ zusammengesteckt. Weitere Ringe aus Draht oder Seil – sechs bis sieben an der Zahl – wurden nach und nach um die gedrehten und gespannten Reiserbündel gesetzt. In einem der mittleren Ringe steckte man dann kürzere, etwas angespitzte Ruten rundum ein, bis der Besen eine bestimmte Handlichkeit hatte und die Kehrseite „bauschig“ wurde. Der Griff wurde „bündig“ geschnitten, noch vorhandene Stielreste glatt abgeschnitten, damit die Finger beim Kehren nicht aufrissen. Zum Schluss wurden die überstehenden Rutenspitzen an der bauschigen Kehrseite des Besens abgeschnitten.
Für die Herstellung der Besenringe haben früher die Besenbinder keinen Draht verwandt – der war zu teuer – sondern „Hassele-Stecke“ (Haselstrauch), die „Scheenstecke“. Die „Hassele“ waren etwa 1,50 m lang und so dick wie Flaschenköpfe. Die „Stecke“ wurden am Ende eingekerbt, von den Kerben aus die Rinde in ½ cm breiten Riemen (Schalen oder Schienen) abgeschält. Die abgeschälte Rinde war das Flechtmaterial für das Zusammenbinden der Besenreiser.
Jeder Hof hatte früher ein ganzes Sortiment von Besen, zumeist aus Birkenreisern gebunden. Seltener waren Strohbesen, ganz selten Ginsterbesen. Letztere waren kurz und mit einem Stock versehen.
Die Besen fanden eine vielfältige Anwendung. Die Häuser wurden gekehrt, der Stall, der noch ungepflasterte Hof, die Scheune, die Wege, der Misthaufen, Laub im Herbst und Schnee im Winter.
„Nichts wurde unter den Tisch gekehrt“ bei unseren Vorfahren. Doch den „Dorfbesen“ gab es überall. Doch auch diese Zeiten sind längs vergangen: „Damals auf dem Dorf war vieles anders.“
DAS ZIMTWAFFELEISEN MEINER „GROßEL“
Auf dem Dorf wurde früher die Großmutter von den Kindern, ihren Enkeln und Urenkeln, die „Großel“ genannt.
Mit Wehmut erinnern wir uns heute noch an den würzig-süßen Duft von Zimtwaffeln, wenn Großmutter alljährlich in der Adventszeit auf dem Kohlenofen ihre Zimtwaffeln backte. Wie heimelig war es in der Stube, wenn der Duft alle Räume des Hauses durchströmte. Auf Großmutters uraltem Zimtwaffeleisen waren sechs verschiedene Backformen-Symbole.
Da ist eine Schnecke (Spirale) dargestellt als ein Zeichen für die unaufhörliche Bewegung der Zeit, also eine Verheißung der ständigen Erneuerung. Für das Rotkehlchen auf dem Waffeleisen gibt es zwei verschiedene Deutungen. Die christliche lautet, dass das Rotkehlchen dem Herrn am Kreuz einen Dorn aus der Stirn zog, sich dabei selbst verletzte und seitdem den roten Blutfleck auf der Brust trägt. Es kann aber auch sein, dass das Rotkehlchen mit dem Zaunkönig verschmolzen ist, der früher am Tag des heiligen Stephan (26. Dezember), gejagt wurde. Es war der einzige Tag im Jahr, an dem dieser im Naturglauben heilige Vogel getötet werden durfte.
Vier Herzformen symbolisieren das Fest der Geburt Jesu, das Fest der Liebe. Die Christrose, im Volksmund auch Schneerose oder Schneekatze genannt, erinnert an die Blüte Jesse, die mitten im Dunkel der unerlösten Welt aufblühte: „Es ist ein Ros’ entsprungen aus einer Wurzel zart…“ In der Wintersonnenwende haben unsere Vorfahren große Schalen mit Früchten auf den Tisch gestellt, um im kommenden Jahr keinen Mangel zu leiden. Zu den Früchten gehörten vor allem Nüsse als Symbol der Fruchtbarkeit. Die Nüsse waren auch Sinnbilder von Gottes unerforschlichem Ratschluss.
Schließlich ist auf dem Zimtwaffeleisen auch noch ein Kreuzsymbol. Am Luciatag (13. Dezember) wurde vielfach Lucienweizen in Kreuzform in flache Tonschalen gesät und feucht gehalten. Die Weizensaat stellte die wieder keimende Natur dar. „Das Alter nagt am Zahn der Zeit“, ein Symbol auf der Kopfseite der Zimtwaffelpfanne, sieht aus wie ein Rad (Zahnrad) mit einer römischen Eins. Es ist das Rad als Symbol der Sonne im Mithras-Kult der keltischen Vorfahren. Die römische „I“ weist auf den Beginn des neuen Jahres hin.
Und wie hat Großmutter einst Zimtwaffeln gebacken? Man nimmt ½ Pfund Butter, 300 Gramm Zucker, drei große Eier, 100 Gramm Zimt und ein Pfund Mehl. Der Teig muss drei bis vier Stunden lang stehen.
VOM SCHLACHTFEST IN DER ADVENTSZEIT
November und Dezember galten früher auf dem Dorf als Schlachtmonate. Das erste Schlachtfest fand in Süddeutschland in der Regel zu Martini statt, das letzte vor allem in Norddeutschland ein Tag vor Silvester. Wenn früher im Dorf ein Schwein geschlachtet wurde, so war das nicht nur ein wichtiges Ereignis für den betreffenden Hof, sondern für alle Nachbarn und Freunde. Die Kinder auf den Bauerndörfern hatten an diesem Tag schulfrei. Der Schlachter kam ins Haus und alle Frauen, Familienangehörigen und Dienstboten halfen beim Zerlegen, Kochen, Hacken und Wurststopfen. Die Kinder bettelten um kleine, fingerdicke Würste.
Mit Freunden und Nachbarn feierte man abends bei Kerzenschein und flackerndem Kaminfeuer die erledigte Arbeit. Meist gab es eine Schlachtplatte mit Wellfleisch, frisch gekochter Blut- und Leberwurst, die sich früher ungeräuchert nicht lange hielten und deshalb verspeist werden mussten. In manchen Gegenden war es Sitte, aus der Wurstbrühe mit Grütze oder Buchweizen eine Wurstsuppe zu kochen, oft gab es eine Grützwurst mit Zwiebeln, Blut und fein gehacktem Fleisch. Zur Schlachtplatte gab es Siedfleisch, gekochten Speck, Schnuten und Pfoten mit Sauerkraut oder gedünsteten Äpfeln. Wer nicht zum Schlachtfest eingeladen wurde, der erhielt am anderen Tag Würste und Fleischbrühe ins Haus.
Kinder und junge Mädchen zogen zu dem Haus, in dem ein Schlachtfest stattfand, und sangen so lange, bis sie eine Schüssel mit Würsten bekamen. In manchen Gegenden war das Wurststechen beliebt. Das war ein Spaß der jungen Burschen, sie schoben eine lange angespitzte Stange zum Küchenfenster hinein, und wenn sie in der Gunst der Hausfrau standen, so wurde eine große dicke Fleischwurst auf die Stange gesteckt.
In manchen Gegenden Deutschlands war das Schlachtfest auch mit einem Spinnabend der Frauen verbunden.
Das alles waren Zeiten, als die Lehrer im Dorf noch bettelarm waren. Auf das Schlachtfest freuten sich alle Schulmeister, denn es war üblich, dass der Lehrer bei Hausschlachtungen eine Blut- und Leberwurst und einen Kessel Wurstbrühe erhielt. So hat sich in manchen Dörfern bis heute das Lied „Vom armen Dorfschulmeisterlein“ erhalten: „Und wird im Dorf ein Schwein geschlacht’, dann könnt ihr sehen, wie er lacht. Die größte Wurst ist ihm zu klein, dem armen Dorfschulmeisterlein.“
HAUSSCHLACHTUNGEN FRÜHER
Früher waren Hausschlachtungen ein fester Bestandteil des bäuerlichen Jahresablaufes. Traditionell waren November und Dezember die Monate der Schlachtfeste, um genügend Fleisch und Wurst für den Winter zu haben und weil die Lebensmittel in der kälteren Jahreszeit besser haltbar waren. Am Vortag wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Man brauchte Töpfe, Schüsseln, Schürzen, Tücher, Gewürze und Kräuter. Auch die Leitern zum Aufhängen der Schlachthälften durften nicht fehlen.
Am Schlachttag selber wurden viele helfende Hände benötigt, denn Fleisch, Eingeweide und Blut mussten noch im warmen Zustand zu verschiedenen Wurstsorten verarbeitet werden. Leberwurst, Schwartenmagen, Presskopf und Blutwurst fehlten auf keiner Schlachtplatte. Es wurde Fett ausgelassen, eingesalzen, gepökelt und geräuchert. Im ganzen Dorf roch es nach Kesselfleisch und Wurstsuppe.
Nach getaner Arbeit standen die Schweinehälften senkrecht an Leitern gebunden zum Auskühlen an der Hauswand. Hing das Schwein an der Leiter, wurde nach alter Tradition eine Runde Korn ausgeschenkt. Alle Helfer wurden mit Naturalien in Form von Fleisch und Wurst vom frisch geschlachteten Schwein bezahlt.
Hatte man am Kalender einige günstige Tage für die Schlachtung ermittelt, wobei der nächste Neumond den Ausschlag gab, dann bestimmte der bestellte Hausschlachter den genauen Termin und die Stunde, wann alles bereit sein musste. In den Tagen um den Neumond herum durfte nicht geschlachtet werden, man wusste aus alter Erfahrung, dass sich dann das Dauerfleisch nicht gut hielt. Es musste morgens sehr früh geschlachtet werden, um viel Zeit zum Auskühlen zu gewinnen, denn noch am gleichen Tage abends erschien der Schlachter zum zweiten Male, um das Schwein zu zerlegen.
Zu den Vorbereitungen der Schlachtung gehörte es zunächst, dafür zu sorgen, dass das zu schlachtende Schwein einen Tag lang vorher nicht gefüttert werden durfte, denn das erleichterte sehr die Schlachtarbeiten. Die Hausfrau und die Mägde hatten einen ganzen langen Tag Arbeit, um ordnungsgemäße Vorbereitungen zu treffen. Erfolgte das Schlachten in der Waschküche, so wurde diese zuerst geschrubbt, fehlte es aber an einem passenden Raum oder war die Temperatur im Hause zu warm, so machte man draußen im Hof eine Stelle sauber und bedeckte den Boden mit einer Schütte Roggenstroh als Unterlage beim Schlachten.
Ein Knecht musste dem Schlachter helfen. Er ergreift das Schwein am Sterz und hält es fest, bis der Schlachter den Strick um ein Hinterbein geschlungen hat, so haben die beiden das Schwein in der Gewalt und führen es an den Ort, an dem es geschlachtet wird.
Über die Tötungen gab es ganz früher keine Bestimmungen. Das Schwein wurde auf eine Seite gelegt, Knechte und Schlachter knieten sich darauf, und dann machte der Schlachter mit seinem langen Messer einen Schnitt in die Kehle und durch die Drossel, eine Magd fing das ausströmende Blut mit einer Pfanne auf und schüttete es in einen Topf, in dem es mit einem langstieligen hölzernen Löffel so lange gerührt wurde, bis das Schwein ganz ausgeblutet war. Das Rühren erfolgte deshalb, um Klumpenbildung im Blut zu verhindern. Während der ganzen Prozedur des Schlachtens schrie das Schwein ganz unbändig laut, dass man es weithin hören konnte.
Am späten Abend setzte der Schlachter seine Arbeit fort. Ein Hauklotz auf drei Beinen, ein großer Tisch und eine Reihe großer Töpfe standen in der Waschküche bereit. Die Hausfrau gab nun dem Schlachter Anweisung, wie die Zerteilung erfolgen sollte. Die großen Stücke wie Beine und Speckseiten wurden im Keller im Pökelfass eingesalzen, Rippen-, Nacken- und Bratenstücke wurden zunächst auf dem Fleischboden zum Trocknen einige Tage aufgehängt, dann eingekocht.
Alle Mettwürste und alle im großen Kupferkessel gekochten Leber- und Blutwürste wurden zunächst einige Tage zum Trocknen aufgehängt und dann in der stockdunklen Räucherkammer im Speicher geräuchert. Der Rauch des Backofens wurde zu dieser Zeit dann durch die Räucherkammer geleitet. Manche Stücke blieben hier monatelang hängen, bis sie zum Verbrauch heruntergeholt wurden. Nach zwei Wochen wurden auch die Schinken und die Speckseiten aus dem Pökelfass herausgeholt, abgewaschen, getrocknet und ebenfalls zum Räuchern in der Räucherkammer aufgehängt.
ALS GROßMUTTER NOCH DEN „LAXEM“ RÜHRTE
Kaum waren die letzten Körbe an der Reihe, richtete Großmutter schon den Kupfer- oder Emailkessel her, sorgte für gutes Brennmaterial und einen guten „Rührer“. Da herrschte dann Hochbetrieb in der „Worschdkich“ (Wurstküche) oder in der „Wäschkich“ (Waschküche). Die Luft war geschwängert vom Dunst und Musgeruch. Da brotzelte es es Tag und Nacht. 24 bis 48 Stunden dauerte die Arbeit des Einkochens. Da musste die brodelnde Masse dauernd gerührt werden, damit das Mus nicht anbrannte. Hier zeigte sich die gute Nachbarschaft, die alte Dorfgemeinschaft allzeit hilfsbereit. Etwas Gutes zu essen und zu trinken gab es, Bohnen- oder Zichorienkaffee und Zwetschgenkuchen gehörte dazu.
In fein gesäuberte und gesüßte „steinerne Hawe“ (Töpfe) wurde der Laxem nun eingetopft und sorgsam verschlossen. Jede Hausfrau hatte eine „Spezialität“ beim Einkochen. Meine Großmutter nahm recht viel Gewürze, Nelken und Ingwer; meine „Tilchegoth“ Mathilde vermengte die Zwetschgen mit Nüssen oder Holunder, die „Annagoth“ mit recht vielen Mostbirnen.
Wir Kinder bekamen am nächsten Morgen eine große „Laxemschmeer“ mit zur Schule. Nach der Pause hatten die meisten einen saftigen braunen „Schnorres“ (Schnurrbart). Die größte Freude der Kinder aber war dann das Auslecken der geleerten Latwergkessel. Da pappten Gesicht und Hände von der süßen „Schmeer“ (Mus, Marmelade).
Laxem heißt auch „Latwerg“ oder „Latwerich“. „Latwerg“ ist eigentlich ein eingedickter Heilsaft, der „geleckt“ wurde. So wurde der „Huf-Lattich“ als Brustsirup eingedickt und „geleckt“.
ALS ES NOCH EICHELKAFFEE UND BUCHECKERFERIEN GAB
Zwei uralte Rezepte, die bei den Urgroßmüttern im Herbst auf dem Küchenplan standen, waren Apfelringe und Eichelkaffee. Die Äpfel wurden in Scheiben geschnitten, die auf einem Backblech ausgelegt und im Backrohr bei niedriger Wärme leicht angetrocknet wurden. Jetzt wurden die Apfelringe einzeln an einem langen Faden aufgereiht und an die Luft zum Trocknen aufgehängt. Aber nicht in der prallen Sonne! Das zerstörte Geschmack und Vitamine. Die getrockneten Apfelringe wurden in Papiertüten verpackt und für den Winter im Vorratsschrank aufbewahrt. Unsere Vorfahren nutzten alles, was die Natur im Herbst hervorbrachte. Selbst die Baumfrüchte des Waldes waren gefragt: Eicheln, Buchecker, Haselnüsse, Hagebutten und Kastanien.
Nur noch unseren Urgroßeltern war der Eichelkaffee bekannt. Die Eicheln wurden geschält, das Fruchtinnere klein geschnitten. Es wurde in einer Pfanne ohne Fett braun geröstet. Es durfte nicht anbrennen oder sogar schwarz werden. Die braun gerösteten Teile wurden in einem Mörser zu Pulver zerstoßen. Auf eine Tasse Kaffee kam ein gestrichener Teelöffel Eichelpulver. Kurz aufgekocht, abgeseiht, mit Zimt etwas gewürzt und mit Milch gemischt, war Eichelkaffee ein beliebtes Getränk noch im 19. Jahrhundert auf dem Land.
Mein Großvater Ludwig erzählte mir noch von den Schweinehirten auf dem Dorf, die im Spätherbst zur Zeit der Eichelmast die Schweine in den Eichenwald trieben und dort wochenlang hüteten. Eichelmast war wohl das beliebteste Futter für die Schweine.
Aus Rosskastanien stellten unsere Vorfahren Mehl her. Kastanien schmecken bekanntermaßen recht bitter. Und so trieben unsere Vorfahren die Bitterstoffe aus den Rosskastanien heraus: In einem Feuer stark erhitzte Steine wurden in ein Erdloch gelegt. Da hinein schüttete man die Kastanien und deckte sie mit heißer Asche zu. Nach einem Tag waren die Kastanien gegart und wurden mit einem Stein zerstampft. Der Mehlbrei kam in einen engmaschigen Korb, der in einen klaren Bach gestellt wurde. Zwei Tage lang floss das Wasser durch den Korb. Dann wurde das Mehl ausgedrückt. Auch ein Klebstoff steckt in den Kastanien. Buchbinder und Tapezierer haben früher einmal daraus Leim hergestellt. Aus den geschälten Kastanien hat man sogar Seife gewonnen.
Im Krieg und in den Hungerjahren danach hat man sackweise Bucheckern gesammelt. Es gab damals sogar Bucheckerferien, damit Mutter und Kinder gemeinsam die ölhaltigen Früchte sammeln konnten. Buchecker schmecken gut, doch sollte man nicht zu viele davon knabbern. Vorsicht ist geboten, denn roh enthalten sie den giftigen Inhaltsstoff Fagin. Meine Mutter und ich schleppten den vollen Sack mit den Bucheckern zur benachbarten Ölmühle Wern nach Fürth im Ostertal, wo Öl daraus gepresst wurde. Aus 100 Kilogramm Bucheckern gewann man 12 Liter Speiseöl. Das Öl ist nach dem Erhitzen frei von giftigen Stoffen.
Im Krieg und in den beiden Hungerjahren danach gab es auf dem Dorf auch Kartoffelferien. Zusammen mit den Großeltern und Eltern mussten dann die Kinder bei der Kartoffelernte helfen.
Wie Großmutter noch Sauerkraut einlegte
„Eben geht mit einem Teller
Witwe Bolte in den Keller,
dass sie von dem Sauerkohle
eine Portion sich hole,
wofür sie besonders schwärmt,
wenn er wieder aufgewärmt.“
Wie Wilhelm Buschs Darstellung zeigt, war Sauerkraut auch schon früher recht beliebt – und der Oktober mit der Weißkrauternte bietet sich wie kein anderer Monat an, einige Portionen für den Eigenbedarf selbst herzustellen. Das Einsalzen von Sauerkraut ist nicht nur eine recht einfache und vergnügliche Arbeit für die private Vorratshaltung, sondern beschert dem winterlichen Küchenzettel eine gesunde Bereicherung.
Sauerkraut entsteht, weil Hefepilze und Milchsäurebakterien im Weißkohl eine Gärung bewirken. Sie wandelt den Großteil der vorhandenen Kohlenhydrate in Milchsäure um. Diese desinfiziert regelrecht den Darm, bekämpft Fäulnisvorgänge und wirkt im Körper ähnlich gesund wie Sauermilch und Joghurt. Dazu kommen noch die Vitamine des roh verzehrten Sauerkrauts und seine bekannte Bedeutung als Schlankmacher oder Schlank-Erhalter. Am selbst eingelegten Sauerkraut wird besonders Großmutters „Hausmachergeschmack“ gerühmt. Durch kleine Veränderungen in der Würze und bei den Zutaten erhält jedes Kraut seinen unverwechselbaren Geschmack. Sauerkraut mit Kasseler und Bier – ein deftiger Schmaus, der den Deutschen den Spitznamen „die Krauts“ eingebracht hat, aber immer eine genussvolle Mahlzeit verspricht.
Die zum Einlegen von Sauerkraut bestimmten Steintöpfe werden gründlich gescheuert, mit heißem Wasser ausgespült und getrocknet. Feste, frische Weißkrautköpfe werden von der äußeren, unansehnlichen und losen Blättern befreit. Je nach Rezept werden die entsprechenden Zutaten hergerichtet, ein Leintuch wird in klarem Wasser ausgekocht und ein größerer Stein besorgt.
Einmachen: Die gesäuberten Weißkohlköpfe fein hobeln – auf 5 kg Weißkraut ca. 100 g Salz zugeben – das Kraut abwechselnd mit Salz in den vorbereiteten Steintopf stampfen (mit der Hand, der Faust oder einem Holzstampfer lagenweise so fest einstampfen, dass der Saft jeweils über dem Kohl steht) – am Schluss alles mit dem Tuch abdecken, mit Brett und Stein beschweren – zugedeckt ca. 4 bis 6 Wochen an einem kühlen Ort gären lassen.
Hinweise für Veränderungen: 1. Möglichkeit: auf 5 kg Weißkraut ca. 1 Pfund geviertelte Äpfel oder Apfelscheiben einschichten (Apfelkraut). 2. Möglichkeit: Wacholderbeeren, Lorbeer- oder Weinblätter mit einschichten (Würzkraut). Hinweis: Manche bevorzugen es, Lorbeer und Wacholder erst beim Kochen dazuzugeben, wodurch der Würzgeschmack weniger intensiv wird.
3. Möglichkeit: Eine böhmische Variante für die Herstellung einer größeren Menge ist: Auf 50 Pfund Kraut 250 g Salz, 1 Päckchen Kümmel, 5 Pfund geschälte Zwiebeln mit in das Kraut hobeln; dazu 4 bis 5 Pfund geschälte, entkernte Äpfel in die Achtelstücken lagenweise einschichten (Böhmisches Kraut). Kontrollen: Spätestens alle zwei Wochen Tuch, Brett und Stein sauber abspülen – falls die Salzlake im Winter das Kraut noch mehr bedeckt, erkaltete Salzlösung nachfüllen (10 g Salz pro Liter Wasser) – das Kraut möglichst nicht mit Metall-, sondern mit Holzgabeln oder Holzlöffeln aus dem Steintopf herausnehmen.
EIN HÖLZERNES TOR ZU WUNDERSAMEN WELTEN
Einst war der Gartenzaun ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten. Zaunwinden, Vogelwicken und Kapuzinerkressen an den Holzlatten und Pfählen umrankten die Zäune mit ihren Fingern; der Holunderstrauch in der Ecke malte Motive unserer Vorfahren als Schatten in das Gartenbeet. Wenn der Bauer am frühen Morgen in den taufrischen Garten ging, war folgendes das erste was er tat: „Er zog den Hut ab vor dem Holunder“, galt er doch bei unseren Vorfahren als „heiliger Strauch“ und gleichzeitig als lebendige Hausapotheke. Oft stand der Hollerstock dicht am Hausgiebel, weil man glaubte, er könne das Haus vor Blitzschlag schützen. So hatte auf dem Dach auch die Donner- oder Hauswurz ihren Stammplatz, schützte doch auch sie Haus und Scheune vor Blitzschlag.
Dahlien, Astern, Gladiolen und Georginen drängten prunkvoll zwischen dem Gartenzaun, der im Alter oft moosbedeckt war. Stockrosen, Malven, Alant, Eibisch und die Engelwurz Angelika eiferten in ihrer bunten Vielfalt und in ihrer majestätischen Größe um die Wette. Über den Gartenzaun schob die Sonnenblume neugierig ihr goldenes Löwenhaupt. Der schönste Zaun im Dorf war der einfache Lattenzaun, vor allem deshalb, weil er dem Pflanzenreichtum keinen Einhalt bot. Hinter dem Gartenzaun begann eine eigene, kleine wundersame Welt der Bauernfamilie. Hier arbeitete man nicht nur tagsüber, hier wohnte und feierte man an lauen Sommerabenden. Jeder Zaun erzählt seine eigene Geschichte.
Die Blumenbegeisterung meiner Großmutter machte am Zaun nicht halt, so dass auch noch der Rand der Dorfstraße mit farbenfrohen Stauden und Edelrosen geziert war. Hier hatte auch die Pfingstrose ihren Stammplatz und in ihrer Nähe auch der lilafarbene Fliederstrauch. In ihrem Reich spielte auch der ambrosianische Duft von Pflanzen eine Rolle. Ein Sträußchen gepresster Duftminzen und Thymian im Gebetbuch sollte mit seinem Aroma während der Sonntagspredigt die Bäuerin wach halten, die ja schon vor dem Kirchgang ein hartes Arbeitspensum hinter sich hatte. Und im Gartenbeet durfte auch das Mutterkraut nicht fehlen, das als „Mottenkraut“ im Kleiderschrank die Motten abwehrte. Genauso war es mit Großmutters Lavendelsäckchen, das auch beim Einschlafen half, wenn es unter dem Kopfkissen lag.
Am späten Abend nach getaner Arbeit saß man gemütlich unterm Walnussbaum, der als Dorfbaum zu jedem Bauernhof gehörte, wohl wissend, dass der Geruch der Walnussblätter Stechmücken vertrieb.
Doch am allerschönsten war an lauen Sommerabenden der Plausch in der Gartenlaube, die früher in keinem Bauerngarten fehlen durfte.
Der alte Bauernhof
Hinter dem Garten am nahen Wiesenhain
stand unser altes Bauernhaus,
wo Efeu und wilder Wein den Gipfel umrankten,
wo Sonnenblumen thronten am Gartenzaun,
Stockrosen und Eibisch im Vorgarten prangten.
Am Abend drang der silberne Mondenschein
durch die gemütliche Laube hinein:
Ein kleines Paradies auf Erden,
ein trautes Heim:
Im Stall das Wiehern der Pferden.
Ein hölzernes Tor zu wundersamen Welten
öffnete den Blick auf Großmutters Garten,
wo schlanke Edelrosen sich zur Pose stellten
und Käfer schwirrten auf moosigen Platten.
Vogelwicken umwanden die alten Pfosten,
mit ihren langen, gebogenen Fingern,
sie drehten ihren Blütenhals nach Osten,
Heidelbeeren im Gesträuch der Hecken ringten,
Lavendel in dem Kräuterbeet
seinen Sommerduft ins Hause weht.
Der heilige Hollerstock stand dicht am Giebel
und auf dem Hausdach in den alten Ziegeln,
die Donnerwurz das Haus vor Blitzschlag schützte:
Großvaters Aberglaube, der sich im Sommer nützte.
Im Kräuterbeet das alte Mutterkraut,
es schützte in der Nacht das Kleid vor Motten,
im Kleiderschrank ein Säckchen hing,
das frische Heu stark duftete nach Cumarin,
woraus die Bäurin einen Tee gebraut
und Perlentau drang aus der Gräser Soden.
Hut ab, vor dem Holunder!
Das war die erste Prozedur,
wenn Großvater am frühen Morgen
in die Wunderwelt des Gartens trat,
geheilt von allen finstren Sorgen
für seinen ganzen arbeitsreichen Tag.
Wenn sich die Bäuerin zur Ruhe legte
nach einem schweißerfüllten Tag,
sie in der späten Nacht das Beten pflegte,
wo unter ihrem Kissen der Lavendel lag.
Großmutter war das Heimchen am Herd,
wo Bratäpfel im Winter sprühten
und im Advent die Zimtwaffeln glühten.
Der süße Duft zog durch den ganzen Raum:
Auch heute noch für mich ein Kindheitstraum!
An Weihnachten das Scheitholz brannte,
die heißen Gluten durch die Stube flammten.
Großvater am Kamin schlief ein,
die Müdigkeit zog ihn in den wohlverdienten Schlaf hinein.
Er war der Herr der alten Scheune,
im Stall war es der große Knecht,
die junge Magd die Herrin auf dem Felde:
Zusammen sich erfüllten alle Bauernträume,
ein jeder mit der schweren Arbeit kam zurecht:
Sie waren alle vier im Bauerndorf die Helden.
Der Hahn, er war der Ritter auf dem Hof,
am frühen Morgen er den Bauern weckte,
die große Hühnerschar sich um ihn reckte,
schon ging die schwere Arbeit los.
Am späten Abend nach getaner Arbeit,
saß man gemütlich unterm Walnussbaum,
es war die erste kurze Ruhezeit,
nach vielen Stunden im alten Gartenraum.
Ich höre heute noch die Bäurin rufen,
wenn Mäuse in der Tenne tobten,
zart in der Stimme, sanft im Ton:
„Heimsje komm! Heimsje komm!“
Die Katze war der Wächter auf dem Hof,
sie war die Herrin in der vollen Tenne,
und in der Nacht stets auf der Pirsch,
mit Arien ihrer Miezenklänge
ließ sie im Stall die Winde los,
wenn sie durch Haus und Hofe schlich.
Im Frühjahr war’s der Schwalben Sang,
die in der Scheune ihre Nester bauten,
im Sommer war es Großvaters Sensenklang,
der früh am Morgen unser Herz erfreute,
wenn auch die Morgenglocken läuten.
Im frühen Herbst die Heimchen in der Stube zirpten,
die Grillen auf dem Ährenfeld,
die letzten Schwalben an den Drähten schwirrten:
Die volle Ernte war bestellt.
Das Heimchen am Herd,
das Heimchen im Zimmer,
das Heimsje im Haus!
Die alten Gesichter kleiden sich aus
für ewig und immer.
Wo ist die Zeit geblieben?
Wann kommt sie wieder,
die gute, alte Zeit?
Sie ist von uns geschieden
hernieder in ein Armenhaus.
Wann geh’n die Lichter aus
Im alten Bauernhaus?
Großmutter, Mutter, Enkel und Kind,
in einer Stube zusammen sind:
Das war einmal
vor langer Zeit.
Kommt sie zurück geeilt?
Wir haben unsre Zeit gestohlen,
die schwangren Ackerschollen und die Gartenbohlen,
den alten Bauerngarten und das Bauernhaus:
Die Lebenslichter auf dem Dorf –
Sie gehen aus.
VON DER HEUBLUMENMEDIZIN MEINER URGROßMUTTER – ALS DAS HEU NOCH NACH WALDMEISTER DUFTETE
Meine Urgroßmutter Magdalena Raber hat mir meine frühe Kindheit auf wunderbare Weise vergoldet. Meine Erinnerungen an sie leuchten heute noch wie goldene Sonnenstrahlen am Firmament. Im Volksmund war es die „Stemmchemodder“, weil sie in Steinbach „Auf dem Stümpfchen“ wohnte. Ich hatte das große Glück, dass sie 98 Jahre alt wurde. Noch heute gehe ich im Traum mit ihr durch Fluren und Wälder, sehe ihr lachendes Gesicht und ihre Kräuterbüschel über dem Rücken. Sie hat mir die Natur in die Wiege gelegt.
Noch mit 90 Jahren war sie geistig und körperlich sehr rüstig. In den Kriegsjahren und danach streifte sie mit mir den Sommer über durch Wald und Feld. Jeden Samstag und Sonntag waren wir oft stundenlang unterwegs. Auch der kleinste Zipfel auf der Gemarkung meines Heimatdorfes Steinbach im Ostertal war uns vertraut. Ihr „heiliger“ Sammeltag war der Johannistag (24. Juni), wenn sie ihre Lieblingsheilpflanze, das „Herz-Jesu-Blut“, pflückte. Sie presste die jungen Blüten des Johanniskrautes zwischen den Daumen und zeigte mir den blutroten Farbstoff. Am liebsten waren wir im „Kerbacherloch“, auf dem „Wälenberg“ und auf der „Trift“ auf der Suche. Sie kannte fast alle Kräuter, von der Kamille über das Tausendgüldenkraut, die Schafgarbe bis hin zum Arnika. Damals waren Arnika und Tausendgüldenkraut noch weit verbreitet, heute sind sie selten und stehen unter Naturschutz. Hatten wir die Körbchen voll, dann schnürte sie Kräuterbündel, hängte sie uns über den Nacken und wir trugen sie heim. Zu Hause wurden die Kräuter zu kleinen Sträußchen unter den Walnussbaum gelegt, wo sie dann im Schatten trockneten. Das ganze Jahr über hatten wir unseren Kräutertee. Im Hochsommer pflückte sie auch Kornblumen in den Getreidefeldern, die heute fast gänzlich verschwunden sind. Ihre blauen Blüten dienten zur Färbung des Tees.
Aber auch im zeitigen Frühjahr waren wir schon auf Tour. Da galt es vor allem das Scharbockskraut zu sammeln. Sie wusste, dass es ein wichtiger Vitaminspender für die Frühjahrskur war. Aus den Blättern bereitete sie einen köstlichen Salat, aus den stärkehaltigen Knöllchen „gebratene Feigen“. Natürlich sammelten wir im März, wie das vor allem im Saarland so üblich ist, den „Bettseicher“ (Löwenzahn). Jeden Morgen pünktlich um 10 Uhr kam sie zu meiner Mutter Bertha, um die Kartoffeln für den Mittagstisch zu schälen. Im Herbst schnitt sie Kartoffelscheiben, färbte sie und stellte für mich wundersame Muster mit Kartoffelstempeln her.
Meine Urgroßmutter pflegte noch das „Brauchen“, wie das früher auf den Dörfern so üblich war. Hatte ich im Winter eine Erkältung, dann brachte mich meine Mutter zur „Stemmchemodder“. Das „fleißige Handauflegen“ bei Entzündungen im Kopfbereich war damals noch ein viel gepriesenes Mittel.
Ein Bett im Heustadel, eine Ruhestunde im Heuschwaden oder ein Schäferstündchen auf dem Heuboden in der Tenne ist heute nicht mehr romantisch. Früher roch das Heu stark nach Kumarin, was dem typischen Waldmeisterduft entspricht. Kumarin ist eine Zuckerverbindung, die erst beim Verwelken der Pflanzen frei wird und ihren unvergleichlichen Heuduft entfaltet, ist vornehmlich im Ruchgras („Riechgras“) der Wiese, im Waldmeister, im Steinklee, in der Weinraute und in vielen Wiesenblumen enthalten. Da diese ja häufig aus den Wiesen verschwunden sind oder man sie nicht mehr ausblühen lässt, mangelt es heute dem Heu am würzigen Duft.
„Heublumen“ aber sind keine Blumen. Es handelt sich um Pflanzenteile, die sich im Laufe der Zeit auf den Heuböden, häufig in einer mehrere Zentimeter dicken Schicht, ablagern. Diese Heublumen bestanden früher aus Blättchen, Samen, Blütenstaub und Blütchen der Gräser und Kräuter, die mit dem Heu eingebracht wurden. Neben den eigentlichen Gräsern fand man Bestandteile des Löwenzahns, der Schafgarbe, des Eisenkrautes, des Ehrenpreises, des Kerbels, des Sauerampfers und andere Kräuter.
Auch heute noch kann man Heublumen pfundweise in den Apotheken kaufen. Sie sollen gut getrocknet sein und nur bis zur nächsten Heuernte verwendet werden. Ältere Heublumen verlieren ihre Wirkung.
Die Behandlung mit Heublumen war für meine Urgroßmutter eine „Chefsache“. Vor allem Vollbäder mit Heublumen und der Gebrauch von Heublumensäckchen waren bei meiner Urgroßmutter dorfweit bekannt. Sie halfen bei rheumatischen Erkrankungen, Gicht, Hexenschuss, schmerzhaften Gelenkentzündungen und bei Erkältungskrankheiten. Für Vollbäder benötigte sie ein bis zwei Kilo Heublumen. Sie überbrühte mit fünf Liter Wasser, ließ zehn Minuten ziehen, seihte ab und setzte den Aufguss dem heißen Badewasser zu. Nach dem Bad gönnte man sich eine längere Bettruhe. Für Sitz- und Fußbäder nahm sie ¼ kg Heublumen.
Am bequemsten war für sie der Gebrauch von Heublumensäckchen. Dazu benutzte sie einen Leinenbeutel, den sie fast vollständig mit Heublumen füllte. Der Beutel wurde zugebunden und in kochendes Wasser gebracht. Bei zugedecktem Topf wurde er zehn Minuten ziehen gelassen. Der ausgedrückte Leinenbeutel wurde – so heiß wie nur möglich – auf die erkrankten Körperstellen gebracht. Die Heublumenauflage wurde mit wollenen Tüchern gut abgedeckt.
Auch Heublumendampfbäder für Nebenhöhlen und Bronchien wurden empfohlen. Der Heublumenaufguss wird dabei nicht abgeseiht. Die Dämpfe lässt man 15 Minuten einwirken.
„Wir fahren ins Heu“, hieß es früher in den Tagen um Johanni (24. Juni), wenn in Süddeutschland die Heuernte begann. Die Bauern warteten vielfach die regnerisch-kühle Schafskälte ab, um sicher zu sein, dass das Gras auf den Mähwiesen auch austrocknen konnte. Zudem sollten Gräser und Kräuter in voller Blüte stehen. „Vor Johanni bitt’ um Regen, nachher kommt er ungelegen“, lautet eine alte Bauernregel. Oder: „Nach dem Tag des Sankt Johann, der Landmann das Heu erst loben kann.“
Heute allerdings wird vielfach schon Ende Mai oder Anfang Juni das Gras für die Silage gemäht. Kurz angetrocknet, wird es zum Gären in die Silos gefahren. Der typische Heugeruch, der uns an die Heuernte unserer Kindheit erinnert, fehlt der Silage.
ALS ES IM KELLER NOCH EINE WASCHKÜCHE GAB UND WIR KINDER NOCH „DOKTERCHES“ SPIELTEN
In unserem Haus war ein großer Kellerraum, der am Waschtag mit Koks geheizt wurde. Mein Vater war Bergmann über Tage auf Grube Kohlwald. Im Herbst erhielt er von der Grube kostenlos Koks, der das ganze Jahr über reichte. Das Einschaufeln des Koks in den Kohlenkeller war jedes Mal eine Knochenarbeit für ihn. Im Keller war kein Licht, er wurde mit Karbidlampen erleuchtet, wenn montags Waschtag war. Im großen Kellerraum in der linken Ecke stand ein großer Waschkessel aus Kupfer, der im Krieg schon angerostet war. Neben dem Waschkessel stand ein kleiner Kupferkessel, in dem im September Latwerg (Laxem) gerührt wurde. Da gingen bei den Weibern die Mäuler wie geschmiert, da wurde getratscht, geratscht und geklatscht wie in der Spinn- und Strickstube im Winter. Wenn dann die Steinbacher Kirmes war, die „Quetschekerb“, wurden die Verwandten und Bekannten aus den Nachbarorten eingeladen. Als „Kerweessen“ (Kirmesessen) gab es Rindfleisch mit Meerrettich und braune „Hitlersuppe“. Meiner Mutter schmeckte diese Kartoffelsuppe, mit reichlich Maggi gewürzt – deswegen „braune Hitlersuppe“ – überhaupt nicht, es war aber meine Lieblingssuppe. Zwei bei uns im Frühjahr 1944 einquartierte Soldaten aus Friesland wussten nicht was „Grombiere“ (Grundbirnen) waren. Wir verstanden uns gegenseitig fast nicht, wenn jeder in seiner Mundart sprach. So mussten wir alle hochdeutsch sprechen.
An Heiligabend 1944 war mein Cousin Arthur im Alter von 18 Jahren in Stalingrad gefallen.