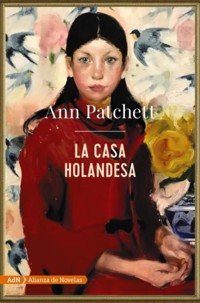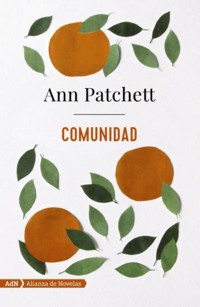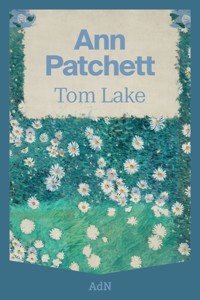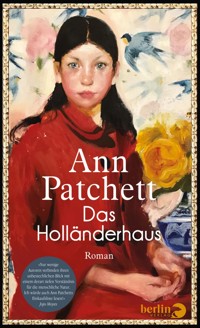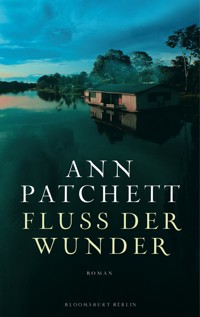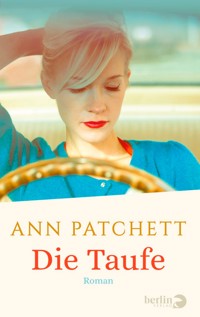6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von New-York-Times-Bestsellerautorin Ann Patchett - ein Roman über die Kraft der Liebe und der Musik Leise klirrende Champagnergläser, raschelnde Chiffonabendkleider – dann, am Ende der Arie, tosender Beifall, ein leidenschaftlicher Kuß – und plötzlich Schüsse, Schreie, Dunkelheit. Die elegante Villa des Vizepräsidenten gab den perfekten Rahmen für diese exklusive Geburtstagsfeier zu Ehren des japanischen Wirtschaftsmagnaten ab, bei der sogar die begnadete Operndiva Roxane Coss auftrat. Dann aber, als die Terroristen das prachtvolle Gebäude stürmen und die Geburtstagsgäste plötzlich Geiseln sind, hat alles ein jähes Ende. Oder ist es – für Täter wie für Opfer – ein Neuanfang? Monate später jedenfalls, als die Verhandlungen mit der Regierung immer noch andauern, hat sich die lebensbedrohliche Situation in eine beinahe paradiesische verwandelt: Und vierzig Menschen, die sich vorher nicht kannten, erleben täglich durch die Kraft der Musik die kostbarsten Augenblicke ihres Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Für Karl VanDevender
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Karen Lauer
ISBN 978-3-492-98300-6Oktober 2016© Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2016© 2001 Ann PatchettDie Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel Bel Cantobei HarperCollins Publishers, New YorkDeutschsprachige Ausgabe:© 2012 Bloomsbury Verlag GmbH, BerlinCopyright der deutschen Übersetzung von Karen Lauer© 2003, 2012 Piper Verlag GmbH, MünchenCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Samir Bafna, ShutterstockDatenkonvertierung: psb, BerlinAlle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Fonti e colline chiesi agli Dei;M’ udiro alfine, pago io vivrò,Né mai quel fonte co’ desir miei,Né mai quel monte trapasserò ...
Ich bat die Götter um Hügel und Quellen;Sie haben mich endlich erhört. Nun werd ich zufrieden leben,Und nie wird es mich verlangen, an dieser Quelle vorbeiOder über diesen Berg zu gehen ...
Vincenzo Bellini,Sei Ariette I: Malinconia, ninfa gentile
Sprecher:
Ihr Fremdlinge, was treibt euch an, in unsere Mauern zu dringen?
Tamino:
Freundschaft und Liebe.
Sprecher:
Bist du bereit, sie mit deinem Leben zu erkämpfen?
Tamino:
Ja!
Als das Licht ausging, gab ihr der Pianist einen Kuß. Vielleicht hat er sich ihr zugewandt, unmittelbar bevor es dunkel wurde, vielleicht hat er die Arme gehoben. Irgendeine Bewegung, irgendeine Geste muß er wohl gemacht haben, denn alle, die dort im Wohnzimmer waren, erinnerten sich später an einen Kuß. Nicht, daß sie ihn gesehen hätten, das war schlichtweg unmöglich. Die Dunkelheit, die über sie hereinbrach, war erschreckend total. Doch nicht nur waren sich alle sicher, daß er sie geküßt hatte, sie behaupteten auch noch, zu wissen, wie: stürmisch und voller Leidenschaft, ein Kuß, der sie völlig überrumpelt habe. Alle Augen waren auf sie gerichtet, als das Licht ausging. Sie applaudierten noch, waren aufgesprungen und klatschten mit erhobenen Ellbogen frenetisch in die Hände. Nicht ein einziger zeigte Zeichen der Ermüdung. Die Italiener und die Franzosen schrien: »Brava! Brava!«, und die Japaner wandten sich von ihnen ab. Hätte er sie wohl so geküßt, wenn es hell gewesen wäre? Beherrschte sie sein Denken so sehr, daß er die Hand ausstreckte, sobald das Licht ausging – schaltete er so schnell? Oder wurde sie von allen im Raum begehrt, jedem Mann und jeder Frau, so daß es sich um eine kollektive Einbildung handelte? Sie waren so hingerissen von der Schönheit ihrer Stimme, daß sie ihren Mund mit ihrem eigenen bedecken, daran trinken wollten. Vielleicht war Musik übertragbar, konnte verschlungen, besessen werden. Was bedeutete es wohl, den Mund zu küssen, der solche Töne in sich barg?
Manche von ihnen liebten sie schon seit langem. Sie hatten daheim jede Aufnahme von ihr. Sie führten ein Notizbuch, in dem sie jeden Ort eintrugen, an dem sie sie gesehen hatten, in welcher Oper, mit welcher Besetzung, unter welchem Dirigenten. Andere, die an dem Abend da waren, hatten ihren Namen nie gehört – Leute, die, wenn man sie gefragt hätte, gesagt hätten, die Oper sei für sie ein sinnloses Gejaule und lieber säßen sie drei Stunden auf dem Zahnarztstuhl. Das waren diejenigen, die jetzt unverhohlen weinten, die, die sich so furchtbar getäuscht hatten.
Keinem von ihnen machte die Dunkelheit angst. Ja sie nahmen sie kaum wahr. Sie hörten nicht auf zu applaudieren. Die Ausländer unter ihnen dachten, daß so etwas hier wohl normal sei. Das Licht geht mal an, und mal geht es aus. Diejenigen, die aus dem Gastland kamen, wußten, daß dem so war. Außerdem war der Zeitpunkt nicht ohne dramatische Wirkung und schien genau zu passen, so als wollten die Lampen sagen: Ihr braucht nichts zu sehen. Sperrt die Ohren auf. Niemand stutzte und fragte sich, warum im selben Moment oder direkt davor auch die Kerzen auf den Tischen erloschen. Der angenehme Geruch eben ausgeblasener Kerzen hing in der Luft, ein süß duftender, nicht im geringsten bedrohlicher Rauch. Ein Geruch, der einem sagte, daß es schon spät war, Zeit zum Schlafengehen.
Sie klatschten weiter. Sie nahmen an, daß sich die beiden weiter küßten.
Der lyrische Sopran Roxane Coss war der einzige Grund, warum Herr Hosokawa in dieses Land gekommen war. Und Herr Hosokawa war der Grund, warum alle anderen zu dieser Feier erschienen waren. Es war kein Land, das man um seiner selbst willen besucht. Der Grund, warum sich das Gastland (ein armes Land) für die Geburtstagsfeier eines Ausländers derart verausgabte, den man nahezu hatte bestechen müssen, damit er kam, war, daß es sich bei diesem Ausländer um den Gründer und Aufsichtsratsvorsitzenden von Nansei handelte, der größten Elektronikfirma Japans. Das Gastland wünschte sich nichts sehnlicher, als Herrn Hosokawas Gunst zu erlangen, auf daß er ihnen in einem der unzählichen Punkte half, in denen sie Hilfe brauchten. Das konnte durch Ausbildung von Fachkräften oder durch Handel geschehen. Vielleicht könnte man (und dies war ein so kühner Traum, daß er fast unaussprechlich war) hier sogar eine Fabrik bauen, wobei alle Beteiligten von der billigen Arbeitskraft profitieren würden. Eine solche Industrie könnte die Wirtschaft vom Koka- und Mohnanbau wegführen und die Illusion erzeugen, daß sich das Land von so verwerflichen Stoffen wie Kokain und Heroin distanzierte, was ihm mehr Unterstützung durch das Ausland einbringen und den heimlichen Handel mit ebendiesen Drogen erleichtern würde. Doch aus diesem Plan war bisher nichts geworden, denn die Japaner neigten von Natur aus zu übertriebener Vorsicht. Sie glaubten an die Gefahren und die Gerüchte über Gefahren, die ein solches Land barg. Wenn also Herr Hosokawa persönlich und nicht irgendein Manager, irgendein Politiker kam und sich mit ihnen an einen Tisch setzte, so zeigte dies, daß sich ihnen vielleicht eine Hand entgegenstrecken würde. Vielleicht mußte diese Hand durch Schmeicheln und Betteln hervorgelockt, aus ihrer eigenen tiefen Tasche herausgeholt werden. Doch dieser Besuch mit dem prunkvollen Geburtstagsessen einschließlich Opernstar, mit den für den nächsten Tag geplanten Treffen und Besichtigungen möglicher Fabrikbauplätze brachte sie diesem Ziel schon viel näher, als sie ihm je gekommen waren, und die Luft im Raum war geschwängert von süßen Hoffnungen. Repräsentanten von mehr als einem Dutzend Ländern, die über Herrn Hosokawas Absichten getäuscht worden waren, hatten sich zu der Feier eingefunden. Investoren und Botschafter, die ihren Regierungen vielleicht davon abraten würden, auch nur zehn Cent in dieses Land zu investieren, jede Anstrengung seitens Nansei jedoch unterstützen würden, standen jetzt in Smoking und Abendgarderobe im Raum, prosteten sich zu und lachten.
Was Herrn Hosokawa betraf, so war der Grund für diese Reise für ihn weder geschäftlicher noch diplomatischer Natur, noch eine etwaige Freundschaft mit dem Präsidenten, wie die Medien später behaupteten. Herr Hosokawa verreiste nicht gern, und den Präsidenten kannte er nicht einmal. Er ließ nicht den geringsten Zweifel an seinen Absichten, das heißt daran, daß er keine hatte. Er hatte nicht vor, in dem Land eine Zweigstelle zu bauen, und hätte sich nie bereit erklärt, in ein fremdes Land zu fahren, um dort mit Menschen, die er nicht kannte, seinen Geburtstag zu feiern. Ja er legte noch nicht einmal Wert darauf, seinen Geburtstag mit Menschen zu feiern, die er kannte, und schon gar nicht seinen dreiundfünfzigsten, eine Zahl, die er für völlig bedeutungslos hielt. Er hatte bereits ein halbes Dutzend nachdrückliche Einladungen von ebendiesen Menschen zu ebendieser Feier abgelehnt, bis man ihm als Geschenk die Anwesenheit von Roxane Coss versprach.
Und wer würde ein solches Geschenk ablehnen? Egal, wie weit der Weg war, wie unangemessen, wie irreführend die ganze Unternehmung, wer konnte dazu nein sagen?
An einem anderen Geburtstag, seinem elften, hatte Katsumi Hosokawa seine erste Oper gesehen, Verdis Rigoletto. Sein Vater hatte mit ihm den Zug nach Tokyo genommen, und bei strömendem Regen waren sie zu Fuß zur Konzerthalle gegangen. Es war der 22. Oktober, so daß es ein kalter Herbstregen war, und auf den Straßen lag eine papierdünne, wächserne Schicht aus nassen roten Blättern. Als sie bei der Konzerthalle ankamen, waren sie bis aufs Unterhemd durchgeweicht. Die Karten, die Katsumi Hosokawas Vater aus seiner Brieftasche zog, waren naß und verfärbt. Sie hatten keine besonders guten Plätze, aber freie Sicht auf die Bühne. Im Jahr 1954 war das Geld noch knapp; Bahnfahrkarten und Opernbesuche lagen jenseits des Vorstellbaren. Zu anderen Zeiten hätte man eine solche Aufführung wohl als zu anspruchsvoll für ein Kind angesehen, doch der Krieg war noch nicht lang vorbei, und man konnte davon ausgehen, daß die Kinder vieles verstehen würden, das heute als für Kinder ungeeignet erscheint. Sie stiegen die vielen Treppenstufen zu ihrer Reihe hinauf, ohne in den schwindelnden Abgrund unter ihnen hinunterzusehen. Sie verbeugten sich vor allen, die aufstanden, um sie vorbeizulassen, und baten jeden um Entschuldigung, dann klappten sie ihre Sitze herunter und setzten sich vorsichtig hin. Es war noch sehr früh, doch die anderen waren noch früher gekommen, denn das Recht, schweigend an diesem schönen Ort zu sitzen und zu warten, gehörte mit zu dem Luxus, für den man bezahlte. Sie warteten, Vater und Sohn, ohne ein Wort zu sagen, bis es schließlich dunkel wurde und von irgendwo unter ihnen ein erster Hauch von Musik heraufdrang. Winzige Menschen, Insekten gleich, schlüpften hinter dem Vorhang hervor, öffneten den Mund und überzogen mit ihren Stimmen die Wände mit dem goldenen Schmelz ihrer Sehnsucht, ihres Schmerzes, ihrer grenzenlosen, unbesonnenen Liebe, die jeden einzelnen von ihnen ins Verderben stürzen würde.
Es war bei jener Aufführung des Rigoletto, daß die Oper sich Katsumi Hosokawa unauslöschlich einprägte, eine Botschaft auf die hellrote Innenseite seiner Lider schrieb, die er sich vorlas, während er schlief. Viele Jahre darauf, als es nur noch die Firma gab, als er härter arbeitete als irgend jemand sonst in einem Land, dessen Wertesystem auf harter Arbeit gründet, glaubte er, daß das Leben, das wirkliche Leben, etwas war, das in der Musik verwahrt wurde. Während man in die Welt hinausging und seine Pflicht tat, lag das wirkliche Leben, sicher verwahrt, in der Musik von Tschaikowskijs Eugen Onegin. Er wußte natürlich (auch wenn er es nicht ganz verstand), daß Opern nicht jedermanns Sache waren, doch er hoffte, daß jeder so etwas wie die Oper hatte. Die Platten, die ihm so teuer waren, die wenigen Abende, an denen er eine Aufführung zu sehen bekam – das war die Richtschnur, an der er seine Liebesfähigkeit maß. Nicht seine Frau, seine Töchter oder seine Arbeit. Dabei hatte er nie das Gefühl, das, was seinen Alltag hätte ausfüllen sollen, in die Oper verlagert zu haben. Vielmehr wußte er, daß dieser Teil von ihm ohne die Oper nicht überlebt hätte. Es war zu Beginn des zweiten Aktes, als Rigoletto und Gilda ihr Duett sangen, ihre Stimmen sich verflochten und in die Höhe schwangen, daß er nach seines Vaters Hand griff. Er hatte keine Ahnung, was sie einander sagten, er wußte nicht einmal, daß sie der Rolle nach Vater und Tochter waren, er wußte nur, daß er sich irgendwo festhalten mußte. Er fühlte sich so sehr zu ihnen hingezogen, daß er spürte, wie er nach vorn fiel, aus seinem Sitz heraus, der so hoch oben und so weit weg lag.
Solche Liebe bringt Treue hervor, und Herr Hosokawa war ein treuer Mann. Er vergaß nie, welche Rolle Verdi in seinem Leben gespielt hatte. Wie jedermann entwickelte er bald eine Vorliebe für bestimmte Sängerinnen und Sänger. Er sammelte Platten von Schwarzkopf und Sutherland. Vor allem glaubte er an das Genie der Callas. Sein Tagesablauf ließ ihm nicht sehr viel Zeit, nicht die Zeit, die ein solches Interesse verdient hätte. Wenn er vom Abendessen mit irgendwelchen Kunden heimgekehrt war und die letzten Schreibarbeiten erledigt hatte, hörte er gewöhnlich eine halbe Stunde lang Musik und las Librettos, bis er einschlief. Äußerst selten, vielleicht an fünf Sonntagen im Jahr, kam es vor, daß er drei Stunden hintereinander Zeit hatte, um sich eine ganze Oper anzuhören. Einmal, als er Ende Vierzig war, aß er eine verdorbene Auster und zog sich eine schwere Lebensmittelvergiftung zu, die ihn für drei Tage ans Haus fesselte. In seiner Erinnerung war diese Zeit so schön wie der schönste Urlaub, denn auf seiner Stereoanlage lief ununterbrochen Händels Alcina, sogar während er schlief.
Es war seine älteste Tochter Kiyomi, von der er seine erste Aufnahme von Roxane Coss zum Geburtstag bekam. Ein Geschenk für ihren Vater zu finden war fast unmöglich, und als sie die CD sah, mit einem Namen, den sie nicht kannte, wagte sie den Versuch. Doch was sie daran anzog, war nicht der unbekannte Name, es war das Gesicht der Frau. Kiyomi fand die Fotos von Sopranistinnen meist irritierend. Ihr Blick ging stets über die Köpfe von Fans hinweg oder schien durch weiche Schleier gedämpft zu sein. Doch Roxane Coss sah dem Betrachter direkt ins Gesicht, selbst ihr Kinn war ganz gerade, und ihre Augen waren weit geöffnet. Kiyomi griff nach der CD, noch bevor sie sah, daß es Lucia di Lammermoor war. Wie viele Aufnahmen von dieser Oper besaß ihr Vater wohl? Es war egal. Sie gab dem Mädchen an der Kasse das Geld.
An dem Abend, an dem Herr Hosokawa die CD auflegte und in seinem Sessel Platz nahm, um sie sich anzuhören, blieb er lange dort sitzen. Es war, als wäre er wieder der Junge hoch oben in den Rängen in Tokyo, dessen Hand in der großen, warmen Hand seines Vaters lag. Er spielte die CD immer wieder, wobei er ungeduldig alles übersprang, was nicht ihre Stimme war. Wie erhaben diese Stimme war, wie warm und komplex und wie furchtlos. Wie konnte sie so kontrolliert und doch so verwegen sein? Er rief nach Kiyomi, und sie kam und blieb auf der Schwelle stehen. Sie wollte etwas sagen – Ja? oder: Was ist? –, doch bevor sie ein Wort herausbrachte, hörte sie diese Stimme, die Frau mit dem geraden Blick auf dem Foto. Ihr Vater brauchte gar nichts zu sagen, er zeigte nur mit der offenen Hand auf einen Lautsprecher. Es freute sie ungemein, so sehr das Richtige getroffen zu haben. Die Stimme sang ihr Lob. Herr Hosokawa schloß die Augen. Er träumte vor sich hin.
Seitdem waren fünf Jahre vergangen, in denen er achtzehn Aufführungen mit Roxane Coss gesehen hatte. Beim ersten Mal war es ein glücklicher Zufall, die anderen Male fuhr er dorthin, wo sie sein würde, erfand Geschäfte, die ihn in jene Stadt führten. La Somnambula sah er an drei Tagen hintereinander. Er war nie zu ihr gegangen, hatte nichts getan, was ihn über die anderen Zuschauer erhob. Er glaubte nicht, daß er ihre Begabung mehr schätzte als irgend jemand anderes. Eher war er geneigt, anzunehmen, nur ein Narr würde für sie nicht das gleiche empfinden wie er. Was hätte man mehr verlangen können, als dasitzen zu dürfen und ihr zuzuhören.
Man brauchte nur ein Profil Katsumi Hosokawas in irgendeinem Wirtschaftsmagazin zu lesen. Er benutzte zwar niemals leidenschaftliche Worte, denn Leidenschaft war etwas rein Privates, aber die Oper war immer da, als die menschliche Seite, die ihn den Leuten näherbrachte. Andere Firmenchefs wurden beim Angeln in schottischen Flüssen gezeigt oder beim Anflug auf Helsinki mit dem eigenen Lear Jet. Herr Hosokawa wurde bei sich zu Hause in dem Ledersessel fotografiert, in dem er Musik hörte, eine EX-12-Stereoanlage von Nansei im Rücken. Irgendwann kam dann immer die Frage nach seinen Lieblingssängern. Und es kam immer dieselbe Antwort.
Für eine Summe, die erheblich höher war als die, die der Rest des Abends gekostet hatte (das Essen, die Bedienung, die Flugtickets, die Blumen, das Sicherheitspersonal), ließ Roxane Coss sich überreden, zu der Feier zu kommen, da diese gerade zwischen die Spielzeit an der Scala und ihren ersten Auftritt im Teatro Colón in Argentinien fiel. An dem Abendessen würde sie nicht teilnehmen (sie aß nie etwas, bevor sie sang), doch sie würde gleich danach eintreffen und mit ihrem Pianisten sechs Arien vortragen. Herrn Hosokawa wurde in einem Brief mitgeteilt, wenn er die Einladung annähme, könne er einen Wunsch äußern – sie könnten ihm zwar nichts versprechen, würden seine Bitte jedoch an Miss Coss weiterleiten. Es war die von Herrn Hosokawa gewählte Arie aus Rusalka, die sie gerade gesungen hatte, als das Licht ausging. Es hätte der letzte Programmpunkt sein sollen – doch wer weiß, ob sie, wäre es hell geblieben, nicht noch ein oder zwei Zugaben gesungen hätte?
Herr Hosokawa hatte Rusalka als ein Zeichen seiner Hochachtung für Miss Coss gewählt. Die Arie war das Herzstück ihres Repertoires, und sie brauchte sie nicht extra einzustudieren – sie hätte sie wahrscheinlich ohnehin in das Programm aufgenommen. Er suchte nicht etwas besonders Entlegenes heraus, wie etwa eine Arie aus Partenope, um sich als Kenner auszuweisen. Er wollte sie einfach Rusalka singen hören, während er im selben Raum stand, nicht weit von ihr entfernt. Wenn er im Traume mich wirklich sieht, wach er auf und gedenke mein. Sein Dolmetscher hatte es ihm schon vor Jahren aus dem Tschechischen übersetzt.
Die Lampen gingen nicht wieder an. Der Applaus begann ein klein wenig nachzulassen. Die Leute blinzelten in dem Versuch, die Sängerin im Dunkeln zu erkennen. Eine Minute verstrich und noch eine, und die Gäste blieben nach wie vor angenehm unbesorgt. Dann sah Simon Thibault, der französische Botschafter, dem man, bevor er in dieses Land gekommen war, den sehr viel attraktiveren Posten in Spanien versprochen hatte (den dann, während Thibault und seine Familie schon packten, unfairerweise ein anderer bekommen hatte, als Gegenleistung für einen verwickelten politischen Freundschaftsdienst), unter der Küchentür Licht. Er war der erste, der begriff. Ihm war, als wäre er aus tiefem Schlaf geschreckt, noch ganz benommen von Alkohol, Schweinefleisch und Dvo¡rák. Er griff nach der Hand seiner Frau, griff im Dunkeln nach oben, denn sie klatschte noch, und zog sie hinein in die Menge von dunklen Körpern, in die er sich hineindrängte, ohne sie zu sehen. Er strebte in Richtung der Glastüren, die sich seiner Erinnerung nach auf der anderen Seite des Raumes befanden, und reckte den Hals, ob dort nicht ein Stern funkelte und ihm den Weg wies. Doch was er sah, war der schmale Lichtstrahl einer Taschenlampe, erst einer und dann ein zweiter, und er spürte, wie sein Herz nach unten sank, ein Gefühl, das sich nur als Traurigkeit bezeichnen ließ.
»Simon?« flüsterte seine Frau.
Das Netz war schon gespannt, ohne daß er es sah, war schon geknüpft und um das Haus zusammengezogen, und während sein erster Impuls, die natürliche Reaktion, darin bestand, sich dennoch weiter voranzuschieben und zu versuchen, es trotzdem zu schaffen, hielt die Vernunft ihn zurück. Lieber nicht auffallen. Lieber nicht zum Exempel werden. Irgendwo dort vorn küßte der Pianist die Sängerin, und so schloß der Botschafter Thibault seine Frau in die Arme.
»Ich würde auch im Dunkeln singen«, rief Roxane Coss, »wenn mir jemand eine Kerze bringt.«
Bei diesen Worten stockten sie – als sie merkten, daß auch die Kerzen erloschen waren, erstarb der letzte Applaus. Der Abend war an sein Ende gelangt. Die Leibwächter in den Limousinen waren eingenickt, wie große, überfütterte Hunde. Überall im Raum griffen Männer in ihre Taschen und fanden darin nur frischgebügelte Taschentücher und ein paar Geldscheine. Stimmen wurden laut, es entstand Bewegung, und dann ging das Licht wie durch Zauberhand wieder an.
Es war eine schöne Feier gewesen, auch wenn sich später niemand daran erinnerte. Weißer Spargel mit Sauce hollandaise, Steinbutt mit knusprigen milden Zwiebeln, winzige Koteletts, nur drei oder vier Bissen groß, mit Preiselbeersoße. Normalerweise tischten wirtschaftlich schwache Länder den Chefs von großen ausländischen Firmen, die sie beeindrucken wollten, russischen Kaviar und französischen Champagner auf. Russisch und französisch, russisch und französisch, als könne man nur auf diese Weise Reichtum demonstrieren. Orchideenzweige mit gelben Blüten, die nicht größer waren als ein Daumennagel, alle aus heimischer Zucht, zitterten und tanzten auf jedem Tisch wie Mobiles, die sich bei jedem Hauch neu anordneten. All die Mühe, die auf die Vorbereitungen verwendet worden war, auf die Plazierung jedes einzelnen Stengels, auf die schwungvolle Kalligraphie der Tischkarten, war nicht einen Moment lang gewürdigt worden. Aus dem Nationalmuseum hatte man Bilder entliehen: Über dem Kaminsims hing eine dunkeläugige Madonna, die dem Betrachter auf den Fingerspitzen einen winzigen Christus mit einem merkwürdig erwachsenen, wissenden Gesicht präsentierte. Der Garten, den die Gäste doch nur sekundenlang sehen würden, wenn sie die paar Schritte von ihrem Wagen zur Haustür gingen oder vor Einbruch der Dunkelheit zufällig einmal aus dem Fenster sahen, machte mit seinen Paradiesvögeln und den eng gewickelten Cannas, den Wollziest-Beeten und dem smaragdgrünen Farn einen gepflegten, wohlgeordneten Eindruck. Der Dschungel war nicht fern, und selbst in dem kultiviertesten Garten versuchten die Blumen, die langweilige Fläche aus gestutztem Bermudagras in Besitz zu nehmen. Seit dem frühen Morgen hatten junge Männer darin gearbeitet, mit feuchten Tüchern den Staub von den ledrigen Blättern gewischt und die herabgefallenen Blüten der Bougainvilleen, die unter den Hecken verfaulten, aufgesammelt. Drei Tage zuvor hatten sie die hohe, verputzte Mauer, die das Haus des Vizepräsidenten umgab, frisch geweißt, wobei sie achtgaben, daß der Rasen keine Farbspritzer abbekam. Alles war sorgfältig ausgewählt: Salzfäßchen aus Kristallglas, Zitronenmousse, amerikanischer Bourbon. Es gab keine Tanzfläche und keine Band. Musik würden sie nur nach dem Essen hören: Roxane Coss und ihren Pianisten, ein Schwede oder Norweger, der Mitte Dreißig war, mit feinem, strohblondem Haar und schönen, schlanken Fingern.
Zwei Stunden vor Beginn von Herrn Hosokawas Geburtstagsfeier hatte Präsident Masuda, der als Kind japanischer Eltern in diesem Land geboren worden war, in ein paar Zeilen erklärt, er könne wegen einer wichtigen Angelegenheit, die außerhalb seiner Macht stünde, leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
Nachdem sich der Abend zum Schlechten gewandt hatte, wurde über die Gründe dieser Entscheidung viel spekuliert. War das ganz einfach Glück? War es Gottes Wille? Oder
ein Hinweis, eine Verschwörung, ein Komplott? Bedauerlicherweise war es nichts so Zufälliges. Die Feier sollte um acht Uhr beginnen und hätte bis nach Mitternacht dauern sollen. Die Lieblingsserie des Präsidenten begann um neun. Unter seinen Kabinettsmitgliedern und Beratern war es ein offenes Geheimnis, daß die Staatsangelegenheiten von Montag bis Freitag eine Stunde lang ruhen mußten, von zwei bis drei Uhr nachmittags und am Dienstagabend von neun bis zehn. Herrn Hosokawas Geburtstag fiel in diesem Jahr auf einen Dienstag. Daran war nichts zu ändern. Und niemand hatte eine Idee, wie man eine solche Feier auf zehn Uhr abends verlegen oder um halb neun beenden könnte, damit der Präsident noch rechtzeitig nach Hause kam. Man schlug ihm vor, die Sendung aufzunehmen, doch das haßte er. Das mußte er schon oft genug ertragen – immer, wenn er außer Landes war. Alles, was er verlangte, war, daß bestimmte Zeiten in der Woche freigehalten wurden. Über das Problem von Herrn Hosokawas so ungünstig gelegenem Geburtstag wurde tagelang diskutiert. Nach zähen Verhandlungen gab der Präsident schließlich nach und versprach, an der Feier teilzunehmen. Doch wenige Stunden davor änderte er aus offensichtlichen, wenn auch nicht genannten Gründen – diesmal unwiderruflich – seinen Entschluß.
Während Präsident Masudas Leidenschaft für seine Seifenoper unter seinen politischen Vertrauten kein Geheimnis war, schaffte man es irgendwie, diese Leidenschaft vor der Presse und dem Volk geheimzuhalten. Obwohl das ganze Land verrückt nach Seifenopern war, empfand das Kabinett die unerschütterliche Treue des Präsidenten zu seinem Fernseher als eine solche Peinlichkeit, daß es sie liebend gern gegen eine indiskrete Geliebte eingetauscht hätte. Selbst Regierungsmitglieder, von denen man wußte, daß auch sie bestimmte Serien verfolgten, konnten einfach nicht mitansehen, welch unerbittliche Form die Obsession bei ihrem Staatsoberhaupt annahm. So registrierten viele Besucher der Feier, die mit dem Präsidenten zusammenarbeiteten, seine Abwesenheit zwar enttäuscht, jedoch ohne großes Erstaunen. Die übrigen Gäste erkundigten sich: Ist etwas Schlimmes passiert? Ist Präsident Masuda krank?
»Probleme in Israel«, erklärte man ihnen im Vertrauen. »Israel«, flüsterten sie. Sie waren beeindruckt, hätten sie doch nie gedacht, daß man sich bei Problemen in Israel an Präsident Masuda wenden würde.
Die fast zweihundert Gäste der Feier gliederten sich in zwei klar getrennte Fraktionen: diejenigen, die wußten, wo sich der Präsident befand, und die, die keine Ahnung hatten – und so blieb es auch, bis beide Seiten ihn völlig vergaßen. Herr Hosokawa nahm von seiner Abwesenheit kaum Notiz. Er legte nicht viel Wert darauf, ihn kennenzulernen. Was für eine Rolle spielte ein Präsident schon an einem Abend, an dem man Roxane Coss gegenüberstehen würde?
Vizepräsident Ruben Iglesias trat in die entstandene Lücke und übernahm die Rolle des Gastgebers. Das lag nahe, denn die Feier fand in seinem Hause statt. Während des Aperitifs und der Horsd’œuvres, während sie beim Essen saßen und während des schmelzenden Gesangs, dachte er die ganze Zeit an den Präsidenten. Er konnte sich unschwer vorstellen – er hatte es schon hundertmal gesehen –, wie sein Nebenbuhler in seiner Suite im Präsidentenpalast im Dunkeln auf dem Bettrand saß: Sein Jackett lag zusammengefaltet über einem Stuhl, seine Hände steckten gefaltet zwischen seinen Knien. Er würde auf einen kleinen Fernseher auf der Kommode starren, während seine Frau sich die Serie auf dem großen Bildschirm unten im Arbeitszimmer ansah. In seiner Brille spiegelte sich ein hübsches Mädchen, das an einen Stuhl gefesselt war. Sie drehte die Handgelenke hin und her, wieder und immer wieder, bis das Seil plötzlich nachgab und sie die eine Hand herauszog. Maria war frei! Präsident Masuda ließ sich auf dem Bett nach hinten fallen und klatschte lautlos in die Hände. Und das hätte er fast verpaßt, nach wochenlangem Warten! Das Mädchen sah sich schnell in dem Lagerraum um, lehnte sich vor und löste das grobe Seil, mit dem seine Füße gefesselt waren.
Dann war Marias Bild plötzlich verschwunden, und Ruben Iglesias hob den Kopf zu den Lampen, die auf einmal wieder sein Wohnzimmer erleuchteten. Er hatte gerade festgestellt, daß auf einem Beistelltisch eine Glühbirne durchgebrannt war, als durch jedes Fenster und aus jeder Wand Männer in den Raum hineinplatzten. Überall, wo der Vizepräsident hinsah, schienen sich die Begrenzungen des Raumes schreiend nach vorn zu bewegen. Schwere Stiefel und Gewehrkolben durchstießen Lüftungsgitter, stürmten durch Türen herein. Menschen wurden zusammengedrängt und stoben in tierischer Angst gleich wieder auseinander. Das Haus schien emporgehoben zu werden wie ein Boot von dem weiten Arm einer Welle und auf die Seite zu kippen. Tafelsilber flog durch die Luft, in Gabelzinken verkantete Messerklingen, Vasen zerbarsten an Wänden. Menschen rutschten aus, fielen hin, rannten, aber nur für einen Moment, nur bis sie sich wieder an das Licht gewöhnt hatten und sahen, daß es keinen Sinn hatte zu kämpfen.
Es war leicht zu erkennen, wer die Anführer waren: die älteren Männer, diejenigen, die die Kommandos brüllten. Sie stellten sich in dem Moment noch nicht vor, und so identifizierte man sie innerlich nicht mit ihren Namen, sondern mit ihren auffälligsten äußeren Merkmalen. Benjamin: schwere Gürtelrose im Gesicht. Alfredo: Schnurrbart, linke Hand ohne Daumen und Zeigefinger. Hector: goldene Nickelbrille mit nur einem Bügel. Zu den Generälen gehörten fünfzehn Soldaten, die zwanzig bis vierzehn Jahre jung waren. Die Zahl der Anwesenden hatte sich also um achtzehn vermehrt. Doch keiner der Gäste konnte sie zu dem Zeitpunkt zählen. Sie bewegten sich und verteilten sich. Sie verdoppelten und verdreifachten sich, während sie durch den Raum schwirrten, hinter Vorhängen hervorkamen, die Treppe herunterliefen, in der Küche verschwanden. Es war unmöglich, sie zu zählen, weil sie überall zu sein schienen, weil sie alle gleich aussahen – es war, als wolle man die Bienen in einem Bienenschwarm zählen, der einem um den Kopf schwirrte. Sie trugen ausgeblichene Kleidung in dunklen Farben, die meisten in dem trüben Grün seichter, sumpfiger Weiher, einige in Jeansblau oder Schwarz. Darüber trugen sie wie eine zweite Schicht ihre Waffen: Patronengurte, protzige Messer in Gesäßtaschen, alle Arten von Schußwaffen, kleinere, an den Oberschenkel gebunden oder optimistisch aus Gürteln herausragend, größere, die sie wie Babys im Arm hielten oder wie Stöcke schwangen. Sie trugen Mützen mit in die Stirn gezogenen Schirmen, doch die Gäste interessierten sich nicht für ihre Augen, nur für ihre Gewehre, ihre gezähnten Messer. Ein Mann mit drei Schußwaffen wurde unbewußt als drei Männer registriert. Und auch in anderer Hinsicht sahen sich die Männer ähnlich: Sie waren alle dünn, entweder unterernährt oder noch dabei zu wachsen, und ihre Schultern und Knie ragten spitz unter der Kleidung hervor. Außerdem waren sie schmutzig, so schmutzig, daß es auffiel. Selbst in der Verwirrung des Augenblicks konnte jeder sehen, daß sie mit Schlamm bespritzt waren, daß ihre Hände, Arme und Gesichter voller Erde waren, als hätten sie sich, um zu dem Geburtstag zu kommen, unter dem Garten hindurchgegraben und eine Platte im Boden aufgestemmt.
Das Ganze konnte höchstens eine Minute gedauert haben und kam den Gästen doch länger vor als alle vier Gänge des Essens zusammen. Jeder von ihnen hatte Zeit, sich eine Strategie zu überlegen, sie völlig umzuändern und dann zu verwerfen. Ehemänner fanden ihre Frauen, die ans andere Ende des Raumes gedrängt worden waren, Landsleute suchten einander und standen, hastig miteinander redend, beisammen. Alle auf der Feier waren sich einig, daß sie nicht von La Familia de Martin Suarez entführt worden waren (so benannt nach einem zehnjährigen Jungen, der beim Verteilen von Flugblättern für eine politische Kundgebung von Regierungstruppen erschossen worden war), sondern von der sehr viel berühmteren Terroristengruppe La Dirección Auténtica, einer revolutionären Vereinigung von Mördern, die sich in den vergangenen fünf Jahren durch alle möglichen Grausamkeiten einen Namen gemacht hatte. Es war die unausgesprochene Überzeugung eines jeden, der diese Organisation und das Gastland kannte, daß sie alle so gut wie tot waren, während es doch in Wirklichkeit die Terroristen waren, die das Ganze nicht überleben würden. Dann hob der Terrorist mit den zwei fehlenden Fingern, der eine zerknautschte grüne Hose trug und eine nicht dazu passende Jacke, sein Maschinengewehr und feuerte zwei Runden in die Decke. Der herabfallende Putz ließ einen Teil der Gäste weiß bestäubt zur Seite springen, und einige der Frauen schrien, entweder wegen der Schüsse oder weil auf einmal etwas ihre nackten Schultern traf.
»Achtung«, sagte der Mann mit dem Gewehr auf spanisch. »Das ist eine Gefangennahme. Wir verlangen Ihre hundertprozentige Kooperation und Aufmerksamkeit.«
Etwa zwei Drittel der Gäste sahen verängstigt drein, doch ein über den Raum verteiltes Drittel wirkte nicht nur verängstigt, sondern auch verwirrt. Es waren diejenigen, die sich zu dem Mann mit dem Gewehr hinbeugten anstatt weg von ihm. Es waren die, die kein Spanisch sprachen. Sie flüsterten ihren Nachbarn schnell etwas zu. Das Wort atención wurde in mehreren Sprachen wiederholt. Es war deutlich genug.
General Alfredo hatte erwartet, daß auf seine Erklärung eine Art gespanntes, erwartungsvolles Schweigen folgen würde, doch es wurde keineswegs still im Raum. Das Gemurmel ließ ihn noch einmal in die Decke schießen, dieses Mal ohne hinzusehen, so daß er eine Lampe traf, die in tausend Stücke zersprang. Es wurde dunkler im Raum, und Glassplitter fielen in Hemdkrägen und blieben auf Haaren liegen. »Arresto«, wiederholte er. »Detengase!«
Es mag vielleicht zunächst erstaunen, daß so viele von den Gästen die Landessprache nicht beherrschten, doch die Veranstaltung diente schließlich dem Zweck, um das Interesse des Auslands zu werben, und die beiden Ehrengäste hätten keine zehn Wörter Spanisch zusammengebracht – wobei Roxane Coss sich unter arresto noch etwas vorstellen konnte, Herr Hosokawa dagegen nicht das geringste. Sie beugten sich vor, als könnten sie ihn dann besser verstehen. Miss Coss konnte sich nicht sehr weit vorlehnen, da der Pianist sie wie ein Schutzschirm umschloß, bereit, ja geradezu begierig darauf, mit seinem Körper jede Kugel abzufangen, die sich in ihre Richtung verirrte.
Gen Watanabe, der junge Mann, der Herrn Hosokawa als sein Dolmetscher begleitete, lehnte sich zu seinem Chef hinüber und wiederholte die Worte auf japanisch.
Nicht daß es ihm in der momentanen Situation viel geholfen hätte, aber Herr Hosokawa hatte einmal versucht, Italienisch zu lernen – von der Kassette, im Flugzeug. Von seiner Arbeit her hätte er zwar eher Englisch lernen sollen, doch er wollte sich die Oper auch von dieser Seite näherbringen. »Il bigliettaio mi fece il biglietto«, sagte das Band. »Il bigliettaio mi fece il biglietto«, bildete er mit den Lippen lautlos nach, um die anderen Passagiere nicht zu stören. Doch seine Anstrengungen blieben auf ein Minimum beschränkt, und so machte er keinerlei Fortschritte. Der Klang der gesprochenen Sprache weckte in ihm die Sehnsucht nach der gesungenen, und nach kurzer Zeit legte er statt dessen Madama Butterfly auf.
Als junger Mann war sich Herr Hosokawa darüber im klaren, wie hilfreich Fremdsprachen waren. Als er älter wurde, wünschte er, er hätte sich die Mühe gemacht, sie zu lernen. Diese Dolmetscher! Sie wechselten unentwegt, waren mal gut, mal steif wie Schuljungen, mal hoffnungslos dumm. Manche beherrschten kaum ihre Muttersprache und brachten die Unterhaltung ständig ins Stocken, indem sie im Wörterbuch nachschlugen. Andere erfüllten zwar ihre Aufgabe, gehörten jedoch nicht zu den Menschen, die man gern mit auf Reisen nahm. Manche ließen ihn stehen, sobald das letzte Wort einer Sitzung gesprochen war, so daß er hilflos und stumm zurückblieb, wenn weitere Verhandlungen nötig wurden. Andere klebten geradezu an ihm, ließen ihn bei keiner Mahlzeit allein, wollten mit ihm spazierengehen und ihm haarklein ihre ganze freudlose Kindheit erzählen. Was hatte er nicht alles durchgemacht nur für ein paar Brocken Französisch, ein paar klare Sätze auf englisch. Was hatte er nicht alles durchgemacht, bevor er Gen traf.
Gen Watanabe war ihm bei einer Tagung zum Thema weltweiter Warenvertrieb in Griechenland zugewiesen worden. Normalerweise versuchte Herr Hosokawa, sich böse Überraschungen durch örtliche Dolmetscher zu ersparen, doch seine Sekretärin hatte keinen Griechisch-Dolmetscher gefunden, der ihn kurzfristig hätte begleiten können. Auf dem Flug nach Athen redete Herr Hosokawa kein Wort mit den beiden stellvertretenden Geschäftsführern und den drei Verkaufsleitern, die mit ihm zu der Tagung fuhren. Statt dessen setzte er seinen Nansei-Kopfhörer auf, hörte sich eine CD von Maria Callas mit griechischen Liedern an und dachte sich voller Gleichmut, daß er, falls er bei den Sitzungen nichts verstand, doch wenigstens das Land würde gesehen haben, das sie als ihre Heimat betrachtete. Nachdem er am Schalter angestanden, einen Stempel in seinen Paß bekommen und sein Gepäck hatte durchstöbern lassen, sah Herr Hosokawa einen jungen Mann, der ein Schild hochhielt, auf dem in säuberlicher Schrift »Hosokawa« stand. Es war ein Japaner, was ihn sehr erleichterte. Mit einem Landsmann, der ein bißchen Griechisch sprach, kam man leichter zurecht als mit einem Griechen, der ein bißchen Japanisch sprach. Für einen Japaner war dieser Dolmetscher ziemlich groß. Sein Haar war dicht und vorn so lang, daß es über den Rand seiner kleinen runden Brille fiel, seinen Versuchen, es auf einer Seite zu halten, zum Trotz. Er wirkte sehr jung. Es war die Frisur. Seine Frisur wies für Herrn Hosokawa auf einen Mangel an Ernst hin, oder vielleicht war es auch nur die Tatsache, daß der junge Mann in Athen war und nicht in Tokyo, die ihn weniger ernst wirken ließ. Herr Hosokawa ging auf ihn zu und blieb mit der Andeutung einer Verbeugung stehen, die sich auf den Hals und den oberen Schulterbereich beschränkte, eine Geste, die so viel bedeutete wie: Sie haben mich gefunden.
Der junge Mann griff nach Herrn Hosokawas Aktenkoffer, wobei er sich bis zur Taille verbeugte. Ebenso ernst, wenn auch nicht ganz so tief, verbeugte er sich vor den beiden stellvertretenden Geschäftsführern und den drei Verkaufsleitern. Er stellte sich ihnen als ihr Dolmetscher vor, fragte sie, ob sie einen angenehmen Flug gehabt hätten, nannte ihnen die ungefähre Fahrzeit zum Hotel und die Uhrzeit, um die die erste Sitzung beginnen würde. In dem Gedränge auf dem Flughafen von Athen, wo jeder zweite Mann voller Stolz einen Schnurrbart und eine Uzi zu tragen schien, zwischen all dem Gepäck und bei dem Geschrei und dem Dröhnen der Lautsprecheransagen, entdeckte Herr Hosokawa in der Stimme dieses jungen Mannes etwas, das ihm vertraut und tröstlich vorkam. Diese Stimme hatte nichts Melodisches, und doch berührte sie ihn wie Musik. Sagen Sie doch noch etwas.
»Woher kommen Sie?« fragte Herr Hosokawa.
»Aus Nagano.«
»Eine schöne Stadt, und die Olympiade –«
Gen nickte, ohne sich zur Olympiade zu äußern.
Verzweifelt suchte Herr Hosokawa nach einem anderen Gesprächsthema. Es war ein langer Flug gewesen, und es schien, als hätte er in dieser Zeit vergessen, wie man Konversation macht. Dabei fand er, daß es eigentlich Gens Sache sei, ihn auszufragen. »Und Ihre Familie, lebt sie noch dort?«
Gen Watanabe hielt einen Moment lang inne, als versuche er sich zu erinnern. Ein Schwarm von australischen Teenagern mit Rucksäcken auf dem Rücken ging an ihnen vorbei. Die ganze Ankunftshalle war von ihrem Geschrei und ihrem Gelächter erfüllt. »Wombat!« rief eines der Mädchen, und die anderen antworteten im Chor: »Wombat! Wombat! Wombat!« Sie stolperten vor lauter Lachen und hielten sich aneinander fest. »Ja, sie leben alle noch dort«, sagte Gen, der den Teenagern mißtrauisch nachsah. »Mein Vater, meine Mutter und meine zwei Schwestern.«
»Und sind Ihre Schwestern verheiratet?« Die Schwestern interessierten Herrn Hosokawa nicht im geringsten, doch diese Stimme war etwas, das er fast wiedererkannte, wie die Anfangstakte des ersten Aktes von – ja, von was?
Gen sah ihm direkt ins Gesicht. »Ja, sie sind verheiratet.«
Auf einmal bekam diese stumpfsinnige Frage die Peinlichkeit eines Fauxpas. Herr Hosokawa sah weg, während Gen seinen Koffer nahm und die ganze Gruppe durch die gläserne Schiebetür hinausführte in die griechische Mittagsglut. Draußen wartete eine Limousine auf sie, träge und kühl, und die Männer stiegen ein.
In den nächsten zwei Tagen ging alles, was Gen in die Hand nahm, völlig problemlos vonstatten. Er tippte Herrn Hosokawas handgeschriebene Notizen ab, kümmerte sich um den Terminplan, besorgte Karten für eine Aufführung von Orfeo ed Euridice, die eigentlich schon seit sechs Wochen ausverkauft war. Bei der Konferenz sprach er für Herrn Hosokawa und seine Begleiter griechisch und mit ihnen japanisch und erwies sich in allem als intelligent, schnell und professionell. Doch es war nicht etwa seine Präsenz, die Herrn Hosokawa für ihn einnahm, es war eher, daß er gar nicht da zu sein schien. Gen war eine Art Verlängerung seiner selbst, ein unsichtbares Ich, das alle seine Bedürfnisse voraussah. Er hatte das Gefühl, Gen würde stets an alles denken, was man vergessen hatte. Eines Nachmittags, als Gen bei einem privaten Gespräch über Reedereien gerade seine Worte ins Griechische übersetzte, erkannte Herr Hosokawa schließlich die Stimme. Sie klingt so vertraut, hatte er gedacht. Es war seine eigene.
»Ich bin nur selten geschäftlich in Griechenland«, sagte Herr Hosokawa an jenem Abend zu Gen, als sie in der Bar des Hilton etwas tranken. Die Bar lag im obersten Stock des Hotels, mit Blick auf die Akropolis, und es schien, als wäre die Akropolis, die dort in der Ferne klein und kreideweiß aufragte, nur zu diesem Zweck errichtet worden: als visueller Leckerbissen für die Hotelgäste. »Was können Sie eigentlich sonst noch für Sprachen?« Herr Hosokawa hatte ihn am Telefon englisch sprechen hören.
Gen fertigte eine Liste an, die er von Zeit zu Zeit durchging, um zu sehen, was darauf noch fehlte. Er teilte die Sprachen danach ein, ob er sie mehr als fließend, fließend oder einigermaßen gut sprach oder nur lesen konnte. Die Liste der Sprachen, die er beherrschte, war länger als die Liste der ausgefallenen Cocktails auf der Karte in dem Plexiglasständer auf ihrem Tisch. Sie bestellten beide einen Drink, der Aeropagus hieß, und stießen an.
Spanisch sprach er mehr als fließend.
Am anderen Ende der Welt, in einem noch viel fremderen Land, dachte Herr Hosokawa jetzt an den Athener Flughafen, an all die Männer mit Schnurrbart und Uzi, die dem Mann mit dem Maschinengewehr in der Hand so ähnlich sahen. Das war der Tag, an dem er Gen begegnet war. War es vier Jahre her oder fünf? Danach war Gen mit ihm nach Tokyo zurückgekehrt, um ganz für ihn zu arbeiten. Wenn es nichts zu übersetzen gab, schien Gen sich einfach um alles zu kümmern, bevor irgend jemand merkte, daß es nötig war. Inzwischen war Gen ein fester Bestandteil seines Denkens, ja er vergaß zuweilen, daß er selbst die Sprache gar nicht beherrschte, daß die Stimme, der die anderen zuhörten, nicht seine eigene war. Er hatte den Mann mit dem Gewehr nicht verstanden, und doch war ihm klar, was er gesagt hatte. Schlimmstenfalls war dies das Ende. Bestenfalls war dies der Anfang einer langen Leidenszeit. Herr Hosokawa war in ein Land gekommen, das er niemals hätte betreten sollen, hatte fremde Menschen glauben lassen, was nicht der Wahrheit entsprach, nur um eine Frau singen zu hören. Er blickte quer durch den Raum zu Roxane Coss hinüber. Es war kaum etwas von ihr zu sehen, denn ihr Pianist hatte sie zwischen sich und dem Flügel eingeklemmt.
»Präsident Masuda«, sagte der Mann mit dem Schnurrbart und dem Gewehr.
Die elegant gekleideten Gäste wechselten nervös die Stellung – keiner wollte der Überbringer der schlechten Nachricht sein.
»Präsident Masuda, treten Sie vor.«
Die meisten warteten mit möglichst leerem Blick, bis der Mann mit dem Maschinengewehr den Lauf senkte, so daß dieser in die Menge wies, wobei es aussah, als ziele er auf eine blonde Frau Mitte Fünfzig, eine Schweizer Bankdirektorin, die Elise hieß. Sie blinzelte ein paarmal und preßte dann die flachen Hände eine über der anderen gegen ihr Herz, als wäre dies die Stelle, auf die er am ehesten schießen würde. Sie war bereit, ihre Hände zu opfern, wenn sie dadurch ihr Herz auch nur den Bruchteil einer Sekunde lang würde schützen können. Ein paar der Zuschauer stöhnten auf, aber das war alles. Ein peinliches Warten begann, das jeden Gedanken an Heldentum oder auch nur ritterliches Benehmen ausschloß, bis der Vizepräsident des Landes schließlich einen kleinen Schritt nach vorn trat und sich vorstellte.
»Ich bin Vizepräsident Ruben Iglesias«, sagte er zu dem Mann mit dem Gewehr. Der Vizepräsident sah außerordentlich müde aus. Er war ein sehr kleiner, schmächtiger Mann, der nicht nur wegen seiner politischen Überzeugungen, sondern ebenso wegen seiner Größe für diesen Posten ausgewählt worden war. In der Regierung war man allgemein der Ansicht, neben einem größeren Vizepräsidenten würde der Präsident schwach und austauschbar wirken. »Präsident Masuda war heute abend leider verhindert. Er ist nicht hier«, erklärte der Vizepräsident mit schleppender Stimme. Er mußte zuviel von dieser Last auf sich nehmen.
»Sie lügen«, korrigierte ihn der Mann mit dem Gewehr.
Ruben Iglesias schüttelte traurig den Kopf. Niemand wünschte mehr als er, daß Präsident Masuda jetzt hier wäre, statt zu Hause in seinem Bett zu liegen und die heutige Folge seiner Serie zufrieden an seinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. General Alfredo drehte das Gewehr in seiner Hand blitzschnell herum, so daß er es nun am Lauf statt am Griff hielt. Er hob das Gewehr und schlug den Vizepräsidenten auf den Schläfenknochen neben dem rechten Auge. Als der Gewehrkolben auf die Haut über dem Knochen traf, gab es ein dumpfes Geräusch, das viel weniger brutal wirkte als die Handlung selbst, und der kleine Mann ging zu Boden. Sein Blut ließ nicht lange auf sich warten – es spritzte aus einer drei Zentimeter langen Platzwunde neben dem Haaransatz. Ein Teil davon lief ihm ins Ohr, zurück in seinen Kopf. Trotzdem waren alle, einschließlich des Vizepräsidenten selbst (der jetzt halb bewußtlos auf seinem eigenen Wohnzimmerteppich lag, wo er sich keine zehn Stunden zuvor im Spaß mit seinem dreijährigen Jungen gerauft hatte), überrascht und froh, daß man ihn nicht erschossen hatte.
Der Mann mit dem Gewehr sah auf den Vizepräsidenten hinab, und als würde ihm der Anblick gefallen, befahl er dem Rest der Gesellschaft, sich hinzulegen. Das verstanden auch die, die der Sprache nicht mächtig waren, denn ein Gast nach dem anderen sank auf die Knie und streckte sich am Boden aus.
»Mit dem Gesicht nach oben«, fügte er hinzu.
Die wenigen, die es falsch gemacht hatten, drehten sich auf den Rücken. Zwei von den Deutschen und ein Argentinier blieben hartnäckig stehen, bis die Soldaten hingingen und ihnen das Gewehr in die Kniekehlen stießen. Im Liegen nahmen die Gäste sehr viel mehr Raum ein als im Stehen, und aus Platzmangel legten sich einige in die Eingangshalle und andere ins Eßzimmer. Einhunderteinundneunzig Gäste, zwanzig Kellner, sieben Köche und Küchenhilfen legten sich auf den Boden. Die drei Kinder des Vizepräsidenten und das Kindermädchen wurden aus ihrem Zimmer im ersten Stock geholt, wo sie trotz der späten Stunde noch nicht schliefen, weil sie Roxane Coss von der Treppe aus zugehört hatten, und sie legten sich ebenfalls hin. Über den Boden verteilt wie Teppiche, lagen einige wichtige und einige hochwichtige Persönlichkeiten – Botschafter und diverse Diplomaten, Kabinettsmitglieder, Bankdirektoren, Firmenchefs, ein Monsignore und eine berühmte Opernsängerin, die so auf dem Boden liegend viel kleiner wirkte als zuvor. Der Pianist schob sich nach und nach auf sie und versuchte, sie mit seinem breiten Rücken zu verdecken. Sie wand sich ein wenig. Diejenigen unter den Frauen, die glaubten, das Ganze würde bald überstanden sein und spätestens um zwei Uhr würden sie in ihrem eigenen Bett liegen, zupften ihre weiten Röcke unter sich zurecht, damit sie möglichst wenig zerknautschten. Diejenigen, die glaubten, sie würden jetzt gleich erschossen werden, ließen die Seide getrost Falten bilden und knittern. Als schließlich alle ruhig auf dem Boden lagen, war es im Raum auffallend still.
Jetzt waren die Anwesenden eindeutig in zwei Gruppen geteilt: diejenigen, die standen, und diejenigen, die auf dem Boden lagen. Denjenigen, die auf dem Boden lagen, wurde befohlen, still zu sein und sich nicht zu bewegen, während diejenigen, die standen, jene auf dem Boden nach Waffen durchsuchen und nachsehen sollten, ob nicht einer von ihnen insgeheim der Präsident war.
Man sollte meinen, daß man sich auf dem Boden noch verletzlicher fühlen, mehr Angst haben würde als im Stehen. Es hätte jemand den Fuß auf sie stellen, sie treten können. Es hätte sie jemand erschießen können, ohne daß sie die Chance gehabt hätten davonzulaufen. Doch tatsächlich fühlte sich jeder von ihnen auf dem Boden viel besser. Sie konnten sich nicht länger fragen, wie sie einen Terroristen überwältigen könnten oder ob sie blindlings losrennen sollten in Richtung Tür. Sie liefen kaum noch Gefahr, beschuldigt zu werden, etwas zu tun, was sie nicht taten. Sie waren wie kleine Hunde, die versuchten, den Kampf zu umgehen, und den scharfen Zähnen freiwillig Hals und Bauch entgegenstreckten – nimm mich. Selbst die Russen, die sich noch wenige Minuten zuvor flüsternd über eine mögliche Flucht beraten hatten, verspürten jetzt die Erleichterung der Resignation. Etliche von den Gästen schlossen die Augen. Es war spät. Sie hatten Wein getrunken und Steinbutt gegessen und leckere kleine Koteletts, und wenn sie auch alle Angst hatten, so waren sie doch auch müde. Die Stiefel, die um sie herumgingen und über sie hinwegstiegen, waren alt und mit Erde verkrustet, die abbröckelte, so daß sie den kunstvoll gemusterten Savonnerie-Teppich (der zum Glück weich unterfüttert war) mit Schmutzspuren überzogen. Die Stiefel hatten Löcher, durch die man die Spitzen von Zehen sah, jetzt, da Zehen und Augen einander so nahe waren. Zum Teil hatten sich die Stiefel aufgelöst und waren mit silbernem Isolierband umwickelt, das auch schon völlig verdreckt und an den Rändern eingerollt war. Die jungen Leute beugten sich über die Gäste. Sie lächelten nicht, doch ihre Gesichter wirkten auch nicht sehr bedrohlich. Man konnte sich vorstellen, wie das Ganze ausgesehen hätte, wenn sie alle gestanden hätten, wenn sich zum Beispiel ein kleinerer Junge mit einer Reihe von Messern bei einem großen, älteren Mann im teuren Smoking hätte Geltung verschaffen müssen. Jetzt dagegen huschten die Hände der Jungen über sie hinweg, griffen schnell in Taschen, strichen mit gespreizten Fingern über Hosenbeine. Bei den Frauen klopften sie nur hier und da vorsichtig auf die Röcke. Manchmal beugte sich ein Junge über eine Frau, zögerte und ließ sie unbehelligt liegen. Sie fanden nicht viel Interessantes – schließlich war dies nur ein festliches Abendessen.
Folgende Gegenstände trug der wortkarge General Hector in ein Notizbuch ein: sechs silberne Taschenmesser aus Hosentaschen und vier Zigarrenschneider an Uhrketten, ein Revolver mit Perlmuttgriff, kaum größer als ein Kamm, aus einer Damenhandtasche. Sie hielten ihn zunächst für ein Feuerzeug und lösten bei dem Versuch, es anzuzünden, versehentlich einen Schuß aus, der eine schmale Furche im Eßzimmertisch hinterließ. Ein Brieföffner mit einem Goldemaillegriff vom Schreibtisch und alle möglichen Arten von Messern und Fleischgabeln aus der Küche, Feuerhaken und Schaufel vom Ständer neben dem Kamin und eine stupsnasige Smith & Wesson, Kaliber .38, aus dem Nachttisch des Vizepräsidenten – eine Waffe, von der der Vizepräsident auf Befragen unumwunden zugab, daß er sie besaß. All diese Gegenstände wurden in einem Wäscheschrank im ersten Stock verschlossen. Die Uhren, die Brieftaschen und den Schmuck rührten sie nicht an. Ein Junge nahm sich ein Pfefferminzbonbon aus dem Satintäschchen einer Frau, bat sie jedoch, es hochhaltend, vorher stumm um Erlaubnis. Sie bewegte den Kopf einen Zentimeter nach unten und wieder hoch, und er lächelte und wickelte es aus.
Ein Junge sah zunächst Gen und dann Herrn Hosokawa aufmerksam an und studierte dann ein zweites Mal ihre Gesichter. Er starrte auf Herrn Hosokawa und wich dann zurück, wobei er einem Kellner auf die Hand trat, der zusammenzuckte und sie schnell wegzog. »General«, sagte der Junge, viel zu laut für die Stille, die im Raum herrschte. Gen rutschte näher an seinen Chef heran, wie um klar zu machen, daß man sie nur im Doppelpack bekam.
General Benjamin stieg über die warmen, atmenden Gäste hinweg. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, er sei mit einem großen, portweinfarbenen Muttermal gestraft, doch auf den zweiten war deutlich zu sehen, daß in seinem Gesicht etwas Lebendiges wütete. Der leuchtend rote Strom des Ausschlags entsprang tief unter seinem schwarzen Haar, zog eine Schneise über seine linke Schläfe und blieb kurz vor dem Auge stehen. Schon bei dem Anblick wurde einem aus Mitgefühl flau vor Schmerz. Der Junge zeigte auf Herrn Hosokawa, und General Benjamin starrte ihn ebenfalls lange an. »Nein«, sagte er zu dem Jungen. Er drehte sich wieder um, doch dann hielt er inne und sagte im Plauderton zu Herrn Hosokawa: »Er dachte, Sie wären der Präsident.«
»Er dachte, Sie wären der Präsident«, sagte Gen leise, und Herr Hosokawa nickte. Ein Japaner, Mitte Fünfzig, mit Brille – es lag noch ein halbes Dutzend davon um sie herum.
General Benjamin senkte sein Gewehr zu Gens Brust und stützte die Mündung wie einen Spazierstock darauf. Die runde Öffnung war nicht viel größer als die Knöpfe an seinem Hemd – ein kleiner, scharf umrissener Druckpunkt. »Hier wird nicht geredet.«
Gen bildete mit den Lippen das Wort traductor. Der General dachte einen Moment lang nach, so als hätte man ihm gerade erklärt, der Mann, mit dem er gesprochen habe, sei taub oder blind. Dann zog er sein Gewehr zurück und ging weg. Es gibt bestimmt, dachte Gen, ein Medikament, das diesem Mann helfen würde. Als er einatmete, spürte er an der Stelle, wo das Gewehr gewesen war, einen kleinen, stechenden Schmerz.
Nicht weit entfernt, neben dem Flügel, stießen zwei Jungen dem Pianisten ihr Gewehr in die Rippen, bis er mehr neben Roxane Coss lag als auf ihr. Es war für sie zunächst äußerst unbequem, auf ihren Haaren zu liegen, die am Hinterkopf zu einem kunstvollen Knoten hochgesteckt waren. Sie hatte heimlich die Nadeln entfernt und sie in einem ordentlichen Häuflein auf ihren Bauch gelegt, von wo sie als Waffen eingesammelt werden konnten, falls irgendwem danach zumute war. Jetzt lag ihr langes, lockiges Haar ausgebreitet um ihren Kopf, und die jungen Terroristen ließen es sich nicht nehmen, einer nach dem anderen vorbeizukommen und es sich anzusehen, ja einige wagten sogar, es zu berühren, wenn auch nur vorsichtig mit einem Finger an den gelockten Spitzen, ohne sich die tiefe Befriedigung eines richtigen Darüberstreichens zu gönnen. So über sie gebeugt, rochen sie ihr Parfüm, das ganz anders war als die Parfüms der anderen Frauen, die sie inspiziert hatten. Die Opernsängerin hatte auf irgendeine Weise den Duft der kleinen weißen Blumen im Garten kopiert, an denen sie auf dem Weg zu den Luftschächten vorbeigekommen waren. Selbst an diesem Abend, an dem ihnen die Möglichkeit ihres eigenen Todes und die Möglichkeit der Befreiung vor Augen standen, war ihnen der Geruch dieser kleinen, glockenförmigen Blumen aufgefallen, die an der hohen Mauer wuchsen, und ihn jetzt hier nach so kurzer Zeit im Haar der schönen Frau wiederzufinden kam ihnen wie ein Zeichen, wie ein gutes Omen vor. Sie hatten sie singen gehört, während sie eingezwängt in den Luftschächten gewartet hatten. Jeder von ihnen hatte genaueste Anweisungen, eine bestimmte Aufgabe. Die Lampen sollten nach dem sechsten Lied ausgehen, denn was eine Zugabe war, hatte ihnen nie jemand erklärt. Niemand hatte ihnen erklärt, was eine Oper war oder daß es eine andere Art des Singens gab, als wenn man leise vor sich hin sang, während man Holz ins Haus trug oder Wasser aus dem Brunnen holte. Niemand hatte ihnen jemals etwas erklärt. Selbst die Generäle, die schon öfter in der Hauptstadt gewesen waren und eine Ausbildung hatten, hielten den Atem an, um die Sängerin besser zu hören. Die jungen Terroristen, die in den Luftschächten warteten, waren einfache Leute, die einfache Dinge glaubten. Wenn ein Mädchen in ihrem Dorf eine schöne Stimme besaß, sagten die alten Frauen, sie habe einen Vogel verschluckt, und das versuchten sie sich jetzt zu sagen, während sie das Häuflein von Haarnadeln auf dem pistaziengrünen Chiffon ihres Kleids anstarrten: Sie hat einen Vogel verschluckt. Doch sie wußten, daß das nicht stimmte. Bei all ihrer Unwissenheit, all ihrer Weltfremdheit wußten sie doch, daß es solch einen Vogel nicht gab.
In dem stetigen Strom sich nähernder Jungen war einer, der sich neben sie hinhockte und ihre Hand nahm. Er hielt sie ganz locker, ließ eigentlich nur ihre Handfläche auf seiner eigenen ruhen, so daß sie sie jederzeit hätte zurückziehen können, was sie jedoch nicht tat. Roxane Coss wußte, je länger er ihre Hand hielt, um so mehr würde er sie lieben, und wenn er sie liebte, würde er eher versuchen, sie vor den anderen, vor ihm selbst zu beschützen. Das Gesicht des Jungen unter der Schirmmütze sah unglaublich jung und zerbrechlich aus, und seine Augenlider hatten unzählige seidige, schwarze Wimpern. Er trug einen Patronengurt quer über der schmalen Brust, und sein Körper krümmte sich unter seinem Gewicht. Der grobe Holzgriff eines einfachen Küchenmessers ragte oben aus einem Stiefel, und eine Pistole fiel ihm fast aus der Tasche. Roxane Coss dachte an Chicago und daran, wie kalt es dort jetzt, Ende Oktober, in der Nacht bereits war. Hätte dieser Junge in einem anderen Land gelebt, in einer ganz anderen Welt, hätte er nächste Woche an Halloween noch mit von Haustür zu Haustür ziehen können, selbst wenn er dafür zu alt sein sollte. Er hätte sich als Terrorist verkleiden können, mit alten Stiefeln aus dem Geräteschuppen, einem selbstgebastelten Patronengurt aus Wellpappe und den Lippenstiften seiner Mutter als Munition. Der Junge sah ihr nicht ins Gesicht, nur auf ihre Hand. Er studierte sie ganz genau, so als hätte sie keine Verbindung zu ihr. In jeder anderen Situation hätte sie sie ihm entzogen, doch nach den ungewöhnlichen Ereignissen des Abends hielt sie still und ließ ihn ihre Hand studieren.
Der Pianist hob den Kopf und sah den Jungen finster an, woraufhin dieser Roxane Coss’ Hand wieder neben ihr Kleid legte und sich entfernte.
Zwei Dinge standen fest: Keiner von den Gästen war bewaffnet, und keiner von ihnen war Präsident Masuda. Einzelne Gruppen von Jungen wurden mit dem Gewehr im Anschlag in verschiedene Ecken des Hauses geschickt, hinunter in den Keller, nach oben auf den Dachboden, hinaus zu der hohen Mauer, um nachzusehen, ob er sich in dem Durcheinander irgendwo hatte verstecken können. Doch immer wieder kam die Meldung, daß dort niemand sei. Durch die offenen Fenster drang das rauhe Summen geschäftiger Insekten herein. Im Wohnzimmer des Vizepräsidenten war alles still. General Benjamin hockte sich neben den Vizepräsidenten, der heftig in die Stoffserviette blutete, die seine neben ihm liegende Frau ihm an den Kopf hielt. Sein Auge war jetzt von einem unheilvollen violetten Ring umgeben. Es sah jedoch längst nicht so schmerzhaft aus wie die Entzündung im Gesicht des Generals. »Wo ist Präsident Masuda?« fragte ihn der General, als wäre ihnen seine Abwesenheit gerade erst aufgefallen.
»Bei sich zu Hause.« Er nahm seiner Frau die blutige Serviette aus der Hand und bedeutete ihr, sich zurückzuziehen.
»Warum ist er nicht gekommen?«
Was der General wissen wollte, war: Hatte er in seiner Organisation einen Maulwurf, war der Präsident über ihre Pläne informiert? Doch der Vizepräsident war noch benommen von dem Schlag und außerdem ziemlich verbittert, denn die Wahrheit war nun einmal bitter. »Er wollte seine Lieblingsserie sehen«, sagte Ruben Iglesias, und da alle im Raum befehlsgemäß still waren, drang seine Stimme an jedes Ohr. »Er wollte sehen, ob Maria heute freikommt.«
»Warum hat man uns gesagt, daß er hier sein würde?«
Der Vizepräsident sprach es ohne zu zögern und ohne jede Reue aus. »Er hatte zugesagt und hat es sich dann doch noch anders überlegt.« Auf dem Boden entstand eine gewisse Unruhe. Diejenigen, für die dies eine Neuigkeit war, waren ebenso schockiert wie jene, die es die ganze Zeit gewußt hatten. Ruben Iglesias hatte gerade seine eigene politische Karriere zerstört. Masuda und er hatten sich nie besonders gemocht, und nun würde Masuda ihn ruinieren. Als Vizepräsident arbeitete man hart, weil man glaubte, man würde eines Tages das Präsidentenamt übertragen bekommen, wie einen Besitz, der vom Vater auf den Sohn übergeht. Bis dahin schluckte man seinen Ärger hinunter, übernahm die Dreckarbeit, die Beerdigungsfeiern, die Besuche von Erdbebengebieten, und bei den endlosen Reden des Präsidenten nickte man zustimmend. Doch an diesem Abend glaubte er nicht mehr daran, daß er eines Tages Präsident werden würde. An diesem Abend glaubte er, er würde erschossen werden, zusammen mit einigen seiner Gäste oder vielleicht auch mit allen, vielleicht sogar mit seinen Kindern, und für den Fall sollte die ganze Welt erfahren, daß Eduardo Masuda, ein Mann, der kaum einen Zentimeter größer war als er, zu Hause saß und fernsah.
Die katholischen Priester, die Nachfahren jener mordenden spanischen Missionare, erzählten den Leuten gern, daß die Wahrheit frei mache, und in diesem Fall hatten sie tatsächlich recht. Der General, der Benjamin hieß, hatte sein Gewehr schon entsichert und war bereit, an dem Vizepräsidenten ein Exempel zu statuieren und ihn ins Jenseits zu befördern, doch die Geschichte mit der Lieblingsserie hielt ihn davon ab. So schmerzlich die Erkenntnis war, daß fünf Monate Vorbereitung auf diesen einen Abend, auf die Entführung des Präsidenten und womöglich den Sturz der Regierung, vergeblich gewesen waren und er statt dessen nun zweihundertzweiundzwanzig Geiseln am Hals hatte, die vor ihm auf dem Boden lagen – die Geschichte des Vizepräsidenten klang absolut überzeugend. Niemand hätte sich so etwas ausdenken können. Es war einfach zu billig und zu banal. General Benjamin hatte keine Skrupel, jemanden umzubringen, denn nach seiner Erfahrung bestand das Leben aus nichts als unsäglichen Leiden. Wenn der Vizepräsident gesagt hätte, der Präsident habe eine Erkältung bekommen, hätte er ihn erschossen. Wenn er gesagt hätte, der Präsident habe wegen einer dringenden nationalen Angelegenheit verreisen müssen, hätte er ihn umgebracht. Wenn er gesagt hätte, das Ganze sei nur ein Trick gewesen und der Präsident habe nie vorgehabt, zu der Feier zu kommen, dann: Peng! Aber Maria – sogar im Dschungel, wo ein Fernseher eine Seltenheit war, die Stromversorgung miserabel und der Empfang gleich null, sprach man von dieser Maria. Selbst Benjamin, der sich für nichts anderes interessierte als die Freiheit der Unterdrückten, hatte von Maria gehört. Die Serie lief von Montag bis Freitag am Nachmittag, und am Dienstagabend gab es eine Extrafolge, eine Zusammenfassung der ganzen Woche, für alle, die tagsüber arbeiteten. Wenn Maria freikommen sollte, dann würde dies an einem Dienstagabend geschehen.
Sie hatten einen Plan gehabt, und der hatte darin bestanden, daß sie den Präsidenten gefangennehmen und innerhalb von sieben Minuten wieder verschwinden wollten. Jetzt hätten sie die Stadt eigentlich schon verlassen haben und die gefährlichen Straßen entlangrasen sollen, die zurück in den Dschungel führten.
Durch die Fenster drang helles rotes Stroboskoplicht herein, das zuckend über die Wände lief, begleitet von einem hohen Jaulen. Es klang zeternd und vorwurfsvoll – nicht entfernt wie Gesang.